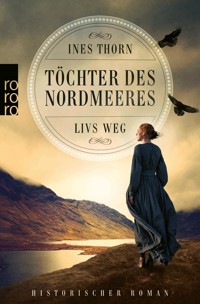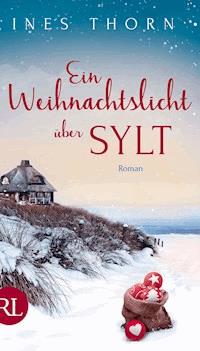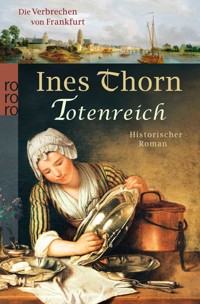
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Verbrechen von Frankfurt
- Sprache: Deutsch
Die Heilkraft des Todes Unheilvolle Dinge ereignen sich im Frankfurt des frühen Jahres 1533: Dreimal findet Pater Nau nach der Beichte blutiges Frauenhaar im Beichtstuhl. Dann wird am Mainufer die Leiche einer schwangeren Frau gefunden – ausgeweidet, vom Ungeborenen fehlt jede Spur. Und weitere Schwangere werden vermisst. Pater Nau gerät unter Verdacht. Nur die Richterswitwe Gustelies und ihre Tochter Hella glauben an seine Unschuld und beschließen, selbst zu ermitteln. Doch Hella begibt sich damit in höchste Gefahr, denn auch sie erwartet ein Kind …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Ines Thorn
Die Verbrechen von Frankfurt. Totenreich
Historischer Roman
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Kapitel 1
Frankfurt im Januar 1533
Pater Nau fror. Seit zwei Stunden saß er schon im Beichtstuhl und hörte sich die Sünden seiner Schäfchen an. Als junger Pater hatte er geglaubt, im Winter sündigten die Menschen aufgrund der Kälte weniger. Doch inzwischen wusste er, dass dies ein Irrtum war. Auf den Straßen lag Schnee, der Wind heulte durch die Gassen, die Frankfurter blieben in ihren warmen Stuben hocken und kamen vor lauter Nichtstun auf die seltsamsten Einfälle. Brave Ehemänner prügelten aus Langeweile ihre Weiber, Schwestern machten ihren Schwägern zum Zeitvertreib schöne Augen, Mütter hatten Muße, die Mängel ihrer Schwiegertöchter genauer zu erkunden, und die Gesellen in den Werkstätten trieben zur Zerstreuung ihren Schabernack mit den Lehrbuben.
«Und dann, Pater, hatte ich unzüchtige Gedanken, als ich dem Schlachter beim Zerlegen eines Schafes zuschaute.»
«So, so», sagte Pater Nau. «Ihr seid jetzt über sechzig Jahre, Mutter Dollhaus. Ihr solltet Eure Gedanken zügeln.»
«Ja, Pater. Ich bete jeden Abend dafür. Aber wenn ein Mann so kräftige Muskeln hat, dann vergesse ich mein Alter. Erst gestern …»
Pater Nau hörte diese Geschichten Woche für Woche wieder, er langweilte sich unsäglich, und seine Gedanken schweiften ab. Vor seinem geistigen Auge erschien eine Kanne mit dampfendem Würzwein, auf dem Tisch stand ein gedeckter Apfelkuchen mit Schlagsahne. Hoffentlich sind Nüsse darin, dachte Bernhard Nau.
«Pater? Pater!»
«Äh … ja?»
«Meine Buße.»
«Ach so, ja. Also, Ihr betet zehn Rosenkränze und zehn Ave-Maria und nehmt heute Abend eine kalte Waschung vor.»
«Das ist alles? Ich soll mich nicht geißeln?»
«Herr im Himmel, nein, Mutter Dollhaus. Ihr sollt etwas viel Schwierigeres tun. Nämlich Eure Gedanken im Zaum halten. Und jetzt geht. Der Herr sei mit Euch.»
Ein Niesanfall des Paters begleitete die Abschiedsformel.
Im Beichtstuhl neben ihm raschelte es, und der Pater seufzte auf. Hoffentlich war Mutter Dollhaus die Letzte, dachte er. Es ist unglaublich, wie viele Sünden sich in einer Woche so ansammeln können.
Er lauschte nach draußen, und als alles ruhig blieb, schlüpfte er zurück in seine neuen Schuhe, die an den Zehen furchtbar drückten, und wollte den Beichtstuhl verlassen. Da hörte er schwere Schritte durch das Kirchenschiff hallen. Seufzend ließ sich der Pater zurück auf seinen Stuhl fallen. Kurz darauf knarrte die Tür, ein Schatten fiel durch die Luke zwischen den beiden kleinen Kammern.
«Der Herr sei mit Euch …», leierte Pater Nau, doch von nebenan kam kein Laut. Er beugte sich etwas nach vorn und spähte durch die vergitterte Luke zwischen den beiden Beichtkammern. Er sah eine Gestalt, die in einen dunklen Umhang gehüllt war, die Kapuze tief in die Stirn gezogen, und heftig schnaufte, aber ansonsten regungslos dasaß.
«Welche Sünde habt Ihr auf Euch geladen?», wollte der Pater wissen.
Ein Schnauben war die Antwort.
«Könnt Ihr nicht reden?», fragte der Pater.
Der andere schwieg. Pater Nau überlegte, ob es in seiner Gemeinde jemanden gab, der stumm war. Doch außer einer alten Magd fiel ihm niemand ein. Obwohl er den Schatten nur kurz gesehen hatte, war er überzeugt, dass es sich bei dem Jemand nebenan auf gar keinen Fall um die stumme Magd handelte. Und wenn es nicht die stumme Kathrein war, dann konnte der Schatten auch sprechen.
«Wie soll ich von Euren Sünden erfahren? Ihr müsst schon reden. Dafür ist die Beichte gemacht. Erleichtert Euer Gewissen. Sprecht Euch aus. Alles, was gesagt wird, bleibt unter uns. Das wisst Ihr doch, oder?»
Von der anderen Seite erklang ein tiefer Seufzer.
«Na, los doch. Redet mit mir.»
Noch mehrmals versuchte Nau, den Sünder zum Sprechen zu bewegen, doch außer hastigen Atemzügen und leisem Röcheln war nichts zu hören. Schließlich verlor Pater Nau die Geduld. «Also gut. Es ist kalt hier. Ich sitze seit Stunden in diesem Kasten. Meine Zehen sind eingefroren. Wenn Ihr nicht reden wollt, so lasst Ihr es eben. Ich spreche Euch von Euren Sünden los, so Ihr keine Todsünde begangen habt und aufrichtig bereut. Betet zehn Rosenkränze und zehn Ave-Maria und nehmt heute Abend eine kalte Waschung vor.»
Da begann der Schatten zu sprechen. Eigentlich war es nur ein Flüstern, und Pater Nau musste sich sehr anstrengen, um die Worte zu verstehen:
«Warum bin ich nicht gestorben von Mutterleib an?
Warum bin ich nicht verschieden, da ich aus dem Leibe kam?
Warum hat man mich auf den Schoß gesetzt? Warum bin ich mit Brüsten gesäugt?
So läge ich doch nun und wäre still, schliefe und hätte Ruhe
mit den Königen und Ratsherren auf Erden, die das Wüste bauen,
oder mit den Fürsten, die Gold haben und deren Häuser voll Silber sind.
Oder wie eine unzeitige Geburt, die man verborgen hat, wäre ich gar nicht, wie Kinder, die das Licht nie gesehen haben.
Daselbst müssen doch aufhören die Gottlosen mit Toben; daselbst ruhen doch, die viel Mühe gehabt haben.
Da haben doch miteinander Frieden die Gefangenen und hören nicht die Stimme des Drängers.
Da sind beide, klein und groß, und der Knecht ist frei von seinem Herrn.»
«Was? Was sagt Ihr da? Das kenne ich doch. Es stammt aus der Bibel. Altes Testament, wenn mich nicht alles täuscht. Was wollt Ihr damit sagen?», fragte der Pater.
Doch statt einer Antwort hörte Pater Nau, wie neben ihm der Jemand aus dem Beichtstuhl schlüpfte. Doch ehe Nau seine Schuhe gefunden hatte und aus dem Beichtstuhl hervorlugen konnte, hörte er schon die schwere Kirchentür ins Schloss schlagen.
«Merkwürdig», murmelte er. «Kommt zur Beichte und rezitiert die Bibel. Wenn mir nur einfiele, wo diese dunklen Worte stehen! Na ja, der Sünder wird schon wissen, was er meint. Ist es meine Aufgabe, die Schrift zu deuten? Nein, das ist es nicht, dafür bin ich nicht gelehrt genug. Und nun endlich raus hier, sonst erstarre ich noch zu Eis.»
Pater Nau blies warmen Atem in seine eiskalten Hände, schob die Klappe nach unten, löschte die Kerze und verließ den Beichtstuhl. Dann ging er nach nebenan, um auch dort die Kerze zu löschen. Er öffnete die Tür – und prallte zurück. Auf der Sünderbank lag ein blutiges Stück Haut, und an dem Stück hing langes, blutverschmiertes blondes Haar.
Gern hätte der Pater aufgeschrien, doch seine Kehle war wie zugeschnürt. Er starrte auf den Skalp, unfähig, sich zu rühren. «Ich brauche Branntwein», flüsterte er. «Sehr viel Branntwein.» Dann sackten ihm die Knie weg.
Als er wieder zu sich kam, wusste er sofort, was geschehen war. Er rappelte sich auf, sah sich in seiner Kirche um. Alles war still. Vorsichtig und dabei nach Luft schnappend, öffnete er erneut die Tür zur Beichtkammer. Er hoffte, die Sünderbank wäre leer, alles nur ein böser Spuk gewesen, doch da lag noch immer das schwartige Stück Kopfhaut mit den langen Haaren daran.
Augenblicklich wurde ihm wieder schlecht, doch dieses Mal riss sich der Pater zusammen. Ganz tief atmete er ein und wieder aus, presste eine Hand auf sein rasendes Herz.
Vorsichtig trat er einen Schritt näher, doch er konnte den Anblick des Skalps wirklich nicht ertragen. Er dachte daran, ins Pfarrhaus zu laufen und seine Schwester und Haushälterin Gustelies zu rufen. Er wollte nach dem Kirchendiener schreien, nach dem Schultheiß, dem Bischof, dem lieben Gott, doch nichts davon tat er.
Wie gelähmt blieb Pater Nau stehen, rang nach Luft und starrte auf das Ding im Beichtstuhl. Dann schloss er die Augen, zählte in Gedanken die Becher Wein, die er heute schon getrunken hatte, und öffnete vorsichtig das linke Auge. Die Kopfschwarte lag noch immer da. Und sie konnte dort unmöglich liegen bleiben.
Dieser Gedanke verursachte ihm einen solchen Schwindel, dass er mit hastigen, wankenden Schritten in die Sakristei eilte. Dort griff er ohne nachzudenken nach der Kanne mit dem Messwein, goss sich den Abendmahlspokal voll und trank ihn in einem Atemzug aus. Er spürte, wie der Wein ihn ein wenig beruhigte, doch noch immer lag der Skalp dort draußen, und Pater Nau schüttelte es. Also goss er sich den Pokal noch einmal voll und noch einmal. Allmählich ging es ihm besser.
Mit einer Hand angelte er nach der Kanne und äugte hinein, doch das Gefäß entglitt seiner Hand, fiel auf den Boden und ergoss seinen Inhalt über die Steinfliesen.
Gustelies wird mir die Hölle heißmachen, wenn sie die Schweinerei hier sieht, dachte der Pater und brach in aufgeregtes Gelächter aus. Dann überkam ihn eine solche Müdigkeit, dass er den Kopf auf die Brust sinken ließ und wenige Augenblicke später eingeschlafen war.
Er träumte davon, ein ganzes Fass Wein zu bekommen. Das Fass kam vom Weingut Burg aus Dellenhofen und enthielt einen so köstlichen Spätburgunder, dass ihm nur beim Anblick schon das Wasser im Munde zusammenlief. Da erschien ein Schatten hinter dem Fass. Der Schattengeist befahl Pater Nau, den Wein ins Taufbecken zu gießen. Und als der Pater gehorchte, floss kein Wein in das Becken, sondern lange, blutige Haare. Im Traum schrie der Pater, und von seinem eigenen Schrei wachte er auf.
Sofort wusste er wieder, was geschehen war. Der Skalp, dachte er, der Skalp liegt noch immer im Beichtstuhl. Er muss da weg. Auf der Stelle. Er schluckte, spürte, wie der saure Wein ihm in die Kehle stieg. Gern hätte er sich noch ein wenig Mut angetrunken, doch die Kanne lag leer am Boden. Also faltete der Pater die Hände, richtete seinen Blick auf den Gekreuzigten und flehte: «Herr Jesus Christus, steh mir bei. Gib mir die Kraft und die Stärke, das verfluchte Ding zu holen, und sage mir, wo ich es verstecken kann.»
Die Glocken vom nahen Katharinenkloster schlugen die sechste Stunde. Schon bald würden die ersten Gläubigen zur Abendmesse erscheinen. Pater Nau musste sich sputen.
Er verließ die Sakristei, die rechte Hand um einen Rosenkranz geklammert. Am Taufbecken angekommen, strich er sich ein wenig Weihwasser auf die Stirn und warf einen flehenden Blick auf den Gekreuzigten. Hilf mir, bat er dringlich. Der Herr sah milde auf ihn herab.
Pater Nau begab sich mit zögernden Schritten zum Beichtstuhl. Vorsichtig öffnete er die Tür. Ihm war, als lauere der Teufel gerade dahinter.
Die Kopfschwarte mit den langen, blonden, blutdurchtränkten Haaren lag noch immer so, wie er sie verlassen hatte. Pater Nau sah sich nach allen Seiten um. Noch war die Kirche leer.
Er kniff die Augen zusammen, packte den Skalp bei den Haaren, schüttelte sich, dann zog er das Ding von der Sünderbank und eilte, den Arm ausgestreckt, als hielte er eine Pfanne mit kochendem Öl, zurück in die Sakristei.
Kaum war die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen, ließ er die Haare los. Sie fielen direkt unter den Tisch mit den Gerätschaften fürs Abendmahl. Von draußen waren Geräusche zu hören, und ihm fiel ein, dass er die Bürgersfrau Fernau als Strafe damit beauftragt hatte, den Altar mit Pflanzen zu schmücken. Er hatte gehofft, wenn die Fernauerin im Januar nach Blumen suchen musste, hätte sie weniger Zeit, ihre Nachbarin auszuspionieren und sie des Weinpanschens zu beschuldigen. Aber es schien so, als könne die Fernauerin an zwei Stellen gleichzeitig sein.
«Pater? Pater Nau, seid Ihr da drinnen? Ich muss dringend mit Euch reden. Heute Morgen hat meine Nachbarin ein höchst seltsames Gespräch mit ihrer Magd geführt», hörte er sie rufen.
«Ja», erwiderte der Pater mit einer Stimme, die er selbst nicht kannte. «Wartet, ich komme gleich zu Euch. Einen winzigen Augenblick noch. Richtet inzwischen den Altar her. Und seht zu, dass Ihr es mit der nötigen Andacht tut.»
Seine Blicke huschten durch die Sakristei. Der Skalp musste weg. Sofort. Die Fernauerin brachte es fertig und stürmte hier herein, wenn sie den Altar gerichtet hatte.
Aber wohin? Gustelies, die auch gleich kommen würde, um ihm beim Ankleiden zu helfen, kramte in jedem Schrank, in jeder Truhe. Und wenn sie erst einmal gefunden hatte, was er so eilig verbergen wollte, war das Beichtgeheimnis keinen Pfifferling mehr wert.
Gustelies und das Beichtgeheimnis. Das waren zwei Dinge, die sich gegenseitig aufhoben. Selbst der Papst, das wusste Pater Nau, würde irgendwann reden, wenn Gustelies ihn einmal in der Mangel hatte. Seine Schwester war eine gute, gottesfürchtige Frau, doch ihre Neugier war unersättlich.
Da fiel sein Blick auf die Truhe mit der Weihnachtskrippe. Dort hinein mit dem grausigen Ding, dachte er erleichtert. Weihnachten war schon ein paar Wochen her. Und ehe die Krippe das nächste Mal gebraucht würde, dauerte es Monate. Ja, in der Truhe war die Kopfschwarte einstweilen sicher.
Der Pater packte den Skalp mit vor Ekel verzogenem Mund, öffnete die Truhe, nahm das Jesuskind aus der Futterkrippe und legte es Maria vor die Füße, dann stopfte er den Skalp in die Wiege des Jesuskindleins, packte ein paar Heureste darauf, verschloss die Truhe, ließ sich darauf fallen und atmete erleichtert auf.
Kapitel 2
Hella nahm die Teller vom Wandbord der Pfarrhausküche und verteilte sie auf dem Tisch, während Gustelies im Kupferkessel rührte und Heinz die Stiege nach oben zu Pater Naus Studierstube stieg. Er klopfte höflich, doch als von drinnen nichts zu hören war, öffnete er die Tür. Er sah den Pater mit gebeugtem Rücken an seinem Schreibpult stehen. «Zweites Buch der Makkabäer, Kapitel sieben, Vers sieben und acht», hörte er ihn murmeln.
«Bernhard, das Essen ist fertig», sagte er leise, doch Pater Nau schaute nicht einmal auf, sondern murmelte weiter vor sich hin: «Als der Erste so aus dem Leben geschieden war, führten sie den Zweiten auch hin, um ihren Mutwillen mit ihm zu treiben; und sie zogen ihm vom Kopf Haut und Haar ab und fragten ihn, ob er Saufleisch essen wollte oder den ganzen Leib Glied für Glied martern lassen.
Er aber antwortete in seiner Sprache und sagte: Ich will’s nicht tun.
Daher marterten sie ihn weiter wie den Ersten.»
«Bernhard!» Heinz Blettner sprach ein wenig lauter. «Was tust du da? Gustelies hat das Essen fertig. Es gibt einen Schmortopf.»
«Was?» Der Pater schreckte hoch. «Was hast du gesagt?»
«Das Essen ist fertig. Was, zum Himmel, tust du da?»
«Ich?»
«Ja. Du. Oder ist sonst noch jemand hier?»
Der Pater sah sich in seiner Stube um. «Nein, hier ist niemand. Gottlob.»
«Was hast du gemacht?»
Pater Nau spitzte die Lippen und stieß die Luft pfeifend hervor. «Ich bereite meine nächste Predigt vor. Was denn sonst? Schließlich bin ich dafür zuständig.»
«Eine Predigt, in der es darum geht, einem anderen die Kopfhaut samt Haaren abzuziehen?»
Pater Nau nickte eifrig. «Jawohl. Siehst du, mein Sohn, die Bibel besteht aus Gleichnissen. Das Gleichnis mit der Kopfhaut hat also eine Bedeutung. Und diese versuche ich zu ergründen.»
«Aha. Der Schmortopf wartet», entgegnete der Richter und wandte sich ab. «Kommst du?»
Pater Nau erhob sich. «Ja, ja, gleich. Vorher will ich dich noch fragen, was du für eine Bedeutung hinter diesem Gleichnis vermutest.»
Heinz Blettner blickte den Onkel seiner Frau verblüfft an. «Seit wann fragst du mich so etwas? Ist Bruder Göck etwa krank?»
Pater Nau winkte ab. «Ach, weißt du, mein Sohn, mit Bruder Göck kann man hervorragend theologisch disputieren. Von Gleichnissen versteht er nichts. Er lebt in einem Kloster.»
Das leuchtete dem Richter ein. «Was ist mit Samson und Delilah. Waren da nicht auch Haare im Spiel?», fragte er.
«Ha! Das ist gut. Sehr gut sogar. Dem werde ich nachgehen. Gleich nach dem Essen.» Der Pater rieb sich die Hände. «Und jetzt lass uns runtergehen. Oder weißt du zufällig, welche Bibelstelle mit den Worten: ‹Warum bin ich nicht gestorben von Mutterleib an› beginnt?»
«Nein, weiß ich nicht. Für die Bibel bist du zuständig. Aber untersteh dich, Hella nach dieser Stelle zu fragen.»
«Warum?» Pater Nau kratzte sich am Kinn.
«Weil sie schwanger ist und vom Sterben bei der Geburt im Augenblick bestimmt nichts wissen will.»
«Das verstehe ich.» Pater Nau nickte. «Diese Art von Reue trifft die meisten ohnehin erst in späteren Jahren.»
Heinz Blettner betrachtete den Pater mit hochgezogenen Augenbrauen. «Geht es dir gut, mein Lieber?»
«Gut, gut. Was heißt das schon? Die Erde ist ein Jammertal und das Leben ein Graus.»
Der gewohnte Spruch des Paters beruhigte den Richter ein wenig.
In der Küche war der Tisch schon gedeckt. Pater Nau steckte seine Nase in den Topf, der über dem Herdfeuer köchelte. «Was gibt es heute?», fragte er.
«Schmortopf», erwiderte Gustelies.
«Und was ist da Schönes drin?»
«Seit wann interessierst du dich denn für Kochrezepte?», wollte Gustelies vom Pater wissen.
Pater Nau verzog den Mund. «Ich interessiere mich für alles, was auf der Welt passiert», teilte er mit beleidigtem Unterton mit.
«Also gut. Rindfleisch ist darin, Rübchen, ein paar Karotten, natürlich Zwiebeln, Lorbeerblätter, und für die Brühe habe ich ein gutes Stück Schwarte ausgekocht.»
Der Pater ließ den Löffel in den Kessel fallen. «Was?», fragte er. «Was hast du gesagt?»
«Schwarte. Das macht man so. Wegen des Geschmacks. Aber keine Angst. Sie war ganz frisch. Ich habe heute Morgen selbst gesehen, wie der Schlachter sie geschnitten hat.»
Pater Nau riss entsetzt die Augen auf.
«Was ist denn los mit dir? Du bist ja ganz bleich.»
Pater Nau würgte. «Ich glaube … mir ist schlecht. Ich … ich werde heute nichts essen.»
Dann würgte er, schlug sich die Hand vor den Mund und rannte hinaus.
Gustelies sah ihm kopfschüttelnd nach.
«Was ist denn mit Onkel Bernhard los?», wollte Hella wissen. «Er führt sich ja auf, als wäre er ebenfalls schwanger.»
«Keine Sorge», erwiderte Gustelies gelassen. «Er hat zu tief in die Messweinkanne geschaut. Als ich vorhin in die Sakristei kam, lag sie umgekippt am Boden. Ich glaube, wir sollten zum Abendessen nicht mehr den guten Tropfen aus Dellenhofen ausschenken. Dem kann mein Bruder einfach nicht widerstehen. Ab sofort werden wir dafür den sauren Wein vom anderen Rheinufer verwenden.»
Gleich am nächsten Morgen begab sich Gustelies auf den Markt, um zu erfahren, wo es den billigsten und sauersten Wein der Gegend zu kaufen gab.
Als Erstes suchte sie ihre Freundin Jutta Hinterer auf, die am Römerberg eine Geldwechselstube betrieb.
Es war noch immer kalt, und Gustelies hatte sich ihr Tuch fest um den Hals gewickelt, doch der Wind blies ihr hart ins Gesicht, die Kälte zwickte in die Wangen. Die Straßen waren zwar so bevölkert wie an jedem Markttag, doch die kleinen Grüppchen, die sich an den Straßenecken sonst versammelten, um Neuigkeiten auszutauschen, fehlten. Auch die Brunnen, wo sich normalerweise Trauben von Mägden aufhielten, lagen heute verlassen. Die Frankfurter versteckten sich in dicken Umhängen und hasteten mit geduckten Schultern und ängstlich darauf bedacht, auf dem vereisten Pflaster nicht auszugleiten, durch ihre Stadt.
Auch Gustelies kam ins Rutschen, konnte sich aber gerade noch an einem Mauervorsprung festhalten. Empört hämmerte sie gegen die Tür, von der die Eisspur mitten auf die Straße führte. Eine junge Frau mit schnippischer Miene öffnete ihr. «Was gibt es denn?», fragte sie.
Gustelies deutete auf die Eisspur. «Ihr habt heute Morgen Euer Waschwasser auf die Gasse gekippt.»
«Na und?»
«Na und, na und! Es ist kalt. Das Wasser ist gefroren, und ich hätte mir um ein Haar den Fuß gebrochen.»
Die junge Frau zuckte gleichgültig mit den Schultern. «Ist das meine Schuld? Dann schaut, wohin Ihr Eure Füße setzt.»
Mit einem Knall flog die Tür wieder zu.
Gustelies holte tief Luft und rief so laut, dass es die ganze Gegend hören konnte: «Wenn Ihr schon Euer Waschwasser auskippt, dann streut wenigstens Asche auf das Eis, damit niemand hinfällt. Ich werde mich beim Rat beschweren, weil Ihr Eurer Bürgerpflicht nicht nachkommt.»
«Ja, zeigt sie nur an. Verdient hat sie es. Und grüßen kann sie auch nicht», mischte sich eine Nachbarin ein, aber Gustelies hob nur die Hand und eilte weiter.
In der Wechselstube von Jutta stand ein gusseisernes Becken, in dem einige Kohlestücke glühten. Jutta selbst hatte sich in ein Schaffell gehüllt, trug zwei Hauben übereinander und saß auf einem Schemel.
«Sitzt du bequem?», fragte Gustelies nach der Begrüßung ein wenig säuerlich. Sie war es gewohnt, dass Jutta aufstand und sie umarmte.
«Ja, das tue ich. Und unter meinen Röcken habe ich einen heißen Stein, der mir die Füße wärmt. Komm, setz dich mir gegenüber und stell deine Füße dazu.»
Gustelies kicherte und schüttelte den Kopf. «Wie sieht das denn aus?»
«Wie soll das schon aussehen? Wie zwei Frauen mit einem heißen Stein zwischen den Beinen. Außerdem kommt sowieso keiner. Zu dieser Zeit gibt es nur wenig Fremde in der Stadt, die Rheinische Gulden in Frankfurter Währung gewechselt haben wollen. Was gibt es sonst Neues bei dir?»
«Nicht viel. Nur, dass Pater Nau gestern den Messwein ausgetrunken hat und ich jetzt auf der Suche nach dem sauersten Wein der ganzen Gegend bin.»
Jutta kicherte. «Denkst du wirklich, das hält ihn vom Trinken ab?»
«Ich hoffe es wenigstens.»
«Na, ich an deiner Stelle würde mir nicht so viel Arbeit machen. Gieß einfach ein bisschen Essig in den Wein, dann ist er sauer genug.»
«In den guten aus Dellenhofen?»
Jutta zuckte gut gelaunt mit den Achseln. «Natürlich, was denn sonst. Wenn schon der gute Wein nicht mehr schmeckt, merkt Nau vielleicht, dass die Wahrheit womöglich doch nicht im Fass liegt.»
Gustelies nickte gedankenverloren. «Das Problem dabei ist nur, dass ich dann auch die saure Plörre zum Abend trinken muss.»
«Da hast du recht. Du kannst ja mal zum Bauern Hilgert in die Vorstadt gehen. Ich habe gehört, er keltert heimlich. Die Trauben dafür nimmt er vom Lohrberg, der eigentlich dem Rat gehört. So etwas Saures wie den Lohrbergwein habe ich noch nie getrunken. Brrr.» Jutta schüttelte sich.
Dann strich sie sich mit der flachen Hand über ihre Wange. «Siehst du was, meine Liebe?», fragte sie.
Gustelies suchte mit Blicken das Gesicht ihrer Freundin ab. «Ich weiß nicht, was du meinst», erwiderte sie. «Ich sehe nur, dass deine Haut glatt und weich ist, während meine von der Kälte rot und geschunden aussieht. Ich wette, wenn der Frühling kommt, ist mein Gesicht um Jahre gealtert.» Sie seufzte. «Früher habe ich geglaubt, dass mit dem Alter alles einfacher wird. Ich habe gedacht, mit vierzig fände man sich in der Welt zurecht. Keine Fragen mehr, dafür reichlich Antworten. Keine Irrtümer mehr, keine falschen Hoffnungen. Jetzt bin ich über vierzig und muss feststellen, dass sich eigentlich nichts geändert hat. Außer meiner Haut. Und meinen Knochen. Die schmerzen schon beim Aufstehen. Weißt du, was das ist, das Alter?»
Jutta zuckte mit den Achseln.
«Das Alter ist teuer und kostet viel Zeit. Was habe ich schon Geld ausgegeben für Haarwuchsmittel und Salben, für Schminke und Hauben, die so viel Stoff haben, dass sie meine Stirnfalten überdecken. Früher bin ich aufgestanden, habe mir eine Handvoll Wasser ins Gesicht geschüttet und war schön. Heute brauche ich erst einmal Kamillensud für die geschwollenen Augen, eine Essigspülung für mein Haar und eine Kampfersalbe für die Beine.» Sie schüttelte den Kopf. «Glaub mir, Jutta, das hatte ich mir wirklich anders vorgestellt.»
Die Freundin nickte nachdenklich. «Mir geht es ähnlich. Seit neuestem kann ich den linken Arm nicht mehr über den Kopf heben, weil er so schmerzt. Und mein Haar wird so grau, dass ich eine Glatze hätte, würde ich mir jedes Graue ausrupfen.» Sie beugte sich nahe zu Gustelies hinüber und raunte: «Stelle dir vor, wenn ich einmal rennen muss, dann schaukeln die Innenseiten meiner Oberschenkel im Takt. Brrr.»
Eine kleine Weile saßen die Frauen schweigend da, dann stand Jutta auf, zog eine Schublade hervor und entnahm ihr einen winzigen Tiegel.
«Hier», sagte sie. «Das zeige ich dir nur, weil du meine beste Freundin bist. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen.»
«Was ist das?» Gustelies öffnete das Tiegelchen, betrachtete die hellrote Paste darin und roch sogar daran. «Mhm, lecker. Es riecht so gut, dass ich direkt Lust habe, hineinzubeißen. Irgendwie erinnert mich der Geruch an die Weihnachtsplätzchen von Klärchen Gaube, du weißt schon, der guten Haut. Aber natürlich habe ich kein Wort gesagt. Also, was ist das?»
«Wenn du mich zu Wort kommen lässt, dann erfährst du es. Mein Jungbrunnen. Du hast ja selbst gesagt, meinem Gesicht hätte der Winter dieses Mal nichts anhaben können.»
«Eine Zaubersalbe?»
Jutta nickte bedeutsam.
«Wo hast du sie her? Los, sag schon.»
Jutta sah sich nach allen Seiten um, doch die Wechselstube war so leer wie zuvor. «Es gibt da jemanden in der Vorstadt, der verkauft diese Salben.»
«Aha. Und was ist da drinnen?»
Jutta zuckte mit den Achseln. «Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Jemand hat erzählt, das Rote wäre das erste Mondblut einer Jungfrau. Darin wären die Wirkstoffe für glatte Haut enthalten. Aber ob das stimmt?»
«Egal», bestimmte Gustelies. «Hauptsache, es hilft. Kannst du mir einen solchen Zaubertiegel beschaffen?»
«Kann ich. Aber ich sage dir gleich, billig ist er nicht.»
«Wie viel?»
«Ein halber Gulden.»
«Nein! Dafür kriege ich ja beim Schlachter ein Achtel von einem Schwein.»
«Tja, alles ist teurer geworden.»
«Das ist wahr», bestätigte Gustelies. «Seitdem der Kaiser für seinen Krieg gegen die Türken vierzig Reiter, fast dreihundert Fußknechte und ein paar Büchsenmeister aus Frankfurt abgezogen hat, gibt es kaum noch Männer, die sich um das tägliche Brot kümmern. Weißt du, was die Käsefrau heute für eine Kanne verdünnte Milch haben wollte? Zehn Pfennige! Wenn das so weitergeht, weiß ich nicht, wie ich meinen Pater satt kriegen soll. Ich habe schon daran gedacht, meinen Käse selbst herzustellen. Ach, es ist wirklich ein Jammer.»
Jutta lachte. «Du hörst dich schon an wie dein Bruder. Was ist nun? Willst du die Salbe, obwohl sie so teuer ist?»
«Egal», wiederholte Gustelies. «Ich sagte ja schon, das Alter ist teuer und kostet viel Zeit. Bring mir so ein Tiegelchen.»
«Gut. Dann komm am Freitag wieder, ich denke, bis dahin habe ich die Salbe. Und jetzt nimm dir einstweilen von meiner.»
Lächelnd griff Gustelies in das Tiegelchen und strich sich großzügig das Wundermittel auf die Wangen.
Kapitel 3
Pater Nau fror schon wieder. Außerdem drückten seine neuen Schuhe so sehr, dass jeder Schritt schmerzte.
Er fluchte leise vor sich und zog seinen Umhang fester um sich. Er hatte denkbar schlechte Laune, denn er verabscheute es, sein geliebtes Pfarrhaus zu verlassen. Die Stadt war ihm zu laut, die Menschen rücksichtslos. Sie rempelten und schrien, sie fluchten und drängelten. Außerdem konnte Pater Nau in vielen Dingen, die sie taten, keinen Sinn erkennen. Was zum Himmel trieb beispielsweise dieses junge Ding da drüben? Schaute sie tatsächlich der Nachbarin ins Fenster? Und der Mann da an der Ecke. Der hockte am Boden neben einem Balken und versuchte, den Frauen unter die Röcke zu schielen, wenn sie dieselben raffen mussten, um über den Balken zu steigen. Bei der Kälte. Mit bloßen Knien auf dem Boden! Pater Nau verstand die Welt einfach nicht. «Die Erde ist in Frevlerhand», murmelte er und wünschte sich sehnlichst zurück in seine Studierstube.
Stattdessen humpelte er zu den Fleischbänken und besah sich die Auslagen der Schlachter. Er verzog den Mund, als er die blauroten Hammelbeine betrachtete, die saftigen, dunkelroten Schweinelebern und daneben die Rindernieren. In einem Eimer an der Seite lagen gelbe Hühnerfüße, daneben befand sich ein Topf mit grauem Kalbshirn. Dem Pater grauste es. Er aß sehr gern, aber das, was Gustelies auf den Tisch brachte, sah ganz anders aus als die ekligen Batzen, die hier herumlagen. Und vor allem stank es hier, dass einem übel werden konnte.
«Na, Pater, ist Eure Gustelies krank?», fragte ihn einer der Männer, die mit blutverschmierten Händen hinter den Bänken standen.
«Wie? Nein, nein. Ich wollte nur selbst einmal sehen, was sie in den Topf wirft.»
Der Schlachter lachte. «Keine Sorge, Pater. Sie nimmt nur das Beste. Niemandem hier ist es bisher gelungen, sie übers Ohr zu hauen.»
Das glaubte der Pater ihm aufs Wort. Er sah den Schlachter an und fand, dass dieser gutmütig aussah. «Sagt mir, mein Sohn, wie schneidet man einen Skalp?», wollte er dann wissen.
«Einen was?»
«Ihr wisst schon, die Kopfschwarte. Wie schneidet man die?»
Der Schlachter blies die Backen auf. «Das weiß ich nicht, Pater. Das tun wir bei unserem Vieh nicht. Wir schneiden ihm einfach nur die Kehle durch und zerlegen es dann in handliche Stücke, welche die Weiber in ihre Kessel werfen können.»
Der Pater wich zurück. «Also könnt Ihr mir auch nicht sagen, ob Skalpieren tödlich ist?»
Der Schlachter schüttelte den Kopf und sah den Pater dabei misstrauisch an. «Wozu wollt Ihr das wissen?»
Pater Nau hob beide Hände. «Ach, nur so. Ich hörte neulich von einem Reisenden, dass man es in der Neuen Welt so hält. Ihr wisst schon, die Seefahrer.»
Der Schlachter nickte. «Nun, so viel ich weiß, töten sie so die Wilden. Aber hier gibt es keine Wilden. Nur Wildschweine.» Er lachte dröhnend.
«Eben», sagte Pater Nau. «Und deshalb frage ich ja.»
Wieder sah der Schlachter misstrauisch auf den kleinen Mann im schwarzen Umhang.
«Aber es war ja nur eine Frage. Uns Geistlichen kommen oft die seltsamsten Gedanken. Gott sei mit Euch, mein Sohn.»
Pater Nau sah zu, dass er davonkam.
Er begab sich zum Hafen, schlenderte wie ein Müßiggänger mit auf dem Rücken verschränkten Händen die Ladestraße auf und ab. Ein paar Auflader mussten ihm ausweichen. Einmal wäre er beinahe über ein Fass gestürzt, das über ein Brett von einem Lastkahn gerollt wurde, ein anderes Mal wich er nur knapp einer Peitsche aus, mit der ein Fuhrwerkskutscher seinen lahmen Gaul antrieb. Überall herrschte ohrenbetäubender Lärm. Die Hafenarbeiter brüllten die Auflader an, die Auflader riefen den Schauerleuten Unflätigkeiten zu. Flüche, Lachen, dazu das knarrende Geräusch einer riesigen Winde, das Poltern der Fässer und Säcke. Es stank nach Pech, mit dem die Fassdeckel verklebt wurden, nach Flusswasser und Männerschweiß. Pater Nau hielt sich am Rande des Geschehens, darauf bedacht, nicht in diesen Mahlstrom zu geraten.
Endlich sah er zwei starkbehaarte und bärtige Männer an einer Ecke stehen, die heimlich einen tiefen Schluck aus einem Krug nahmen.
«Gelobt sei Jesus Christus, meine Söhne.»
«In Ewigkeit. Amen.»
«Was führt Euch in unser Land?»
Die bärtigen Männer sahen sich an. «Wie meint Ihr das, Pater?»
Pater Nau lächelte. «Nun, Ihr seid so schwarz im Gesicht. Da erkennt unsereins gleich, dass Ihr aus der Neuen Welt kommen müsst. Seid Ihr gar mit Kolumbus gesegelt? Habt Ihr die roten Menschen gesehen? Sagt mir, wie geht das vor sich mit dem Skalpieren dort?»
Die Männer sahen sich verdutzt an. Dann trat der eine einen Schritt zurück und erklärte: «Pater Nau, wir waren nie in der Neuen Welt. Erkennt Ihr uns nicht? Wir sind es. Der Peter und der Paul. Wir haben einen Lastkahn mit Kohle entladen. Deshalb sind wir so schwarz.»
Der Pater trat näher heran, dann hob er die Hand und wischte mit dem Finger über Pauls Gesicht. Sein Finger wurde schwarz, und auf Pauls Wange erschien ein heller Streifen. Pater Nau schüttelte den Kopf. «Verstehe einer die Welt», sagte er zu sich. «Aus Weiß wird Schwarz und aus Schwarz wird Weiß, und alles ist durcheinander.»
Dann schüttelte er noch einmal den Kopf und schlenderte von dannen.
«Hast du vielleicht so ganz zufällig mal etwas von dem Sarazenen gehört?», fragte Pater Nau seine Schwester, als er wenig später in der Küche saß und ihr beim Kuchenbacken zusah. Seine Hände umfassten einen Becher mit heißem, gewürztem Wein, seine Füße steckten in einem Zuber mit heißem Wasser.
«Wen meinst du?», fragte Gustelies und knetete mit beiden Händen kraftvoll den Teig. Ihre Wangen färbten sich mit einem Mal rot.
«Du weißt schon, den Totenleser, der bei Heinz’ letztem Fall, dem Kannibalenfall, dabei war.» Er runzelte die Stirn und blies in seinen Becher. «Hat er dir nicht sogar schöne Augen gemacht?»
Gustelies wurde noch röter. «Unsinn. In meinem Alter macht kein Mann mir mehr schöne Augen. Von Arvaelo habe ich nichts mehr gehört, seit das Stadttor hinter ihm ins Schloss gefallen ist. Wie kommst du darauf?»
«Ist mir gerade so eingefallen. Wenn ich gewusst hätte, dass er nicht bleibt, hätte ich ihm noch ein paar Fragen gestellt.»
«Du? Seit wann interessierst du dich für fremde Menschen? Ich meine, für andere Menschen überhaupt? Normalerweise setzt du keinen Schritt vor die Haustür. Dein größtes Vergnügen ist es, mit Bruder Göck zu streiten und Wein zu trinken. Da fällt mir ein, was hast du heute eigentlich bei den Fleischbänken getrieben?»
«Ich?» Pater Nau guckte so unschuldig wie ein neugeborenes Kalb. «Nichts weiter. Du täuschst dich nämlich in mir, meine Liebe. Ich interessiere mich sehr wohl für meine Mitmenschen. Nun, und heute wollte ich die Mitglieder unserer Gemeinde mal in ihrem Alltag betrachten.» Er nickte heftig.
Gustelies verzog den Mund. «Wer’s glaubt, wird selig. Du ergreifst doch schon die Flucht, wenn dich jemand anspricht, den du nicht von Kindesbeinen an kennst. Ich wundere mich ohnehin, dass du alleine den Nachhauseweg gefunden hast. Wann hast du das letzte Mal deinen Fuß auf den Römer gesetzt?»
Gustelies starrte nachdenklich ins Weite. «Ah, jetzt weiß ich es wieder. Zu den Passionsspielen vor zwei Jahren. Also, was ist jetzt mit Arvaelo?»
«Nichts weiter. Ich habe mich nur gefragt, ob man dort, wo er herkommt, die Menschen skalpiert.»
«Skalpiert?»
«Ja, du weißt schon. Man schneidet ihnen die Kopfhaut ab, aber so, dass die Haare noch dran sind.»
Gustelies ließ den Teig zurück in die Schüssel fallen. «Hast du schon wieder getrunken?», fragte sie streng.
Pater Nau schüttelte empört den Kopf.
«Hauch mich an!», befahl Gustelies.
Pater Nau tat es.
«Warum willst du das mit dem Skalpieren wissen?», fragte sie dann.
«Ach, das ist wegen der Predigt am Sonntag. Ich habe da eine Bibelstelle gefunden, die sich mir nicht erklärt.»
«Dann frag Bruder Göck.»
«Das werde ich tun. Gleich heute Nachmittag. Aber vorher wüsste ich gern, was dieser Sarazene dazu gesagt hat. Damit ich nicht gar so dumm vor Bruder Göck dastehe. Das verstehst du doch?»
«Ja», erwiderte Gustelies. Seit Jahren schon stritten Bruder Göck und Pater Nau über alle möglichen theologischen Angelegenheiten, und Gustelies war kein einziger Fall bekannt, bei dem sie mal einer Meinung gewesen waren. Sie fand, die beiden führten sich auf wie zwei Krieger in einer Schlacht. Ständig waren sie bemüht, einander bei einer Unwissenheit zu ertappen.
«Wir haben nicht über das Skalpieren gesprochen», erklärte sie. «Warum auch? Der angebliche Kannibale hatte ja nur die Glieder und den Kopf vom Rumpf getrennt. Nur einmal, ich erinnere mich, es war im Garten von Hella und Heinz, da hielt Arvaelo einen Vortrag über Blut. Ja, und dabei erwähnte er ein Vorkommnis. Ein Mann war mit seinem Haar in eine Winde geraten. Ein Stück Kopfhaut war dabei abgerissen, und Arvaelo war es nur mit Mühe gelungen, die Blutung zu stillen. Der Kopf, hatte er erklärt, blutet nämlich unwahrscheinlich stark.»
«Hat er überlebt?»
«Arvaelo?»
«Unfug. Der Mann mit der Winde.»
Gustelies zuckte mit den Achseln. «Ich habe keine Ahnung. Es ging damals darum, welche Form die Blutspritzer haben, wenn sie auf die Erde treffen.»
«Aha.»
Pater Nau versank in Schweigen. Trübsinnig starrte er in seinen Becher.
Gustelies hatte mittlerweile einen Kessel aufs Herdfeuer gesetzt. Sie nahm eine Handvoll Kräuter aus einem Leinensäckchen und streute sie in den Kessel.
«Das riecht nach Kamille», stellte Pater Nau fest. «Kochst du einen Sud davon? Ich hätte auch gern einen Becher.»
Gustelies verdrehte die Augen. «Nein, das ist kein Sud zum Trinken. Das ist eine Kamillenspülung für mein Haar.»
«Für dein Haar? Ist es etwa erkältet?»
Gustelies drehte sich zu ihrem Bruder herum und stemmte die Fäuste in die Hüften. «Willst du nicht in deine Studierstube gehen und dort ein bisschen nachdenken?»
Der Pater schüttelte den Kopf und zeigte mit dem Finger auf den Kessel. «Kamille für die Haare?», fragte er wieder.
«Ja, Herr im Himmel. Frauen tun das manchmal. Sie spülen ihr Haar mit Kamille, damit es glänzt.»
Pater Nau machte große Augen. «Wozu das denn?»
«Das geht dich nichts an, mein Lieber. Kümmere du dich um deine Predigt.»
Pater Nau stand auf, starrte nachdenklich vor sich hin, dann ließ er sich schwer zurück auf die Küchenbank fallen. «Sind Haare wichtig?», fragte er. «Ich meine, haben Haare eine Bedeutung? Ändert sich was, wenn man keine Haare mehr hat?»
Gustelies seufzte nachhaltig. «Bei Samson steckte die Kraft in den Haaren. Als Delilah sie ihm nahm, war er schwach. Bei Frauen ist das ein bisschen anders. Das Haar ist ein Schmuck, verstehst du, ein Zeichen für ihre Weiblichkeit. Deshalb gilt das Kahlscheren auch als Strafe. Mit Ehebrecherinnen tut man so etwas. Sie werden ihrer Schönheit beraubt. Als Strafe für den Ehebruch.»
«Das Haar als Zeichen der Weiblichkeit?» Pater Nau zog die Stirne kraus.
«Natürlich. Deshalb muss eine verheiratete Frau ja auch ihr Haar unter einer Haube verbergen. Nur ihr Mann darf sie noch in ihrer ganzen Pracht sehen. Die jungen Mädchen dagegen zeigen, was sie haben. Sie bürsten ihr Haar, bringen es zum Glänzen, um den Burschen zu gefallen.»
«Ich verstehe. Also hätte eine glatzköpfige Frau es schwer, jemanden zu finden, der sie heiratet.»
«Genau so ist es, mein Lieber. Und jetzt geh und stör mich nicht weiter. Gleich kommt die Magd vom Seifenmacher und bringt mir neue Ware. Und dann, mein Lieber, mache ich dir heute Abend ein schönes heißes Bad mit frischer Seife.»
«Auch das noch», stöhnte der Mann und schlich sich von dannen.
Kapitel 4
Warum bin ich nicht gestorben von Mutterleib an?
Warum bin ich nicht verschieden, da ich aus dem Leibe kam?», zitierte Pater Nau.
Bruder Göck verzog den Mund. «Buch Hiob», erklärte er. «Wenn mich nicht alles täuscht, Kapitel drei.»
«Hiob?»
Bruder Göcks Blicke irrten in der Studierstube umher. «Hat Gustelies heute keine Plätzchen gebacken? Oder hast du sie wieder versteckt, um mir nichts davon abgeben zu müssen?»
«Hiob?», wiederholte Pater Nau und schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. «Natürlich! Hiob.»
«Sag mal, was redest du da eigentlich?», wollte Bruder Göck wissen. Er war aufgestanden und hatte eine Schublade aufgezogen. «Ah, wusste ich es doch!», sagte er und holte ein Kästchen mit Gebäck hervor, öffnete es und steckte sich ein Stück in den Mund.
«Was hast du denn bloß mit Hiob?», fragte er kauend.
«Ach, die nächste Predigt, weißt du. Ich denke darüber nach, wie es ist, wenn man alles hat und der Herr es plötzlich und scheinbar ohne Grund wieder nimmt.»
«So. Und was soll das bringen? Was willst du deiner Gemeinde damit sagen?»
«Das weiß ich noch nicht», bekannte Pater Nau. «Im Augenblick stelle ich mir nur vor, wie das wohl sein mag.»
«Da musst du nicht selber denken, das kannst du alles in der Bibel nachlesen.»
«Ich will mir aber meine eigenen Gedanken dazu machen. Also, Bruder Göck, wie könnte so etwas sein?»
Der Antoniter goss Wein in seinen Becher. «Traurig. Sehr traurig. Ich glaube, die gesamte Hiobsgeschichte ist zu viel für eine Predigt. Wir haben im Kloster mal ein ganzes Jahr damit verbracht. Nimm dir einen Vers vor und rede darüber. Das ist schon mehr, als mancher an einem Sonntagmorgen verkraften kann. Gib mal die Bibel her.»
Bruder Göck schlug das in Leder gebundene Buch auf. «Hier ist es», sagte er und las. «Das dritte Kapitel handelt davon, dass jemand bedauert, geboren zu sein. Er empfindet das Leben als Fron, den Tod dagegen als Freiheit. Reicht das nicht aus?»
«Er bedauert, geboren zu sein», wiederholte Pater Nau. «Warum bedauert jemand, geboren zu sein? Weißt du das etwa, schlauer Antoniter?»
«Lass mich nachdenken. Wenn ich krank bin und unter schrecklichem Husten leide, dazu vielleicht noch Schnupfen habe, Gliederschmerzen und Ohrenweh, ja, dann bedaure ich schon mal, geboren zu sein. Oder besser gesagt: Dann wünsche ich mir den Tod herbei.»
Pater Nau nickte verständnisvoll. «Ja, eine Erkältung ist etwas wirklich Schreckliches. Aber es geht nicht darum, sich den Tod zu wünschen, sondern das eigene Leben zu verfluchen. Deine Erklärung taugt in diesem Falle nichts, mein Lieber.»
Bruder Göck stopfte nachdenklich ein weiteres Plätzchen in sich hinein.
«Mach nicht so viele Krümel», schimpfte Pater Nau. «Gustelies reißt mir den Kopf ab, wenn sie schon wieder meine Stube fegen muss.»
«Lass mich mit deinen Krümeln zufrieden, ich habe Wichtiges zu bedenken. Also: Wenn ich wünsche, nicht geboren zu sein, dann heißt das, dass mein Leben anders verläuft oder verlaufen ist, als ich mir das gewünscht habe.»
«Klingt einleuchtend.»
«Zum Beispiel», führte Bruder Göck aus, «wenn eine große Schuld auf mir lastet, wenn ich vielleicht eine Todsünde begangen habe, oder wenn meine Hoffnungen sich ins Gegenteil verkehrt haben.»
«Oder!» Pater Nau reckte seinen rechten Zeigefinger in die Höhe. «Wenn ich Gott nicht verstanden habe.»
«Ach was.» Bruder Göck winkte ab. «Das tun die allermeisten Menschen nicht, und viele davon merken es noch nicht einmal.»
Pater Nau hatte schon den Mund zu einer Erwiderung geöffnet, da wurde die Tür aufgerissen. Gustelies stand mit hochroten Wangen auf der Schwelle. «Habt Ihr ein Klopfen überhört?», wollte sie wissen.
«Stör uns nicht, wir jagen gerade einer interessanten theologischen Frage nach», erwiderte Pater Nau.
«Nun, die Jagd kann wohl noch ein paar Augenblicke warten. Ich will jetzt wissen, ob ihr ein Klopfen gehört habt, denn ich brauche unbedingt frische Seife.»
Bruder Göck blickte Gustelies verdutzt an. «Seife?»
«Ja. Seife. Die Magd des Seifenmachers wollte kommen, um sie mir zu bringen. Aber bisher war sie nicht da. Ich war kurz im Garten und kann mir gut vorstellen, dass ihr beiden Jäger das Klopfen überhört habt.»
Bruder Göck und Pater Nau sahen sich an, dann schüttelten sie den Kopf.
«Wozu in aller Welt taugen eure Dispute, wenn sie mich um meine Seife bringen?», fragte Gustelies und knallte die Tür hinter sich zu.
Kurze Zeit später eilte sie, bewaffnet mit einem Weidenkorb über dem Arm, durch die Stadt. Noch immer war es kalt, doch das Eis auf den Gassen begann allmählich zu tauen, der Schnee hatte sich in braunen Matsch verwandelt.
«Iiih!», schrie Gustelies auf, als ein Lehrjunge an ihr vorüberrannte und Matsch hinter ihm aufspritzte, der natürlich auf Gustelies’ Rocksaum ein neues Zuhause fand. «Kannst du denn nicht aufpassen, Bengel?»
Sie war schlecht gelaunt. Heute Morgen auf dem Markt hatte sie festgestellt, dass die Preise weiter gestiegen waren. In der letzten Woche hatte sie noch einen ganzen Hasen für das Geld bekommen, das heute nicht einmal mehr für eine Hasenkeule gelangt hatte. Wenn das so weitergeht, dachte sie, und der Rat dem Wucher nicht endlich Einhalt gebietet, so werde ich mich noch selbst auf die Lauer legen müssen. Bei diesem Gedanken stahl sich ein Lächeln auf ihr Gesicht. Ihr Verhältnis zu den wilden Kaninchen war seit jeher angespannt, doch seitdem sich die Vierbeiner über ihre frischen Pflänzchen hermachten und sogar die Büsche benagten, herrschte zwischen Gustelies und den Kaninchen ein erbitterter Krieg im Pfarrgarten.
Und nun hatten diese beiden Geistlichen, mit denen ohnehin nichts Gescheites anzufangen war, auch noch die Seifenmagd verpasst, sodass Gustelies sich höchstselbst in die Siedergasse aufmachen musste.
Ihr Rock war bis zu den Knien beschmutzt, als sie endlich dort anlangte. Missmutig hämmerte sie an die Tür. Die Frau des Seifensieders öffnete ihr. «Gott zum Gruße, Kurzwegin. Was führt Euch zu uns?»
«Seife, was denn sonst?», antwortete Gustelies bissig. «Eure Magd sollte heute kommen, aber Pater Nau hat wohl ihr Klopfen überhört. Deshalb bin ich nun da.»
«Ach?» Die Frau des Seifensieders legte aufmerksam den Kopf schief. «Bei Euch war sie, die Lilo?»
«Wieso?», fragte Gustelies zurück. «So war es doch ausgemacht, oder nicht?»
Die Seifensiederin sah sich um, winkte einer Nachbarin zu, die aus dem Fenster lehnte. «Kommt lieber rein, Kurzwegin, es müssen ja nicht alle hören, was wir zu bereden haben.»
Verdutzt folgte Gustelies der Frau in die Küche. Hier standen zahlreiche Töpfe, in denen Fett und Asche brodelten. Es roch nach Lavendel und anderen Duftölen, die den Seifen zugesetzt wurden.
«Also, was ist denn nun mit der Magd?»
Die Seifensiederin setzte sich, die Hände auf dem Kittel gefaltet. «Ich weiß es nicht, Kurzwegin, das müsst Ihr mir glauben. Heute Morgen ist sie weggegangen wie immer, hatte alle Bestellungen dabei. Aber ausgeliefert hat sie nichts.»
«Ach?» Gustelies stellte ihren Weidenkorb auf den Fußboden und verschränkte die Arme vor der Brust. «Woher wisst Ihr das?»
«Den ganzen Nachmittag klopft es schon an der Tür. Wütende Kunden, die sich über das Fernbleiben der Lilo beschweren. Ich dachte mir schon das Schlimmste.»
Sie atmete laut aus und hob die Hände. «Aber da sie ja bei Euch war, scheint sie sich nur verschwatzt zu haben. Sie wird eine Ohrfeige bekommen, wenn sie hier auftaucht, und alles ist wieder gut.»
«Nun, ich weiß nicht sicher, ob sie da war, die Lilo. Ich war die ganze Zeit im Haus und nur einmal kurz im Garten. Der Pater schwört, er hätte in dieser Zeit kein Klopfen gehört.»
«Wirklich nicht? Aber Ihr sagtet doch …»
«Ihr kennt doch Pater Nau», unterbrach Gustelies die Seifensiederin. «Wenn er erst einmal in einen Disput verstrickt ist, hört er selbst die Glocken von Jericho nicht mehr.»
«War sie nun da, die Lilo, oder nicht?», wollte die Seifensiederin wissen und hatte auf einmal einen ängstlichen Blick.
«Beschwören kann ich nichts», entgegnete Gustelies.
Da fing die Seifensiederin an zu weinen. Gustelies legte ihr eine Hand auf den Arm. «Na, na, meine Gute, es wird schon nicht so schlimm sein. Viele Mägde laufen ihren Dienstherren davon. Ihr werdet eine neue finden. Die Kunden werden’s Euch nicht nachtragen.»
«Aber darum geht es doch nicht allein», schluchzte die Seifensiederin.
«Nicht? Worum denn dann?»
Die Frau putzte sich mit ihrer Schürze geräuschvoll die Nase. «Unsere Lilo, sie ist schwanger. Schon bald sollte das Kindlein kommen.»
«Oh, verflixt. Wahrscheinlich hat irgendein Tunichtgut die Unschuld des armen Kindes ausgenutzt. Sie ist nicht die Erste, der das geschieht. Vielleicht hat sie sich zusammen mit diesem Schürzenjäger aus dem Staub gemacht? Ach, es ist schon ein Kreuz mit den Männern und der Liebe! Die wenigsten sind es wert, aber das stellt sich immer erst hinterher heraus. In der Hölle soll der Verführer schmoren!»
«Es ist unser Sohn.»
«Was?»
«Der Schürzenjäger, der in der Hölle schmoren soll, das ist unser Sohn.»
Gustelies schluckte. «Oh, das … äh … wollte … also, der Eure, der ist natürlich eine Ausnahme.»
Die Seifensiederin beachtete Gustelies’ Gestammel nicht. «Im letzten Herbst ist er auf Befehl des Kaisers in den Türkenkrieg gezogen. Verheiratet wären die beiden schon, wenn der Krieg nicht wäre, und alles hätte seine Ordnung gehabt. Sie haben sich geliebt, die Lilo und der Lothar. Eine gute Seifensiedersfrau wäre sie geworden. Und ordentlich und anständig dazu.»
«Hmm, dann kann sie also nicht weggelaufen sein.»
«Ja, eben. Deshalb mache ich mir ja solche Sorgen. Immer pünktlich und zuverlässig, die Lilo. So etwas wie heute ist noch nie vorgekommen.»
«Wann und wo ist sie denn zuletzt gesehen worden?», fragte Gustelies.
«Als die Turmuhr die siebte Stunde geschlagen hat, ist sie aufgebrochen. Zur Mittagszeit hätte sie zurück sein sollen. Und danach wollte sie den anderen Teil der Waren ausliefern.»
«Und jetzt läutet es gleich zur Vesper, und sie ist noch nicht zurück.»
Die Seifensiederin nickte und schaute Gustelies hilfesuchend an.
Gustelies stand auf. «Hat sie Verwandte oder Freundinnen in der Stadt?», fragte sie.
«Eine verwitwete Tante. Und ein ehemaliges Nachbarsmädchen. Sie wohnen beide nur zwei Straßen weiter.»
«Gut», erklärte Gustelies. «Ich bin ohnehin auf dem Weg zu meiner Tochter und meinem Schwiegersohn. Ich werde dem Richter erzählen, was hier geschehen ist. Ihr geht derweil zur Tante und zur Freundin und schaut, ob die Lilo vielleicht dort ist. Ist sie es nicht, dann besucht noch einmal alle Kunden, denen die Lilo heute Waren ausliefern sollte, und befragt sie ausführlicher. Auf diese Art können wir feststellen, wo und wann das Mädchen womöglich abhandengekommen ist.»
Die Seifensiederin riss vor Entsetzen die Augen auf. «Ihr meint also, der Lilo ist wahrhaftig etwas zugestoßen?»
«Aber nein, aber nein. Ihr wisst doch, wie die jungen Dinger heutzutage sind. Haben ihre Gedanken oft in den Füßen und rennen los wie junge Hunde, ohne Bescheid zu geben. Und wenn sie dazu noch schwanger ist, herrje! Welche Frau in guter Hoffnung wird nicht von seltsamen Gedanken geplagt? Sie wird sich schon finden, da bin ich ganz sicher.»
Die Seifensiederin nickte, doch ohne viel Hoffnung.
Kapitel 5
Als Gustelies ein wenig außer Atem bei ihrer Tochter im Richterhaus eintraf, fand sie Hella sehr beschäftigt vor. Sie saß in der Küche neben der schwarzen Hilde und starrte mit weitaufgerissenen Augen auf einen Faden, an dem ihr Ehering hing. Die schwarze Hilde pendelte damit über Hellas gewölbten Bauch.
«Was, in aller Welt, treibst du da?», wollte Gustelies wissen und beäugte misstrauisch die schwarze Hilde.
«Wie sieht es denn aus?», fragte Hella zurück. «Ich will doch einfach nur wissen, ob ich einen Jungen oder ein Mädchen bekomme.»
«Aha.» Gustelies stemmte die Hände in die Hüften und sah die schwarze Hilde streng an. «Und? Was ist rausgekommen?»
Die schwarze Hilde fing ihr Pendel ein. «Ihr habt gestört. Jetzt sind die Schwingungen weg.»
«Aha. Ich habe die Schwingungen vertrieben, na, so etwas aber auch. Und vorher? Als ich noch nicht da war?»
«Wir hatten gerade erst begonnen. Das Pendel hat sich noch seinen Weg gesucht.»
«Ist es gekreist oder hin- und hergeschwungen?»
«Mama, jetzt lass doch», mischte sich Hella in das Verhör.
«Also, es hat sich gerade erst eingeschwungen.»
«Mit anderen Worten», beendete Gustelies das Gespräch, «euer Hokuspokus hat zu keinem Ergebnis geführt.»
Die schwarze Hilde stülpte die Unterlippe vor. «Niemand ist verpflichtet, an meine Kunst zu glauben.»
«Das wäre ja auch noch schöner», sagte Gustelies bestimmt, gab der Frau ein paar Groschen und wedelte sie mit der Hand zur Tür hinaus.
«Mutter!» Hella hatte sich aufgesetzt. «Was fällt dir ein? Du kannst doch nicht einfach meine Gäste aus meinem Haus werfen.»
«Gäste? Wenn die schwarze Hilde ein Gast ist, dann bin ich ein Engelchen. Sie hat dich betrogen, deine Gutgläubigkeit ausgenutzt. Pendeln! Pfft! Dass ich nicht lache!»