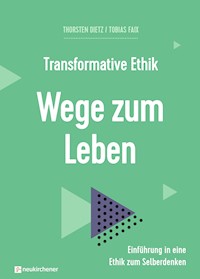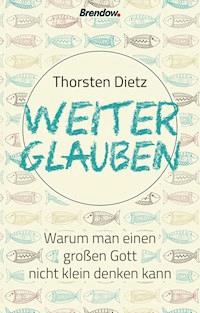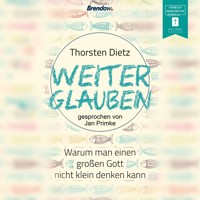Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neukirchener Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Mit Veränderungsprozessen nehmen auch ethische Fragen und Konflikte zu - in unserer Gesellschaft ebenso wie in Kirchen und Gemeinden. Band 2.1 der Transformationsreihe ist diesen Veränderungsprozessen im Bereich der Ethik und den Kriterien für gute und moralische Entscheidungen auf den Grund gegangen. In Band 2.2 geht es nun speziell um Veränderungen und Fragen im Bereich der Sexualethik. Das Buch beleuchtet das vielfältige Thema mit wissenschaftlicher und theologischer Tiefe. Zugleich nimmt es auch die persönliche und gemeindliche Glaubenspraxis in den Blick. Um das Thema nicht eindimensional zu beleuchten, kommen diverse Stimmen zu Wort. Ziel des Buchs ist es erneut Leser:innen dabei zu unterstützen, moralische Konflikte anhand biblischer Leitlinien selbstständig zu lösen. Eine Sexualethik zum Selberdenken. Mit den Themen: Feministische Theologie, Geschlechtergerechtigkeit, Diversity, Homosexualität, Trans- und Intersexualität, Non-Binarität, Polyamorie, Leiblichkeit und Sexualität, Ehe und Familie, Scheidung, Sexualisierte Gewalt und Missbrauch, Prostitution, Pornografie, Scham und Macht, Umgang mit sexualethischen Konflikten u.v.m.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 641
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationeninsbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG zu gewinnen, ist untersagt.
© 2025 Neukirchener Verlagsgesellschaft mbH, Neukirchen-Vluyn
Andreas-Bräm-Straße 18/20, 47506 Neukirchen-Vluyn,
[email protected] Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Grafikbüro Sonnhüter, www.grafikbuero-sonnhueter.de, unter Verwendung eines Bildes © iStockphoto.com
Lektorat: Hauke Burgarth, PohlheimDTP: dtp studio eckart | Jörg Eckart, Frankfurt am Main
Verwendete Schrift: Apollo MT Std, Akko Pro
eBook: PPP Pre Print Partner GmbH & Co. KG, Köln, www.ppp.euISBN 978-3-7615-7038-8 PrintISBN 978-3-7615-7039-5 E-Book
www.neukirchener-verlage.de
Band 2/2: IST – »Interdisziplinäre Studien zur Transformation«
Herausgegeben von Sandra Bils, Thorsten Dietz, Tobias Faix, Tobias Künkler, Sabrina Müller, in Zusammenarbeit mit dem Studiengang Transformationsstudien für Öffentliche Theologie & Soziale Arbeit an der CVJM-Hochschule.
Geleitwort von Peter Dabrock
»Ich begehre, begehrt zu werden!« Mit dieser Sentenz fasst die ungarisch-amerikanische Philosophin Agnes Callard die Bedeutung menschlicher Sexualität zusammen. Und fürwahr, der Satz gilt für all die unterschiedlichen Liebesbeziehungen, wenn es um diese »unverschämt-schöne« Sache geht: vom Solosex bis zur offenen Beziehung, beim körperlichen Lustgewinn, in der romantischen Liebe und auch – irgendwie transformiert – in einer lang gepflegten und krisenerprobten Lebensform, für Heteros oder Queers. »Ich begehre, begehrt zu werden!« Es könnte so schön, es könnte so einfach sein, ist es aber nicht, um die Fanta4 zu bemühen. Denn – und das macht sie so begehrenswert – Sexualität dient nicht nur der Reproduktion, ist nicht mehr nur eingebettet in eine lebenslange, monogame, heterosexuelle Lebensform von (hoffentlich) Liebe, vulgo: in die Institution Ehe (das war sie sowieso immer nur »offiziell«). Nein, gerade nachdem Verhütung im Verhältnis zu früheren Zeiten so viel sicherer geworden ist, kann man dazu stehen, was Sexualität schon immer war – und was sie so prickelnd macht –, mit Emmanuel Levinas gesprochen: Sie ist ein Begehren, das in der Erfüllung nach »mehr« verlangt. Wenn es um Sex geht, erlebt man Kontrollverlust, macht Grenzerfahrungen, darf es wild werden. Die andere Seite von dem, was im Alltag, in Schule, Studium, Ausbildung oder Beruf, in der Gesellschaft erwartet wird – Rationalität, Ordnung, Zielstrebigkeit – kann zurückgelassen werden (obwohl es verrückterweise auch beim Sex Leistungsdruck gibt). Aber genau in diesem Außerordentlichen lauern auch vielfältige Gefahren, für einen selbst und für andere: Kontrollverlust macht nämlich auch anfällig für Machtmissbrauch, für Gewalt – und nicht nur die kontrollierte, der in manchen Formen von Sexualität gefrönt wird. Das kann nicht nur wehtun, sondern traumatisieren und ungerechte Verhältnisse zwischen Menschen, ja in der Gesellschaft auf Dauer infrage stellen. Neben toxischen Beziehungsmustern denkt man sofort an Zwangsprostitution, aber auch die seit über 15 Jahren noch immer die Glaubwürdigkeit von Kirchen schwer belastenden Skandale sexualisierter Gewalt mit ihren ganz unterschiedlichen Ausprägungen haben am Ende zahllose Biografien von Menschen wie dir und mir zerstört.
Kurzum: Auch über eine der »unverschämt-schönsten« Sachen der Welt muss nachgedacht und gesprochen und hoffentlich nicht nur ein Konsens »Nein heißt Nein und Ja heißt Ja« zwischen Sexpartner:innen hergestellt werden, wie es dieses Buch unterstreicht. Sexualität ist ein gesellschaftliches Thema – und es ist auch ein religiöses. Denn jede Religion (jedenfalls von denen, die mir bekannt sind) geht nicht nur aufs Ganze, sondern stellt immer auch Anforderungen an gutes Verhalten gegenüber anderen und sich selbst.
Für evangelische Christ:innen steht für die Beantwortung der ethischen Fragen zudem die Orientierungskraft der Bibel, die gerade in evangelikalen oder freikirchlichen Kreisen als das wortwörtlich zu hörende und Gehorsam verlangende Wort Gottes verstanden wird, auf dem Spiel. Aber kann man dieses Verständnis aufrechterhalten, wenn in der Bibel Gott an manchen Stellen wie ein Vergewaltiger geschildert wird, wenn Frauen notorisch unterdrückt werden oder Sexualität bestenfalls als hinzunehmende Leidenschaft gedeutet wird?
Thorsten Dietz und Tobias Faix haben ein Buch vorgelegt, das sich in evangelisch-theologischer Tradition all diesen Herausforderungen in bester Manier stellt. Ein Wort, tief im Buch verortet, bringt ihren Ansatz auf den Punkt: »Es gibt ein Leben in Orientierung an der Bibel, das auch auf neuen Wegen Halt findet an alten Weisungen. Wechselseitige Liebe, Rücksicht und Vergebungsbereitschaft, Ehrlichkeit und Treue – all das sind Werte, die den Test von Jahrtausenden bestanden haben.« Ich habe dieses Buch mit großem Gewinn gelesen, weil es das Thema Sexualität in der nötigen Breite, mit allen Licht- und Schattenseiten und der gebotenen Sensibilität diskutiert. Selbst aktuelle Fragen von Gender über vermeintliche Pornografiesucht bis hin zu neuen Lebensformen à la Polyamorie werden aufgegriffen. Dabei fällt durchweg der unaufgeregte Stil der beiden Autoren wohltuend auf: Grenzen wahrnehmend, scham- und vulnerabilitätssensibel, hörend und dennoch orientierend. Ihre geschichtlichen Darstellungen wie aktuellen Deutungen erweisen sich durchweg als differenzkompetent und ambiguitätssensibel – alles ohne denkbaren Voyeurismus, aber auch ohne Pseudodistanz. Es geht eben für alle ums Eingemachte. Deshalb möchte das eingespielte Autorenteam mit seiner transformativen Ethik vor allem zum Selberdenken anregen. Die vielen Fragen eignen sich hervorragend als Grundlage für Gruppendiskussionen. Die Testimonials, in denen Menschen ihre eigenen Probleme offen benennen, aber auch – diese Formulierung hat mich beeindruckt, weil sie deutlich macht, dass Sexualität eine lebenslange Lerngeschichte bleibt – »Stand heute« ihre Lösungswege bezeugen.
Nachdem ich selbst zusammen mit einigen Kolleg:innen vor über 10 Jahren unter nicht leichten Umständen eine Sexualethik (Unverschämt – schön) vorgelegt habe, merke ich, wie vieles anders und neu gesagt werden soll, muss und darf. Dieser zu Transformationen, die einfach unser Leben ausmachen, anspornenden Ethik von Thorsten Dietz und Tobias Faix mit ihren klugen Orientierungen, die nie moralistisch daherkommen, wünsche ich viele Leser:innen: Lasst euch zum Selberdenken ermutigen! Denn Sexualität ist »unverschämt-schön«.
Peter Dabrock ist Professor für Systematische Theologie mit dem Schwerpunkt Ethik an der Universität Erlangen. Von 2012 bis 2020 war er Mitglied (und 2016 bis 2020 Vorsitzender) des Deutschen Ethikrats der Bundesregierung.
Einleitung
In den letzten Jahrzehnten hat eine Art »Ethisierung« des Glaubens und der Theologie stattgefunden. Ethische Fragen stehen heute im Zentrum der Aufmerksamkeit. Es sind Fragen, die heute Spannungen verursachen und teilweise sogar Gemeinden und Kirchen spalten können. Das gilt vor allem für Themen aus dem Bereich der Sexualethik. Seit vielen Jahren wird weltweit gerungen um den Umgang mit gleichgeschlechtlich liebenden Menschen, um sexualethische Normen für voreheliche Beziehungen, das Verständnis der Ehe, die Bedeutung von Geschlecht für den Zugang zu Ämtern und Diensten, ein christliches Verständnis von Geschlechtsidentität jenseits einer binären Unterscheidung von männlich und weiblich – und vieles mehr.
Auch unser Ethik-Projekt ist Teil dieser Auseinandersetzungen, weil wir aktuelle ethische Fragen reflektieren und auch selbst Stellung beziehen. Und zugleich geht es uns um mehr. Viele Debatten leiden daran, dass moralische Positionen nicht nur gegensätzlich artikuliert, sondern dadurch Lager gebildet und Fronten der Auseinandersetzung vertieft werden. Wir wissen uns einem Ethikverständnis verpflichtet, das auch solche moralischen Spaltungen kritisch betrachtet.
Ethik bedeutet für uns die Reflexion unserer moralischen Urteile. Ziel des ethischen Nachdenkens muss es sein, Moralisierungen und Schuldzuweisungen zu vermeiden. In der ethischen Reflexion unserer moralischen Urteile bemühen wir uns darum, die eigene Sicht differenziert zu entfalten und soweit es geht zu begründen – und dies im gründlichen Gespräch mit der Bibel und der christlichen Tradition sowie unterschiedlichen ethischen Deutungen, die es zu jedem Thema gibt. Ethik zielt immer auf ein tieferes Verständnis der eigenen und aller anderen Positionen, weil sie grundsätzlich nach einem guten Leben sucht, sowohl für sich selbst als auch für andere. Es wäre illusorisch, von einer Ethik die Auflösung aller Spannungen zu erwarten; wohl aber erhoffen wir uns eine Versachlichung.
Da Ethik, insbesondere Sexualethik, heute im öffentlichen Diskurs eine zentrale Rolle spielt, wollen wir einen sachlichen Beitrag leisten, der zum Selberdenken anregt, ohne fertige Antworten vorzuschreiben. Aufbauend auf den theoretischen Grundlagen von Band 1 zeichnen wir in diesem Werk die großen Linien in den Bereichen Sexualität, Geschlecht und Lebensformen nach, um biblisch-theologische Leitlinien und gesellschaftliche Veränderungen sinnvoll aufeinander zu beziehen. Da wir nicht alle Einzelfragen oder -fälle behandeln können, verweisen wir auf unseren Podcast Karte & Gebiet, der auf Plattformen wie Spotify und Apple Music verfügbar ist. Dort haben wir bereits eine Staffel zu sexualethischen Themen veröffentlicht. Auf dieser Plattform werden wir auch Reaktionen auf unsere Ethik diskutieren können. Die bisherigen Erfahrungen mit Buch und Podcast sind für uns sehr positiv – fast eine halbe Million Downloads zeigen, wie bedeutsam ethische Themen heute sind.
Eine Ethik zum Selberdenken
Nach dem Einleitungskapitel, das unser Verständnis von transformativer Ethik sowie die Kontexte der Sexualethik beschreibt (Kapitel 1), erläutern wir die grundlegende Bedeutung des jeweiligen Menschenbildes für ethische Fragen (Kapitel 2). Diese Erörterung bildet die Basis für die folgenden Kapitel zu den Themen Gender (Kapitel 3), Sexualität (Kapitel 4) und Lebensformen (Kapitel 5). Unser Ziel ist es, verschiedene Positionen darzustellen, sei es deskriptiv oder durch Pro- und Kontra-Darstellungen. Dabei bemühen wir uns, verschiedene Seiten möglichst stark darzustellen, auch jene, die wir selbst nicht vertreten. Dies wird uns nicht immer gelingen, und unsere eigene Meinung wird an manchen Stellen mehr oder weniger deutlich sichtbar werden, denn es gibt ethische und theologische Grundhaltungen, die für uns als Autorenduo zentral sind wie bspw. die Gleichberechtigung von Frauen und queeren Menschen. Wir sind uns als Autorenduo dabei bewusst, dass wir zwei weiße Cis-Männer sind und haben daher sieben weibliche Perspektiven an verschiedenen wichtigen Stellen des Buches aufgenommen, um eine authentische Stimme in biografischen Zeugnissen zu geben. Schafft dies einen Ausgleich? Nein. Wollen wir damit alle Positionen darstellen? Nein. Vielmehr wollen wir damit den eigenen Standpunkt reflektieren und deutlich machen, dass es mehr als den unseren gibt, und dadurch die Reflexion fördern. Zusätzlich haben wir »Ethische Fragen zum Selberdenken« eingebaut, die die Leser:innen bei ihrer Meinungsbildung unterstützen sollen. Das Buch schließt mit einem Kapitel über Instrumente zur Bearbeitung von sexualethischen Konflikten (Kapitel 6), um konstruktive Lösungen bei unterschiedlichen Ansichten zu ermöglichen – insbesondere in Gruppen und Gemeinden.
Sexualethik als Teil unseres brüchigen Lebens
Unsere Überlegungen zur Sexualität stehen nicht im Zeichen idealer Normen, sondern im Kontext von Beziehungen auf dem Weg. Wir wissen, dass Sexualität und Beziehungen oft fragil und brüchig sind und nicht selten Versöhnung und Erneuerung erfordern. Für uns ist Christus derjenige, der heilsame Transformationen und Versöhnung miteinander ermöglicht. Deshalb steht unsere transformative Ethik in der Spannung zwischen der evangelisch-reformatorischen Tradition und kontextuellen Perspektiven wie feministischer und queerer Theologie. Sexualität ist wie alles Menschliche zweideutig und gefährdet, ein wunderbarer, aber auch vulnerabler Teil der menschlichen Identität. Themen wie Sexismus, »MeToo« und sexualisierte Gewalt, die heute leider allgegenwärtig sind, werden daher in unserem Entwurf eine wichtige und notwendige Rolle spielen. Der Begriff »Notwendigkeit« hat dabei im Kontext der Sexualethik oft eine doppelte Bedeutung. Für die einen besteht die Notwendigkeit darin, marginalisierten Gruppen Sichtbarkeit und eine Stimme zu geben. Für andere liegt sie darin, bestimmte Normen und Werte hochzuhalten, um in Transformationsprozessen Stabilität zu gewährleisten. Wir möchten beide Perspektiven beleuchten, die Spannung zwischen ihnen aushalten und uns manchmal auch darin positionieren. Dabei bleiben wir uns bewusst, dass diese Sexualethik weder Sexualwissenschaft noch Sexualratgeber oder eine biblische Exegese ersetzen kann.
Ein herzliches Dankeschön
Dieses Buch wäre ohne die Unterstützung zahlreicher Menschen nicht möglich gewesen. Besonders danken wir den Frauen und queeren Menschen, die ihre Erfahrungen und Perspektiven zu Themen wie Transidentität, sexualisierte Gewalt und Asexualität mit uns geteilt haben. Auch die biografischen Zeugnisse, die daraus entstanden sind, verleihen dem Buch eine besondere Note. Ein großer Dank gilt unseren inhaltlichen Korrekturleser:innen, darunter Sabrina Müller, Tobias Künkler, Sarah Vecera, Laura Schäfer, Kerstin Söderblom, Annegret Puttkammer, Christian Hilbrands, Pascal Vach und Joseph Okon. Ein besonderer Dank gilt dem Neukirchener Verlag (besonders der Verlagsleiterin Ruth Atkinson und unserem Lektor Hauke Burgarth) für Mut, Geduld und Unterstützung sowie die Herausgabe der IST-Reihe – es ist uns immer wieder eine Freude und Ehre, mit euch unterwegs zu sein.
Im Januar 2025Thorsten Dietz und Tobias Faix
1/
Einführung in eine transformative Sexualethik
1.1 Sexualethik – ein konflikthaftes Thema
An Themen wie Gender oder der Frage nach der sexuellen Identität entzünden sich heute moralische Konflikte mit ungeheurer Sprengkraft. Neue Grenzlinien entstehen jenseits bekannter Gebiete von Parteien, Konfessionen oder Kirchen. Fragen wie »Wer bin ich?« oder »Bin ich nur das, was ich selbst gewählt habe, oder was andere mir vor- und zuschreiben?« werden existenzieller. Wie sollen und können wir damit umgehen?
1.1.1 Eine erste Skizze des Gebiets
Zunächst geht es darum zu klären, wovon wir reden, denn viele Begrifflichkeiten werden unterschiedlich verstanden. In unserer transformativen Ethik gehen wir deshalb zu Beginn einige wichtige sexualethische Grundbegriffe durch, damit die Lesenden verstehen, was wir meinen, wenn wir von a) Geschlecht und b) Sexualität reden.
Geschlecht bezieht sich auf die geschlechtliche Identität eines Menschen, also darauf, als was sich ein Mensch geschlechtlich versteht bzw. von anderen verstanden wird, persönlich, sozial und rechtlich. Sexualität bezieht sich hingegen auf die Anziehung durch andere Menschen bzw. auf die Ausrichtung in einem sexuell-körperlichen oder seelisch-romantischen Sinn.
Weil selbst Grundbegriffe oft unklar gebraucht werden, wollen wir mit einem kleinen Glossar beginnen, wie wir die zentralen Begriffe unserer Sexualethik verstehen:1
a) Geschlecht
Als Geschlechtsidentität gilt die Einschätzung (des Menschen selbst bzw. durch andere Menschen) als Mann und Frau, als divers, non-binär oder agender (keine Zuordnung zu einem Geschlecht), als intergeschlechtlich oder als trans.
Cisgeschlechtlich: Menschen, die bei der Geburt dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugewiesen worden sind aufgrund ihrer körperlichen Anatomie, die sich selbst damit identifizieren und sozial auch allgemein so wahrgenommen werden.
Transgeschlechtlich: Menschen, die bei der Geburt dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugewiesen worden sind aufgrund ihrer körperlichen Anatomie, die sich aber mit dem anderen Geschlecht identifizieren und in unterschiedlichem Ausmaß eine soziale und körperliche Transition vollziehen (trans Mann bzw. trans Frau). (Ausführlich in Kap. 3.7)
Intergeschlechtlich: Menschen, die von Geburt an aufgrund anatomischer bzw. biologischer Merkmale nicht eindeutig dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugewiesen werden können. Diese Menschen identifizieren sich entweder als Mann oder als Frau oder als divers bzw. intergeschlechtlich (ausführlich in Kap. 3.6).
Non-binär: Menschen, die sich nicht (gänzlich) mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren, sondern sich in unterschiedlicher Weise überwiegend mit einem Geschlecht (transmaskulin / transfeminin), mit keinem wirklich (agender) oder mit beiden (bigender) identifizieren bzw. dies als wechselhaft erleben (genderfluid). (Ausführlich in Kap. 3.6)
Geschlecht hat immer mehrere Dimensionen, körperliche, seelische und soziale, die man unterscheiden, aber nicht trennen kann. Geschlecht ist eine biopsychosoziale Einheit mit folgenden Ebenen:
Biologisches Geschlecht: Dazu gehört das genetische Geschlecht (Chromosomen), das morphologische Geschlecht, also die körperlichen Merkmale wie Fortpflanzungsorgane, äußere Genitalien, Geschlechtszellen etc. sowie die Sexualhormone, die die Entwicklung und Funktion der dazu notwendigen Fortpflanzungsorgane steuern (ausführlich in Kap. 3.4).
Soziales Geschlecht: Gender bezieht sich auf die sozialen und kulturellen Verhaltensweisen, Aktivitäten und Merkmale, die eine Gesellschaft mit dem Mann- oder Frausein verbindet. Was in einer bestimmten Kultur als »männlich« oder »weiblich« angesehen wird, ist stets sozial und kulturell konstruiert und entsprechend in einem beständigen Wandel (ausführlich in Kap. 3.4).
Psychisches Geschlecht / Geschlechtsidentität. Das Geschlechtsempfinden bezieht sich auf das innere, persönliche Erleben des eigenen Geschlechts. Es ist die tief empfundene Überzeugung, einem bestimmten Geschlecht anzugehören – sei es männlich, weiblich, beides, keins von beiden oder irgendwo dazwischen.
b) Sexualität
Sexualität hat ebenfalls verschiedene Ebenen: körperlich-sexuell (Lust, Begehren), seelisch-»romantisch« (Anziehung, Vertrautheit), lebenszyklische Phasen (Pubertät, Klimakterium etc.), sexuelle Orientierung.
Heterosexuelle Orientierung: Sexuelle und romantische Anziehung durch Personen des anderen Geschlechts (historisch die Mehrheit).
Homosexuelle Orientierung: Sexuelle und romantische Anziehung durch Personen des gleichen Geschlechts (ausführlich in Kap. 4.3.1–3).
Bisexualität: Sexuelle und romantische Anziehung durch Personen des eigenen Geschlechts bzw. eines anderen Geschlechts (ausführlich in Kap. 4.3.4).
Pansexualität / Omnisexualität: Sexuelle und romantische Anziehung durch Personen aller Geschlechter.
Asexualität: Keine (oder nur geringe) sexuelle Anziehung (ausführlich in Kap. 4.3.4).
Aromantik: Keine (oder nur geringe) romantische Anziehung (ausführlich in Kap. 4.3.4).
Diese Differenzierung macht manchen Menschen Mühe und für andere ist sie eine Befreiung, weil sie bisher keine Worte für ihr Empfinden hatten. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Fragen rund um die Geschlechtsidentität eine immer größere Rolle spielen und eine immer größere Macht im aktuellen kirchlichen, theologischen und gesellschaftlichen Diskurs haben, der oftmals vor allem in den sozialen Medien ausgefochten wird. So bringt der katholische Moraltheologe Eberhard Schockenhoff die Veränderung des Gebiets im Bereich Sexualethik sehr gut auf den Punkt, wenn er schreibt: »Auf keinem anderen Gebiet lässt sich der gesellschaftliche Wandel unserer moralischen Anschauungen so deutlich beobachten wie auf dem Feld des sexuellen Verhaltens. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts veränderten sich die Einstellungen der Menschen gegenüber Liebe, Sexualität und Partnerschaft in mehreren Schüben tiefgreifend.«2 Und wenn es um Sexualethik geht, geht es auch um Normen – christliche sowie gesellschaftliche, traditionelle Lebensformen, Doppelmoral und Tabuisierungen. Schauen wir bspw. auf die konservativen Nachkriegsjahre, in deren Ehe und Familie ein gesellschaftlich starkes Leitbild waren und Frauen ohne die Erlaubnis ihres Mannes weder einen Arbeitsvertrag unterzeichnen noch ein Bankkonto eröffnen durften. Die Rolle der Frau war als Hausfrau und Mutter zementiert und das Gesetz zum »Gehorsam der Ehefrau gegenüber ihrem Mann« wurde erst 1957 abgeschafft. Die Kirchen hatten eine starke Stimme, wenn es um das moralische Verhalten in der Gesellschaft ging und so war vorehelicher Geschlechtsverkehr ein Tabu, Selbstbefriedigung Sünde und Kinder außerhalb der Ehe waren eine Schande. Schauen wir auf die empirische Wirklichkeit in der Nachkriegszeit, dann stellen wir fest, dass diese ganz anders aussah: Denn 90 % der Männer und 72 % der Frauen hatten bereits intime Erfahrungen vor der Ehe gemacht ebenso wie 66 % der regelmäßigen Kirchgänger:innen.3 Auch im konservativen Amerika sahen die Zahlen nicht anders aus, so hatten 50 % der Frauen bereits vor der Ehe Geschlechtsverkehr und 62 % praktizierten Selbstbefriedigung.4 So könnten wir in fast jede Zeitepoche eintauchen und eine Diskrepanz zwischen Norm und Wirklichkeit feststellen. Das Wirkliche ist nicht immer das Richtige, aber das Richtige ist auch nicht immer die gesellschaftliche Norm.
Transformative Ethik heißt, dass wir diese Diskrepanz aufnehmen und wahrnehmen wollen, dass wir die Wirklichkeit in ihrem Wandel sowie die Menschen mit ihren Bedürfnissen verstehen wollen (Gebiet), ohne dass wir ethische Normen und christliche Werte (Karte) vernachlässigen. Genau diese Spannung macht Ethik notwendig und hilft nicht nur bei der Reflexion des eigenen moralischen Handelns, sondern auch beim Verständnis der gesellschaftlichen Veränderungen, an die wir kulturell gebunden sind. Die gesellschaftlichen und kulturellen Transformationen haben wir ebenso wie unsere hermeneutischen Grundannahmen und theologischen Wegweiser ausführlich in Band I beschrieben. In diesem Band geht es um die Frage, was dies für sexualethische Felder bedeutet. Besonders wollen wir auf die für die sexualethischen Themen wichtigen gesellschaftlichen Transformationen wie Digitalität und Globalisierung blicken: Die Digitalisierung hat den Zugang zu sexualisierten Inhalten und die Kommunikationskultur, vor allem wenn es um Geschlecht und Sexualität geht, maßgeblich verändert. Die Globalisierung wiederum zwingt uns, die Kontextualität ethischer Ansätze wahrzunehmen und so den eigenen Standpunkt in unserem Gebiet besser zu reflektieren. Wir verstehen Ethik deshalb als Reflexion von Moral und moralischem Handeln. Solche Reflexionen schaffen Abstand zu konfliktorientierter Kulturkampfrhetorik. Wir brauchen Ethik, um überhaupt wieder miteinander über unsere moralischen Intuitionen sprechen zu können. Die Unterscheidung von Reflexion und konkreter normativer Auffassung bewahrt die Freiheit zur Reflexion und Auseinandersetzung, auch wenn die Reflektierenden selbst moralische Prinzipien haben, die ihre Reflexion anleiten. Ohne Ethik gibt es keinen Dialog. Nur durch Ethik werden wir fähig, zwischen die Konfliktlinien zu gehen und jeweils das kommunikative und selbstreflexive Element zu fördern. Das Ziel ist eine eigenständige ethische Urteilskraft. Damit verbunden ist auch eine Ambiguitätstoleranz gegenüber anderen Weltauffassungen und Werten. Daher sollen verschiedene Perspektiven eine faire Darstellung finden.
1.1.2 Transformative Ethik – was wir darunter verstehen
Transformative Ethik klingt zunächst einmal nach einem Widerspruch. »Transformativ« nennen wir Akteur:innen oder Impulse, die nicht nur Wandel befördern, sondern grundlegende Veränderungen bewirken. Steht eine solche Haltung nicht im Widerspruch zum gerade beschriebenen Verständnis von Ethik als Reflexion auf Moral? Eine solche Haltung ist offenbar etwas anderes als eine aktive Veränderung der Welt. Was soll dann die programmatische Bezeichnung einer transformativen Ethik besagen? Der Begriff Transformation ist dabei in den letzten Jahren zu einem fast inflationär gebrauchten Begriff geworden, deshalb wollen wir ihn im Kontext unserer transformatorischen Ethik skizzieren.
Transformation als Gegenstand: Wenn wir von Transformation im Kontext unserer Gesellschaft reden, dann ist immer ein deskriptiver Blick auf die Veränderung gemeint, »die tiefgehend (statt oberflächlich), paradigmatisch / umfassend (statt partiell), nachhaltig (statt situativ) und systemverändernd bzw. strukturell«5 ist. Es geht um eine »Trans-Formation«, die Neu- oder Umformatierung einer bestehenden Formation. Beispielhaft können hier Transformationen von Staatsformen (von der Autokratie hin zur Demokratie) sein, die Singularisierung6 unserer Gesellschaft oder die Auswirkung der Säkularisierung auf die institutionelle Religion.
Transformation als Ziel: Hier geht es nicht um eine Analyse oder neutrale Beschreibung, sondern um eine Zielstellung, auf die die Transformation hinlaufen soll. Zum Beispiel die »Große Transformation« hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft.
Mit dieser Doppeldeutigkeit wollen wir eine grundlegende Spannung beschreiben, die wir als wichtig und entscheidend erachten. Denn wenn Ethik ein beschreibender und reflektierender Umgang mit Werten und Normen ist, so ist sie gerade dadurch auch eine Praxis, die verändert und zielorientiertes Handeln möglich macht.
Transformative Ethik ist immer auch kontextuelle Ethik
Entscheidungssituationen liegen nicht einfach vor. Sie stehen immer in einem bestimmten Kontext und einer bestimmten Geschichte. Darum kann keine Ethik von der Wahrnehmung der jeweiligen Situation bzw. ihrer Zeit insgesamt absehen. Eine Ethik, die ihren eigenen Standort nicht ausdrücklich mitdenkt, ist naiv. Die Wahrnehmung der Welt steht nicht einfach fest. Letztlich sind weltanschauliche Annahmen und empirische Beobachtungen miteinander verzahnt. In diesem Sinne gibt es die gesellschaftlichen und ideellen Transformationen unserer Zeit, auf die sich jede ethische Reflexion einstellen muss. Solche gesellschaftlichen Transformationen sind beschreibend, zugleich aber auch nie ganz frei von einer normativen Komponente. Jede Erfassung der aktuellen Situation zeigt in irgendeiner Weise auf, welche Entwicklungen problematisch sind und welche Veränderungen nötig werden. Die Herausforderungen sind enorm, da es gleichzeitig technische und soziale Innovationen, gesellschaftlichen Bewusstseinswandel und politisch-ökonomische Maßnahmen braucht. Diese grundlegenden Veränderungen der Gesellschaft finden statt und sie betreffen uns alle.
Unser Verständnis von transformativer Ethik haben wir ausführlich in Band 2/1 unserer Reihe dargelegt und hier bauen wir darauf auf und wenden es für eine Sexualethik an.7 Dabei sind uns folgende Schlüsselwerte besonders wichtig:
1.1.3 Schlüsselwerte einer transformativen Ethik
Eine transformative Ethik ist zuallererst eine theologische Ethik. Gott schreibt Geschichte und führt diese mit den Menschen zum Ziel. In diesem größeren Zusammenhang findet transformative Ethik statt. Gott ist die Kraft, die durch die Geschichte handelt und diese zum Ziel führt (missio Dei). Er ist ein lebendiger Gott, der in Bewegung ist und Transformation bewirkt. Transformative Ethik bewegt sich in dieser Zielrichtung und trägt selbst dazu bei.
Transformative Ethik ist eine biblische Ethik. Wie im ersten Band begründet, kann die Bibel nicht einfach das Lösungsbuch einer Regelbefolgungsmoral sein. Die Bibel ist keine Gebrauchsanweisung für alle Fragen des heutigen Lebens. Aber die biblischen Texte sind bis heute Ausgangspunkt und Grundlage christlicher Gotteserkenntnis und Lebensorientierung. Grundlegende biblische Prinzipien wie Liebe, Freiheit und Gerechtigkeit (ausführlich im nächsten Punkt) geben der transformativen Ethik Orientierung und Richtung bei den ethischen Entscheidungen in den gesellschaftlichen Spannungen. Transformative Ethik ist immer eine Liebesethik. Zentraler Inhalt der jesuanischen Ethik ist eindeutig die Liebe. Dabei geht es nicht nur um eine Liebe zu anderen, sondern auch um die verändernde Liebe Gottes zu den Menschen. Auf die Frage »Welches ist das höchste Gebot von allen?« antwortete Jesus: »Das höchste Gebot ist das: ›Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft‹ (Dtn 6,4–5). Das andre ist dies: ›Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst‹ (Lev 19,18).Es ist kein anderes Gebot größer als diese.« (Mk 12,28–32) Jesu Antwort ist nicht kreativ. Er fasst die Thora zusammen mit zwei Zitaten aus dem Buch Deuteronomium und dem Buch Levitikus. Das Verhältnis zu Gott und das Verhältnis zum Nächsten gehören zusammen. Beides wird im Liebesgebot miteinander verbunden, sodass die Liebe Gottes zum Menschen und die Antwort der Liebe zu Gott und zum Nächsten beide Gebote miteinander verbinden. Aus dieser Liebe heraus ist eine transformative Ethik für uns Menschen eine Orientierungsethik und zielt dabei auf unterschiedliche Veränderungsebenen ab, dem Menschen selbst, aber ebenso dem System, in dem er lebt. Beides ist nicht voneinander zu trennen. Damit verbunden ist das Moment von Transformation, das in der Bibel immer wieder angesprochen wird: »Stellt euch nicht dieser Welt gleich.« (Röm 12,2) Verwandlung und Erneuerung betreffen alle Gläubigen gleichermaßen. Transformative Ethik ist eine Reflexionsgestalt christlicher Theologie, die auf diese großen Dimensionen der Wandlung eingestellt ist. Eine solche Ethik wird selbst Teil dieser Bewegungen. Darin liegt eine gewisse Gefahr der Moralisierung ethischen Nachdenkens, dem man nicht dadurch begegnen kann, dass man die Involvierung in diese Bewegung schlicht bestreitet. Schon das Ringen um ein angemessenes Wirklichkeitsverständnis und der offene Dialog über die Wahrnehmung der Welt und die Normen unseres Handelns haben transformierende Kraft.8 Das ethische Ringen um das richtige Tun verändert die Beteiligten, die nun nach gemeinsamen Wegen der Gestaltung der Welt suchen können. Transformative Ethik ist als Reflexion christlicher Moral Einladung zum Gespräch über Gestalt und Richtung der großen Transformationen, ein Gespräch, das nicht außerhalb, sondern inmitten dieser Dynamiken seinen Ort hat. Diese Involvierung stellt unsere Zielstellung von der transformativen Ethik dar, nämlich eine Ethik für das gute Leben aller Menschen. Was die meisten Menschen einigt, ist die Suche nach dem guten Leben. Und so ist es nicht verwunderlich, dass das gute Leben in der Ethik von Beginn an im Mittelpunkt vieler Auseinandersetzungen steht. Schon bei Aristoteles und seiner Tugendethik ist die Glückseligkeit das höchste Gut, wonach alle streben, der letztendliche Zweck aller menschlichen Bemühungen. Wir sind in dem Maße glücklich, wie wir das menschlich Beste in uns verwirklichen. Dieses Handeln braucht Freiheit, Mitbestimmung und Selberdenken, weshalb eine transformative Ethik immer Empowerment, Gemeinschaft und Partizipation fördert sowohl bei Individuen als auch in Vergemeinschaftungen. Transformative Ethik betont die Bedeutung von Partizipation und demokratischer Mitbestimmung in Entscheidungsprozessen, die Gemeinwohl und Kirche betreffen. Individuelle Handlungen werden im Kontext ihrer Auswirkungen auf die Gemeinschaft und die Umwelt betrachtet. Sie legt Wert auf die Qualität von zwischenmenschlichen Beziehungen und strebt danach, gerechte und respektvolle Interaktionen zu fördern.
Transformative Ethik ist dem Prinzip der Freiheit verpflichtet. Die Schöpfung Gottes und sein erlösendes Handeln zielen auf den freien und befreiten Menschen. Schon von daher kann eine transformative Ethik den Liberalismus der Moderne nicht pauschal verdächtigen oder verurteilen; sie wird ihn vielmehr als Teil einer Wirkungsgeschichte des Christentums in dieser Welt sehen. Zugleich ist die christliche Freiheit im Kontext des biblischen Narrativs stets relationale Freiheit: eine Freiheit in Beziehung, in wechselseitiger Anerkennung von Freiheit und in der Liebe, die in ganzheitlicher und wechselseitiger Anerkennung der Menschen ihre Einbettung findet. Darin ist transformative Ethik dem Prinzip der Gerechtigkeit verpflichtet. Dabei ist uns sehr klar, dass es nicht um eine Utopie auf Erden geht, sondern um ein Handeln im Vorletzten, im angebrochenen Reich Gottes, welches noch nicht vollendet ist, oder um es mit Bonhoeffer zu sagen: »Man kann und darf das letzte Wort nicht vor dem vorletzten sprechen. Wir leben im Vorletzten und glauben an das Letzte.«9 Deshalb ist transformative Ethik immer auch eschatologische Ethik. Das heilsgeschichtliche Handeln Gottes (Bibel als Story) versteht Ethik nicht nur von der Schöpfung her, sondern denkt sie vom Ziel, von der Vollendung her. Ihre Normen sind nicht bloße Sollbestimmungen, sie sind von der Hoffnung auf Veränderung getragen. Diese Perspektive verändert die Intention einer ethischen Entscheidung, weil klar wird, dass im angebrochenen Reich Gottes (»schon jetzt und noch nicht«) alle ethischen Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen, nur vorletzte Entscheidungen sind, denn die letzte Entscheidung bleibt Gott am Ende der Zeit vorbehalten. Die Hoffnung auf Gottes Zukunft bestimmt das Ziel und die Motivation des ethischen Handelns.
Diese Grundlagen einer transformativen Ethik haben wir im ersten Band unserer Ethik in acht methodische Schritte zusammengefasst, die helfen, eine eigene ethische Entscheidung zu fällen. Diese Schritte spielen auch in diesem Band eine Rolle beim Selberdenken, deshalb wollen wir sie hier kurz zusammenfassen:
1.1.4 Acht Schritte unserer Ethik zum Selberdenken
Die ethische Urteilsbildung folgt einem systematischen Prozess, um moralische Entscheidungen fundiert und reflektiert treffen zu können. Wir formulieren in unserem Modell ethischer Urteilsfindung drei Etappen: Losgehen, Orientieren und Ankommen. Diese Etappen entfalten wir in acht Schritten, die mit konkreten Fragestellungen gefüllt sind.10
Losgehen: Standortbestimmung und Situationsanalyse: Dieser Schritt beinhaltet die Wahrnehmung der Situation, die Verortung des Konflikts und die Reflexion des eigenen Standpunkts.
Schritt 1: Der Konflikt: Dieser Schritt umfasst die Beschreibung der Problemstellung. Es geht darum, die Ursachen des moralischen Konflikts zu identifizieren, die beteiligten Personen und Organisationen sowie ihre Beziehungen und Interessen zu benennen. Fragen nach den Ursachen des Konflikts, den beteiligten Personen und ihren Interessen sowie dem gesellschaftlichen Kontext werden analysiert.
Schritt 2: Gebiet und Erkundung: In diesem Schritt werden die Fakten des Falls ermittelt. Es geht um die Erkundung der verschiedenen Dimensionen und Bereiche, die von dem Konflikt betroffen sind wie persönliche Ziele, Identitätsfragen und rechtlich relevante Aspekte. Dabei werden spezifisches Wissen und Sachverhaltskunde eingebracht, um eine fundierte Analyse zu ermöglichen.
Schritt 3: Standortbestimmung: Dieser Schritt bezieht sich auf die Reflexion der eigenen Position und Prägung. Es geht darum, die eigene biografische Erfahrung, das persönliche Weltbild und die theologischen Grundannahmen in die Wahrnehmung des Konflikts einzubeziehen. Dies hilft, die eigene Rolle im Konflikt zu verstehen und zu reflektieren.
Orientieren: Zielvorstellungen und Wegüberprüfung: Nach der ersten Erkundung des Gebiets geht es darum, Orientierung zu gewinnen. Dieser Prozess wird in zwei Schritte unterteilt:
Schritt 4: Biblisch-theologische Erörterung: Diese umfasst die Analyse des moralischen Konflikts im Licht der biblischen Lehren und der großen Story Gottes. Es werden historische Einzelfallurteile, allgemeine Regeln, universale Prinzipien und die zentrale Botschaft der Bibel berücksichtigt, um den Konflikt zu bewerten.
Schritt 5: Ethische Reflexion: Hier werden allgemeine ethische Prinzipien wie Liebe, Freiheit und Gerechtigkeit in die Reflexion des Konflikts einbezogen. Es geht darum, diese Prinzipien in den Kontext der modernen Menschenwürde und Menschenrechte zu stellen und ihre Relevanz für den konkreten ethischen Konflikt zu prüfen.
Ankommen: Handlungsmöglichkeiten und Entscheidungen: Dieser Prozess wird in drei Schritte unterteilt:
Schritt 6: Handlungsoptionen: Es werden verschiedene Handlungsoptionen entwickelt und ihre Machbarkeit sowie die Vor- und Nachteile analysiert. Eine Abschätzung der Konsequenzen wird vorgenommen, um die möglichen Folgen der Entscheidungen zu bewerten.
Schritt 7: Vorläufige Entscheidung und Überprüfung: Nach der Formulierung einer vorläufigen Entscheidung werden die Argumentationen, Motive und Werte reflektiert. Es wird geprüft, wie diese Entscheidung zu den eigenen Überzeugungen und der großen Story Gottes passt. Bleibende Unsicherheiten und fehlende Informationen werden berücksichtigt.
Schritt 8: Entscheidung: Dieser Schritt umfasst die Umsetzung der Entscheidung und die Kommunikation ihrer Gründe. Die tatsächlichen Folgen der Entscheidung werden überprüft und ggf. Anpassungen vorgenommen. Es wird reflektiert, wie ähnliche Konflikte in der Zukunft vermieden werden können.
Dieses Modell der ethischen Urteilsbildung bietet eine Orientierungshilfe, die es ermöglicht, den Weg zur eigenen Position immer wieder zu reflektieren und gegebenfalls neu auszurichten. Unser Modell folgt keinem linearen Wegschema von der Bibel zum ethischen Urteil. Wie das Modell des Überlegungsgleichgewichts ist es flexibel und kann sich mit neuen Erfahrungswerten weiterentwickeln.
1.2 Karte und Gebiet: Auf der Suche nach dem richtigen Weg
Die Besonderheit unseres Ansatzes haben wir in Band 2/1 ausführlich beschrieben, wobei uns die Metapher »Karte & Gebiet« geholfen hat. Wir wollen dieses Bild auch für diesen Band aufnehmen und für die Sexualethik fruchtbar machen. Damals haben wir die Bibel als »Karte« ausführlich dargelegt und wollen hier nur noch einmal die wesentlichen Verständnispunkte wiederholen. Etwas mehr Zeit nehmen wir uns dann für das »Gebiet«, weil wir den Eindruck haben, dass sich die großen gesellschaftlichen Transformationen maßgeblich auf die Wahrnehmung von Sexualität, Gender oder Lebensformen ausgewirkt haben.
Die Bibel ist aus nachvollziehbaren Gründen gerade im christlichen Kontext oftmals ein Gegenstand von Auslegungskämpfen, in denen um Deutungsmacht gerungen wird. Dabei spielt sie als zentraler Orientierungspunkt eine wichtige Rolle auf der Suche nach dem richtigen Weg in einer sich verändernden Sexualethik. Der Weg der Wandernden führt nicht nur durch ein Gebiet, das sich verändert hat. Er verändert die Wandernden auch selbst. Dies gilt auch und besonders für sexualethische Themen, da der Mensch an sich ein sexuelles Wesen ist und mit seiner eigenen Sexualität genauso umgehen muss wie mit einer Gesellschaft, in der sexualethische Themen gerne in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Dabei hinterlassen alle eigenen Erfahrungen, die guten genauso wie die schlechten, ihre Spuren, denn jede erfolgreiche Zielankunft stärkt, jeder Umweg, jede Gefahr, die man erlebt, prägt einen. Deshalb reden wir von einer transformativen Ethik. Wir glauben, dass es nicht nur um die Veränderungen unserer Routen durch das Gebiet oder auch des Gebiets an sich geht, sondern dass uns die Beschäftigung mit ethischen Entscheidungen selbst verändert. Ethik, die verändert. So könnten wir es in Kürze ausdrücken, denn wir glauben, dass hinter dem großen Wanderatlas ein großer Gott steht, der uns als Wanderer sieht und durch alle, auch eigene, Veränderungen mitgeht. In diesem Band wollen wir dies zuspitzen und konkretisieren auf sexualethische Fragen. Wir wollen uns dafür zunächst das sich verändernde Gebiet anschauen und uns dann fragen, wer wir selbst auf der Wanderung sind (Anthropologie), und wie uns die Bibel als Karte Orientierung geben kann.
1.2.1 Die Bibel als Karte zur Orientierung in unsicheren Zeiten
Wie können sich Christ:innen an solchen umfassenden Transformationsprozessen beteiligen? Ist die Bibel als feststehende Grundlage ihrer Überzeugungen nicht viel zu statisch und vor allem zu alt, um heute noch richtungsweisend sein zu können? Die eigentliche Stärke christlicher Ethik wird von außen wie auch von innen immer wieder unterschätzt. Orientierung gibt die Bibel nicht nur als festgefügtes Set von Regeln, Prinzipien und Gütern. Biblische bzw. christliche Ethik ist in sich selbst geschichtlich verfasst. Sie beschreibt transformative Veränderungen ihrer Zeit (Exodus, Königtum, Exil etc.) und beschreibt, wie Gottes transformatives Handeln immer neu Gestalt gewinnt. So werden die biblischen Texte Grundlage einer inspirierenden Ethik,11 um auch im Horizont heutiger Transformationen nach einem guten Leben mit und für andere in gerechten Institutionen zu suchen.12 Wollen wir einen ersten kurzen Blick auf unser Verständnis der Bibelauslegung wagen, dann können wir es in vier zentrale Punkte zusammenfassen:
Die Bibel ist im Kontext der ganzen Schriftwahrzunehmen (Kanonizität) und im Zusammenhang mit der Heilsbotschaft des christlichen Glaubens, dem Evangelium von Jesus Christus, zu verstehen / deuten (christologisch). Anders ausgedrückt: Die große Geschichte Gottes und ihre Zielstellung müssen beachtet werden.Wir lesen die biblischen Texte immer aus unserer eigenen Biografie, Wahrnehmung und Geschichte heraus (Kontext). Dessen müssen wir uns bewusst sein und dies gilt es zu reflektieren (Verortung).Dabei sind die einzelnen Texte philologisch und historisch im Kontext ihrer Zeit zu verstehen und aus ihr heraus zu verstehen und zu interpretieren (Geschichtlichkeit).So kommt es zu einer Wechselwirkung zwischen biblischen Normen und der eigenen Wahrnehmung (Kontextualisierung).Die Bibel entfaltet diese Zielrichtung im Rahmen einer großen Geschichte Gottes, eines Grand Narrative, der viele kleine Metanarrative umfasst. Dabei lassen sich in der Bibel zwei unterschiedliche Transformationsverständnisse beobachten: Transformation als deskriptive Beschreibung der gesellschaftlichen Veränderung. So wird bspw. die Geschichte Israels mit allen rechtsstaatlichen Transformationsprozessen (vom Exodus bis zum Königtum) beschrieben. Gleichzeitig beschreibt die Bibel das transformatorische und heilsgeschichtliche Handeln Gottes (missio Dei) an der Menschheit und dieses ist zielbestimmt (eschatologisch) und vom eingreifenden Handeln Gottes bestimmt (vom Sinai bis zur Inkarnation Christi). Der Orientierungshorizont einer christlichen Ethik ist durch die narrative Struktur der biblischen Texte bestimmt.
1.2.2 Veränderungen des Gebiets der Sexualethik am Beispiel der Aufklärung
Jede Zeit hat ihre Konflikte und sucht nach Ordnungsprinzipien, die helfen, diese zu hören – auch und gerade in sexualethische Fragen. Vor der Neuzeit galt in der Regel eine natürlich oder religiös begründete hierarchische Ordnung: der Mann über der Frau, die Obrigkeit über dem Einzelnen, Klerus und Adel über den Bürger:innen und Sklav:innen. Damit war eine natürliche Ordnung hergestellt, die unumstößlich war und gesetzlich und gesellschaftlich das öffentliche und private Leben formte.
In der Neuzeit ändert sich diese Logik, vor allem im Westen. Ein wesentliches Merkmal der Aufklärung war die Betonung der individuellen Autonomie und des Rechts auf Selbstbestimmung. In der Sexualethik führte dies zu einer verstärkten Betonung der persönlichen Freiheit und Selbstbestimmung in sexuellen Angelegenheiten. Individuelle Entscheidungen und der freie Wille wurden als zentrale Werte anerkannt, was zu einem wachsenden Bewusstsein für persönliche Rechte und Freiheiten führte. Besonders in der Romantik zeigte sich dies darin, dass die jeweiligen Partner nicht mehr von den Eltern, sondern selbst ausgesucht wurden. Dass nicht mehr nur Verwandtschaft, gesellschaftlicher Stand oder finanzielle Mitgift entscheidend waren, sondern persönliche Liebe und Gefühle. Es gab einen wachsenden Diskurs über die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Notwendigkeit, Frauen mehr Rechte und Freiheiten, auch in sexuellen Angelegenheiten und der Liebe, zu gewähren.
Ein weiterer zentraler Punkt der Aufklärung war die Säkularisierung des Denkens, die zunehmende Trennung von Kirche und Staat und die Verlagerung moralischer Fragen von einer religiösen und kirchlichen zu einer weltlichen Basis.13 Dies bedeutete, dass sexuelle Moralvorstellungen zunehmend unabhängig von religiösen Dogmen formuliert wurden und die Machtdominanz der Kirche in sexualethischen Fragen dementsprechend zurückging. Dies zeigte sich in einer zunehmenden Liberalisierung der Vorstellungen von Ehe und Familie. Die Ehe wurde zunehmend als Partnerschaft zwischen gleichberechtigten Individuen gesehen und es wurde mehr Wert auf die persönliche Erfüllung und das Glück in der Ehe gelegt, anstatt sie nur als wirtschaftliche oder soziale Institution zu betrachten. Das Gebiet der Sexualethik hat sich so von traditionellen, oft religiös geprägten Normen zu einem komplexen Feld entwickelt, das von Säkularisierung, Pluralismus, Rechten und Anerkennung, sexueller Bildung und wissenschaftlichen Fortschritten geprägt ist. Diese Veränderungen spiegeln sich in der breiteren Akzeptanz unterschiedlicher sexueller Identitäten und Praktiken sowie in der Betonung der sexuellen Autonomie und Gesundheit wider. Heute sprechen wir von einer Pluralisierung sexualethischer Normen, die sich in der Akzeptanz unterschiedlicher Lebensentwürfe und sexueller Identitäten zeigt. So gibt es in vielen Ländern eine rechtliche Anerkennung und den Schutz von LGBTIQ+-Personen. Gleichgeschlechtliche Ehe, Adoptionsrechte und Antidiskriminierungsgesetze sind dann praktische Beispiele für diese Veränderungen. Aber auch die Rechte von Frauen erleben eine stärkere Anerkennung.
1.2.3 Sexualethik: Konfliktlinien Gender, Sexualität und Lebensformen
Werfen wir nun einen Blick auf das veränderte Gebiet und sehen uns die großen Konfliktlinien an, die anhand von drei großen Stichwörtern, die hier kurz und dann ausführlich im Buch nachgezeichnet werden sollen: Gender, Sexualität und Lebensformen.
a) Zentrale Konfliktlinien im Bereich Gender (Kap. 3)
Wie ist im Verständnis von Geschlecht das Verhältnis von biologischen und sozialen Perspektiven zu bestimmen? Lässt sich Geschlecht allein oder in erster Linie als eine biologische Realität verstehen? Oder ist auch die Biologie selbst von historisch-kulturellen Entwicklungen geprägt, sodass Geschlecht eine körperliche, aber auch eine soziale, geschichtlich wandelbare Realität ist? Vor allem um das Verständnis von Transidentität und die Anerkennung der Rechte von trans Menschen ist in den letzten Jahren viel gerungen worden. Manche plädieren für die Verwendung geschlechtsneutraler Sprache und die Anerkennung der Pronomenwahl von Individuen als Zeichen des Respekts und der Inklusion. Andere argumentieren, dass solche sprachlichen Anpassungen erzwungen oder unnötig seien und traditionelle Sprachstrukturen untergraben würden. Auch sehr umkämpft ist die Frage nach frühkindlicher Bildung und schulischer Erziehung. Viele setzen sich dafür ein, dass Schulen geschlechtssensible und inklusive Inhalte lehren sollen, die Vielfalt und Akzeptanz fördern. Es gibt jedoch auch Widerstand gegen solche Änderungen im Lehrplan, oft aus der Sorge heraus, dass sie traditionelle Werte und Normen untergraben oder solche Veränderungen verwirrend für Kinder sein könnten. Gerade in religiös konservativen Kreisen ist dies eine wichtige Konfliktlinie. Ein letztes Beispiel der Konfliktlinien sind nach wie vor die unterschiedlichen Geschlechterrollen und die Frage der Gleichstellung von Mann und Frau. Auch hier existieren gegensätzliche Standpunkte. Einige Menschen und Gruppen befürworten traditionelle Geschlechterrollen, die bestimmte Verhaltensweisen und Aufgaben für Männer und Frauen vorschreiben. Befürworter der Gleichstellung hingegen setzen sich für die Aufhebung starrer Geschlechterrollen ein und fördern die Idee, dass Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht jede Rolle oder Aufgabe übernehmen können und sollten.
b) Zentrale Konfliktlinien im Bereich Sexualität (Kap. 4)
Die zentralen Konfliktlinien in der Sexualethik unserer Zeit sind vielfältig und spiegeln die komplexen und oft kontroversen Ansichten und Überzeugungen innerhalb der Gesellschaft wider. Ein bedeutender Konfliktpunkt ist die Anerkennung und Akzeptanz von LGBTIQ+-Personen und ihren Rechten. Dies umfasst Debatten über die moralische und rechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlich liebender Menschen oder den Umgang mit Sexualität außerhalb der Ehe. Während einige Gesellschaften starke Veränderungen in Sachen Anerkennung und Schutz der Rechte von LGBTIQ+-Personen gemacht haben, gibt es in anderen Ländern weiterhin erheblichen Widerstand und Diskriminierung. Auch die Frage, wie und wann Kinder und Jugendliche über Sexualität aufgeklärt werden sollten, ist ein umstrittenes Thema. Einige befürworten umfassende Sexualaufklärung, die Themen wie Einvernehmlichkeit, Verhütung, LGBTIQ+-Themen und sexuelle Gesundheit abdeckt. Andere bevorzugen einen stärker abstinenzorientierten Ansatz oder lehnen bestimmte Inhalte in der Sexualaufklärung ganz ab, oft aus religiösen oder kulturellen Gründen. Eine weitere Konfliktlinie ist die Verbreitung und der Konsum von Pornografie. Befürworter sehen in der Pornografie eine Form der sexuellen Ausdrucksfreiheit und Unterhaltung. Kritikerinnen und Kritiker hingegen weisen auf die potenziell negativen Auswirkungen hin wie die Förderung von unrealistischen Erwartungen, Suchtverhalten, die Objektivierung von Frauen und den möglichen Zusammenhang mit sexueller Gewalt. Auch die ethischen und rechtlichen Fragen rund um Prostitution und Sexarbeit sind ebenfalls stark umstritten. Einige argumentieren für die Entkriminalisierung und Regulierung von Sexarbeit, um die Rechte und Sicherheit der Sexarbeiter:innen zu schützen. Andere sehen in der Prostitution eine Form der Ausbeutung und setzen sich für ein Verbot oder strenge Einschränkungen ein.
c) Zentrale Konfliktlinien im Bereich Lebensformen (Kap. 5)
Aktuelle ethische Konfliktlinien beim Thema Lebensformen umfassen eine Vielzahl von Bereichen, die persönliche, gesellschaftliche und rechtliche Aspekte betreffen. Ein bedeutender Konfliktpunkt ist die Anerkennung und Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen und Partnerschaften. Während viele Länder dies mittlerweile legalisiert haben, gibt es weiterhin starken Widerstand in anderen Ländern, oft basierend auf religiösen oder traditionellen Werten. Deshalb ist die Pluralisierung der Lebensformen für unsere transformative Ethik ein wichtiges Gebiet. Die Anerkennung von Familien, die aus gleichgeschlechtlichen Paaren und ihren Kindern bestehen, ist ein weiterer ethischer Brennpunkt. Manche argumentieren, dass Kinder am besten in traditionellen heterosexuellen Familien aufwüchsen, während andere auf Studien verweisen, die keine Unterschiede in der Kindesentwicklung zeigen. Die gesellschaftliche Akzeptanz von Polyamorie und anderen nicht-monogamen Beziehungsformen ist ebenfalls eine bedeutende Konfliktlinie. Während solche Lebensformen zunehmend sichtbar werden und Unterstützung finden, stoßen sie auch auf Kritik und Ablehnung, die oft auf traditionellen und religiösen Vorstellungen von Monogamie und familiären Strukturen basieren. Auch Singles sehen sich oft mit gesellschaftlichen Erwartungen und Stigmatisierungen konfrontiert, weil das Paar- und Familienleben vielfach als Norm gilt. Die Anerkennung und Unterstützung von Lebenspartnerschaften und alternativen Lebensformen älterer Menschen sind zunehmend wichtig. Dies betrifft rechtliche Fragen wie Erbschaftsrechte, medizinische Vollmachten und gesellschaftliche Unterstützung für ältere Paare und Gemeinschaften. Gesetzgeber, Kirchen und politische sowie gesellschaftliche Entscheidungsträger sind oft in Konflikte verwickelt, wenn es darum geht, neue Lebensformen rechtlich anzuerkennen und zu regulieren.
Fassen wir die drei Entwicklungen der Konfliktlinien Sexualität, Gender und Lebensformen zusammen, dann könnte man vereinfacht sagen, dass sich in den letzten Jahrhunderten eine moderne Entwicklungslogik entfaltet hat. Zunehmend haben Werte wie Gleichheit aller Menschen, Selbstbestimmung und Individualisierung an Einfluss gewonnen:
Gleichheit: Gleichheit für alle, nicht nur für Mann und Frau, sondern auch für Minderheiten in der Gesellschaft, Menschen mit Behinderungen, PoC, aber eben auch in der Sexualethik wie homo, cis / trans.Freiheit: Zur Selbstbestimmung des Individuums zählen wir heute nicht nur die Wahl von Lebensform, Beruf und Wohnort, sondern auch den Umgang mit der eigenen Sexualität und dem eigenen Geschlecht.Man könnte bislang denken, dass sich die Konfliktlinien binär durch das Gebiet ziehen und auf der einen Seite die eher traditionellen und konservativen Menschen und auf der anderen Seite eher die progressiven und liberalen stehen. Aber es ist durchaus komplexer. Respekt voreinander und Rücksicht miteinander ist keine Frage von konservativ oder progressiv.
1.2.4 Sexualethik zwischen Grenzwahrung, Scham und Vulnerabilität
In jedem Gebiet kommt es darauf an, achtsam mit Grenzen umzugehen. Wenn wir daher über Sexualethik schreiben, dann stehen wir in der Spannung zwischen dem Positiven der Sexualität und dem Wissen, dass Sexualität verletzlich ist und geschützt werden muss. So gehört es zu den fundamentalen Prinzipien des Umgangs, respektvoll und verantwortungsvoll mit der eigenen Sexualität und der Sexualität anderer umzugehen. Wir nehmen wahr, dass unterschiedliche Grenzverletzungen die eigene Biografie prägen können und das Thema Sexualität auch ein vulnerables ist. Die eigene Verwundbarkeit wurde in den letzten Jahren vermehrt psychologisch, juristisch, theologisch, politisch und philosophisch untersucht.14 Es gehört zur transformativen Ethik dazu, dass ein selbstbestimmtes Handeln und Empowerment zur Wahrung der eigenen Grenzbestimmung wichtig und notwendig sind, gerade weil wir wissen, wie verletzlich die eigene Sexualität ist. Grenzverletzungen können kompensiert werden in Wut gegenüber sich selbst oder anderen, in Ohnmachtserfahrungen und emotionaler Isolation. Schuld bildet dabei oftmals eine negative Bindung und hat eine große Macht auf der Beziehungsebene zu sich selbst oder zu anderen. Deshalb ist die Grenzwahrung und das gegenseitige Respektieren und Einhalten persönlicher, moralischer und sozialer Grenzen im sexuellen Kontext unverhandelbar.15 Diese Grenzen können physisch, emotional, psychologisch oder sozial sein und sind oft durch persönliche Werte, kulturelle Normen und rechtliche Bestimmungen definiert. In der Sexualethik ist die Grenzwahrung entscheidend für das Erreichen eines respektvollen Umgangs miteinander. Ein grundlegendes Prinzip der Grenzwahrung ist die Einvernehmlichkeit, wobei beide Partner freiwillig und bewusst in eine sexuelle Handlung einwilligen müssen (»nur Ja heißt Ja«). Dies setzt voraus, dass sie über die nötige Reife und Urteilsfähigkeit verfügen und dass keine Formen von Zwang oder Manipulation im Spiel sind. Offene und ehrliche Kommunikation ist essenziell, um Missverständnisse und unfreiwillige Grenzverletzungen zu vermeiden. Auch deshalb empfinden wir die Ehe als einen solchen Schutzort, in dem über Jahre dieser gegenseitige Schutz und Respekt kommunikativ eingeübt werden kann, auch wenn wir wissen, dass die Ehe in der Vergangenheit oft nicht dieser Schutzraum war (ausführlich in Kap. 5). Gravierende Beispiele für Grenzverletzungen sind sexuelle Übergriffe, bei denen sexualisierte Gewalt, Missbrauch oder Belästigung die Autonomie und Würde der betroffenen Person verletzen und tiefgreifende traumatische Folgen haben (vgl. dazu auch Kap. 4.5). Auch subtile Formen von Druck oder Manipulation, die eine Person dazu bringen, gegen ihren Willen oder ihre Überzeugungen zu handeln, sind Grenzverletzungen. Dies kann emotionaler oder psychologischer Natur sein und das Vertrauen und die Sicherheit in einer Beziehung zerstören. Jede sexuelle Handlung, die ohne klare, freiwillige und bewusste Zustimmung erfolgt, ist ebenfalls eine Grenzverletzung. Dies schließt Situationen ein, in denen eine Person aufgrund von Bewusstlosigkeit, Beeinträchtigung durch Substanzen oder mangelnder Reife nicht in der Lage ist, eine informierte Einwilligung zu geben. Ein ethisch verantwortungsvoller Umgang mit Sexualität erfordert ein ständiges Bewusstsein und die Sensibilität für die eigenen Grenzen und die Grenzen anderer. Die Einhaltung dieser ethischen Prinzipien trägt dazu bei, eine Kultur des Respekts und der Achtung zu fördern, in der sexuelle Handlungen und Beziehungen auf Vertrauen, gegenseitigem Respekt und Einvernehmlichkeit basieren. Durch die Bewusstmachung und das Vermeiden von Grenzverletzungen wird die Integrität der eigenen und der betroffenen Personen geschützt, und es wird ein sicherer und respektvoller Raum für sexuelle Begegnungen geschaffen.
Eines der kraftvollsten Gefühle im Kontext der Sexualethik ist die Scham. Alexandra Grund-Wittenberg stellt dazu fest: »SchamisteinemachtvolleGröße,dienichtseltenimVerborgenenwirkt.Sieisteinheimliches,nachMöglichkeitverheimlichtesGefühl,dasMenschenoftmitsichselbstausmachen.«16 Sie erwächst aus unserem Selbstwert und kann unseren Selbstschutz und unsere persönliche Integrität sichern. Das Übergehen der eigenen Schamgrenzen durch einen selbst oder andere hingegen stellt Menschen bloß und kann tiefe Wunden reißen. Die eigene Nacktheit zeigt dabei die eigene körperliche und psychische Zerbrechlichkeit. Deshalb spricht der katholische Ethiker Martin Lintner über Scham meist in Verbindung von Vulnerabilität.17 Scham hat etwas mit der eigenen Verletzlichkeit zu tun. Deshalb ist Scham ein Ausdruck von Vulnerabilität. Schamgefühle in sexuellen Kontexten spiegeln oft eine tiefe Verletzlichkeit wider. Wenn eine Person Scham empfindet, zeigt dies, dass sie sich in ihrer Intimität und ihrem Selbstwertgefühl getroffen fühlt. Schon ganz am Anfang der Bibel, in einer der ersten Erzählungen in Genesis 3, wird berichtet, dass Adam und Eva Scham empfanden, nachdem sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben.»DagingenbeidendieAugenauf,undsieerkannten,dasssienacktwaren.SieheftetenFeigenblätterzusammenundmachtensichSchurze.«(Gen3,7)
Scham kann dabei durch tatsächliche oder auch befürchtete Verletzungen der eigenen Würde und Integrität ausgelöst werden, sei es durch das Überschreiten persönlicher Grenzen oder durch negative soziale Urteile. Übermäßige oder ungerechtfertigte Scham kann die Vulnerabilität von Individuen verstärken, indem sie zu einem Gefühl der Isolation, des Selbsthasses und der sozialen Ausgrenzung führt. Nach Klaas Huizing sind Scham und Ehre tief in den menschlichen Erfahrungen und sozialen Interaktionen verankert und spielen eine zentrale Rolle in der Ausbildung von moralischen Identitäten und Gemeinschaften.18 Scham beschreibt er als ein intensives Gefühl des Unbehagens oder der Erniedrigung, das entsteht, wenn eine Person ihre eigenen Standards oder die Erwartungen der Gemeinschaft verletzt. Scham ist demnach nicht nur ein persönliches Empfinden, sondern auch ein sozial vermitteltes Phänomen, das stark von den normativen Werten und Normen der Gemeinschaft abhängt. Diese Normen bestimmen, was als schamhaft empfunden wird. Huizing betont, dass Scham eine regulative Funktion hat, da sie Individuen dazu anhält, sich an die moralischen und sozialen Normen ihrer Gemeinschaft zu halten.
In der Sexualethik ist es daher wichtig, einen ausgewogenen Umgang mit Scham zu finden, der einerseits die moralische Integrität schützt, andererseits aber auch Raum für Selbstakzeptanz und positive sexuelle Identitäten schafft. Deshalb ist Scham als Schutzmechanismus der eigenen sexuellen Integrität besonders wichtig, indem sie dazu beiträgt, die Verletzlichkeit einer Person zu bewahren. Sie signalisiert, dass eine Grenze überschritten wurde oder dass das eigene Verhalten nicht mit den inneren moralischen Standards übereinstimmt.
Historisch gesehen wurde Scham in vielen Kulturen und Religionen stark mit Sexualität verknüpft. Sexualethische Normen, die auf religiösen oder traditionellen Überzeugungen basieren, haben oft eine schaminduzierende Wirkung gehabt; insbesondere in Bezug auf vorehelichen Sex, Homosexualität oder andere, als abweichend betrachtete, sexuelle Verhaltensweisen. Diese Scham kann tiefgreifende psychologische Auswirkungen haben, die von Schuldgefühlen, Kompensationshandlungen bis hin zu sozialer Isolation reichen. Die sozialen Medien sind voll von solchen Berichten.19 Der Umgang mit Scham ist dabei ambivalent und die Betroffenen fühlen sich oft zusätzlich zu ihrer Scham noch schuldig und sind so doppelt bestraft. »Verschiebe nicht die Scham in die Schuld«, lautet dabei ein bekannter ethischer Imperativ. Denn wenn die Scham in Schuld umgewandelt wird, entkommt der Beschämte zwar der Passivität der Scham-Situation, aber nur zum Preis der Schuld: Er wird selbst zum / zur Täter:in gegen sich selbst.
Im Kontext unserer transformativen Ethik bedeutet dies, die verletzliche Position von Individuen anzuerkennen und gleichzeitig Maßnahmen zu fördern, die Scham reduzieren und Selbstachtung stärken. Dies kann durch Bildung, offene Kommunikation sowie die Förderung von Akzeptanz und Respekt für unterschiedliche sexuelle Identitäten und Orientierungen erreicht werden. Dabei ist klar, dass die jeweiligen Schamgrenzen aber zutiefst kulturell verankert und biografisch geprägt sind. Aus theologischer Sicht hängen Scham und Vulnerabilität mit der Gottebenbildlichkeit zusammen. Der Mensch ist ein gefährdetes und erlösungsbedürftiges Wesen und damit auch verwundbar und verletzlich. Gott selbst ist ein vulnerabler Gott, macht sich in Christus verwundbar und verletzlich und seine Barmherzigkeit durchzieht die gesamte Bibel und hat ihren Ursprung in Gott selbst. Gott ist dem Menschen emotional zugewandt, weshalb Lintner von einem »leidsensiblen Gott« spricht, der das Leben kennt, fördert und schützt.20
1.3 Herausforderung einer Sexualethik in einer neuen Öffentlichkeit
Die Rolle von Religion und Sexualität in der Öffentlichkeit21 hat sich in der westlichen Welt in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert. Deshalb wurde zunehmend die Frage angestoßen, was »Öffentlichkeit«22 heute ist und welche Rolle Religion und Sexualität in der Öffentlichkeit spielen. Der kanadische Religions- und Sozialphilosoph Charles Taylor stellt dazu grundlegend fest, dass moderne demokratische Gesellschaften durchdrungen sind von moralischen Ordnungen und diese in der Öffentlichkeit gleichermaßen diskutiert als auch reproduziert werden, und zwar sowohl auf politischer als auch auf individueller Ebene. Moderne Gesellschaftsordnungen sind also immer Teil der Konzeption von Öffentlichkeit.23 Öffentlichkeit verstehen wir deshalb als zivilgesellschaftlichen Gestaltungsraum, der »seine Bedeutung und Profilierung erst durch diese Deutungs- und Handlungsaktivitäten selbst gewinnt. Öffentlichkeit fungiert hier also als Signatur unterschiedlicher politischer Diskursorte und zugleich als Möglichkeitsraum«.24 Dies hat eine hohe Bedeutung und braucht die Gestaltungskraft von Kirche und anderen Religionsträgern, um in einer von Medien bestimmten Öffentlichkeit verstanden zu werden.25 Dies bedeutet, dass es einen zugangsfreien und gleichberechtigten Raum für Aushandlungen in der Öffentlichkeit geben muss, der Menschen nicht ausgrenzt.26 Für unsere transformative Ethik ergibt sich an dieser Stelle eine doppelte Herausforderung: Sie muss innerhalb der christlichen Kirchen und Strömungen in die Auseinandersetzung eintreten, sich in der innerchristlichen Pluralität bewähren und gleichzeitig in einer neuen säkularen Öffentlichkeit sichtbar und verstehbar für das einstehen, was wir als wahrhaft christliche Orientierung verstehen. Dazu kommt, dass viele Kirchen und Religionsgemeinschaften als in sich geschlossene Räume gelten, die ihre eigenen sexualethischen Werte und Regeln haben. Sie sind es einfach nicht gewohnt, diese in der Öffentlichkeit zu erklären oder gar zu verteidigen. Zwar gilt hier nach wie vor die Religionsfreiheit für Religionsgemeinschaften in Deutschland, die den Religionsgemeinschaften weite Rechte zubilligt, die sogar über das Antidiskriminierungsgesetz hinausgehen – doch ist der neuen Öffentlichkeit kaum noch zu erklären, warum Frauen keine Messen halten (katholische Kirche) oder queere Menschen nicht mitarbeiten dürfen (was in vielen Freikirchen der Fall ist). Sexualität ist dabei ein öffentliches Thema geworden, gerade im Blick auf Machtausübung, wie bspw. die #Metoo-Debatte gezeigt hat, aber auch der öffentliche Diskurs diverser Missbrauchsskandale. Sexualethik ist ein öffentliches Thema und Kirchen und Gemeinden tun sich oftmals schwer, in diesen neuen öffentlichen Diskursraum einzutreten, ihre Argumente darzulegen und ggf. auch zu verteidigen.
1.3.1 Steffen Mau und die Triggerpunkte der neuen Öffentlichkeit
Der Berliner Soziologe Steffen Mau hat in seinen Arbeiten mehrere zentrale Triggerpunkte im Kontext der Öffentlichkeit und der Digitalität identifiziert.27 Einer der wesentlichen Punkte ist die zunehmende Datifizierung des sozialen Lebens, bei der immer mehr Aspekte des Lebens durch digitale Daten erfasst und analysiert werden. Diese Entwicklung führt zu einer umfassenden Überwachung durch staatliche Institutionen, Unternehmen und Plattformen, die Daten sammeln, speichern und auswerten. Dies beeinflusst das Verhalten der Menschen, da sie sich der Beobachtung bewusst sind und möglicherweise ihr Verhalten anpassen, was zu einer Einschränkung von Freiheit und Privatsphäre führen kann. Ein weiterer kritischer Aspekt ist die algorithmische Steuerung von Entscheidungsprozessen, bei der Algorithmen zunehmend bestimmen, welche Informationen wir sehen, welche Produkte uns angeboten werden und sogar welche sozialen Kontakte uns empfohlen werden. Diese Steuerung durch Algorithmen verschiebt die Kontrolle von Individuen zu nicht-transparenten technischen Systemen, was Bedenken hinsichtlich Manipulation, Diskriminierung und des Verlusts menschlicher Autonomie aufwirft. Mau thematisiert zudem die digitale Spaltung, die Ungleichheit im Zugang zu und in der Nutzung von digitalen Technologien. Diese Spaltung verschärft bestehende soziale Ungleichheiten, da Menschen ohne Zugang zu digitalen Ressourcen zunehmend von wirtschaftlichen, sozialen und politischen Teilhabechancen ausgeschlossen werden. Dies verstärkt soziale Ungerechtigkeiten, indem der Zugang zu Bildung, Informationen und wirtschaftlichen Möglichkeiten ungleich verteilt und bestehende Privilegien weiter zementiert werden. Ein weiterer zentraler Triggerpunkt ist die Erosion des öffentlichen Diskurses durch die Fragmentierung von Informationen und die Bildung von Echokammern in sozialen Medien. Diese Entwicklungen führen zu einer Polarisierung der Gesellschaft und schwächen die Grundlage für demokratischen Austausch und Konsensbildung. Die zunehmende Fragmentierung und Polarisierung untergraben die demokratische Kultur und das Vertrauen in demokratische Institutionen, was langfristig die Stabilität demokratischer Systeme gefährden kann. Steffen Mau fasst diese aktuellen Entwicklungen unter Einbeziehung der Polarisierungsthese in der Metapher der Kamelgesellschaft zusammen, in der die zwei steil aufragenden Höcker für eine stark polarisierte Gesellschaft stehen. Diese Höcker repräsentieren die tiefen sozialen und ökonomischen Unterschiede, die verschiedene gesellschaftliche Gruppen voneinander trennen. Zwischen diesen beiden »Höckern« liegt eine scharfe Kluft, die den unüberwindbaren Unterschied zwischen den sozialen Klassen zeigt. In einer solchen Gesellschaft sind die Extreme wie Reichtum und Armut oder Eliten und Unterprivilegierte deutlich ausgeprägt und klar voneinander getrennt. Aber auch weitere Themen wie Ethnizität, Kultur und Nation oder der Umgang mit Normalitäts- und Abweichungsvorstellungen im Bereich von Geschlecht und Sexualität spielen hierbei eine große Rolle. Und das Gefühl ist immer: Es gibt eine große Kluft in den Meinungen, die nicht überwunden werden kann. Sei das in der Gesellschaft oder eben auch in Kirche und Gemeinde. Themen wie Homosexualität, Transidentität oder Gender fallen in die Vorstellung einer »Kamelgesellschaft«, die vor allem durch die sozialen Medien vorangetrieben wird. Steffen Mau und seine Kollegen stellen nun die These auf: Was, wenn diese These gar nicht stimmt? Wenn es kein Kamel, sondern ein Dromedar ist? Wenn die wahrgenommene Polarisierung in den (sozialen) Medien und an den Stammtischen empirisch gar nicht stimmt, sondern nur eine »gefühlte Wahrheit« ist? Und er stellt die Dromedargesellschaft dar, die durch einen einzigen, gleichmäßig über den Rücken gespannten Höcker symbolisiert wird. Dieses Bild steht für eine Gesellschaft, in der die verschiedenen Themenbereiche weniger stark ausgeprägt, und die Unterschiede zwischen den Gruppen weniger deutlich sind als gefühlt. Der einzelne, langgezogene Höcker symbolisiert eine Art »Mittelschichtsgesellschaft«, die mehr Gemeinsames hat als angenommen. Und er zeigt auf, dass es eine stabile Mehrheit gibt bei den Themen Rassismus, soziale Gerechtigkeit, Sexismus oder Diskriminierung. Aber die rechten und linken Ränder sind oftmals so laut, dass diese stabile Mehrheit der Mitte nicht mehr wahrgenommen wird. Durch viele empirische Studien zeigt das Autorenteam auf, dass es in jedem Bereich zwar polarisierende Triggerpunkte gibt (gendergerechte Sprache, Einwanderungspolitik, Frauenquote etc.), aber in der Sache sich mehr Menschen einig sind, als dies medial den Anschein hat.28
1.3.2 Digitale Präsenz als Teil der neuen Öffentlichkeit
Digitale Medien haben in dieser Entwicklung eine wichtige soziale Funktion. Sie verändern sowohl unsere Kommunikation als auch unsere Beziehungen auf unterschiedlichen Ebenen auch gegenüber der Wahrnehmung der eigenen Sexualität.29 Der Trend ist klar: X, Instagram, TikTok etc. arbeiten stark mit Bildern und die Medialisierung gewinnt an Bedeutung. Die Frankfurter Religionspädagogin Viera Pirker hat die Bedeutung von Bildkulturen30 in den sozialen Medien gut erforscht, und stellt fest, dass Bilder einen höheren Glaubwürdigkeits- und Wahrheitscharakter haben, sodass innerhalb von Sekunden mit einem Identitätsgefühl zwischen »positiv-authentisch« und »negativ-nicht authentisch« entschieden wird31. Dabei entscheiden die User:innen nach inneren Kriterien wie Kohärenz, Authentizität und Anerkennung und so bilden sich neue Identitätskonstruktionen, die Auswirkungen auf das Selbstbild, die Wirklichkeitswahrnehmung und die Peergroup haben. Es entsteht dabei nicht nur ein neuer Umgang mit Bildern, sondern ein neuer Blick auf die Wirklichkeit. Der Schweizer Professor für Digitale Kultur und Theorien der Vernetzung, Felix Stalder, nimmt diese Entwicklung auf, reflektiert sie und nennt diese öffentliche Produktion von Kulturgütern »Referenzialität im digitalen Raum«. Er beschreibt damit, wie bereits Bestehendes mit Neuem verbunden und zu einer Synthese wird.32 Es entsteht ein Remix: ein Zusammenführen, Verändern und Hinzufügen von unterschiedlichen Kommunikationsformen, sodass sich ständig etwas Neues entwickelt. Bestehendes wird mit Neuem verbunden – nicht als Brücke, sondern als Synthese. Zusammenführen, Verändern und Hinzufügen ist somit ein ständiger Prozess mit fließenden Übergängen. Ein weiteres Merkmal der digitalen Referenzialität ist nach Stalder die Fragmentierung von Informationen. Im Gegensatz zu traditionellen Bibliotheken oder gedruckten Werken werden Informationen online oft in kleinen, fragmentierten Einheiten präsentiert, die durch Links miteinander verknüpft sind. Dies kann die Tiefe und Kontinuität der Informationsverarbeitung beeinflussen, da die Bedeutung stark vom jeweiligen Kontext abhängt, der durch verlinkte und benachbarte Inhalte bestimmt wird.
1.3.3 Der sexualethische Deutungskampf in den sozialen Medien
In der Flüchtigkeit von Instagram, TikTok und YouTube erleben wir eine neue Form im Umgang mit Spiritualität und Sexualität, die sich dem Zwang der üblichen kirchlichen Verortungen entzieht und sich eigene liquide Wege sucht. Denn die Identifizierung von unterschiedlichen Praktiken in den sozialen Medien sowie deren Urteilsfindung gleicht mehr einem iterativen als einem systematischen Prozess. So gesehen entpuppt sich bei genauerem Hinsehen Instagram als neue Kanzel, TikTok als Exerzitienmeister und die Yoga-App als spiritueller Ort des Gebets. Die junge Generation ist dabei gewöhnt, private Inhalte und persönliche Gedanken online mit einer breiten digitalen Öffentlichkeit zu teilen. Sie sind vernetzt und finden in den sozialen Medien Menschen mit ähnlichen Interessen über Orts- und Landesgrenzen hinweg. Sie finden online echte Freundschaften, eine neue Form der Vergemeinschaftung und Identitätsangebote, auch zu Fragen der eigenen Spiritualität und der Sexualität. Sie werden dabei zu eigenständigen Akteur:innen und Creator:innen, weil sie verstanden haben, dass es nicht auf Alter, Rolle und Position, sondern auf das eigene Einbringen, Mitgestalten und die Kenntnisse über das entsprechende Medium ankommt.33 Gleichzeitig ist ihnen auch bewusst, wie schnelllebig die sozialen Medien sind, wie schnell man sich online angreifbar macht und wie unbarmherzig und toxisch Exklusionsdynamiken greifen können. Social-Media-Kanäle bilden dabei mit ihren Darstellungsmöglichkeiten von eigenen Ideen, Bildern, Emotionen, Gedanken, Erlebnissen, Plänen und Utopien verschiedene Facetten des eigenen Ichs und auch der Wahrnehmung anderer ab. Sie werden dabei als Räume für freien Austausch von Ideen verstanden und können wertschätzend, anregend, weiterführend, gemeinschaftsbildend und auch kritisch sein. Dabei sind Social-Media-Kanäle auch Orte eines ständigen Kampfs um Anerkennung. Man hat Angst, übersehen zu werden, und im Vergleich mit anderen und deren Schönheit, Intelligenz und Originalität nicht mithalten zu können, nicht begehrt zu werden, exkludiert zu sein. Durch die omnipräsente Selbstinszenierung stehen die User:innen oft im Vergleichs- und Bewertungsmodus. Gerade in der Thematik der eigenen Sexualität wird Erfahrenes öffentlich verarbeitet, vor allem bei der Thematik der Purity Culture kommt es hier zu schweren Auseinandersetzungen. Alles in allem: Social-Media-Kanäle prägen soziale Praktiken, die von Freiheit, Selbstentfaltung und Gemeinschaftsbildung wie auch von Zwang, Verunsicherung und De-Solidarisierung geprägt sind.
1.3.4 Scham und Beschämung in den sozialen Medien