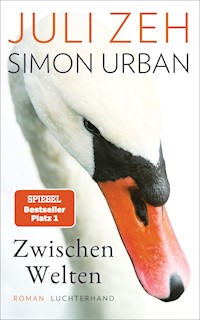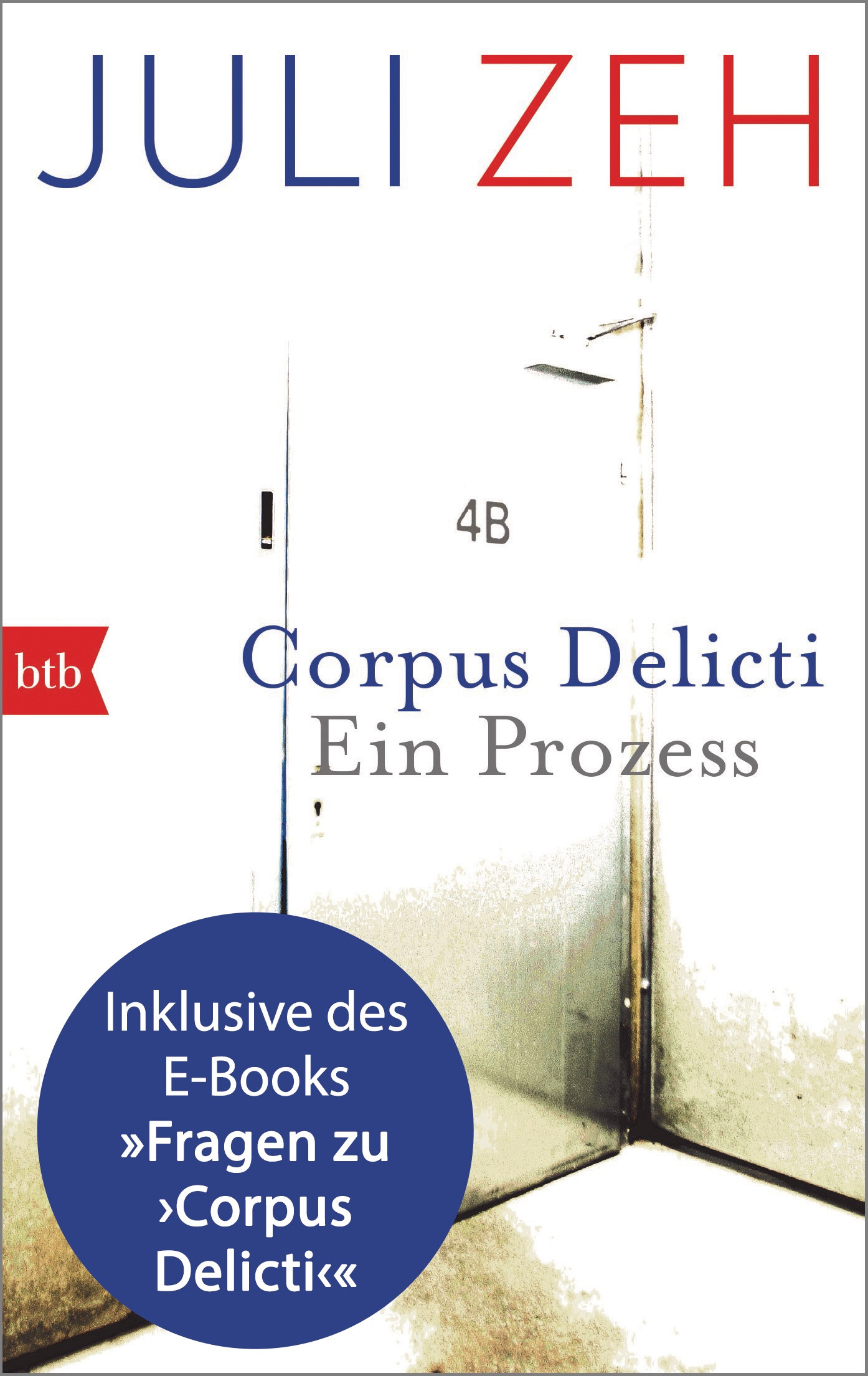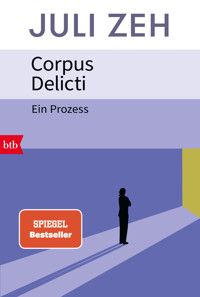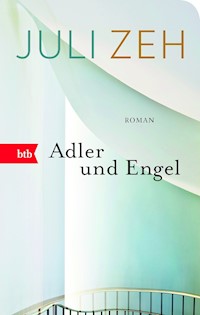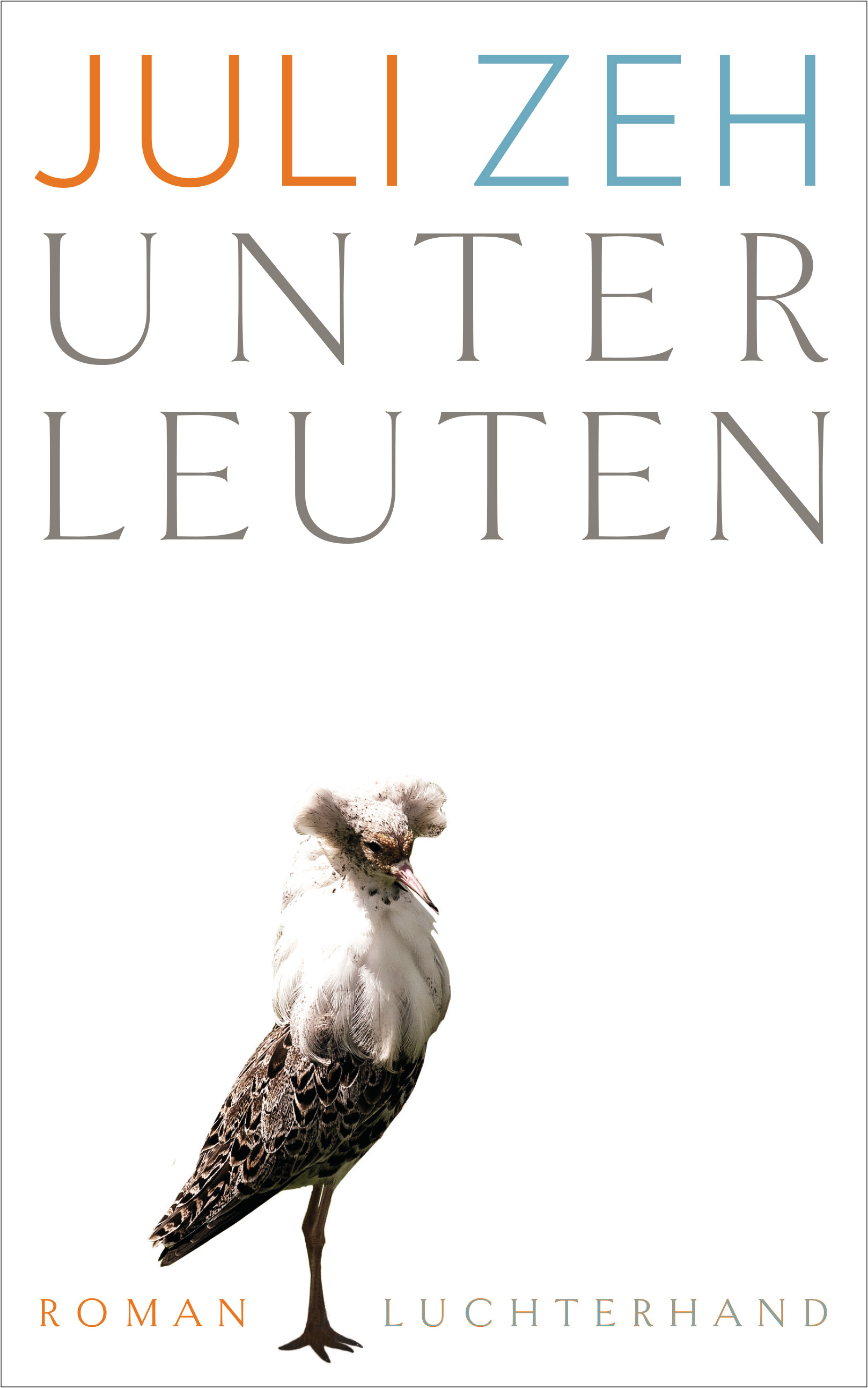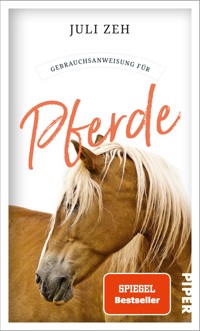3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Poetik ist etwas für »Quacksalber, Schwächlinge, Oberlehrer, Zivilversager und andere Scharlatane«, so Juli Zeh 2013 in ihren Frankfurter Poetikvorlesungen: »Poetik klingt immer so, als wüsste der Autor, was er da tut – dabei weiß er bestenfalls, was er getan hat.« Diese Erkenntnis im Kopf lässt es sich befreit aufspielen und wunderbar poetologisieren, über die Bedeutung der Erinnerung für das Schreiben zum Beispiel: »Ein Ereignis ist nicht das, was passiert ist, sondern das, was erzählt werden kann.« – Eine »Anti-Poetologie« – frech, klug und witzig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Titel
Treideln
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Zur Autorin
Zum Buch
Impressum
Juli Zeh
Treideln
btb
1
Sehr geehrte Goethe-Universität in Frankfurt am Main,
herzlichen Dank für die Einladung zur Frankfurter Poetikvorlesung. Ich fühle mich sehr geehrt. Trotzdem muss ich leider absagen. Im Jahr 2013 werde ich mit dem Verfassen mehrerer Romane, Theaterstücke, Essays, Drehbücher, E-Mails, Steuererklärungen, Tagebucheinträge und Einkaufszettel so beschäftigt sein, dass mir zum Ausarbeiten einer Poetikvorlesung leider die Zeit fehlt.
Mit freundlichen Grüßen
Juli Zeh
Mein lieber Verleger,
das kannst du vergessen. Kommt nicht in Frage. Man ist entweder Autor oder Poetikbesitzer. Ich bin doch nicht mein eigener Deutsch-Leistungskurs. Ohne mich.
Deine liebe Autorin
Chef!
jetzt fall mir nicht in den Rücken! Was heißt, ich soll mich freuen? Warum soll ich mich immer freuen? Freu du dich doch! Es ist eine Zumutung, sich freuen zu müssen! »Freu dich doch« heißt: »Friss oder stirb«! Das sag ich das nächste Mal zu dir, wenn du einen Bildband über Aufsitzrasenmäher zum Geburtstag geschenkt bekommst! Vielleicht sogar von mir! Dieser kapitalistische Glückszwang, der permanent in Form des erfolgreichen, gesunden und hocherfreuten Idealmenschen in Wort und Bild an uns herangetragen wird, führt lediglich dazu, dass wir Depression und Burn-out inzwischen als neue Volkskrankheiten bezeichnen! Die Leute werden nicht krank, weil sie so viel arbeiten! Sondern weil sie sich ständig freuen sollen! Wer sich nicht freut, ist ein Versager! Der hat was falsch gemacht! Nicht das Richtige gegessen, nicht genug Sport gemacht, nicht die richtige Creme benutzt, nicht die richtige Sex-Praktik ausgeübt! Nicht die richtige Poetikvorlesung gehalten! Das muss behandelt werden, am besten medikamentös! Bestimmt gibt es Poetik auch in Pillenform! Poetocetamol 500 mg! Davon schlucke ich dann die ganze Packung und sterbe an einer Überdosis, und dann stehst du weinend an meinem Grab und auf dem Grabstein steht: Freu dich doch! Ich übertreibe? Das ist mein Beruf! Und egal, was du jetzt sagst, es ist auf jeden Fall falsch!
Ich liebe dich trotzdem. Jetzt muss ich Schluss machen, die Ausrufezeichen sind alle.
Dein Vorzimmer
Alter Schwede,
so, hast du gehört, ja? Pfeifen es die Seeadler von den Stockholmer Dächern? Dann weißt du mehr als ich. Bin im Stellungskrieg. Oder, wie du sagen würdest: Bin am Rumzicken.
Juliette
Sehr geehrte Goethe-Universität in Frankfurt am Main,
da haben Sie mich ertappt. Zeitmangel ist eine schlechte Notlüge, wenn eine Veranstaltung regelmäßig zweimal pro Jahr stattfindet. Ich habe behauptet, nächstes Jahr keine Zeit zu haben, und natürlich sagen Sie, dann soll ich eben übernächstes Jahr kommen. Wenn ich jetzt sage, dass ich übernächstes Jahr auch nicht kann, laden Sie mich für überübernächstes Jahr ein, und wenn ich überübernächstes keine Zeit habe, dann eben überüberübernächstes, da capo, da capo, und am Ende ist nur die Frage, wer früher stirbt. Aber ich konnte schlecht zurückschreiben: Gehen Sie mir aus der Sonne, ich habe keine Lust. Das wäre unhöflich und dabei nicht einmal zutreffend. Lassen Sie mich anders versuchen, Sie abzuwimmeln.
Für diese ehrenvolle Aufgabe wäre ich eine denkbar schlechte Besetzung. Zu deutlich stehen mir Vormittage an deutschen Gymnasien vor Augen, wo ich der zwangsversammelten Schülerschar als lebendiger Beweis für die Existenz von Gegenwartsliteratur präsentiert wurde. Ich saß da im sicheren Glauben, einen typischen Hilfe-ich-muss-wieder-zur-Schule-Albtraum zu durchleben, und wartete aufs Aufwachen. Als der Lehrer begann, zur Einführung eine gekürzte Version meines Wikipedia-Eintrags vorzulesen, dämmerte mir, dass ich erstens schon wach und folglich, zweitens, viel zu früh aufgestanden war. Aus Rache für diesen unerfreulichen Befund ließ ich den Oberexegeten vulgo Deutschlehrer wie die Titanic auf Eis laufen, indem ich die Lieblingsfrage aller Textinterpreten, »Was will uns die Autorin damit sagen?«, mit einem frohgemuten »Nichts!« beantwortete. Und fügte abmildernd hinzu, während die Klasse feixte und sich der jeweilige Deutschlehrer im Blute seiner Existenzberechtigung wand: »Jedenfalls nicht, dass ich wüsste.«
Mit anderen Worten: Ich habe keine Poetik. Niemand hat eine Poetik, jedenfalls nicht, solange er Bücher schreibt.
Mit freundlichen Grüßen
Juli Zeh
Mein lieber Verleger,
ja, ich habe die Liste der Namen der bisherigen Referenten im Rahmen der Frankfurter Stiftungsgastdozentur für Poetik zur Kenntnis genommen. Ja, die Liste ist beeindruckend. Am beeindruckendsten ist vielleicht die Tatsache, dass es bei uns so viele staatstragende Schriftsteller gibt, dass seit 1959 jedes Semester einer die Poetikvorlesung abhalten kann und bis in alle Zukunft wird abhalten können, ohne dass uns jemals die Schriftsteller ausgehen werden. Irgendwo muss es eine geheime unterirdische Schriftstellerfabrik geben, in der ständig neue Schriftstellermodelle vom Band laufen, mit serienmäßig eingebauter Poetikfähigkeit und literarischer Bedeutsamkeitsgarantie bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag.
Mich lässt die Frage nicht los, warum die das machen. Ich würde ja gerne sagen: um Geld zu verdienen, aber ich hab’s mal durchgerechnet – selbst mit wohlwollender Schätzung des Aufwands liegt der Stundenlohn nicht über fünf Euro, wofür die Autoren auch Zeitungen austragen könnten.
Tun sie aber nicht. Stattdessen stehen sie im Audimax, Semester für Semester, Schriftsteller für Schriftsteller, und führen aus Verzweiflung über das nicht vorhandene Objekt ihrer Bemühungen stundenlang rhetorische Taschenspielertricks vor. Verlesen ihre eigenen Rezensionen, beschweren sich über die EU, spielen Musik, zeigen Filme, lesen fiktive Briefe an real existierende Verleger vor. Warum?
Du wirst sagen: Weil es dem Schriftsteller ein tief empfundenes Bedürfnis ist, der Leserschaft seine Poetik nahezubringen. Weil er den großen Garten der Literaturtheorie durch sein bescheidenes Poetikpflänzchen bereichern möchte. Weil er sich der historischen Bedeutung seines Tuns bewusst ist. Weil da über Jahre hinweg ein faszinierendes Panorama von Selbstauskünften entsteht. Ein literaturgewordenes Jahrhundert. Poetikgewordene Zeitgeschichte.
Klingt gut und schön wär’s. Wenn es Poetik überhaupt gäbe. Poetik ist das, was Autoren erfinden, wenn sie zu Poetikvorlesungen eingeladen werden. Erst war die Poetikvorlesung, dann die Poetik. Poetikvorlesungen besitzen den Glaubwürdigkeitsgehalt einer Teleshopping-Präsentation.
Nein, mein lieber Verleger, wir beide kennen das wahre Geheimnis hinter der Poetikfreudigkeit der Schriftstellerzunft. Es ist das Herta-Müller-Prinzip. Seit vier Jahren schreibt mir jeder zweite Veranstalter, der mich zu einer Lesung einlädt, dass Herta Müller auch schon da war. Mühelos könnte ich ein Bewegungsprofil von Herta Müller erstellen. Sie war wirklich schon fast überall. Die Veranstalter gehen davon aus, dass ich auch einmal dort gewesen sein will, wo Herta Müller schon war. So ist es auch mit der Poetikvorlesung. Du schickst mir die Namensliste, weil du weißt, dass ich dann nicht absagen kann. Zu diesem erlesenen Kreis muss ich gehören. Das riecht nach Olymp und nach ein bisschen Unsterblichkeit. Nicht einmal Unbürgerliche wie Rainald Goetz, Einar Schleef und Thomas Meinecke haben die Einladung abgelehnt. Wie sollte eine Oberbürgerliche wie ich sich dann entziehen?
Das ist nicht einmal Eitelkeit. Es ist der dringende Wunsch, dabei zu sein. Auf einen kurzen Pfiff kommen die Schriftsteller gelaufen, stellen sich ans Pult und rackern sich ab bei dem Versuch, mit einer einigermaßen erträglichen Mischung aus Selbstdarstellung und Literaturtheorie den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Jeder Einzelne getrieben von der Not, mit den anderen mithalten zu müssen, den Anschluss an die Herde nicht zu verlieren.
Was sagt das über uns Autoren aus? Wir haben Angst. Gegenwartsliteratur, also die Summe nicht der geschriebenen, sondern der wahrgenommenen Texte, ist das Ergebnis einer merkwürdigen Auslese von Zufall, Publikumslaune und Kritikergeschmack. Ein Haus, aus dem man jederzeit wieder hinausgeworfen werden kann. Jedenfalls glauben das die Autoren. Ihre Existenzberechtigung im Betrieb müssen sie sich immer wieder neu verdienen. Durch das Absolvieren von Zugehörigkeitsriten. Durch das Stattfinden im Feuilleton, das Vortanzen auf Buchmessen, durch öffentliches Lügen im Rahmen von renommierten Poetikvorlesungen.
Bitte missversteh mich nicht: Das ist keine Klage. Das ist nicht einmal Kritik. Es ist nur das Eingeständnis, dass mich die Einladung durcheinanderbringt, weil ich feststelle, von welch ungeheurer Demut gegenüber der Möglichkeit des Nicht-Gelesen-Werdens meine Autorenexistenz dominiert wird. Umso mehr, als wir Schriftsteller heutzutage unser Hobby gern zum Beruf machen. Fast ist es ein Naturereignis: Wie viele Schriftsteller in diesem Land von der Literatur leben können, vielleicht nicht vom Bücherverkauf, aber doch von Lesungen, Stipendien und Poetikdozenturen! Das ist ein feiner Luxus sowohl fürs Land als auch für die Autoren. Allerdings erweitert es die Gefahr des Untergehens im Aufmerksamkeitszirkus um eine empfindliche Dimension. Nicht-Gelesen-Werden wäre für die meisten deutschen Autoren nicht nur ein rezeptionsästhetisches, sondern auch ein finanzielles Problem.
Man könnte meinen, das beste Mittel gegen die Angst vor dem Nicht-Gelesen-Werden sei das Schreiben des nächsten Romans. Ist es aber nicht. Es lassen sich Autoren beobachten, die das Schreiben von Romanen praktisch komplett gegen die Ausübung von Gastdozenturen eingetauscht haben. Hin und wieder doch noch erscheinende Publikationen dienen vor allem dem Erhalt der Berufsbezeichnung »Schriftsteller«. Literatur ist dann die Eintrittskarte zum Club der Über-Literatur-Sprechenden.
Jeder Autor weiß, dass das Schreiben von Büchern hierzulande nicht genug ist. Er muss sich seine Leser verdienen, indem er Auskunft gibt. Über sich, über das Schreiben. Aus Urheberrecht folgt Urheberpflicht. Hinter dem Text soll ein Mensch aus Fleisch und Blut sichtbar werden. Weil das eigentlich nicht möglich ist, da literarische Texte auf rätselhafte Weise über die Person hinausgehen, die sie geschrieben hat, wird der Textinszenierung eine Autoreninszenierung hinzugefügt. Eine Fiktion hinter der Fiktion. Das verbirgt sich hinter dem Zauberwörtchen Transparenz, wie wir es heute verstehen: eine Verpflichtung zur Selbstauskunft. Durch das Veranstalten eines verbalen Tags der offenen Tür erhält man die Verlängerung der Lizenz zum Mitspielen. Nicht nur in der Literatur. Überall. Dem Trend zur Privatisierung des Öffentlichen korreliert eine Verpflichtung zur Veröffentlichung des Privaten. Das macht die ohnehin bedrohliche Liste der Namen vergangener Poetikdozenten noch bedrohlicher: Nicht einmal die Größten haben das Gefühl, sich unsichtbar machen zu dürfen.
So, lieber Verleger, falls du dich gerade fragst, ob das jetzt eine Zusage oder eine Absage war, kann ich daran erinnern, dass Mehrdeutigkeit neben Übertreibung die zweite Säule ist, auf der die Literatur ruht. Mit anderen Worten: Laut zu sein und trotzdem nicht verstanden zu werden, ist mein Job.
Deine liebe Autorin
Alter Schwede,
dass du der Meinung bist, ich soll das machen, ist sonnenklar. Seit wir uns kennen, hältst du mir Vorträge über die Rolle des Autors im Medienzeitalter. Dass jeder zeitgenössische Schriftsteller ein Presseprofi sein müsse. Dass mediale und literarische Kompetenz nicht mehr voneinander zu trennen seien. Dass meine Interviews knackiger, die Essays skandalträchtiger und Fernsehauftritte häufiger werden müssten. Als wir uns damals auf der Weihnachtsfeier am Literaturinstitut in Leipzig kennen lernten, hast du mich als Erstes gefragt, wie ich meine Corporate Identity beschreiben würde. Sollte das eigentlich eine Anmache sein? Es ist nur dem Alkohol zu verdanken, dass wir trotzdem ins Gespräch kamen.
Und was hast du gemacht, als letztes Jahr dein erstes Theaterstück in Dortmund uraufgeführt wurde und 3sat dich um ein Interview bat? Du hast mich angerufen und in hellster Aufregung gefragt, was du denen denn erzählen sollst! Was bloß antworten, wenn sie wissen wollen, warum du das Stück geschrieben hast? Wer oder was dich inspiriert hat? Woran du als Nächstes arbeiten wirst? Man kann doch nicht immer nur »keine Ahnung« sagen! Flugs hast du die These für dich entdeckt, dass der Autor hinter dem Werk verschwinden müsse, statt die Rezeption durch erklärende Ausführungen zu stören. Aber ich soll jetzt mal wieder an meine Karriere denken und in Frankfurt …
Mein lieber Schwede, du bist so was von unglaubwürdig. Schreib erst mal deinen ersten Roman fertig, du Pappnase.
Juliette
Liebe Wanda,
das ist ein verlockendes Angebot. Ich weiß, dass du das ganz hervorragend machen würdest. Erstens bist du nicht nur Lyrikerin, sondern vor allem Germanistin, und zweitens bist du nicht ich. Mir würde es auch leichter fallen zu erklären, warum und wie du deine Gedichte schreibst. Wozu gäbe es denn die ganze Literaturwissenschaft, wenn die Autoren selbst wüssten, was es mit ihren Texten auf sich hat?
Nach jeder neuen Veröffentlichung erlebe ich ein seltsames Phänomen: die Metamorphose vom Autor zum Exegeten der eigenen Texte. Wenn ich auf Lesungen erklären soll, was ich in einem Text gemacht habe und warum, stammele ich wie ein Schulkind, das die Handlung eines Buchs zusammenfassen muss, welches es nicht gelesen hat. Als ich in einem der ersten Interviews zu Nullzeit gefragt wurde, ob Sven ein Prototypus des verantwortungsscheuen Vierzigjährigen sei, fragte ich zurück: »Welcher Sven?« In meinem Kopf hieß der Erzähler immer noch Olli. Ich hatte ihn erst kurz vor Drucklegung in Sven umgetauft. Je eifriger ich das zu erklären versuchte, desto misstrauischer guckte der Journalist. Es war offensichtlich, was er dachte: Die hat das gar nicht selbst geschrieben.
In den folgenden Wochen merke ich dann von Interview zu Interview und von Lesung zu Lesung, wie ich besser werde. Immer neue Fragen bringen mich auf immer neue Interpretationsansätze. Nach und nach decke ich Bedeutungszusammenhänge auf, erkenne den politischen und gesellschaftsrelevanten Gehalt, verfolge Motivketten und lerne sogar, meine schrägen Metaphern mit Sinn zu füllen. Ein paar Monate später bin ich zur Fachfrau in Sachen Selbstinterpretation geworden. Ich kann den jeweiligen Text als vollendetes Ganzes beschreiben, und es klingt, als würde ich über etwas Planvolles, Durchdachtes sprechen. Ein Wortgebäude, dem eine komplexe, in unendlichen Schleifen mit sich selbst verwobene architektonische Struktur zugrunde liegt. Das Verblüffende daran ist, dass ich zu diesem Zeitpunkt selbst zu glauben beginne, jenes zwischen den Buchdeckeln Vorgefundene sei von mir aus nachvollziehbaren Gründen in genau dieser Weise erst gewollt und dann gemacht worden. Noch verwunderlicher ist, dass sogar starke Argumente für diese Annahme sprechen. An der Erstellung des Textes war schließlich niemand außer mir beteiligt. Und trotzdem ist die Annahme falsch. Beim Schreiben habe ich wenig gewollt und noch weniger gemacht.
Jetzt wäre es im Grunde reine Fleißarbeit, die während meiner Lesereisen gesammelten Erkenntnisse zusammenzufassen und in Frankfurt als Poetik zu präsentieren. Ich könnte mir einen netten Angebertitel einfallen lassen – »ZEITARBEIT – Realität, Relativität und Roman« – und in aller Ausführlichkeit erklären, was der auktoriale Erzähler mit Quantenphysik zu tun hat und warum Schreiben nichts weiter ist als das Erzeugen eines Zeitkondensats. Den Leuten würde nichts auffallen. Sie sind es gewöhnt, angelogen zu werden. Ich würde vorgeben, etwas von meiner Arbeit zu erzählen. Einen Einblick in die Werkstatt zu gewähren. Eine Ahnung davon zu vermitteln, wie literarische Texte entstehen und warum. In Wahrheit aber hätte ich klammheimlich die Seiten gewechselt, würde gar nicht mehr als Autorin sprechen, sondern als Leser der eigenen Texte. Das Publikum müsste einem pseudo-literaturwissenschaftlichen Vortrag lauschen, den eine brillante Germanistin wie du in der Tat besser halten würde. Erkenntnisse, die ein Autor in einem solchen Rahmen präsentiert, entstammen nicht der Schreibpraxis. Sie sind nachträglich gefasst worden, und das macht einen entscheidenden Unterschied. Poetik klingt, als wüsste der Autor, was er da tut – dabei weiß er bestenfalls, was er getan hat. Nach Fertigstellung, sprich: Veröffentlichung eines Textes spricht er über Literatur, nicht mehr über das Schreiben. Und schafft auf diese Weise einen falschen Eindruck von dem, was Schreiben bedeutet. Auf typische Journalistenfragen wie »Woher nehmen Sie Ihre Ideen?«, »Wie viel Autobiographie steckt in Ihren Texten?«, »Für wen schreiben Sie?« dürfte es eigentlich immer nur eine Antwort geben: Weiß ich nicht. Aber wir haben von unseren Politikern gelernt, dass man lieber das Blaue vom Himmel herunter erzählt, als zuzugeben, dass man keine Ahnung hat. Also vermitteln Autoren landauf, landab den Eindruck, literarisches Schreiben sei etwas Ähnliches wie das Nachbauen des Eiffelturms aus Streichhölzern: Abbildung der Wirklichkeit mit anderen Mitteln, kompliziert und langwierig, aber planbar. Dabei ist in Wahrheit kein Autor Herr über das Wie seines Schreibens, fehlt ihm doch zumeist schon die Verfügungsgewalt über das Ob.
Und jetzt komm mir bloß nicht mit »Erzähl den Leuten doch einfach ein bisschen, wie das bei dir so aussieht mit dem Schreiben«. Glaubst du wirklich, es interessiert jemanden, ob ich an fauligen Äpfeln rieche, mir Petersilie in die Ohren stecke oder ein Tässchen Kräutertee mit Namen »Sanfte Unsterblichkeit« trinke, wenn ich nicht weiterkomme? Wie viel Prozent meiner Arbeitszeit mit Nasebohren, Solitaire oder Facebook-Surfen vergeht? Wie oft ich zum Kühlschrank renne, nach wie viel Minuten sich der Bildschirmschoner einschaltet, ob ich staubsauge oder Fenster putze, um mich von der Arbeit abzuhalten? Nicht einmal ich selbst will wissen, wie es aussieht, wenn ich mir vor dem Bildschirm die Zähne mit Zahnseide reinige, während ich über einen widerspenstigen Satz nachdenke.
Weißt du was: Du hast den Job. Du schreibst, ich trage vor. Oder du übernimmst das Vortragen auch gleich mit. Niemand wird etwas merken. Ich sehe mir selbst überhaupt nicht ähnlich. Regelmäßig will man mich zu meinen eigenen Lesungen nicht reinlassen, weil ich keine Eintrittskarte habe.
Deine Juli
Chef,
bist du jetzt durchgedreht? Meinst du das ernst? DAS soll ich in Frankfurt machen?
Dein verwundertes Vorzimmer
Alter Schwede,
danke für die guten Wünsche zum Geburtstag, der schon vorletzte Woche war, aber heute natürlich immer noch gilt.
Ich muss dir was erzählen. Der Chef, will sagen, mein treusorgender Ehemann, hat mir zum Geburtstag einen Reader geschenkt, damit ein vollverknöcherter Papierjunkie wie ich wenigstens mal versucht, mit der Zeit zu gehen beziehungsweise zu kriechen. Gut. Meine Lernfähigkeit ist begrenzt, aber vorhanden. Also will ich die kommunikationstechnologische Rundumerneuerung meiner Person durch den Erwerb eines E-Books vorantreiben, welches ich auf meinem nagelneuen Reader zu lesen beabsichtigte. Ich besuche den Kindle-Shop und tippe die Namen von Autoren ein, die ich mag und die mir gerade einfallen. Leo Perutz. Gibt’s nicht als E-Book. Heimito von Doderer. Gibt’s nicht. Arno Schmidt. Gibt’s nicht. Ich versuche es mit Übersetzungen. Kein Roberto Bolaño. Richard Yates, Walker Percy, Vladimir Nabokov nur auf Englisch. Ich beginne zu ahnen, warum meine Karriere als Raubkopiererin nie wirklich in Schwung gekommen ist. Als ich dem Chef mein Leid klage, nennt er mich »digital unterambitioniert« und lädt mir mit drei Handgriffen mehrere E-Books auf den Reader, von denen ich mir gefälligst eins aussuchen soll. Gelesen wird, was auf den Wisch kommt.
Zum Beispiel Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald. Das kenne ich zwar schon, aber noch nicht in elektronischer Form. Alle paar Seiten verirre ich mich in einen anderen Roman, den mir der Chef ebenfalls auf den Reader gespült hat: Grunewaldsee von Hans-Ulrich Treichel. Und dann passiert etwas Merkwürdiges. Fitzgerald und Treichel verbinden sich zu der Gewissheit, dass ich ein Buch schreiben muss. Den großen Gatsby des frühen 21. Jahrhunderts. Eine Zeitgeistnovelle, die anhand einer Figur ein ganzes Jahrzehnt erzählt. Irgendwie steckt ein Funke in dieser Kombination: Das Glamourös-Prototypische des großen Gatsby neben irgendeinem Paul, der in Berlin studiert und in Italien mal eine Affäre mit einer Italienerin hatte. Wie bei vielen männlichen Autoren über fünfzig geht es in Grunewaldsee die ganze Zeit um Sex. Um mittelguten und stets halb gescheiterten Intellektuellen-Sex natürlich, weil man auf diese Weise den nötigen Sicherheitsabstand von Kitsch und Porno wahrt. Männliche Kritiker über fünfzig finden das dann sehr authentisch und nennen es »lakonisch« oder »melancholisch«, was ein Kompliment und keine Beleidigung sein soll. Deutsches Kino in Buchform. Geschrieben von Vertretern einer Generation, deren Libido plötzlich als politisches Problem definiert wurde.
Dass du mich nicht falsch verstehst, lieber Schwede. Ich habe nichts gegen fast sechzigjährige Männer. Ich will nur erklären, was mir zugestoßen ist, während ich Gatsby und Grunewaldsee parallel las. Ich dachte plötzlich: Aber die Vierzigjährigen. Eine Generation, deren Libido schon gar nicht mehr in der Lage ist, ein politisches Problem darzustellen. Was ist mit denen? Um die darf ich mich kümmern.
Treichel legte sich wie eine halb durchsichtige Folie über Fitzgerald und erzeugte die Umrisse einer Hauptfigur. Anfang vierzig, natürlich in Berlin lebend. Dauergast im zur Ewigkeit gedehnten Durchgangsstadium zwischen Universität und Beruf. Ein Profi des Nicht-Hineinwachsen-Wollens in die Welt der Jobmacher, Familiengründer und Häuslebauer. Ein Vertreter der bis über den vierzigsten Geburtstag hinaus verlängerten Pubertät. Kurzum, ein Bild des urbanen Mannes des 21. Jahrhunderts. Turnschuhe, Fünf-Tage-Bart, bequeme Hosen. Kein Führerschein. Nur noch schwach beseelt von dem Glauben, das Selbst sei etwas, das man finden könne. Ohne Gott, ohne Frau, ohne Vaterland. Einer, der von Tag zu Tag weitermacht, weil hinter dem Aufhören nur das Nichts stünde. Der darauf angewiesen ist, dass die Front alltäglicher Ereignisse fest geschlossen bleibt. Der keine Einsamkeit und vor allem keine Stille verträgt. Stark interessiert am eigenen Körper, weil der eigene Körper das letzte Schlachtfeld ist, auf dem ein Mann noch versuchen kann, Herr über sein Schicksal zu werden. Der Bauch. Die Fitness. Die Magenschleimhautreizung. Zu viel Wein. Alle drei Tage mit dem Rauchen aufhören. Schlafstörungen. Abnehmen und Sport treiben wollen und es dann doch nicht tun. Hin und her gerissen zwischen Selbstoptimierung und Bohème. Denkt über Rohkost nach, während er vor einem Teller Tortellini in Butter-Salbei-Soße sitzt. Und umgekehrt. Steht fassungslos vor der Tatsache, dass er trotz aller Infantilität einfach älter wird. Wo er sich doch immer noch im Vorzimmer des eigentlichen Lebens aufhält und darauf wartet, hineingerufen zu werden.
Ich könnte aus dem Stegreif ein ganzes Psychogramm skizzieren, so vertraut ist mir der Typ. Er soll – lach jetzt nicht – Schriftsteller sein. Ja, ich weiß, was du sagen willst. Wir alle hassen Schriftsteller, die über Schriftsteller schreiben. Aber was soll denn ein Vierzigjähriger machen, der in Prenzlauer Berg lebt und keine Familie hat? Komponist? Zu ernsthaft. Maler? Zu mondän. Schauspieler? Zu tragisch. Freier Werbetexter? Zu hamburgisch. Weinladen-Besitzer? Das sind die über Fünfzigjährigen aus der Generation vor ihm. Dem armen Kerl bleibt gar nichts anderes übrig, als Schriftsteller zu sein. Seit zehn Jahren mit einem Roman beschäftigt, der ihm zum Durchbruch verhelfen wird. In der Zwischenzeit auf kleineren Projekten durch den Literaturbetrieb surfend.
Alter Schwede, spätestens jetzt hast du den Braten gerochen. Ich will Teile deines Lebens. Ich brauche dich. Deine Hypochondrie, deinen Klamotten-Fimmel und die Unfähigkeit, dich zwischen Bürgerlichkeit und Bohème zu entscheiden. Wie du eine Anthologie nach der anderen herausgibst, nur um deinen Roman nicht fertigschreiben zu müssen. Ich brauche sogar deine Frisur, diese ewig zu langen Stirnfransen, die du dir ständig aus dem Gesicht wischst, wenn du nervös wirst. Du gehörst zu den ganz wenigen Menschen, die ich mir vorstellen kann. Früher oder später sind die alle fällig. Leider mag ich dich zu sehr, um einfach ungefragt und nach Belieben mit dir zu verfahren, wie ich es normalerweise tun würde. Allerdings bitte ich dich nicht um Erlaubnis. Was ich dir anbiete, ist in etwa das, was deutsche Bürger im Planfeststellungsverfahren für einen neuen Hauptbahnhof bekommen: Transparenz und Beteiligungsrechte. Du wirst informiert und angehört.
Heute erhältst du also ein erstes Informationsschreiben, welches dir den Namen deines neuen alter ego mitteilt. Weil Treichel gewissermaßen der geistige Vater ist, hätte ich meinen Gatsby reloaded