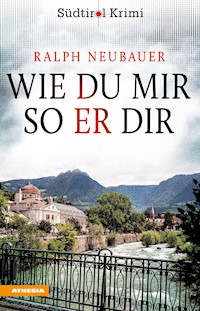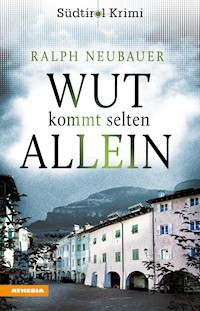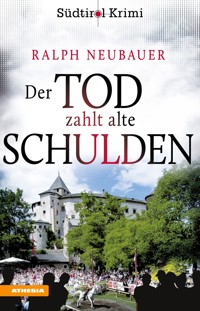Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein vierzig Jahre alter Fall lässt die Gemüter nicht in Ruhe. Ein aktueller Mord und ein rätselhafter Unfall haben möglicherweise etwas miteinander zu tun. Der Dekan von Kaltern weiß etwas, schweigt aber. Der zehnte Fall des Südtirolkrimis beleuchtet das Tun, Denken und Handeln im Weinbau entlang der Südtiroler Weinstraße. Ein alter angesehener Traminer Weinbauer wird in einem seiner Weinberge erschossen aufgefunden. Ein Mann, den man im Dorf achtete, der niemandem etwas getan hatte. Ein Mann ohne Feinde. Die Gerüchteküche im Dorf findet schnell Erklärungen für die abscheuliche Tat. Steckt darin ein Funken Wahrheit? Kann Francesca Giardi, die neue Commissario, den Fall mit Hilfe eines Journalisten lösen, der sich in den Niederungen der Gerüchteküche auszukennen scheint? Oder folgt der Mann nur eigenen Interessen? Ein zweiter Todesfall kurz darauf wirft Fragen auf, denn ein im Kalterer See ertrunkener Mann hat zuvor Gerüchte über den erschossenen Bauern verbreitet. Gab es eine Verbindung zwischen den Männern? Hat sich der Ertrunkene selbst gerichtet, war es ein Unfall oder hat jemand nachgeholfen? Fabio Fameo ist jetzt Vicequestore und ermittelt nicht mehr selbst. Er sucht nach einem gangbaren Weg, um seiner neuen Aufgabe gerecht zu werden. Tommaso verabschiedet sich endgültig in den Ruhestand, landet zuvor aber noch einen Knaller. Alle Figuren haben ihre Positionen gewechselt. Ein neues System muss sich einspielen. Dieser Krimi führt die Leser während der Weinlese in die Dörfer Tramin, Kaltern und Girlan. Sie besuchen die Kellerei Kaltern und eine Sektmanufaktur in Girlan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Donnerstag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Eine Woche darauf
Ein Nachwort
Erläuterungen (Stand Juni 2023)
Donnerstag
- 1 -
»Wenn du damals nicht so schnell reagiert hättest, säßen wir heute nicht zusammen.« Claudio seufzte leise und schaute dabei Tommaso an. Sofort erschien vor ihren Augen die Szene, als wäre sie gestern und nicht vor knapp 40 Jahren geschehen:
Es war dunkel gewesen, außerdem schwül und regnerisch. Die jungen Carabinieri Claudio und Tommaso waren auf Streife. Es hatte einen Mord gegeben, oberhalb von Tramin, in den Wäldern. Drei Jahre war das her und seither waren die Carabinieri besonders wachsam. Ein junger Jäger war tot aufgefunden worden. Man vermutete damals, dass der Jäger einen Wilderer überrascht hatte und von diesem erschossen worden war. Spuren vom Täter gab es keine, auch keinen konkreten Verdacht, denn Wilderer gab es damals viele. Man nahm an, dass sie vornehmlich von der anderen Seite des Bergkamms kamen, aus Dörfern wie Sfruz, Tres oder Smarano. Die Ermittlungen steckten bald fest. Seither patrouillierten die Carabinieri auch auf den Waldwegen. Claudio und Tommaso waren noch jung, gerade mit der Ausbildung fertig. Ihr Maresciallo hatte sie ermahnt, aufmerksam und vorsichtig zu sein: »Die Wilderei ist hier eine Plage. Nehmt euch also in Acht, wenn ihr unterwegs seid. Denkt dran, was dem jungen Jäger passiert ist. Seid im Zweifel schneller.«
Wenig später passierte es tatsächlich. Sie waren mit einem geländegängigen Wagen auf den Forstwegen unterwegs, als sie ein Fahrzeug erblickten, das vor ihnen auf der schmalen Holzabfuhrstraße stand. Die hintere Klappe stand offen. Als sie näher heranfuhren, konnten sie im Licht der Scheinwerfer trotz Regen sehen, dass auf der Ladefläche mehrere Wildkörper lagen.
Sie stiegen aus. Claudio näherte sich dem Fahrzeug. Tommaso blieb hinter der geöffneten Beifahrertür des Polizeifahrzeugs, zog seine Pistole und entsicherte sie. Claudio erreichte die Fahrertür und schaute hinein. Drinnen saß niemand. Er zuckte mit den Schultern und blickte sich um. Der Wald, der die Carabinieri umgab, war finster, ließ nicht zu, dass man in ihn hineinsehen konnte. Claudio bückte sich. In diesem Moment fiel ein Schuss, der ihn knapp verfehlte und mit einem knallenden Geräusch in die Karosserie einschlug. Tommaso hatte das Mündungsfeuer gesehen und hielt drauf. Der Schütze erwiderte das Feuer und ein Geschoss schlug in das Metall des Polizeifahrzeugs ein. In dem Moment erhellte ein Blitz den Schauplatz und Tommaso konnte den Schützen ausmachen. Intuitiv richtete er seine Waffe auf das Ziel, drückte ab und traf, denn es gab kein Gegenfeuer mehr. Claudio war hinter dem Fahrzeug in Deckung gegangen und wartete ab. Tommaso ebenfalls, vom Polizeifahrzeug verdeckt. Beide lauschten angestrengt in die Stille des Waldes. Sie waren gut zehn Meter voneinander entfernt. Tommaso konnte Claudio gut sehen, denn die Scheinwerfer des Polizeiautos leuchteten in Richtung des aufgefundenen Fahrzeugs. Nichts passierte, nichts rührte sich, kein Geräusch war zu hören. Der Regen wurde jetzt stärker. Tommaso starrte in die Dunkelheit, dorthin, wo er den Schützen vermutete. Habe ich ihn getroffen? Lebt er noch?, fragte er sich. Der Wald schluckte alles. Jedes Geräusch, das ganze Licht. Wenn doch ein Blitz noch einmal alles ausleuchten würde, dachte Tommaso, als er im Augenwinkel eine Bewegung ausmachte. Er sah, wie sich ein Gewehrlauf auf den Kopf seines Freundes Claudio zubewegte und was danach passierte, konnte er selbst nicht schildern, weil seine Reaktion schneller war als sein Denken. Die Rekonstruktion der Szene würde ergeben, dass er erkannt haben musste, was passieren würde, währenddessen seine Hand die Pistole in Richtung des Kopfes des Gewehrhalters führte, der Finger den Abzug durchzog und Tommaso so seinem Freund Claudio das Leben rettete.
Claudio und Tommaso waren schrecklich aufgewühlt gewesen. Tommaso stellte sich die Frage, wie der Mann, der das Gewehr auf Claudio gerichtet hatte, unbemerkt die Straße hatte überqueren können. Die ersten beiden Schüsse waren von links gekommen, aber das Gewehr, das auf Claudio gerichtet war, kam von rechts. Tommaso hatte den Angreifer perfekt erwischt. Kopfschuss. Er war der beste Schütze der Ausbildungskompanie gewesen. Man hatte überlegt, ihn in die Sportkompanie zu versetzen. Niemand schoss so schnell und so gut wie er. Als das Knallgeräusch in ihren Ohren langsam verging und nichts weiter passierte, wurde ihnen bewusst, dass die Gefahr vorbei war und sie untersuchten den Toten.
»Mein Gott, der ist kaum älter als wir«, hatte Tommaso damals gesagt. Claudio konnte sich noch gut an das Entsetzen in Tommasos Gesicht erinnern, als er diesen Satz sprach. Dann ging Tommasos Blick hinüber zur anderen Seite des schmalen Holzabfuhrwegs. Claudio war der Gedanke gleichzeitig gekommen: »Es müssen zwei gewesen sein!« Tommaso holte eine starke Taschenlampe aus dem Polizeifahrzeug und suchte die linke Seite des Weges ab. Er musste tief in den Wald eindringen, bis er fand, was er suchte. Claudio und Tommaso standen vor der Leiche eines jungen Burschen. Das Gesicht ganz schwarz. Sie vermuteten zunächst, dass es eingefärbt gewesen war. Später würden sie feststellen müssen, dass Tommaso auch diesen Mann mit einem Kopfschuss getötet hatte. Das Blut war über den ganzen Kopf gespritzt und ließ diesen wie geschwärzt wirken.
Claudio erinnerte sich, wie sich Tommaso übergeben musste und ein Zittern seinen Körper befallen hatte. Es brauchte Zeit, bis sich Tommaso beruhigt hatte. Claudio, dem langsam bewusst wurde, dass er und sein Freund anstelle dieser jungen Männer tot im Wald liegen könnten, funktionierte aber anschließend wie ein Uhrwerk. Er blendete aus, was ihnen hätte passieren können. Erst zu Hause im Bett kam ihm der Gedanke, dass sie in einen Hinterhalt geraten waren. Ihre Ankunft auf dem Waldweg war bemerkt worden und die beiden Wilderer hatten sich, der eine links, der andere rechts vom Waldweg in den schwer einsehbaren Wald zurückgezogen, um sie ins Kreuzfeuer zu nehmen. Tommasos Schießkunst hatte sie gerettet.
Claudio schaute Tommaso an, der gleichfalls in den Bildern von damals gefangen schien, und sagte: »Der erste Schuss auf mich wäre ein Kopfschuss gewesen. Kurz vor dem Schuss hatte ich mich gebückt, weil mir am Boden etwas Funkelndes aufgefallen war. Der Schuss ist genau dort in den Wagen eingeschlagen, wo mein Kopf gewesen war. Durch deine schnelle Reaktion konnte er nicht mehr nachladen und ich hatte die Chance, hinter den Wagen zu gelangen.« Tommaso nickte langsam. Ihm war das alles noch sehr gut in Erinnerung.
Claudio machte eine Pause, holte Luft. Auch heute noch, 40 Jahre danach, kribbelte es ihm im ganzen Körper, wenn er sich diese Nacht in Erinnerung rief. »Sie hätten uns exekutiert, wenn sie die Chance dazu gehabt hätten. Die Kerle hatten keine Skrupel, uns zu töten. Und warum?« Seine Stimme hob sich. »Bloß um ihre Wilderei zu verdecken. Mord zur Verdeckung einer Straftat, nennt man das. Was für ein Scheißmotiv! – Was für Scheißkerle!«
Tommaso legte seine Hand auf Claudios Arm. Er blickte ihn lange an, denn Claudio war verstummt. Auch Tommaso hatte eine belegte Stimme, als er sagte: »Ja, wir säßen heute nicht hier. Da hast du recht. Auch mir läuft die Sache noch hinterher.«
Claudio nickte verständnisvoll. »Einen Menschen zu töten, auch wenn es Notwehr war, ist schwer zu verarbeiten. Du hast mir das Leben gerettet.«
»Das habe ich wahrscheinlich. Aber danach war für mich nichts mehr wie zuvor.« Tommaso drückte den Arm seines Freundes. Ihm war klar, dass Claudio wieder damit anfangen würde. Das war ihr verbindendes Erlebnis, denn danach hatten sich ihre Wege getrennt. Es war üblich, dass man junge Carabinieri versetzte. Tommaso war Maresciallo in Terlan geworden, später hatte er in die Bozner Kaserne gewechselt, was mit einer Beförderung verbunden war. Claudio hatte ebenfalls viele Stationen in seinem 40-jährigen Berufsleben hinter sich gebracht und war vor zehn Jahren Maresciallo von Tramin geworden, dem Ort, an dem er sein schlimmstes Erlebnis gehabt hatte.
»Jetzt lass uns über etwas anderes reden. Was meinst du? Die alten Sachen können doch jetzt ruhen. So wie wir uns bald in den Ruhestand verabschieden. Ich habe meine letzten Wochen und du bist doch auch bald dran, oder?«
Claudio lächelte Tommaso an. »Noch drei Monate. Ist komisch, oder? Ich habe es noch nicht realisiert. Es ist alles noch so weit weg. Damit endet nach 40 Jahren mein Dienst. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, wie wir beide zusammen angefangen haben.«
Tommaso lehnte sich zurück und hätte beinahe angefangen, alte Geschichten aufzuwärmen, als der Wirt mit dem bestellten Herrengröstl an ihren Tisch trat.
»Hier, lasst es euch schmecken«, sagte er.
Claudio lächelte und sagte: »Gelobt sei Jesu Christi.«
»In Ewigkeit. Amen«, antwortete der Wirt und ging.
Tommaso schaute erstaunt. Claudio stach mit Lust in das arrangierte Bratkartoffel-Kalbfleisch-Soße-Gericht und sagte mit vollem Mund: »Werner Dissertori ist studierter Theologe. Drum. Verstehst schon. Deshalb sag ich immer ›Gelobt sei Jesu Christi‹ und er sagt immer ›In Ewigkeit. Amen.‹ Ist so ein Brauch zwischen uns. Er war auch Bürgermeister hier in Tramin. Da hat er mir oft geholfen. Als Maresciallo bist du auf den Bürgermeister schon angewiesen. Kennst du ja.«
Tommaso nickte stumm, denn er hatte vom Herrengröstl gekostet. Aber mit vollem Mund spricht es sich nicht gut. Als der Mund leer war, sagte er: »Das ist klasse. Gibt es kaum noch auf den Speisekarten. Aber auch wenn, dann ist es nicht mehr das, was es mal war.«
Claudio erwiderte mit vollem Mund: »Guter Koch, altes Rezept, so wie früher.«
Tommaso nickte zustimmend. »Warum hat er denn Theologie studiert, wo er doch kein Geistlicher ist, sondern«, Tommaso schaute sich um, »ein Restaurant führt und das Hotel nebenan?«
»Ich denke mir halt, dass es ihn interessiert hat. Nicht aus beruflichen Gründen, nehm ich an. Er hat ein Weingut und baut vor allem Gewürztraminer an. Gute Weine, teils prämiert. Dann das Hotel Plattenhof und das Restaurant, in dem wir sitzen. Dass er auch ein paar Jahre hier der Bürgermeister war, habe ich schon erzählt. Aber so sind sie hier. Sie haben alle verschiedene Jacken an, wenn du verstehst.«
Tommaso nickte. Er kannte die Südtiroler.
- 2 -
»Wir treffen uns um 13 Uhr in der Trattoria Filo D’Olio in der Pfarrgasse«, hatte ihm Roberto zugerufen. »Unter der fetten Henne.« Dabei hatte er gelacht.
Mit der »fetten Henne«, das erkannte Fabio sofort, als er die Trattoria betrat, war ein Gemälde gemeint, das in der Mitte der linken Stirnwand hing. Zuvor erregte jedoch ein anderes Bild seine Aufmerksamkeit. In die mit dunklem Holz verkleidete Decke des schmalen Eingangs war ein Stillleben eingefügt, das verschiedene Früchte, vor allem aber dicke Weintrauben, darstellte. Weißwein- und Rotweintrauben waren zu erkennen. Gute Einstimmung, dachte Fabio, passt zur Jahreszeit. Die Traubenernte hatte in Südtirol begonnen. Fabio betrachtete die Theke, die mit liebevoll beschriebenen Schiefertafeln darüber informierte, was der Gast hier erwarten durfte: »Hier kochen wir mit Liebe. Essen mit Appetit. Trinken mit viel Genuss.« Das ist also ihr Treffpunkt, überlegte Fabio. Er war zu früh, da er sich den Ort vorher anschauen wollte. Seine neuen Kollegen hatten ihn zum ersten Mal zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen. Oder eingeladen, mitzukommen. So genau wusste er es nicht. Jedenfalls freute er sich, offensichtlich willkommen zu sein. Fabio hatte vom ersten Tag an in seinem neuen Amt gespürt, dass ihn Roberto Caputo und Mario Barletta neugierig beäugt hatten. Nie ließen sie eine Gelegenheit verstreichen, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Heute hatten sie ihn schließlich eingeweiht, dass die Trattoria Filo D’Olio ihr Stammlokal für das Mittagessen war. Dabei ließen sie auch eine Spitze gegen Pallua ab: »Ihr Vorgänger war sich zu fein für eine einfache Trattoria. Pallua bevorzugte exquisitere Restaurants. Na ja, der hatte auch das Geld dazu. Aber wir sind zufrieden mit Alfio und Salvatore, das sind der Koch und der Geschäftsführer. Sehr gutes Essen. Das Beste ist aber, dass wir unter der fetten Henne sicher sind. Der Platz ist für uns mittags reserviert. Wir haben die Wand im Rücken, sehen wer reinkommt und können uns ungestört unterhalten. Also, bis heute Mittag, unter der fetten Henne!«
Das hatten sie ihm zugerufen und Fabio wollte es sich mit seinen neuen Kollegen nicht verscherzen.
Er ging beherzt auf den Tisch unter dem Bild mit der »fetten Henne« zu und betrachtete es. Das ist ein Hahn und keine Henne, dachte er, als er von hinten angesprochen wurde.
»Entschuldigung, aber dieser Tisch ist reserviert.« Alfio blickte Fabio freundlich an. »Ich weiß«, sagte Fabio. »Aber ich gehöre dazu.«
Alfios Gesicht verzog sich zu einem Lächeln. »Ah, dann sind Sie der neue Vicequestore. Die Herren haben mir von Ihnen erzählt. Sie kommen seit der Eröffnung der Trattoria zu mir. Beide haben erzählt, dass sie bald einen neuen Kollegen bekommen. Ich bin entzückt. Ich stehe sozusagen unter Polizeischutz.« Er lachte. »Ein Scherz, Vicequestore, nur ein Scherz.«
Fabio wusste nichts zu erwidern, was auch nicht nötig war, denn jetzt traten mit lautem Hallo seine beiden Kollegen ein und begrüßten Alfio überschwänglich, wie man es bei alten Freunden tut.
Roberto fragte gleich: »Was gibt es heute Gutes? Was hat Salvatore heute frisch gemacht?«
Mario mischte sich ein. »Aber zuvor für uns drei einen guten Wein zum Aperitif. Habt ihr euch schon kennengelernt? Das ist Vicequestore Fabio Fameo. Wenn es ihm hier so gut schmeckt wie uns, dann sind wir vielleicht öfter zu dritt, Alfio. Dagegen wirst du nichts einzuwenden haben, schätze ich.«
Schulterklopfend nahm man Platz, die beiden unter dem Bild, Fabio ihnen gegenüber. Währenddessen informierte Alfio, dass es heute Melonensalat mit Büffelmozzarella, Tomaten und Blattsalat, Heidelbeerrisotto und Tagliata vom Hirsch mit Polenta oder Röster als Beilage gäbe. Bevor sie bestellten, sagte Mario: »Heute laden wir dich ein, Fabio, als Willkommensgruß. Aber danach zahlt jeder für sich.« Damit waren die Regeln klar.
»Sagt mal«, begann Fabio das Gespräch, »ihr wisst schon, dass die fette Henne ein Hahn ist?« Roberto grinste ihn an. »Ja, das wissen wir, aber die Dame, die den Hahn hält, na, du kannst es doch gut erkennen, oder?« Fabio hatte bemerkt, dass der Maler die weibliche Figur üppig ausgestattet hatte. Er verstand.
»Ist ein Code. Wir sagen ›fette Henne‹ und nur wir wissen, was damit gemeint ist. Wir hätten auch ›polnische Militärmission‹ oder etwas anderes sagen können. Hauptsache ist, dass die Chefetage nicht weiß, wo wir sind. Die fette Henne ist unser Rückzugsort. Manchmal braucht man so einen Platz.«
Fabio nickte, denn er hatte mit Tommaso auch so einen Rückzugsort gehabt. Das Café Marlin, nicht weit von der Trattoria. Bis der Inhaber gewechselt hatte, trafen sie sich dort, wenn sie unter sich reden wollten. Ein kurzer Moment von Traurigkeit erfüllte ihn, weil diese Zeit nun endgültig zu Ende ging. Tommaso würde in wenigen Wochen pensioniert werden. Hinzu kam, dass Fabio als Leiter des Amtes für kriminalpolizeiliche Ermittlungen andere Aufgaben hatte als zuvor. Die Zeiten als Commissario waren vorbei. Er war nicht mehr direkt mit den Fällen betraut. Das mussten Francesca und Eduard allein übernehmen.
»Was ist, Kollege?«, rief Mario. »Warum so ein trauriger Gesichtsausdruck? Bloß weil wir die Dame als ›fette Henne‹ bezeichnen? Also, wenn dich das stört, dann suchen wir uns ein anderes Tarnwort. Vorschläge nehme ich ab sofort entgegen.« Mario lachte Fabio an.
Fabio musste jetzt auch lachen. »Nein, nein, es ist alles gut. Mir schoss eine Erinnerung an alte Zeiten durch den Kopf. Das werdet ihr an meinem Gesichtsausdruck gesehen haben. Gefühle halt. Aber jetzt bin ich wieder ganz bei euch. Mit der ›fetten Henne‹ kann ich leben.«
»Die alten Zeiten als Commissario sind für dich vorbei. Willkommen im Club der Entscheidungsträger. Deine Nachfolgerin, Commissario Giardi, wird das gut machen. Sie war in der Vergangenheit positiv aufgefallen, soweit wir das mitbekommen haben. Dein alter Chef war uns gegenüber eher sparsam im Austausch. Fachlich korrekt, aber so auf informeller Ebene, da war er entweder ein Autist oder er kochte lieber sein eigenes Süppchen.« Roberto lehnte sich zurück und beobachtete, wie Fabio reagierte.
Fabio hatte nicht damit gerechnet, dass sich das Tischgespräch als Erstes um Vicequestore Pallua drehen würde, seinen früheren Chef. Ihm hatte er einiges zu verdanken. Unter anderem, dass Fabio ihm nachfolgen konnte. Vor drei Jahren, als Pallua in Pension hätte gehen können, hatte er auf Kanälen, die er auch gegenüber Fabio nie offenbart hatte, wahrgenommen, dass eine Person auf diesen Stuhl gesetzt werden sollte, die bereits Jahre zuvor für Ärger gesorgt hatte. Für einige Monate hatte diese Person, Carmelita Cantallielo, damals Vicequestore Pallua ersetzt. Pallua kam zurück und die Cantallielo verschwand, weil ihr eine Plagiatsaffäre nachgewiesen wurde. Fabio war es vorgekommen, als hätte Pallua im Hintergrund an vielen Fäden gezogen, um ein ihm genehmes Ergebnis erzielen zu können. Pallua schlug Fabio vor, dass er noch zwei Jahre auf seinem Vicequestore-Sessel kleben bleiben wolle, um so zu verhindern, dass die Cantallielo in einem zweiten Anlauf diesen Platz einnehmen konnte und somit Fabios Aufstieg blockierte. So war es auch gekommen. Nach den zwei Jahren »Nachsitzen« schien die Gefahr vorüber und Fabio konnte Pallua beerben.
Fabio überlegte also gut, wie er auf die Äußerung seiner neuen Kollegen reagieren wollte. »Es ist doch so, dass jeder seine Eigenheiten hat. Ich bin mit meinem Chef gut ausgekommen. Dass er so war, wie ihr ihn schildert, kann ich aus meiner Erfahrung nicht bestätigen. Mir und meinen Kollegen gegenüber war er zugewandt und vor allem sehr interessiert an unserer Arbeit. Wir hatten die Freiheit, die wir brauchten, und bekamen Unterstützung, bei Bedarf.« Fabio machte eine Pause. Die anderen schauten ihn an. Neugierig, so kam es ihm vor. »Was ihr mir erzählt, kann ich nur glauben. Ich war nicht dabei.« Dabei ließ es Fabio bewenden und beobachtete seine Kollegen. Die beiden schienen nicht weiter interessiert, denn ihre Blicke gingen Richtung Küche, aus der Alfio mit einem Ensemble Teller auf dem Arm auf sie zu balancierte.
»Hier kommen zweimal Melonensalat und einmal das Risotto, kleine Portion. Bitte schön. Ich wünsche guten Appetit. Soll ich noch Wein bringen?«
Roberto und Mario nickten und mit Appetit widmeten sie sich ihrem ersten Gericht.
Die Stimmung war sofort gesellig, gemütlich und nett, wie Fabio feststellen konnte. Offensichtlich hatten die beiden großen Spaß am Essen und zelebrierten das auch. Das Thema Pallua war vom Tisch. Auf dem Tisch stand die Tagliata vom Hirsch. Es war köstlich.
- 3 -
»Mutter, wie kannst du so was sagen?« Margit war außer sich. So engstirnig hatte sie ihre Eltern nicht eingeschätzt. Vor Jahren hatte sie sich ihnen gegenüber geoutet, dass sie keinen Mann an ihrer Seite haben würde, der als Weinbauer die schwere Arbeit im Weinberg übernehmen könnte. Ihre Eltern hatten Hoffnung geschöpft, dass ihre einzige Tochter im heiratsfähigen Alter endlich den ersehnten Mann ins Haus holen würde, als sie für kurze Zeit mit dem Sarner Eduard angebandelt hatte. »Ist zwar ein Sarner und kennt nur Vieh, aber den machen wir zum Weinbauern«, hatte der Vater damals zur Mutter gesagt. Da hatte er bereits ausgeblendet, dass Eduard Polizist war und deshalb eine andere berufliche Perspektive hatte. Margits Vater ging davon aus, dass der Mann seiner Tochter den Weinbaubetrieb übernehmen würde. Dann kam das. Sie hatte ihnen verkündet, dass es mit Eduard aus sei, weil sie jetzt endgültig wisse, dass sie mit den Männern nichts am Hut habe. Sie liebe eben Frauen. Punkt. Die Eltern müssten es akzeptieren. Das war ein Schock. Sie wussten nicht damit umzugehen. Aber solange es im Dorf nicht rum war, wäre es zu ertragen. Außerdem änderten sich Dinge. Man müsse Geduld haben. In den Jahren danach hatten sie nicht feststellen können, ob sich bei Margit etwas bewegte. Sie hatte keine Freundin, von der sie gewusst hätten. Im Dorf redete man zwar über die »Jungfrau vom Wolkensteinhaus«, aber es waren leise Töne. Noch waren es leise Töne. Jedes Jahr wurden auf den Dorffesten die neuen Verbindungen zwischen den Geschlechtern befestigt. Margit blieb weiterhin unbemannt. Nicht, dass es ihr an Bewerbern mangelte, aber sie blitzten alle ab. Für Margit war das Stress, für die Bewerber eine Niederlage. Schnell galt sie als Prinzessin auf der Erbse, der man es nicht recht machen konnte. Margit konnte damit leben, ihre Eltern, darauf angesprochen, flüchteten sich in Ausreden.
Doch jetzt hatte ihnen ihre Tochter soeben eröffnet, dass sie mit dieser Polizistin, dieser Francesca, zusammenziehen wolle. Die Mutter erschrak, der Vater wurde wütend. Wie stelle sie sich das vor? Was würde das Dorf sagen? Das waren noch die harmlosen Einwände. Die Sätze prasselten auf Margit ein wie Hammerschläge. Die Eltern entluden sich. »Nicht unter meinem Dach!«, hatte der Vater gerufen. Der Frust der vergangenen Jahre, die Hoffnung, dass sich alles zum Besseren regeln würde, all das platzte aus ihnen heraus. Da wurde Margit schlagartig bewusst: Sie war 30 Jahre alt, die Stütze des Betriebes, denn sie regelte seit Jahren alles Kaufmännische, half auch beim Wimmen und der Betreuung der Erntehelfer in der Zeit der Traubenlese, verhandelte mit der Genossenschaft, wenn der Vater für Streit gesorgt hatte, und jetzt musste sie sich anhören, dass sie nicht länger im Dorf wohnen könne, zöge sie mit der Walschen zusammen. Mit der »Walschen«, das war das Wort, das für Margit das Fass überlaufen ließ.
»Wo steht ihr denn überhaupt, dass ihr mir mit diesen alten Zöpfen kommt! ›Mit der Walschen‹! Geht’s noch? Das ist Denken von vorgestern!«, schrie Margit zurück. Sie war derart in Wut geraten, dass ihr nur noch die Flucht blieb. Ansonsten hätte sie alles zusammenschlagen müssen. Laut knallend schlug sie die Tür zu und musste sofort Distanz gewinnen.
Margit wusste nicht wohin. Sie wusste nur, dass man ihr ansah, dass sie stinkwütend war. Das Einzige, was in diesem Moment half, war Bewegung. Am liebsten wäre sie laut schreiend weggelaufen. Aber im Dorf geht so was nicht. Tramin ist klein, übersichtlich. Jeder kennt hier jeden. Das würde Gerede geben. Von der Hans-Feur-Straße, wo ihr Geburtshaus, das Wolkensteinhaus, stand, war es nicht weit bis in die Weinberge. Mit schnellen Schritten eilte sie zum Dorf hinaus. Manch neugieriger Blick folgte ihr. Angesprochen wurde sie aber von niemandem.
Erst zwischen den Weinpergeln konnte sie den Versuch starten, ihre Gedanken zu sammeln. Sie tobten wild durch ihren Kopf. Es ist doch nicht zu fassen. Das also denken sie wirklich. Ich kann da nicht bleiben. So geht das nicht. »Eine Walsche« haben sie gesagt. Das ist schlimmer, als ich es mir jemals gedacht habe. Schon klar, dass sie Schwierigkeiten haben, mich so zu akzeptieren. Kein Mann an meiner Seite, der für die Arbeit passt. Keine Enkelkinder. Ist blöd für sie. Aber nur aus ihrer Sicht. Meine Sicht scheint sie nicht zu interessieren.
Während die Gedanken rasten, schritt sie kraftvoll aus. Hier und da fielen Wörter aus ihr heraus. Selbstgespräche. Das half eigentlich, sich zu fokussieren. Jetzt aber nicht. Sie war viel zu aufgewühlt. Die Stimme traf sie daher unvorbereitet: »Hallo Margit. Was ist los mit dir?« Es war eine freundliche Stimme. Margit kannte sie. Sie gehörte ihrem Onkel.
»Ach, Onkel Alfred, du sollst mich nicht so sehen.«
Alfred trat aus den Weinpergeln hinaus auf den Weg, der zwischen den Weinbergen verlief. »Mit dir ist was, das sehe ich doch«, sagte er und nahm seine Nichte in den Arm. Er hatte sofort erkannt, dass hier ein großer Kummer unterwegs war. Tränenreich brach es aus Margit hervor. Sie erzählte ihrem Onkel alles. Alfred hörte geduldig zu. Dabei schritten sie beide langsam den Weg bergauf, Richtung Söll. Es musste gegen drei am Nachmittag sein, denn die Glocke von St. Jakob in Kastelaz schlug drei Mal. Zwei Männer begegneten ihnen. Margit und Alfred erkannten ihren Maresciallo und grüßten. Den zweiten Mann kannten sie nicht. Claudio grüßte zurück, stockte kurz, als er das verheulte Gesicht von Margit sah. Aber da er Alfreds Miene entnahm, dass er alles im Griff hatte, beließ er es bei dem Gruß. Irgendwann endete Margits Vortrag. Sie hatte fertig erzählt. Alfred war im Bilde und er verstand Margit und ihren Kummer. Er verstand auch Margits Eltern. Alfred war der ältere Bruder von Margits Mutter Bruni. Seinen Schwager schätze er nicht besonders, aber für einen handfesten Streit hatte es nie gereicht.
Er überlegte, wie er Margit trösten konnte. »Schau, Margit, das Leben ist kompliziert. Hier auf dem Dorf musst du es schlau angehen. Das gilt auch für deine Eltern. Ich teile deine Auffassung, dass deren Ansicht, dass eine Walsche nichts für dich ist, völlig daneben ist, geradezu aus der Zeit gefallen. Ich kann dich auch verstehen, wenn du sagst, dass du jetzt nicht mehr im Wolkensteinhaus leben möchtest. Aber wie lösen wir das Problem?« Er machte eine Pause, drehte sich zu Margit und schaute ihr ins Gesicht. »Ich habe da eine Idee. Die hatte ich schon länger.« Er seufzte leise. »Weißt, mein Mädchen, es wird sich bald alles fügen.« Er machte eine lange Pause. Margit war so sehr in ihrem Gedankenkarussell gefangen, dass sie es nicht bemerkte. Dann sagte Alfred: »Du musst jetzt die Zähne zusammenbeißen und bitte zu Hause kein Porzellan zerschlagen, bis ich mit dir das nächste Mal gesprochen habe.« Er überlegte. »Wir treffen uns bei mir, nächste Woche Montag um 9 Uhr. Nur wir beide. Erzähl bitte niemanden davon, vor allem deinen Eltern nicht. Versprich es mir.«
Margit nickte. Sie überlegte. Heute war Donnerstag. Bis zum Montag würde sie es aushalten, auch wenn sie sich nicht vorstellen konnte, ins Wolkensteinhaus hineinzumarschieren, als sei nichts geschehen. Wie sollte sie es mit ihren Eltern zukünftig halten, wie es mit ihnen aushalten? Sie wischte über ihr Gesicht, schaute Alfred an: »Gut, ich halte mich zurück. Aber nur bis Montag.«
Alfred schien zufrieden, hakte sich bei Margit unter und sagte: »Komm, Liebes, wir schauen mal, ob man beim Plattenhof einen ordentlichen Apfelstrudel hinbekommt.« Er lachte. »Das war ein Scherz. Der Apfelstrudel dort ist klasse.«
- 4 -
»Hast du das auch mitgekommen? Der Alfred soll gebeichtet haben. Beim Herrn Dekan. Gestern erst.«
»Nein, wirklich? Warum denn in Kaltern? Er kann doch auch in Tramin beichten gehen.« Das Gesicht hellte sich auf. »Ach, jetzt verstehe ich. Der Alfred wollte nicht, dass es in Tramin bekannt wird. Der ist doch noch nie beichten gegangen. Der Alfred doch nicht. So kenn ich ihn. Niemals ist der zur Beichte.« Nach einer kleinen Pause. »Bist du da sicher? Ich meine, war das wirklich der Alfred? Beim Herrn Dekan sagst du?«
Der Angesprochene nickte. »Hat mir die Resi erzählt, die will es vom Messner gehört haben.«
Mit einer wegwischenden Handbewegung kam die Antwort: »Ach, hör doch auf! Der eine weiß es vom anderen, der es irgendwo von irgendwem, irgendwann gehört hat.«
»Ja, aber an jedem Gerücht ist etwas Wahres dran.«
Die beiden schauten verträumt über ihre Weingläser hinweg in den Innenhof des Drescherkellers, der sich allmählich mit Fahrradtouristen füllte, die ihre Tour entweder hinter sich hatten oder ihre Fahrt hier unterbrachen, um sich zu stärken. Binnen kurzer Zeit war der Eingang mit E-Bikes zugeparkt und Rentner in Fahrradkluft besetzten die letzten freien Plätze im Freien.
»Das hat zugenommen.«
»Ja, und wie. Das sag ich dir. Mein Bruder verleiht die Dinger in seinem Hotel. Seitdem ist er ausgebucht. Sporthotel ist er jetzt.«
»Ja, wenn’s Geld bringt.«
- 5 -
»Du kommst zu meiner Verabschiedung?« Tommaso stellte diese Frage. Etwas anderes als eine Zusage hätte er nicht erwartet.
Claudio nickte ihm zu. »Kommst du später dann zu meiner?«
Diesmal nickte Tommaso. Das gemeinsame Mittagessen im Plattenhof hatte ihnen gutgetan. Sie hatten bisher selten die Zeit gehabt, gemeinsam etwas zu unternehmen. Seine Frau Anna verstand sich ganz gut mit Magdalena, der Frau von Claudio. »Wenn wir dann beide frei sind, sollten wir uns besuchen. Prissian ist nicht weit weg. Anna kocht vorzüglich.«
Claudio lachte und schüttelte Tommasos Hand. »So wollen wir es halten. Lass uns hoffen, dass uns kurz vor der Pensionierung nicht noch ein dickes Ding eingebrockt wird.«
Tommaso schüttelte den Kopf: »Nein, das wird nicht passieren. Wir genießen die letzten Tage, räumen den Schreibtisch auf und dann war es das.«
- 6 -
Als Francesca das Telefongespräch mit Margit beendete, spürte sie ungute Gefühle in sich aufkommen. Da waren Angst und eine leichte Wut in ihrem Bauch. Sie atmete tief durch.
Mit so einem Konflikt hatte sie nicht gerechnet. Margits Eltern waren ihr gegenüber bisher freundlich aufgetreten. Es war noch alles recht frisch, ein knappes Jahr, seit sie und Margit ein Paar wurden. Sie hatten sich seither mal in Tramin, mal in Bozen getroffen. Im Februar hatten sie einen schönen gemeinsamen Urlaub in Costa Rica verbracht, hatten das beschwingte Gefühl und den lockeren Lebensstil dort genossen, der Frohsinn und Optimismus verbreitete. Dieses beschwingte Urlaubsgefühl hatte bis in den Herbst hinein, bis heute, angehalten. Jetzt zerbrach es an der bisher verborgenen Haltung von Margits Eltern. So ein Mist, dachte sie. Das kann ich nicht gebrauchen.
Francesca hatte Margit sofort angeboten, zu ihr nach Bozen zu ziehen. Zumindest fürs Erste. So lange, bis sich die Dinge klären würden. Was auch immer man darunter verstehen will. Eine andere Lösung hatte Francesca nicht anzubieten.
Margit wollte noch einige Sachen aus dem Wolkensteinhaus besorgen und dann nach Bozen kommen. Heute Abend wird es eine Krisenbesprechung geben, dachte Francesca.
- 7 -
»Ja, der Herr Dekan, grüß Gott.«
»Grüß Gott«, und mit einem Blick auf seine rote Nase, »Heute wieder lange im Drescherkeller gewesen?«
»Ja, ja, es gibt schon den Neuen.«
»Ah, den Neuen hast du verkostet?«
»Ja, ja, der ist nicht schlecht.« Er schaute dem Dekan von unten ins Gesicht. »Stimmt es, dass der Alfred bei Ihnen zur Beichte war?«
»Wie kommst du da drauf?«
»Es wird erzählt. Das wäre komisch, wo der Alfred doch von Tramin ist.«
»Ja, aber ich bin der Dekan. Zu mir können alle kommen. Auch du, wenn du es brauchst. Aber ich habe dich noch nie bei mir im Beichtstuhl gesehen. Dann brauchst du es wohl nicht?«
»Aber ist schon komisch, das mit dem Alfred. Also ich tät denken, dass er nicht wollen hat, dass man in Tramin weiß, dass er beichten war. Drum ist er nach Kaltern. Oder?«
»Mach dir keinen Kopf dazu. Bei mir darf beichten kommen, wer mag und es braucht.«
»Also, dann war er doch beichten?«
»Das habe ich nicht gesagt und du wirst es von mir auch nicht erfahren. Beichtgeheimnis nennt sich das.«
»Ich will nicht wissen, was er gebeichtet hat, sondern nur, ob er gebeichtet hat.«
Der Dekan schaute nach oben. Herr, lass Hirn vom Himmel fallen, dachte er. Freundlich sagte er: »Frag ihn doch selber.«
Montag
- 1 -
»Hast du alles zusammen?«
»Ja, ich habe alles.«
»Das ist jetzt schon blöd, dass die hier überall mit der Weinlese beginnen.«
»Aber ich konnte nicht anders. Ich habe nur diese eine Woche Urlaub bekommen.«
»Was machen wir, wenn sie uns rauswerfen? Ich meine, vielleicht sind die Weinberge auch verschlossen? Ich habe so etwas gelesen. Da soll es eine Art Wächter geben, stand in dem Buch. Saltner heißen die. Sehen unheimlich aus.«
»Ach, was du immer liest. Ist das ein Buch von früher? Ich glaub das nicht. Lass uns jetzt losgehen. Noch ist es früh. So früh ist keiner unterwegs.«
- 2 -
Alfred Oberhofer war mit dem ersten Tageslicht bei seinen Trauben unterhalb von St. Jakob. Bald kann ich wimmen, überlegte er, als er sie prüfend betrachtete und kostete. Ich muss noch den Lesetermin mit der Kellerei abstimmen. Er pfiff ein leises Lied. Alles ist besorgt. Die Dinge sind geregelt. Aber diese Lese will ich noch machen.
Der nächste Gedanke zerbarst in seinem Kopf.
- 3 -
»Halte die Sonde hier hin. Da könnte was sein.«
»Nee, keine Ausschläge. Hier ist nichts.« Er blickte den Hang hinauf, sah St. Jakob oben auf dem Hügel. »Bist du sicher, dass hier eine Burg war? Ich sehe nichts, was darauf hindeutet. Nur eine kleine Kirche.«
»Das stimmt schon. Die Burg gruppierte sich um diese Kapelle, St. Jakob in Kastelaz. Das soll bewiesen sein. So um 1200 oder 1300. Genauer weiß ich das nicht. Die Burg hatte keinen ewigen Bestand. Die Kapelle ist geblieben. Auf diesem Hügel rund um die Burg finden wir bestimmt etwas. Hier muss es von interessanten Funden wimmeln. Wir müssen sie nur finden.«
»Was ist mit den Römern?«
»Die haben überall etwas hinterlassen. Es gab hier Funde. Aber nichts aus Metall, glaube ich.«
»Soll ich ein Feld höher gehen?«
»Mach das. Ich suche hier weiter.«
»Was ist das denn? Da liegt einer. Komm mal!«
- 4 -
»Sie haben den Mann so aufgefunden, wie er hier liegt und nichts verändert?«
»Ich habe an ihm gerüttelt. Wollte wissen, ob ich ihm helfen kann. Dann«, ihm brach die Stimme, »dann habe ich gesehen, dass alles voll Blut war. Danach habe ich ihn nicht mehr angerührt, ehrlich.«
Claudio traute diesen Touristen nicht. Hobby-Schatzsucher seien sie, haben sie ihm erklärt. Sie hatten komische Geräte dabei. Metallplatten an langen Griffen, von denen Kabel zu einem Kopfhörer gingen. Damit könnten sie hören, ob unter der Erde Metall läge.
»Haben Sie etwas gehört? Einen Schuss vielleicht?«
»Nein, nein, hier war alles ruhig.«
Claudio war aufgewühlt. In der letzten Woche vor seiner Pensionierung so etwas. Der Tote war Alfred Oberhofer. Jeder im Dorf kannte ihn. Einer der großen Winzer. Claudio hatte in sofort erkannt. Ihm fiel die Geschichte von vor 40 Jahren ein. Ich dachte, das wären alle Leichen gewesen, die ich je sehen würde. Und jetzt, kurz vor Schluss noch ein Bekannter. Schrecklich. Claudio hatte zurzeit einen weiteren Carabiniere in seiner Wache, doch er kam erst nachmittags. Daher war er zunächst allein, als die beiden Touristen die Nummer der Carabinieri angerufen hatten. Jetzt stand er vor Alfreds Leiche und hatte diese zwei Zeugen.
»Geben Sie mir bitte Ihre Ausweise. Wo wohnen Sie?«
Wie sich Claudio gedacht hatte, waren sie im zentralen Hotel im Dorf abgestiegen. Ohne ihre Ausweise werden sie sich nicht davonmachen, überlegte er. »Ihre Ausweise behalte ich vorerst. Bitte halten Sie sich zu unserer Verfügung. Ich komme dann später in Ihr Hotel und nehme alles zu Protokoll. Dann bekommen Sie auch Ihre Ausweise zurück. Jetzt bitte ich Sie, diesen Tatort zu verlassen. Gehen Sie in Ihr Hotel und reden Sie mit niemanden, bis ich bei Ihnen war. Haben Sie das verstanden?«
Die beiden Männer nickten. Sie sammelten ihre Utensilien ein und gingen mit hängenden Köpfen davon.
»Was für ein blöder Urlaub.«
»Kann man so sehen. Oder auch ganz anders. Kommt auf den Standpunkt an.«
»Wie jetzt? Unsere Schatzsuche? Die ist doch blöd gelaufen, oder?«
»Aber wir sind jetzt mitten in einem Mordfall. Das ist doch auch spannend.«
Claudio beobachtete den Abmarsch der beiden Männer. Die Uhr von St. Jakob schlug neun Mal. Es war 9 Uhr in der Frühe. Dann herrschte wieder Stille. Nur die Vögel waren zu hören. Claudio betrachtete den toten Alfred. Er zog seine Dienstmütze und verharrte. Dann straffte er sich und zog die Nase hoch. Bloß nicht schwach werden, sagte er zu sich selbst. 40 Jahre im Dienst und jetzt zum Schluss noch einen Toten. Einen Mord, wie er gedanklich ergänzte. Die beiden hatten nichts gehört, hatten sie ausgesagt. Auch, dass sie seit 8 Uhr hier unterwegs gewesen wären. Auf der Suche nach Metall, das in der Erde liegen könnte. Alte Gürtelschnallen und so was. Darauf waren sie aus. Claudio kannte solche Vögel. Seit hier in der Gegend Altertümer gefunden worden waren, kamen sie hin und wieder.
Also muss Alfred vor 8 Uhr erschossen worden sein. Aber woher kam der Schuss? Er blickte sich um. Rings um ihn waren Rebstöcke. Weitläufige Felder, die zu St. Jakob in Kastelaz anstiegen. Abfallend endeten die Felder im Dorf. Einen Schuss müsste man im Dorf gehört haben. So weit sind die ersten Häuser nicht weg, dass man einen Schuss nicht hören kann, überlegte er. Claudio kannte das Haus, das Alfred gehörte. Die alte Kellerei in der Hans-Feur-Straße. Er konnte von seinem Standpunkt aus gut einschätzen, wo es war. Also wurde er nicht weit von seinem Haus erschossen. Inmitten seiner Reben. Claudio betrachtete die Leiche. Alfred lag auf dem Rücken. Der Schuss hatte ihn in der Herzgegend getroffen. Die Einschussstelle war gut zu erkennen. Unter ihm hatte sich eine Blutlache gebildet. Die Erde schluckte sie nicht ganz. Alfred lag mit dem Kopf hangabwärts. Claudio schaute hangaufwärts. Es fiel ihm nichts auf. Keine konkrete Position, von der aus der Schuss hätte abgegeben werden können. Eigentlich von überall her, dachte er. Das wird die Kriminaltechnik herausfinden, seufzte er und zog sein Telefon aus der Tasche.
- 5 -
St. Jakob schlug neun Mal und Margit stand vor der Tür zur alten Kellerei, dem Haus von Onkel Alfred. Sie konnte das Geläut schwach ausmachen. Es war ihr aber vertraut, weil sie es seit 30 Jahren vernahm. Nicht vertraut war ihr, dass der Onkel unpünktlich war. Oder hatte er unsere Verabredung vergessen? Das sieht ihm nicht ähnlich. Sie klingelte erneut. Nichts rührte sich.
Wohin jetzt?, überlegte sie. Im Wolkensteinhaus war sie seit Donnerstagabend nicht mehr gewesen. Kurz rein, das Gerede der Eltern ignoriert, keinen Satz mehr gewechselt, schnell das Nötigste zusammengerafft, rausgestürmt und keine Nachricht hinterlassen, wo sie zu finden sei. Sollen schon merken, dass mit mir ab jetzt nicht zu spaßen ist. Dass sie bei Francesca unterkommen würde, würden sie sich denken können. Danach herrschte Funkstille. Kein Anruf. Nichts.
Er wird sich verspätet haben, überlegte sie. Etwas ist dazwischengekommen. Aber er hätte eine Nachricht schicken können. WhatsApp oder eine SMS. Sie rief ihn an.
Es läutete in Alfreds Hosentasche. Claudio hörte es. Er musste es ignorieren. Der Auffindeort durfte nicht verändert werden. Die Spurensuche und Dr. Phillipi vom Institut der Gerichtsmedizin waren informiert und würden bald hier sein.Dann kann er jetzt nicht drangehen, überlegte sie. Lange rumstehen vor der Tür mag ich nicht. Ins Wolkensteinhaus will ich auch nicht. Was bleibt? ’s Platzl vielleicht. Ja, das geht. Auf einen Caffè. Onkel Alfred hat mich jetzt in seiner Anrufliste. Er wird sich schon melden.
- 6 -
Dr. Phillipi und seine Assistentin Paula nahmen die Leiche in Augenschein. Nachdem die Spurensicherung alles fotografiert hatte, drehten sie den Leichnam um. »O Mann«, entfuhr es Paula. Auch Phillipi stieß Luft durch die zugespitzten Lippen. Claudio folgte ihren Blicken. Da sah er den Grund, der sie zu ihren Lautäußerungen veranlasst hatte. Das ganze Hemd war blutgetränkt, im unteren Rücken total zerfetzt. Das legte den Blick auf den Rücken frei und der wies ein großes Ausschussloch auf. Nicht so ein Loch, wie es ein durchschlagendes Geschoss normalerweise aufweist. Das erkannte auch Claudio. Hier musste ein besonderes Geschoss verwendet worden sein. Claudio überlegte. Wenn der Einschuss in der Herzgegend war und der Ausschuss tief unten im Rücken, dann müsste der Schütze weit über dem Opfer gestanden haben. Er müsste von oben heruntergeschossen haben. Sein Blick ging erneut nach oben, den Hang hinauf. Auch Paula und Phillipi schauten nach oben. Das Einzige, was sie sehen konnten, war der Turm von St. Jakob. Die drei schauten sich an. Phillipi trat zu Claudio. »Da sollten Sie suchen. Wir haben alle drei dasselbe gedacht. Es wird noch dauern, bis wir alles durchgerechnet haben. Schusswinkel, Entfernung und all das. Sie bekommen eine Skizze von uns. Aber wie ich das sehe, kann es gut sein, dass der Schütze von dort oben heruntergeschossen hat.« Phillipi nahm einen Stock, der auf dem Boden lag, und stellte sich knapp neben die Stelle, an der der tote Alfred lag. Er justierte den Stock in der Höhe seiner Herzgegend und neigte ihn bis zu der Stelle, an der der Schuss Alfreds Körper verlassen hatte. Paula ging in die Hocke und visierte über den Stock die Schussrichtung. Sie winkte Claudio herbei. Claudio tat es ihr nach. Der Stock zielte ziemlich genau auf die oberen Fenster des Kirchturms von St. Jakob.
- 7 -
»Hoi Margit«, grüßte Heidrun freundlich. »Einen Caffè?« Margit grüßte zurück und setzte sich. »Ich hätte auch gerne ein Hörnchen«, rief sie. »Gerne«, tönte es hinter der Theke zurück.
’s Platzl war Margits Lieblingsrückzugsraum in Tramin. Klein und fein, fand sie es. Nicht so laut wie anderswo. Sie nahm auf der halbrunden Sitzbank gleich rechts vom Eingang Platz, von der aus man einen guten Blick auf die Vitrine hatte.
»Ach, Heidrun, ich hätte auch noch gerne eines von den Tramezzini, das mit Thunfisch bitte.«
Heidrun brachte ihr das Gewünschte. »Noch kein Frühstück gehabt?«
Margit druckste ein wenig herum. »Ich war das Wochenende unterwegs und hatte mich um 9 Uhr mit Onkel Alfred verabredet. Da hätte ich ein Frühstück bekommen. Aber jetzt ist er nicht da. Wahrscheinlich etwas dazwischengekommen. Da habe ich an dich gedacht.« Sie lächelte Heidrun an.
»Fein, dass du an mich denkst.« Bevor sie fragen konnte, warum es bei ihr zu Hause, nicht weit von der alten Kellerei des Onkels, kein Frühstück gab, betrat eine Schar Männer ’s Platzl, besetzten die Theke, bestellten Caffè und für jeden ein Hörnchen. Heidrun hatte jetzt alle Hände voll zu tun.
Margit betrachtete die Einrichtung des kleinen Cafés, um ihre Gedanken zu beruhigen. Am Kopf des Raumes stand ein Holzregal, gefüllt mit Flaschen, Büchern und dem Bild einer Meerjungfrau, das Heidruns Tochter gemalt hatte. Über dem Regal hing eine Replik von Edward Hoppers berühmten Bild Nighthawks, auf dem drei Gäste in einer Bar eine einsame Kommunikation übten. Das Besondere an der Replik war, dass in das Bild zwei Leuchtstreifen, grün und rot, eingearbeitet waren, die für ein stimmungsvolles grünes Deckenlicht sorgen. Das rote Licht strahlte nach unten. Links daneben hing eine Uhr. Sie zeigte 9.45 Uhr.
Die Männer hatten ihren Caffè getrunken und verschwanden lärmend, nicht ohne ihre Blicke über Margit schweifen zu lassen. Einige der Burschen zwinkerten ihr zu. Margit kannte das. Sie lächelte zurück, obwohl sie dazu keine Lust hatte.
Onkel, wo bleibst du, dachte sie. Du bist jetzt echt überfällig. Sie versuchte erneut, ihn zu erreichen.
Alfreds Telefon klingelte zum zweiten Mal in seiner Hosentasche. Paula griff behandschuht hinein und nahm das Gespräch an.
Eine fremde Stimme meldete sich: »Ja?« Margit dachte, dass sie sich verwählt hatte und legte auf. Aber die Nummer war doch gespeichert. Ich kann mich nicht verwählt haben. Sie versuchte es erneut und wieder meldete sich die weibliche Stimme mit einem »Ja?«
»Hier ist Margit. Ich möchte meinen Onkel Alfred sprechen. Das ist doch seine Nummer?«
»Ja, das ist seine Nummer. Ich heiße Paula und kann Ihnen jetzt nur sagen, dass Ihr Onkel nicht zu sprechen ist. Aber vielleicht sagen Sie mir, was Sie von ihm wollen?«
Margit war erstaunt. Eine Paula hat Onkel nie erwähnt. Hat der Junggeselle auf seine alten Tage jemanden gefunden? Oder kannte er diese Paula schon länger und hat das geheim gehalten? Dieser Schlingel! »Wir waren für 9 Uhr verabredet und ich fahnde jetzt nach ihm. Können Sie ihm das ausrichten?«
»Wo waren Sie denn verabredet?«, fragte Paula zurück.
»Hören Sie, ich kenne Sie nicht. Vielleicht geht Sie das nichts an. Geben Sie mir meinen Onkel oder richten ihm aus, dass ich jetzt im Café ’s Platzl bin, am Rathausplatz in Tramin. Ich würde gerne wissen, ob es sich lohnt, zu warten.«
Paula überlegte kurz. »Ich werde es ausrichten. ’s Platzl sagen Sie? Am Rathausplatz. Geht in Ordnung.« Sie legte auf. »Claudio, kennen Sie eine Margit? Sie soll die Nichte des Toten sein.«
Claudio bestätigte das. »Die beiden waren für 9 Uhr verabredet und jetzt wartet die Nichte im Café ’s Platzl. Wollen Sie?« Sie sprach nicht weiter.
»Was ist mit dem Kirchturm?«
Phillipi mischte sich ein. »Der läuft nicht weg. Einen Täter werden wir dort jetzt nicht mehr finden. Wenn wir Glück haben, finden wir Spuren.« Phillipi machte eine Pause. »Sind Sie allein hier?«
Claudio nickte. »Ich habe noch einen jungen Carabiniere auf der Wache. Aber er kommt erst am Nachmittag. Als mich die Zeugen angerufen haben, bin ich allein hier rauf. Da war noch nicht klar, dass wir es mit einem Mord zu tun haben. Ich melde das jetzt nach Bozen. Dort wird man entscheiden, wer noch eingeschaltet wird.« Claudio dachte dabei an Tommaso.
»Ich führe jetzt das Telefonat und dann entscheide ich, was ich als Erstes mache.«
- 8 -
Tommaso hörte Claudio zu, ohne ihn zu unterbrechen. Er ahnte, was in seinem Freund vorging. Auf die letzten Tage noch einen Mord. Aber Carabiniere sein, heißt im Dienst zu sein. Das geht auch über die Pensionierung hinaus. Einmal Carabiniere, immer Carabiniere. So sagt man.
Tommaso sah die konkrete Situation. Unterrichtung der Angehörigen. In diesem Fall jedenfalls die Nichte, die in einem Café saß und auf ihren Onkel wartete. Außerdem die Spurensuche im Turm von St. Jakob. Das kann man allein nicht machen. Was zu tun war, wusste er sofort.
»Claudio, du kennst die Menschen im Ort. Geh du jetzt zur Nichte und unterrichte die weiteren Verwandten des Toten. Befrage sie, du weißt schon: Hatte das Opfer Feinde und so weiter. Dann knöpfe dir noch einmal die beiden Schatzsucher vor. Muss ich dir nicht erklären. Ich übernehme jetzt die Arbeit am Tatort. In 20 Minuten bin ich da. Phillipi und Paula sollen auf mich warten. Auch die Leute von der Spurensicherung. Mit ihnen werde ich mir den Turm der kleinen Kirche ansehen, schauen, ob von dort geschossen wurde. Wenn ich mich richtig erinnere, steht das Kirchlein nicht allein, sondern da gibt es Häuser drum herum. Dort müsste man doch einen Schuss gehört haben. Vielleicht gibt es Augenzeugen? Vielleicht hat einer jemanden weglaufen gesehen? Sollen wir es so machen?«
Claudio willigte gerne ein. Ihm war es recht, wenn Tommaso die Dinge in die Hand nahm. Einen Mord aufklären. Im Dorf. Mit eineinhalb Carabinieri auf der Station. Kurz vor der Pensionierung.Claudio wusste nicht, ob und wann seine Stelle neu besetzt werden würde. Sie nehmen jetzt ganz junge Maresciallo, direkt von der Akademie. Er hatte noch als einfacher Carabiniere angefangen. Einen mühsamen Aufstieg gemacht. Diese jungen Leute sind alle gut ausgebildet, aber sie haben noch keine Erfahrung. Sie können die Menschen im Dorf nicht kennen, für die sie zuständig sind. Wer weiß, wer da kommen würde.
»Danke, Tommaso. So machen wir es.«
Claudio wandte sich an Dr. Phillipi und teilte ihm das Ergebnis des Telefongesprächs mit.
Phillipi nickte, schaute kurz auf die Uhr. »Das lässt sich für uns einrichten.«
Paula nickte zustimmend. »Wir können in der Zeit die Leiche intensiv betrachten. Ich habe da eine Theorie. Ich denke insbesondere an das große Ausschussloch.«
Paula ist wirklich gut, dachte Phillipi. Dort hätte ich auch angesetzt.
Claudio nahm das Telefon von Alfred Oberhofer und wählte Margits Nummer, die sich als letzte unter den Anrufen fand. Es klingelte bei Margit im ’s Platzl.
Margit kannte Maresciallo Claudio und war zunächst erstaunt, kurz danach bestürzt, als er ihr mitteilte, dass er sie dringend sprechen müsse und dass am besten auch ihre Mutter dabei sein sollte. Er schlug vor, ins Wolkensteinhaus zu kommen.
»Claudio, muss es dort sein? Ich meine, wir können uns auch im ’s Platzl treffen. Warum überhaupt so geheimnisvoll? Was ist mit Onkel Alfred? Du rufst von seinem Handy an. Warum kann er nicht selbst sprechen? Ist ihm etwas zugestoßen? Sag doch was! Bitte!«
»Margit, ich komme nicht ins ’s Platzl. Ich komme ins Wolkensteinhaus«, sagte Claudio sehr bestimmt. »Dort erfährst du alles. Vorerst möchte ich das nur dir und deiner Mutter erzählen. Also, ich komme jetzt zu euch. Bin in zehn Minuten dort.«
Margit erkannte, dass Claudio keinen Widerspruch zuließ. Sie kannte ihn als gemütlichen, angenehmen Menschen, der seine Arbeit ernst nahm und immer ein offenes Ohr für die Belange der Dorfbewohner hatte. Streng und gerecht, aber auch mild und verständnisvoll konnte er sein. So war er all die Jahre gewesen. Jetzt hörte sie an seiner Stimme, dass etwas passiert sein musste, das ihn aufgewühlt hatte. Es ist etwas mit Onkel Alfred passiert. Etwas Schlimmes. Vielleicht ist er verunglückt? Hoffentlich lebt er noch!
Sie richtete sich auf, zahlte und ging mit einem mulmigen Gefühl in der Magengegend zu ihrem Elternhaus, dessen altrosa gestrichene Fassade im Morgenlicht schön aussah. Das Magendrücken nahm aber zu, als sie vor dem gewaltigen Holztor stand, das, weit geöffnet, auch einen Kleinwagen hereinlassen konnte. Es gab im Tor eine mannshohe Eingangstür. Sie schloss die Tür auf und betrat den vertrauten Raum, der sie von je her fasziniert hatte. Von mächtigen Pfeilern getragen, stützen die in- und gegeneinander gemauerten Steinbögen das gesamte Haus, dessen Wohnflächen sich erst ab der ersten Etage befanden. Das Erdgeschoss und die Keller waren Wirtschaftsräume, Lagerräume gewesen. So, wie sie im Mittelalter für den Handel erforderlich gewesen waren. Das Wolkensteinhaus war eines von vielen architektonisch und historisch interessanten Gebäuden in Tramin.
Margit betrat die erste ausgetretene Stufe des steinernen Treppenaufgangs links vom Eingangsportal und sofort öffnete sich oben, auf der ersten Etage, die Tür zu Wohnung ihrer Eltern. Ihre Mutter kam heruntergestürzt.
»Da bist du ja endlich wieder. Warum warst du so lange weg? Wir können doch reden!«, rief sie aus. Sie war sichtlich in Sorge. Der wortlose Abgang der Tochter am Freitag hatte sie zunächst geärgert, dann aber überwog die Sorge. Nicht die Befürchtung, dass ihrer Tochter etwas passieren könne, sondern dass sie, die Mutter, allein dastehen würde. Nur noch ihren Mann hätte. Dass die Stütze wegfiel, die ihr die Tochter war.
Ihr Mann hatte seither nicht viel gesprochen. Er war immer ein Grantler gewesen. Reden war nicht seine Stärke. Er machte sich Sorgen über die anstehende Weinlese und darüber, dass er jetzt die Arbeit, die Margit sonst übernahm, allein verrichten musste. Das war nicht wenig. Sein Teil der Arbeit war es, die Erntehelfer beim Wimmen zu unterstützen und vor allem, die Trauben zur Kellerei zu fahren. Margit koordinierte den Einsatz der Helfer und half selbst mit beim Wimmen. Wenn sie ausfiel, musste ein weiterer Erntehelfer bezahlt werden. Außerdem fehlte dann die Aufsicht in den Reben. Es musste jemand ein Auge darauf haben, ob die Helfer auch ordentlich arbeiteten. Sonst warfen sie womöglich faule Trauben mit rein und das gab dann Abzüge bei der Bewertung in der Kellerei. Margits Mutter sorgte für die Verpflegung der Männer. Zur Lesezeit war die ganze Familie jeden Tag im Einsatz. Oftmals länger als zwölf Stunden am Tag. Ein Ausfall von Margit war schwer zu ersetzen. Außerdem war sie die kaufmännische Leiterin des Betriebs. Sie kannte sich mit allem aus, was Zahlen brauchte. Auch darin war Brunis Mann nicht gut.
Die beiden hatten am Wochenende nicht mehr über »das Problem« gesprochen. Es stand wie der berühmte Elefant im Raum. Dick, nicht zu übersehen, aber durchaus schweigend ignoriert.
In Margits Mutter brodelte es. Das Mutterherz, ihre Angst, dass sie das einzige Kind verlassen könnte.