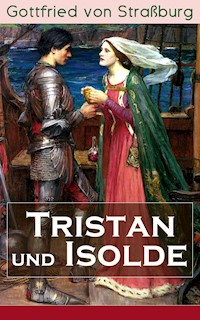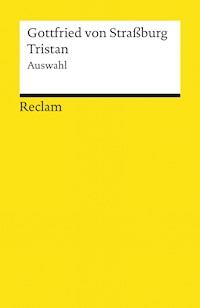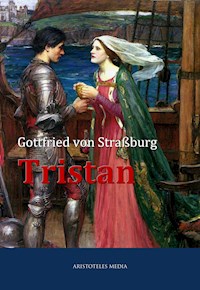3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. ›Tristan und Isolde‹ ist eine der bekanntesten Liebesgeschichten aller Zeiten. Der mutige und listige Ritter Tristan nimmt es auf sich, einen Drachen zu töten, um die schöne Isolde zu gewinnen. Im Auftrag seines Onkels. Doch die beiden jungen Menschen verfallen einer unsterblichen Liebe zueinander, die auch nach Isoldes Hochzeit nicht enden will. Sie begehen Ehebruch. Dieter Kühns kongeniale Übertragung eröffnet einen lebendigen Blick auf das sagenhafte Mittelalter, dessen Sorgen und Nöte unseren so ähnlich sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 626
Ähnliche
Gottfried von Straßburg
Tristan und Isolde
Roman
Übersetzt und mit einem ausführlichen Kommentar versehen von Dieter Kühn
Fischer e-books
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon.
Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur.
Gottfried intoniert eine Ouvertüre von großem Sprachklang, selbstbewußt und souverän. Ihr vorangestellt ist ein großes G. Eine Initiale für Godefridus? Ein Großbuchstabe für Gott, der hier, indirekt, um Beistand gebeten wird? Ein dankbarer Hinweis auf einen Grafen? Hier ist viel gerätselt worden, der Punkt muß offenbleiben.
Auffällig sind weitere Initialen, die, in der Reihenfolge von Strophenanfängen, einen Namen ergeben: DIETERICH. Dieses Akrostichon habe ich in der Übertragung nachgebildet, hier dürfte der Name des Mäzens genannt sein, der das entstehende Werk unterstützte oder erst ermöglichte.
Diesen zehn Initialen schließen sich gleich zwei weitere an: ein T und ein I. Bald darauf die Umkehrung: ein I und ein T. Das Schema wird fortgeführt, schließlich sind ein TRIS und ein ISOL parallelgesetzt. Schon daran zeigt sich: Der große Roman konnte nicht vollendet werden.
Die Buchstabenzeichen werden von Gottfried nicht kommentiert. Doch er äußert sich in eigener Sache: Ein gutes Werk, auch der Literatur, soll angemessen gefeiert und gefördert werden. Folgt eine Absichtserklärung: Dem noblen Publikum will er – zu Unterhaltung und Belehrung – die Geschichte einer leidenschaftlichen Liebe erzählen. Es wird also nicht nur ein Tristan-Roman vorgelegt, sondern die Geschichte der Liebe von Tristan und Isolde präsentiert. Und zwar für Leser und Zuhörer, die selbst die Erfahrung intensiver Liebe gemacht haben oder unter Einwirkung solch einer Erfahrung stehen. Schließt sich die Frage an, wie man mit dieser Geschichte umgeht; einige Vorsichtsmaßnahmen werden angedeutet, denn dies alles ist brisant.
Ehe Gottfried mit der Vorgeschichte der Eltern Tristans beginnt, einer großen und großartigen Intonation des Themas Liebe, erörtert er kurz noch die Quellenlage, begründet seine Entscheidung für die französische Vorlage seiner Nachdichtung: den Tristan-Roman des Thomas aus der Britannie.
Gedächte man im Guten nicht
des Mannes, der das Gute tut,
so wäre alles wie ein Nichts,
was man der Welt an Gutem tut.
Der noble Mann, was er der Welt
in guter Absicht Gutes tut –
wer hier nicht etwas andres als
das Gute sieht, der handelt schlecht.
Ich hör, daß oft verrissen wird,
was man doch gern begrüßen will:
an Schwachem gibt es allzu viel –
man will oft, was man gar nicht will.
Es sollte so sein: daß man preist,
was man sich gern zu eigen macht;
man nehm mit Wohlgefallen an,
was einem weiterhin gefällt.
Teuer, lieb ist mir der Mann,
der unterscheidet: gut und schlecht,
der mich und jeden andren Mann
beurteilt nach dem wahren Wert.
Es fördern Gunst und Lob die Kunst,
sofern die Kunst das Lob verdient;
wo sie den Flor des Lobs erhält,
floriert die Kunst in jedem Zweig.
Runter gehts mit einem Werk,
das man nicht lobt und honoriert;
im Ansehn steigt jedoch ein Werk,
das Gunst und Lob zu Recht erwirbt.
Ist es nicht bei vielen Brauch,
daß Gutes sie als schlecht bezeichnen,
das Schlechte wiederum als gut?
Die fördern nicht, die widerfördern!
Coulantes Urteil, wahre Kunst –
gemeinsam hellen sie sich auf;
doch nistet sich die Mißgunst ein,
verdämmern Kunst und Urteilskraft.
Ha, Vollendung: schmal die Stege
zu dir hin, die Wege schwer!
Doch wer zu dir die Stege, Wege
erwegt, erstegt, der sei gesegnet!
Trödelei mit meiner Zeit,
obwohl ich reifen Alters bin –
da würd ich dieser Welt nicht so
geweitet sein, wie ich es bin.
Ich hab mir für die hohe Welt
nun eine Arbeit vorgenommen;
sie sage noblen Herzen zu –
den Herzen, die ich herzlich liebe,
der Welt in meinem Herzensblick.
Die Welt der Mehrzahl mein ich nicht,
von der ich mir erzählen lasse,
daß sie kein Leid ertragen kann
und sich nur Freude machen will –
die laß denn Gott in Freude leben …
Jener Welt und solchem Leben
wird mein Erzählen unbequem –
ihr Leben divergiert von meinem!
Ich denk an völlig andre Menschen,
deren Herzen dies umschließen:
ihr süßes Bittres, schönes Leid,
ihr Herzensglück, ihr Liebesleid,
und schönes Leben, schweren Tod,
den schönen Tod und schweres Leben.
Solches Leben will ich leben,
dieser Welt bleib ich geweitet,
ich stehe, falle nur mit ihr.
Ich hab bisher mit ihr gelebt,
hab meine Zeit verbracht mit ihr,
die meinem Leben (so bedrückend!)
Geleit, Belehrung geben sollte.
Dieser Welt leg ich mein Werk
nun vor zur Unterhaltung;
ich will mit dem, was ich erzähle,
halbwegs lindern, was für sie
Schmerz ist, der sie sehr bedrückt,
will ihr Leid damit verringern.
Denn faßt man etwas in den Blick,
womit sich das Gemüt beschäftigt,
entkümmert es Bekümmernis,
ist heilsam gegen Herzenskummer.
In diesem Punkt stimmt jeder zu:
Wo einen Menschen in der Muße
die Liebesqualen überlasten,
dort steigert Muße Liebesqualen;
zum Liebesschmerz noch Müßiggang,
da wächst nur noch der Liebesschmerz!
Und so empfiehlt sich: Wessen Herz
voll Herzenspein ist, Liebesleid,
der richte seinen Sinn darauf,
Beschäftigung für sich zu suchen;
sogleich kommt sein Gemüt zur Ruhe –
was fürs Gemüt zur Wohltat wird …
Doch rate ich entschieden ab,
daß ein Mensch, der Liebe will,
Zerstreuung sucht in einer Weise,
die schlecht ist für die reine Liebe.
Jeder, der wahrhaftig liebt,
befasse sich, mit Herz und Mund,
mit der Geschichte einer Liebe,
versüße sich damit die Zeit.
Zu weit verbreitet ist die Meinung,
die ich zu gerne teilen würde:
Je mehr ein liebendes Gemüt
sich einläßt auf erzählte Liebe,
desto mehr wird es belastet …
Ich stimmte dieser Meinung zu,
doch hindert mich daran ein Punkt:
Wo Liebe aus dem Innern kommt,
da löst das Herz sich nicht von ihr,
auch wenn sie dieses Herz sehr quält.
Gemüt, das aus dem Innern liebt:
je stärker, stärker das entbrennt
in seiner Glut der Leidenschaft,
desto feuriger die Liebe!
Dieses Leid ist so voll Glück,
dies Elend tut so herzlich gut,
daß es ein nobles Herz verschmerzt –
es wird dadurch erst recht beherzt.
Ich weiß mit voller Sicherheit,
ich schließe das aus meinem Leid:
Der noble Mensch als Liebender
schätzt Geschichten von der Liebe.
Nun, wer Geschichten sucht der Liebe,
der ist hier an sein Ziel gelangt:
aufs schönste will ich ihm erzählen
von noblen Menschen in der Liebe,
die reine Liebe offenbarten:
der Liebende, die Liebende,
der Mann die Frau, die Frau der Mann,
Tristan-Isolde, Isolde-Tristan …
Ich weiß durchaus, es haben viele
erzählt von Tristan und gelesen,
doch hat kaum jemand über ihn
erzählt, gelesen, was auch stimmt.
Täuschte ich nun freilich vor,
und spräch es als mein Urteil aus:
Daß mir nicht eine der Versionen
des Romans gefallen will,
so verhielte ich mich falsch.
Das tu ich nicht. Sie haben schön
erzählt und mit Noblesse,
mir zum Besten und der Welt.
Ja, ihre Absicht, sie war gut;
was man in guter Absicht tut,
das ist auch gut, ist wohlgetan.
Doch wenn ich sagte, daß sie nicht
erzählten, lasen, was auch stimmt,
so trifft, was ich euch sage, zu:
sie blieben nicht bei der Tradierung,
der Thomas der Britanne folgt;
als großer Kenner der matière
studierte er Britannen-Bücher
zu Lebensläufen hoher Herren
und brachte dies für uns heraus.
Die authentische Version,
die er uns von Tristan gibt,
suchte ich gewissenhaft
in Büchern beider Sprachen:
in Latein und auf romanisch,
und gab mir darauf alle Mühe,
dies, nach richtiger Tradierung,
richtig nachzudichten.
Umfangreiche Studien trieb ich,
bis ich zuletzt in einem Buch
die komplette Fassung fand,
die Thomas der matière gegeben.
Was ich dort von der Geschichte
der Liebe las, der Leidenschaft,
das lege ich, aus freien Stücken,
allen noblen Herzen vor;
sie mögen sich mit ihr befassen:
sie wird den Lesern nützlich sein.
»Nützlich? …« Äußerst nützlich, ja:
sie macht die Liebe lieb und nobelt
das Gemüt, sie festigt, was loyal ist,
verleiht dem Leben höchsten Wert!
Wer liest, wer sich erzählen läßt
von einer derart großen Treue,
dem wird, in seiner eignen Treue,
die Treue lieb, auch weitre Tugend.
Liebe, Treue und Konstanz,
Ehre, weitre hohe Werte –
dies wird einem nirgendwo
so wichtig und so lieb wie dort,
wo man erzählt von Herzensliebe
und Liebes-Herzeleid beklagt.
Liebe ist ein solcher Glücksfall,
ist als Regung so beglückend,
daß ohne dieses Lockbild niemand
Vortrefflichkeit und Ruhm erringt.
Wo Liebe so den Wert des Lebens steigert,
wo so viel Trefflichkeit aus ihr entsteht –
ach, daß nicht alles, was da lebt,
allein nach Herzensliebe strebt,
daß ich so wenig Menschen finde,
die ein reines Herzbegehren
nach dem Geliebten spüren wollen –
nur wegen jenem großen Kummer,
der dabei gelegentlich
im Herzensgrund verborgen liegt.
Weshalb erträgt ein nobles Gemüt
nicht gern ein Leid für tausend Freuden,
nicht einen Schmerz für sehr viel Glück?
Wen nie die Liebe leiden ließ,
dem schenkte Liebe niemals Glück.
Glück und Leid, sie waren stets
unzertrennlich in der Liebe.
Man muß mit diesen beiden
Lob erringen, hohen Rang –
oder scheitern, ohne sie.
Von deren Liebe nun erzählt wird:
hätten sie in einem Herzen
für Freud nicht Leid, für Herzensglück
nicht Schmerz der Leidenschaft erfahren –
ihr Name, ihr Geschick, sie hätten
so vielen noblen Herzen nicht
Glück vermittelt in der Liebe.
Noch heute hören wir sehr gern,
ja, immer wieder mit Vergnügen,
von ihrer innig treuen Liebe,
von Glanz und Elend, Glück und Leid.
Obwohl sie schon so lange tot sind –
ihr süßer Name überlebte sie.
Es mög ihr Tod zum Besten
der Welt noch lang, für immer leben,
mög allen, die danach begehren,
die Liebe schenken und die Ehre;
ihr Tod sei für uns Lebende
in Zukunft ständig neues Leben.
Wo man noch heute rezitiert
von ihrer großen Liebe, Treue,
von Herzensglück, von Herzeleid:
Das ist für noble Herzen Brot.
Und damit lebt ihr beider Tod:
wir lesen ihr Leben, hören vom Tod,
dies ist für uns so frisch wie Brot.
Ihr Leben, ihr Tod sind unser Brot.
So lebt denn ihr Leben, lebt ihr Tod.
So leben sie fort und sind doch tot,
und ist ihr Tod der Lebenden Brot.
Und wer nun wünscht, daß man ihr Leben,
ihr Glück, ihr Leid erzählt, ihr Sterben,
der mache Herz und Ohren auf:
für ihn erfüllt sich, was er wünscht!
Gottfried beginnt mit der Vorgeschichte zur Geschichte der Liebe von Tristan und Isolde, erzählt von Tristans Eltern.
Riwalon, sehr junger Herrscher von Parmenien (irgendwo am Ärmelkanal), führt Krieg; nach dem Sieg über den Erzfeind Morgan aus Irland geht er auf Reisen, kommt zur Burg Tintagel an der Küste Cornwalls. Burgherr und Landesherr Marke gibt dort ein großes Mai-Fest – die Beschreibung als Festspiel der Sprache. Riwalon lernt Blanchefleur kennen, die gleichfalls sehr junge, dazu überaus schöne Schwester des Königs Marke. Mit einem Seufzer beginnt die Liebesgeschichte. Schließlich hymnische Beschwörungen des Einswerdens – hier aber führt leidenschaftliche Liebe nicht zum Ehebruch. Vor der Ehe wieder ein Krieg; Riwalon, als Mitstreiter Markes, wird schwer verwundet nach Tintagel zurücktransportiert. Voller Liebe und Mitleid sucht Blanchefleur den tödlich Verletzten auf, belebt ihn durch leidenschaftliche Küsse; Umarmung; Zeugung. Erneut ein Krieg, Riwalon muß in sein Land zurück. Die schwangere Blanchefleur, Skandal und Erniedrigung fürchtend, folgt ihm heimlich nach Parmenien – dies wird als Entführung ausgelegt. Nach Riwalons Rückkehr drängt sein Stellvertreter, Marschall Rual, auf rasche Legalisierung der Beziehung. Die Ehe wird geschlossen; Riwalon zieht in den Kampf, fällt im Duell mit Morgan. Im Schock der Todesnachricht gebiert Blanchefleur ein Kind; sie stirbt bei der Geburt.
Ein Herrscher lebte in Parmenien,
den Jahren nach ein Bub, so las ich,
der war (dies überliefert uns
die rechte Fassung der histoire)
von Hause aus im Königsrang,
war im Besitzstand fürstlich groß,
war schön, war prächtig von Gestalt,
war mutig, mächtig, schenkte gern;
für alle, die er erfreuen sollte,
war dieser Herrscher zeit des Lebens
eine Sonne, freudenspendend;
er war ein Glücksfall der Gesellschaft,
ein Vorbild für die Ritterschaft,
ein Ehrentitel der Verwandtschaft,
die große Hoffnung seines Landes.
Er zeigte alle Qualitäten,
die ein Herrscher haben sollte,
allein: er wollte hoch hinaus
im Aufwind seines Herzens schweben
und nur nach seinem Willen leben.
Später ward ihm das zum Nachteil,
denn leider war und bleibt es so:
Wilde Jugend, reicher Besitz –
die Paarung führt zum Übermut!
Nachsicht üben (was viele Herren
von großer Macht noch fertigbringen),
auf den Gedanken kam er nicht.
Böses mit Bösem zu vergelten,
Gewalt zu setzen gegen Gewalt,
darauf war sein Denken aus.
Nun geht es nicht auf Dauer gut,
wenn man für jeden Zwischenfall
heimzahlt mit der schwersten Münze.
Bei Gott, in diesem Lebenshandel
muß man eine Menge schlucken,
sonst steckt man viele Schläge ein –
wer keinen Schlag verkraften kann,
der kriegt sehr viele Schläge ab.
Dieser Ablauf führt zum Tod,
auf diese Weise fängt man Bären:
der rächt sich gleich für jeden Schlag,
bis er zum Schluß erschlagen ist.
Ich denk, auch ihm erging es so;
ja, er nahm so häufig Rache,
daß er damit geschlagen war.
Daß ihn so viele Schläge trafen,
ergab sich nicht aus seiner Bosheit,
die ja so manchem Schläge bringt,
es lag nur im Verhalten
seiner jungen Jahre.
Daß er in seiner Jugendblüte
mit seiner jungen Herrschermacht
sein eignes Glück befehdete,
das lag an der verspielten Jugend,
die mit ihrem Überschwang
in seinem Herzen Blüten trieb.
Er war wie alle jungen Leute,
die nie an ihre Zukunft denken,
er schloß die Augen vor Problemen,
ja lebte, lebte, lebte so dahin.
Als sein Leben sich belebte,
aufging wie der Morgenstern,
und lächelnd sah er in die Welt,
da nahm er an (was nie geschah!),
er werde stets so weiterleben
und nur in süßem Leben schweben.
Nein, sein Lebensanfang führte
bloß zu einem kurzen Leben.
Die morgendliche Sonne
seiner Lebensfreude: kaum daß sie
zum ersten Mal zu lachen begann,
fiel schon ein jäher Abend ein
(was ihm jedoch verborgen blieb)
und löschte seinen Morgen aus.
Welchen Namen er denn trägt,
das gibt uns der Roman bekannt,
das offenbart uns die histoire:
sein rechter Name: Riwalon,
sein Zusatzname: Canel-Angres.
Viele behaupten, gehn davon aus,
der erwähnte Herrscher sei
ein Lohnoisier gewesen,
König des Landes von Lohnois;
nun weist uns freilich Thomas nach,
der dies in den histoires studierte,
daß er aus Parmenien stammte.
Er hatte separates Land
aus des Britannen Machtbereich,
dem er die Lehnspflicht schuldig war:
Le duc Morgan hieß dieser Mann.
Als nun der Herrscher Riwalon
drei Jahre tätig war als Ritter,
erfolgreich und höchst ehrenvoll,
als Panzerreiter alles Können
in seine Scheuer eingebracht
mit reichen Kriegs-Ressourcen
(er hatte Herrenland und Geld) –
ob es aus Notwehr da geschah,
aus Übermut, das weiß ich nicht,
die histoire berichtet nur,
daß er den Kampf begann mit Morgan –
als hätte der ihm Unrecht getan.
Er kam mit einer derart großen
Kriegsmacht in sein Land geritten,
daß er ihm, mit deren Einsatz,
viele seiner Burgen stürmte;
die Städte mußten sich ergeben,
sie zahlten für Besitz und Leben
exakt, was beides ihnen wert war,
bis er derart viel Tribut,
zugleich Vermögen eingezogen,
daß er für seine Rittertrupps
so viel Verstärkung kaufen konnte,
daß er (wo er auch aufmarschierte,
ob gegen Burgen oder Städte)
seinen Willen durchgesetzt.
Jedoch, er steckte viele Schläge ein,
verlor so manchen tapfren Kämpfer,
denn Morgan wußte sich zu wehren,
griff oft ihn an mit seinem Heer
und schlug ihn wiederholt.
Zum Kampf, zum Krieg von Panzerreitern
gehören Sieg und Niederlage.
So verlaufen nun mal Kriege:
mit Niederlagen und mit Siegen
ziehen sich die Kämpfe hin.
Ich glaub, ihn ahmte Morgan nach:
stürmte gleichfalls Burgen, Städte,
raubte ihm durch manchen Handstreich
Untertanen und Besitz,
bekämpfte ihn mit aller Macht –
doch brachte ihm das kaum was ein,
denn immer schlug ihn Riwalon
mit Entschlossenheit zurück
und in die Stadt. Tat dies so oft,
daß er Morgan so weit brachte,
auf jeden Ausfall zu verzichten
und seine Rettung schließlich nur
in seinen Festungen zu suchen,
den stärksten und den besten.
Die belagerte Riwalon
und warf sich machtvoll gegen sie
in batailles, in schweren Kämpfen;
immer wieder trieb er Morgan
schnurstracks zu den Toren rein.
Häufig zeigte er vor denen
schöne Reiterpulk-Manöver.
Er besaß im Krieg die Vormacht
und verheerte ihm das Land,
legte Feuer, raubte aus,
bis Morgan anbot zu verhandeln
und mit knapper Not erreichte,
daß beide sich verständigten,
einen Waffenstillstand schlossen
auf ein Jahr und dies wie üblich
beiderseits bekräftigten
mit Geiselstellung, Eidesleistung.
Heimwärts zog nun Riwalon
mit seinen Männern, mächtig stolz
und gut gelaunt, belohnte sehr
und machte alle Kämpfer reich –
gestreng nach seinem Ehrenkodex
ließ er sie in guter Laune
zurück in ihre Heimat ziehn.
Nach diesem Sieg des Riwalon
verging nur eine kurze Zeit,
und er faßte den Entschluß,
sich zu mouvieren (neue Reise!)
und stattete sich wieder aus
mit großem Luxus, für die Fremde –
wie einer, der nach Ehren strebt.
Hab und Gut und alle Mittel,
die er nötig haben würde
für die Dauer eines Jahres,
sie wurden ihm aufs Schiff gebracht.
Er hatte oft erzählen hören,
wie höfisch edel, hochgeehrt
jener junge König sei:
Marke, der von Cornwall; damals
nahm sein Ansehn mächtig zu.
Er besaß zu jener Zeit
Cornwall und dazu noch England.
Cornwall hatte er geerbt;
bei England war die Lage so:
er besaß es seit der Zeit,
als die Sachsen (die von Wales)
die Britannen dort vertrieben
und im Land als Herren blieben;
durch sie verlor denn auch das Land,
das einst Britannie hieß, den Namen,
und es ward von den Walisern
sogleich in England umbenannt.
Als sie dieses Land besetzt
und aufgeteilt, ganz unter sich,
da wollten alle Königlein
und Herrn von eignen Gnaden sein;
sie wurden damit zu Verlierern,
sie fingen an, sich gegenseitig
zu ermorden, totzuschlagen,
bis sie sich mit ihrem Land
dem Schutz von Marke unterstellten.
Es diente ihm seit dieser Zeit
in jedem Punkt so sehr, mit Furcht,
wie nie ein Königreich zuvor
dem König Dienst geleistet hatte.
Des weitren meldet die historia,
daß in all den Nachbarländern,
wo man seinen Namen kannte,
kein König Markes Rang erreichte.
Dorthin zog es Riwalon,
dort gedachte er zu bleiben,
ein Jahr bei ihm zu leben,
bei ihm Vollendung anzustreben,
das Ritterhandwerk zu verbessern,
die Umgangsformen zu verfeinern.
Sein nobles Herz gab ihm den Rat:
Studiert er fremder Länder Sitten,
verbessert er damit die eignen,
wird dadurch selber renommiert.
Mit dieser Absicht brach er auf.
Er übergab sein Land, die Leute
zu treuen Händen seinem Marschall,
einem Herrn in seinem Lande,
von dem er wußte, daß er treu war;
er hieß »Rual le très loyal«.
So reiste Riwalon bald drauf
mit zwölf Begleitern übers Meer –
ihm reichte dies Gefolge aus,
er brauchte keinen weitren Mann.
So kam er im Verlauf der Zeit
vor der Küste Cornwalls an
und hörte dort – noch auf der See –,
daß der hochberühmte Marke
auf Tintágel residiere;
so nahm er Kurs auf diese Burg.
Er landete, traf ihn dort an
und war darüber herzlich froh.
Sich und seine Männer ließ er
prächtig kleiden, ranggemäß.
Als er dort vor den König trat,
empfing der edle Marke ihn
mit ausgesuchter Höflichkeit
und sein Gefolge ebenfalls.
Man bereitete Riwalon
einen Empfang, so ehrenvoll –
man hatte ihm noch nie zuvor
(zu keiner Zeit, an keinem Ort)
so viel Respekt erwiesen!
Dies beflügelte sein Denken,
er schätzte diese Etikette.
Immer wieder dachte er:
»Gott selber, wahrlich, hat mich
zu diesen Landesherrn geführt!
Fortuna meint es gut mit mir!
Was ich von Markes Trefflichkeit
je rühmen hörte, das trifft zu.
Sein Lebensstil ist gut und höfisch.«
Er sagte Marke, was er plante,
weshalb er hergekommen sei.
Als nun Marke den Bericht
und seine Pläne angehört,
rief er: »Willkommen, Gott und mir!
Was ich bin und was ich habe –
es soll Euch zur Verfügung stehn!«
Canel-Angres gefiel der Hof,
der Hof war für ihn eingenommen.
Es hatte ihn dort jedermann
gerne, und man schätzte ihn –
kein Gast war jemals so beliebt!
Es gab auch allen Grund dazu:
der wahrhaft edle Riwalon
verstand sich wirklich gut darauf,
mit der Person, mit seinen Gaben,
mit seiner ganzen Höflichkeit,
zu gefallen und zu dienen.
So lebte er denn hochgeschätzt
und in der wahren Güte,
die er täglich dem Gemüte
eingab durch Vortrefflichkeit.
Und so kam Markes Fest heran …
Marke hatte dieses Fest,
indem er einlud (beinah vorlud!),
höchst verbindlich festgesetzt:
sobald er ihnen Boten schickte,
kamen augenblicks die Ritter
aus dem Königreich von England
zu diesem einen Jahrestreffen
nach Cornwall angeritten.
Die Herren reisten an
in Begleitung hübscher Damen
und so mancher andren Schönheit.
Nun ward die Festlichkeit geplant,
angekündigt, anberaumt
für den Monat in der Blüte,
und zwar: sobald der süße Mai
beginnt, bis hin zu seinem Ende,
und dies so nah bei Burg Tintagel,
daß man sich gegenseitig sah
auf derart schöner Aue,
wie sie zuvor und wie sie später
kein Augenlicht je überstrahlte.
Die sanfte, süße Sommerszeit,
sie hatte süße Geschäftigkeit
für sie entwickelt, süß im Eifer.
Die kleinen Vögelchen des Waldes,
die jedes Ohr erfreuen müssen,
Blumen, Gräser, Blätter, Blüten,
und was sonst dem Auge schmeichelt,
was nobles Herz begeistern muß –
es füllte diese Sommeraue.
Was immer man vom Mai erwartet,
man fand dort, was man suchte:
den Schatten und das Sonnenlicht,
die Linden an der Quelle,
die milden, linden Lüftchen,
die der Hofgesellschaft Markes
im Wesen ganz entgegenkamen.
Die lichten Blumen lachten
hervor aus dem betauten Gras.
Der Freund des Mai, der grüne Rasen,
hatte sich ein Sommerkleid
aus Blüten angelegt, so schönen,
daß sie den beglückten Gästen
die Augen glänzen ließen.
Die süße Baumesblüte schaute jeden
mit derart süßem Lächeln an,
daß das Herz und das Gemüt
mit Augen, die erstrahlten,
das Blütenlächeln spiegelten
und mit Lächeln Antwort gaben.
Der zarte Sang der Vögel,
der süße, der schöne,
der für Ohren und Gemüt
stets die reinste Wohltat ist,
erscholl dort auf dem Berg, im Tal.
Die Nachtigall, die herrliche,
dies liebe, süße Vögelchen
(es bleibe auch in Zukunft süß!),
es sang dort aus der Blüte
mit einem solchen Überschwang,
daß so manches noble Herz
fröhlich wurde, hochgestimmt.
Es hatte diese Hofgesellschaft
in einem wahren Freudentaumel
Hütten gebaut auf grünem Gras –
ein jeder so, wie er das wollte.
Und jeder lag so, wie das seinem
Wunsch nach Lustbarkeit entsprach:
die Herren lagerten herrschaftlich;
wer höfisch war, im Stil des Hofes;
diese lagen unter Seidenplanen,
jene – woanders – unter Blüten;
die Linde war ein Dach für viele,
und viele sah man gut behüttet
unter Ästen, frischem Laub.
Hofstaat oder Herrengäste
hatten anderswo noch nie
so herrlich Unterkunft gefunden.
Auch fand man dort in Überfülle
(wie das auf Festen üblich ist)
Speisen, noble Kleidungsstücke,
die ein jeder, nach Belieben,
dorthin mitgenommen hatte.
Marke versorgte sie zudem
mit so verschwenderischem Aufwand,
daß sie herrlich und in Freuden
lebten und sehr glücklich waren.
Und so begann das große Fest!
Worauf ein Mann, der gern was sah,
Lust bekam, es anzuschaun,
das bot sich ihm hier reichlich an –
man sah hier, was man sehen wollte:
die zogen los zum Damengucken,
andre wollten Tänze sehn;
die sahen Reiterspielen zu,
andre wieder Lanzenkämpfen.
Welche Wünsche man auch hegte –
man fand hier alles reichlich vor.
Kurz: sie alle, die dort waren,
in ihren allerbesten Jahren,
verschafften sich im Wettbewerb
Lustbarkeiten auf dem Fest.
Und Marke, dieser edle Mann,
der höfisch feine, hochgestimmte,
er hatte viele schöne Damen
einbezogen in den Kreis,
er hatte außerdem, apart,
ein Wunder ganz besondrer Art:
seine Schwester Blanchefleur –
ein Mädchen von so großer Schönheit,
wie man sie nie gesehen hatte.
Von ihrer Schönheit hören wir,
daß sie kein Mann aus Fleisch und Blut
mit seinen Herzensaugen sah,
der Frauen und Vollkommenheit
künftig nicht noch stärker liebte.
Diese wahre Augenweide
machte auf dem offnen Land
viele Männer keck und kühn,
stimmte noble Herzen hoch.
Es gab in dieser Aue
noch viele schöne Damen,
deren jede in der Schönheit
königlichen Rang besaß;
alle Männer, die dort waren,
beschenkten sie mit Glück und Freude;
sie stimmten viele Herzen froh.
Indes begannen Reiterspiele
des Hofstaats und von Herrengästen;
die Vornehmsten und Besten
ritten her, von hier, von da.
Auch war der edle Marke dort
und sein Gefährte Riwalon –
abgesehn von weitrem Hofstaat:
sie alle strengten sich sehr an,
sich dort so hervorzutun,
daß sie von sich reden machten
und großes Lob erhielten.
Man sah an diesem Sammelpunkt
viele Rösser, gut bedeckt
mit Prunk- und Zindelseide:
Schabracken weiß wie Schnee,
gelb, grün, rot, blau, violett –
andre sah man anderswo
aus feiner Seide schön gewirkt;
und andre waren kombiniert
in je zwei Farben, in Kontrasten,
unterschiedlich embelliert.
Die Herren Ritter trugen Roben
von wirklich staunenswerter Pracht,
hier aufgeschlitzt, dort unterlegt.
Und der Sommer führte vor,
daß er auf seiten Markes war:
aus Blumen sah man in der Schar
so manchen hübschen lütten Kopfschmuck,
als Tribut, an ihn entrichtet …
In dieser schönen Sommerfülle
begannen schöne Ritterspiele:
Scharen keilten sich in Scharen,
drängten sich nach hier, nach dort;
das setzte sich so lange fort,
bis sich der Gruppenkampf zuletzt
dorthin verschob, wo Blanchefleur,
die edle, dieses Weltenwunder,
mit vielen andren schönen Damen
saß, um sich das anzuschaun.
Die Reiter waren derart prächtig,
waren derart majestätisch,
daß viele Augen dies gern sahn.
Was immer man dabei vollbrachte –
es war der Hofmann Riwalon
(es konnte gar nicht anders sein!),
der diesen Tag auf diesem Kampfplatz
sie alle glanzvoll übertraf!
Er fiel damit den Damen auf;
sie erklärten, in der Schar
zeige keiner solchen Stil
als Ritter, solch Geschick beim Reiten –
alles priesen sie an ihm.
»Schaut!« so riefen sie, »der Jüngling
ist eine herrliche Erscheinung!
Alles, was er dort vollbringt –
wie herrlich paßt es zu dem Mann!
Sein Körper ist ein wahrer Traum!
Seine Beine: majestätisch,
in der Bewegung so harmonisch!
Und sein Schild bleibt unverrückt
an seinem Platz – wie angeleimt!
Wie liegt der Schaft in seiner Hand!
Wie gut sieht seine Rüstung aus!
Wie schön sein Kopf und die Frisur!
Wie elegant ist sein Verhalten!
Wie herrlich sieht sein Körper aus!
Wie herrlich lebt doch eine Frau,
die ein solcher Mann beglückt!«
Was sie alle riefen, hörte
die edle Blanchefleur;
auch sie verlieh nun diesem Mann
(was immer auch die andren taten)
in ihrem Herzen hohen Rang.
Sie hatte ihn ins Herz geschlossen,
er ging ihr nicht mehr aus dem Sinn.
In ihres Herzens Königreich
trug er mit voller Herrschermacht
das Zepter und die Krone.
Freilich hielt sie das geheim –
so dezent und so diskret,
daß niemand es bemerkte.
Als Schluß war mit dem Reiterspiel,
die Ritter auseinanderrückten,
und jeder wandte sich dorthin,
wohin ihn seine Stimmung führte,
da geschah es, par hasard,
daß Riwalon sich dahin wandte,
wo Blanchefleur, die Schöne, saß;
sogleich galoppierte er näher hin;
als er sie sah, von Angesicht,
sprach er mit großer Freundlichkeit:
»Ah, Dieu vous garde, ma belle!«
»Merci«, disait la fille
und weiter, recht befangen:
»Gott in Seiner reichen Macht,
Der allen Herzen Reichtum gibt,
beschenk Euch reich, in Herz und Geist.
Und: großes Kompliment für Euch!
Jedoch, dies schmälert nicht mein Recht,
mit dem ich Euch zur Rede stelle.«
»Ach, Schöne, was hab ich getan?!«
fragte Riwalon, der Höfling.
»Ihr habt mir über einen Freund
(den besten, den ich je gefunden)«,
sprach sie, »reichlich zugesetzt.«
»Du lieber Gott«, so dachte er,
»was heißt das nun? Auf welche Weise
hab ich mir ihre Gunst verscherzt?
Was wirft sie mir denn vor?«
Und er dachte sich, er hätte
irgendeinem der Verwandten
im Rittertreiben eins verpaßt
(wenn auch ohne jede Absicht),
und deshalb wär ihr Herz betrübt,
wär sie schlecht auf ihn zu sprechen.
Nein, der Freund, den sie erwähnte,
der war ihr Herz, das wegen ihm
diesen Kummer leiden mußte –
das war der Freund, von dem sie sprach!
Nur wußte er davon noch nichts.
Wie es seinem Stil entsprach,
sagte er zu ihr sehr freundlich:
»Schöne Frau, ich möchte nicht,
daß Ihr mir zürnt, mir Böses wünscht.
Doch trifft es zu, was Ihr mir sagt,
sprecht selbst das Urteil über mich.
Ich mach es gut, wie Ihrs befehlt.«
Die Schöne: »Wegen dieses Vorfalls
kann ich Euch nicht furchtbar hassen,
kann Euch deshalb auch nicht lieben.
Doch finde ich bei Euch noch raus,
wie Ihr mir Buße leisten sollt
für das, was Ihr mir angetan.«
Verbeugung, und er wollte gehn,
doch seufzte ihn die Schöne an
(sehr dezent!) und sagte ihm
aus tiefstem Herzen: »Ach,
lieber Freund, Gott segne dich.«
Und jetzt erst fing es damit an,
daß beide aneinander dachten.
Canel-Angres entfernte sich
mit mancherlei Gedanken,
er dachte sich so mancherlei:
Was Blanchefleur bedrücken,
was dahinterstecken könnte.
Er dachte an den Gruß, die Worte,
durchdachte, Punkt für Punkt,
ihr Seufzen, Segnen, ihr Verhalten,
begann im weiteren Verlauf,
ihr Seufzen, ihren süßen Segen
in Richtung Liebe auszulegen;
er faßte ernsthaft den Gedanken,
der Grund fürs eine wie das andre
liege einzig in der Liebe.
Und dies entflammte seine Sinne:
sie versetzten sich zurück
und ergriffen Blanchefleur
und entführten sie sogleich
ins Herzensreich von Riwalon
und vollzogen dort die Krönung
zu seiner Königin.
Ja, Blanchefleur und Riwalon,
die schöne Königin, der König,
sie teilten sich die Königreiche
ihrer Herzen sehr gerecht –
das ihre fiel an Riwalon,
und seines fiel dafür an sie.
Doch wußte keiner von den beiden,
was im anderen geschah.
Einmütig und in einem Sinne
hatten sie einander
angenommen in Gedanken.
Recht geschah, was rechtens war:
sie wuchs auch ihm ans Herz
mit jenem gleichen Schmerz,
den sie nun seinetwegen erlitt.
Doch weil er über ihre Absicht
keine Klarheit finden konnte
(wie sie sich verhalten hatte,
ob aus Feindschaft, ob aus Liebe),
ließ das alle seine Sinne
durch Zweifel schwankend werden.
Und in Gedanken war er ihr
einmal fern und einmal nah:
er wollte weg, auf jeden Fall,
und wollte gleich drauf wieder hin,
bis er sich ganz und gar verfing
in den Schlingen seines Denkens,
und er kam nicht mehr von ihr los.
Riwalon, gedankenschwer,
machte durch sein Beispiel deutlich,
daß des Liebenden Gemüt
einem freien Vogel gleicht,
der im Vollbesitz der Freiheit
auf leimbestrichner Rute landet.
Bemerkt er dann den Vogelleim
und schwingt sich auf, ihm zu entfliehn,
so klebt er mit den Füßen fest;
nun will er flügelschlagend fort,
doch wenn er (sei es noch so flüchtig!)
mit Flügeln an die Rute kommt,
so bleibt er an ihr kleben, haften;
mit aller Kraft reißt er die Flügel
hier los, da los, wieder hier,
bis er sich schließlich ganz und gar
mit seinem Kämpfen selbst besiegt
und auf dem Leim der Rute liegt.
Genau auf diese Art verhält sich
das Gemüt, noch ungebunden:
sobald es in Sehnsucht zu denken beginnt
und Liebe an ihm das Wunder vollbringt
mit aller Qual der Leidenschaft,
so will der heftig Liebende
zurück zur Ungebundenheit,
jedoch er geht der süßen Lockung
der Liebe wieder auf den Leim;
darin verfängt er sich so sehr,
daß er sich weder so noch so
aufrecht halten kann.
So erging es Riwalon;
er verfing sich ebenfalls
mit dem Denken in der Liebe
zu seiner Herzenskönigin.
Dies Verfangen brachte ihn
in kuriose duperie,
wußte er doch nicht, ob sie
ihm feindlich, ihm gewogen war;
er fand nicht dies, nicht das heraus:
ob sie ihn liebte oder haßte.
Ob er nun hoffend, zweifelnd dachte:
kam ihr nicht nah, nicht von ihr los.
Hoffnung, Zweifel ließen ihn
ständig zwischen beidem schwanken.
Ihm sagte Hoffnung Liebe zu
und Zweifel Haß. Im Widerstreit
konnte er mit festem Glauben
auf keine dieser beiden bauen:
nicht auf Feindschaft, nicht auf Liebe.
Es war ein Driften von Gefühlen
in einem gar nicht sichren Hafen:
Hoffnung trieb rein und Zweifel raus!
In beiden fand er keinen Halt,
sie stimmten niemals überein.
Kam Zweifel auf und sagte ihm,
ihn hasse seine Blanchefleur,
so ward er mutlos, wollte fort;
doch gleich kam Hoffnung, brachte ihm
ihre Liebe, süßen Wahn –
schon mußte er erneut verharren.
Bei diesem Kampf: wohin mit sich?
Er wußte weder ein noch aus.
Je stärker er sich von ihr losriß,
desto mehr zwang Liebe zurück;
je entschiedner er dort floh,
desto mehr zog Liebe zurück.
So sprang die Liebe mit ihm um,
bis Hoffnung doch den Sieg errang
und er den Zweifel ganz vertrieb
und Riwalon Gewißheit fand,
daß seine Blanchefleur ihn liebe.
Sein Herz und sein Verstand, sie waren
gemeinsam fest auf sie gerichtet,
dagegen ließ sich nicht mehr kämpfen.
Auch wenn die süße Liebe nun
sein Herz und seinen Kopf
ganz ihrem Willen unterwarf –
ihm war noch der Gedanke fremd,
es könne eine Herzensliebe
zu einer Last von Leiden werden.
Als er sein événement
mit seiner Blanchefleur
von Anfang an durchdachte,
sich alles recht vor Augen führte:
ihr Haar, die Stirn, die Schläfen,
die Wangen, Lippen und ihr Kinn,
den österlichen Tag der Freude,
den, lachend, ihre Augen zeigten,
da kam die LIEBE höchstpersönlich,
die wahre Feuerlegerin,
und fachte an ihr Liebesfeuer,
das Feuer, das sein Herz entflammte,
das ihm, in diesem Augenblick,
offenkundig werden ließ,
was eine Last aus Leiden sei,
was die Qual der Leidenschaft.
Er begann ein neues Leben,
ein zweites Leben ward ihm gegeben,
und er veränderte damit
sein Denken, sein Verhalten,
ward ein völlig andrer Mann,
denn alles, was er nun begann,
war mit befremdlichem Verhalten,
war mit Blindheit untermischt.
Seine angebornen Sinne,
sie wurden durch die Liebe
so unbeständig, ungezügelt,
wie er sich das selbst gewünscht!
Sein Leben trübte sich nun ein:
aus vollem Herzen lachen
(was früher bei ihm üblich war),
dem entsagte er nun ganz!
Die Höhepunkte seines Lebens
wurden Schweigen und Betrübnis;
seine ganze Fröhlichkeit
verging im Schmerz der Leidenschaft.
Sein Fall von Leidenschaft verschonte
nicht Blanchefleur mit Leidenschaft!
Sie litt durch ihn die gleiche Qual,
wie er sie durch sie erlitt;
die LIEBE, die Tyrannin,
war ebenfalls in ihre Sinne
etwas stürmisch eingedrungen
und hatte ihr den größten Teil
der Ausgewogenheit geraubt!
Sie war in ihrem ganzen Verhalten
nicht mehr in gewohntem Einklang
mit sich selbst und mit der Welt.
Freude, die sie sich gegönnt,
Kurzweil, die zu ihr gepaßt:
dies alles widerstrebte ihr.
Ihr Leben fand nur noch die Form,
die ihrem Leiden ganz entsprach,
das ihrem Herzen nahelag.
Bei allem, was sie nun erlitt –
in ihrer Qual der Leidenschaft –,
sie wußte nicht, was sie verstörte,
sie hatte nie zuvor erlebt,
was solche Last von Leiden sei
und solcher Herzenskummer.
Häufig sprach sie mit sich selbst:
»Ach, Gott der Herr, wie lebe ich?!
Was ist denn bloß mit mir geschehn?
Ich hab so manchen Mann gesehn,
von dem mir nie ein Leid geschah,
doch seit ich diesen Mann erblickt,
fühlte sich mein Herz nicht mehr
so frei, so froh wie ehedem.
Der Blick, den ich auf ihn gerichtet –
dieser Vorfall brachte mir
das Leiden ein, das mich bedrückt.
Mein Herz, das solche Qual nie litt,
es wurde nun damit gebrochen;
im Gemüt, in meinem Leben
wurde alles völlig anders.
Soll mit einer jeden Frau,
die ihn hört und die ihn sieht,
geschehen, was mit mir geschah,
und ist dies bei ihm vorbestimmt:
ist seine Schönheit nur vergeudet
und bringt sein Leben nichts als Schaden!
Doch liegt es dran, daß dieser Mann
einen Zaubertrick beherrscht,
der dies kuriose Wunder wirkte,
diese wunderliche Not,
so wär er weitaus besser tot,
ihn dürfte keine Frau erblicken.
Bei Gott, was habe ich durch ihn
an Leid erfahren und an Last!
Dabei warf ich wirklich nie
auf ihn, auf einen andren Mann
einen bös gemeinten Blick,
auch war ich keinem jemals feind –
was habe ich denn bloß getan,
daß mir durch jemand Leid geschieht,
dem ich nur schöne Augen mache?
Doch warum werf ich ihm das vor?
Den Guten trifft wohl keine Schuld.
Das Herzeleid, das ich durch ihn
erdulde und um seinetwillen,
das kommt zum allergrößten Teil,
bei Gott, aus meinem eignen Herzen.
Sah viele Männer und nun: ihn …
Kann er dafür, daß mein Gefühl
nur für ihn allein empfindet
unter all den anderen?
Als ich so viele noble Frauen
diesen Mann, so majestätisch,
und seinen Ruhm als Ritter
loben hörte (wie ein Spielball
rumgetragen, rundgejagt),
und sie zollten ihm viel Lob,
und ich sah mit eignen Augen
die Trefflichkeiten, die man pries,
und mein Herz nahm in sich auf,
was alles rühmlich an ihm war –
das verdrehte mir den Kopf,
und ich verlor mein Herz an ihn.
Ja, so wurde ich verblendet!
Das war der Zaubertrick, durch den
ich mich dann selber so vergaß!
Er hat mir nichts zuleid getan,
der liebe Mann, durch den ich leide,
den ich zum Angeklagten mache.
Mein wirres, zügelloses Herz,
das ist es, das mich leiden läßt,
das ist es, das mir schaden will.
Es will und will ja allzuviel,
was es gar nicht wollen dürfte,
wenn es nur bedenken würde,
was Schicklichkeit, was Ehre ist;
jetzt aber nimmt es nichts mehr wahr
als seinen Eigensinn, den Wunsch
nach diesem wundervollen Mann,
dem es in so kurzer Frist
rettungslos verfallen ist.
Und – Gott mit mir! – ich meine doch,
wenn ichs in Ehren denken darf
und ich mich hier nicht schämen muß,
weil ich noch eine Jungfrau bin –
mir scheint es, dieses Herzeleid,
das wegen ihm mein Herz erträgt,
das hat nur einen Grund: die Liebe!
Das wird mir dadurch auch bewußt,
daß ich so gerne bei ihm wär.
Was immer dies bedeuten mag:
etwas reift in mir heran,
das Liebe will und diesen Mann.
Was ich in meinem Leben über
Frauen hörte, die sehr liebten,
und damit über Liebe selbst,
das ist mir in das Herz gedrungen:
das süße Herzeleid,
das viele noble Herzen
mit süßen Schmerzen quält,
das regt sich auch in meinem Herzen.«
Als nun die höfisch Edle
in der Tiefe des Gemütes,
im Herzen zur Erkenntnis kam
(wie üblich unter Liebenden),
daß Riwalon, ihr Freund, bestimmt sei
zur Beglückung ihres Herzens,
zu Erfüllung, höchstem Leben,
da machte sie ihm Augen, Augen,
besah ihn, wo sie ihn nur sah!
Erlaubte das die Etikette,
so grüßte sie ihn insgeheim
mit ihren Augen voller Liebe.
Ihre sehnsuchtsvollen Blicke
richteten sich oft auf ihn,
lange und voll Zärtlichkeit.
Als der Mann, der sich verliebte,
ihr Liebster, dies so langsam merkte,
erst da begann in ihm die Liebe
zu wachsen, machte er sich Hoffnung,
erst da entbrannte Leidenschaft,
und er erwiderte die Blicke
der Schönen inniger und kühner,
als er das je zuvor gewagt.
Fand er dazu Gelegenheit,
so grüßte er sie mit den Augen.
Als die Schöne ihm nun ansah,
daß er sie liebte wie sie ihn,
war sie die größte Sorge los:
sie hatte vorher Furcht, daß er
kein Verlangen nach ihr hätte.
Sie war nun sicher: sein Gemüt
war ihr gewogen, zugeneigt:
so muß es in der Liebe sein.
Er wußte klar: so wars bei ihr!
Dies entflammte ihre Sinne.
Und fortan begannen sie,
sich zu lieben, zu begehren
mit Gefühlen aus dem Herzen.
Es traf der Satz bei ihnen zu:
Liebesblick in Liebesauge
gibt dem Feuer einer Liebe
Nahrung, die beständig wächst.
Als Markes Fest zu Ende war
(die Herren hatten sich getrennt),
erreichte Marke eine Nachricht:
Einer seiner Feinde sei,
ein König, in sein Land geritten
mit derart großer Heeresmacht,
daß er, so weit die Hufe reichten,
alles niedermachen werde,
schlage man nicht gleich zurück.
Auf der Stelle rief nun Marke
durch Boten Heeresmacht zusammen,
zog ihm mit großem Heer entgegen,
bekämpfte und besiegte ihn.
Marke nahm so viele gefangen,
erschlug so viele, daß von Glück sprach,
wer da entkam, dort überlebte.
Jedoch der edle Riwalon
war durch einen Lanzenstich
in die Seite so verwundet,
daß seine Leute ihn sofort
so gut wie tot von dort
nach Hause transportierten,
nach Tintagel, heftig klagend.
Man bettete den Schwerverletzten.
Es sprach sich gleich herum,
Riwalon sei in der Schlacht
auf den Tod getroffen worden.
Das gab ein Jammern und ein Klagen
am Hof und an den Herrensitzen!
Wer seine Qualitäten kannte,
dem tat sein Unglück herzlich leid.
Man klagte, seine Tüchtigkeit,
sein schöner Leib, die süße Jugend,
die hochgerühmte Trefflichkeit
als Fürst vergingen allzu rasch
bei einem derart frühen Ende.
Sein Freund, der König Marke,
beklagte ihn so heftig,
wie er noch keinen andren Mann
so herzzerreißend je beklagt!
Ihn beweinten noble Frauen,
viele Damen klagten um ihn.
Wer ihn zuvor gesehen hatte,
dem tat sein schlimmer Zustand leid.
Wie groß auch immer all ihr Leid
über die Verwundung war,
es war doch einzig und alleine
seine Blanchefleur, die reine,
die höfische, die gute,
so edel im Gemüt,
die mit den Augen, mit dem Herzen
die Schmerzen ihres Herzgeliebten
beklagte, auch beweinte.
Und mehr: wenn sie alleine war
und ungehindert klagen konnte,
da griff sie sich mit Fäusten an,
die schlug sie tausendfach dorthin
und nur dorthin, wo ihr was steckte,
dorthin also, wo das Herz war,
dorthin schlug die Schöne oft!
So quälte diese schöne Frau
den jungen, schönen, süßen Leib
in einem solchen Leidenskampf,
daß sie einen jeden Tod
(nur nicht einen Liebestod …)
dem Leben vorgezogen hätte.
Und sie wäre auch verschieden,
wär an diesem Leid gestorben,
hätt sie Hoffnung nicht belebt,
Zuversicht nicht hochgehalten,
daß sie ihn sicher sehen werde,
wie immer sich das machen ließe.
Sobald sie ihn gesehen hätte,
nähm sie alles gern in Kauf –
was immer dann mit ihr geschähe.
Auf diese Weise blieb sie leben,
bis sie erneut bei Sinnen war
und sie sich Gedanken machte,
wie sie ihn mal sehen könnte,
auf daß ihr Leid gelindert würde.
Und es kam ihr in den Sinn:
Da ist doch die Erzieherin,
die sie stets, die sie beständig
umsorgt, sie unterrichtet und
in ihrer Obhut stets bewahrt hat.
Die nahm sie beiseite, ging mit ihr
dorthin, wo sie alleine waren,
und sie begann vor ihr zu klagen,
wie alle klagten, heut noch klagen,
denen es geht, wie ihr es ging:
die Augen gingen ihr über,
die heißen Tränen rannen
in dichten Strömen
über ihre hellen Wangen,
und sie faltete die Hände,
hielt sie flehend vorgestreckt.
»Ach, ich Ärmste!« rief sie und:
»Ach, ich Allerärmste, ach!
Ach, herzgeliebte Erzieherin,
beweis mir deine Treue,
die du in reichem Maß besitzt!
Und weil du so viel Güte zeigst,
daß mein Geschick, daß all mein Glück
allein auf deinen Ratschlag bauen,
so klag ich dir, bei deiner Güte,
was mir das Herz so sehr bedrückt.
Hilfst du nicht, so sterbe ich.«
»Nun, Herrin, was bedrückt Euch denn?
Weshalb das Jammern und das Klagen?«
»Meine Liebe, darf ichs sagen?«
»Ja, liebe Herrin, sagt es schon!«
»Mich tötet dieser tote Mann,
Riwalon, der aus Parmenien!
Den säh ich gern, wenns möglich wär –
wenn ich nur wüßte, wie das geht –,
bevor er ganz gestorben ist.
Er wird nicht überleben, leider.
Wenn du mich hierin unterstützt,
erfülle ich dir jeden Wunsch,
solange ich am Leben bleibe.«
Es dachte die Erzieherin:
»Falls ich hier vermitteln würde –
welchen Schaden brächte das?
Dieser Mann, der halb schon tot ist,
er stirbt morgen oder heute –
doch dann hab ich meiner Herrin
das Leben und den Ruf erhalten,
und dann wird sie mich in Zukunft
mehr als andre Frauen schätzen …«
»Liebe Herrin«, sprach sie, »Beste,
Euer Elend tut mir herzlich leid.
Wie immer ich die schlimme Lage
ändern kann, nach besten Kräften,
hier könnt Ihr völlig auf mich zählen.
Ich werde selbst hinuntergehn
und nach ihm sehn – bin gleich zurück!
Ich schau, was sich da machen läßt –
wie er dort liegt, an welchem Platz,
und merke mir, wer bei ihm ist.«
Sie ging dorthin und täuschte vor,
sie zeige Mitleid mit der Not,
und teilte ihm ganz heimlich mit,
die Herrin würd ihn gerne sehn,
und er möge das bewirken,
soweit das schicklich, ehrbar sei.
Sie begab sich auf den Heimweg,
vermeldete die Neuigkeit.
Sie half dem Mädchen, legte ihm
das Kleid an einer Bettlerin;
die Schönheit ihres Angesichts
verbargen Kinn- und Wangenbinde.
Sie nahm die Herrin bei der Hand
und führte sie zu Riwalon.
Der hatte seine Leute schon
samt und sonders weggeschickt
und war nun ganz allein im Raum –
allen hatte er erklärt,
ihm tue das Alleinsein gut …
Die Erzieherin gab vor,
sie bringe eine Ärztin mit,
und erreichte so den Zutritt.
Sie stieß den Riegel vor die Tür:
»Herrin, nun, da seht Ihr ihn!«
Und sie, die Schöne, ging zu ihm,
und als sie sein Gesicht erblickte –
»ach«, so rief sie, »ewig ach!
Oh, wär ich nie geboren worden –
der meine Hoffnung war, er stirbt!«
Riwalon begrüßte sie
mit dem äußerst schwachen Nicken
eines tödlich wunden Mannes.
Doch sie bemerkte das erst nicht,
sie achtete nicht weiter drauf,
sie setzte sich ganz einfach hin
wie blind, und schmiegte ihre Wange
an die Wange Riwalons,
so lange, bis bei ihr
aus Freude wie aus Leid
die Kräfte ihren Leib verließen:
die rosenroten Lippen wurden bleich,
ihr Äußeres verlor nun ganz
die lichte Farbe ihrer Haut,
die eben noch ihr Leib gezeigt,
das Licht in ihren klaren Augen
wurde trüb, dann nächtlich finster;
sie lag in ihrer Ohnmacht
lange Zeit besinnungslos,
an seiner Wange ihre Wange:
es sah so aus, als wär sie tot.
Als sie nach dem Zusammenbruch
erneut zu Kräften kam, ein wenig,
nahm sie den Liebsten in die Arme,
preßte ihren Mund auf seinen,
küßte ihn in rascher Folge
tausend-, abertausendfach,
bis ihr Mund in ihm die Sinne
weckte und die Kraft zu lieben –
ja, ihr Mund war voller Liebe,
ihr Mund bereitete ihm Freuden,
ihr Mund erweckte seine Kräfte,
daß er die königliche Frau
liebevoll ganz fest heranzog
an seinen Körper, der halb tot war.
Es dauerte nun nicht mehr lang,
bis beider Wünsche sich erfüllten,
und die wunderschöne Frau
ein Kind von ihm empfing.
Jedoch: er fand durch diese Frau
und durch das Lieben fast den Tod.
Doch half ihm Gott aus dieser Not,
er hätt das sonst nicht überstanden.
Und er genas – wie vorbestimmt.
So überlebte Riwalon,
doch Blanchefleur, die Schöne, war
durch ihn entlastet und belastet
mit Herzeleid in Doppelform:
ließ großes Leid beim Mann zurück
und nahm mit sich noch größres Leid;
ließ dort die Sehnsuchts-Herzensnot
und nahm mit sich von dort den Tod;
die Not beendet mit dem Lieben,
den Tod empfing sie mit dem Kind.
Wie immer sie auch überlebte,
auf welche Weise sie durch ihn
entlastet und belastet wurde
mit dem Verlust, mit dem Gewinn,
sie hatte doch nur dies im Sinn:
liebe Liebe, lieben Mann.
Sie wußte nichts vom Kind im Leib
(es war ihr tödliches Geschick),
jedoch, was Mann und Liebe sind.
Sie tat, was sehr zum Leben paßt,
was sie als Liebende erweist:
ihr Herz, die Sinne, ihr Begehren
wollten einzig Riwalon.
Genauso wollte sein Begehren
nur sie und ihre Liebe.
Beide spürten in den Sinnen
eine Liebe, ein Begehren.
So war er sie, und sie war er,
er war ihr und sie war sein.
Hie Blanchefleur, hie Riwalon!
Hie Riwalon, hie Blanchefleur!
Hie beide, hie l’amour loyale!
Ihr Leben wurde sehr intim,
sie wurden glücklich miteinander;
mit sehr intimen Zärtlichkeiten
stimmten sie ihr Fühlen hoch.
Und wenn sie sich ein Stelldichein
mit Anstand arrangieren konnten,
so war ihr Sinnenglück vollendet,
sie fühlten sich so glücklich, wohl,
sie hätten keinesfalls ihr Leben
für ein zweites Himmelreich gegeben.
Jedoch, es blieb nicht lange so,
denn in ihrer ersten Zeit,
als sie am allerschönsten lebten
und in eitel Freude schwebten,
erreichten Boten Riwalon:
Feind Morgan hatte starke
Truppen in sein Land geschickt!
Sofort, auf diese Nachricht hin,
ward Riwalon ein Schiff gestellt,
und man verstaute, was er brauchte;
für diese Seefahrt wurden rasch
Proviant und Rösser rangeschafft.
Die liebesschöne Blanchefleur,
als sie die schlimme Nachricht
über den Geliebten hörte,
da fing ihr Leid erst richtig an.
Aus Herzeleid geschah es wieder:
ihr vergingen Hören, Sehen,
und die Haut an ihrem Leib,
sie glich der einer toten Frau;
aus ihrem Munde kam bloß noch
dieses kleine Wörtchen »ach«,
sie rief nur dies, kein andres mehr.
»Ach«, so rief sie dauernd, »ach!
Ach, die Liebe, ach, der Mann –
wie seid ihr mit so vielen Leiden
hergefallen über mich!
Liebe, Unheil dieser Welt:
wo das Glück bei dir so kurz ist,
wo du derart treulos bist,
was schätzt nur alle Welt an dir?!
Ich seh genau, du lohnst es ihr
wie ein rechter Erzbetrüger,
dein Ende, das ist nicht so gut,
wie du es dieser Welt verheißt,
wenn du mit erstem kurzem Glück
hineinlockst in das lange Leid.
Dein verführerisches Täuschen,
das in falscher Süße gaukelt,
es täuscht doch alles, was da lebt.
Das hat sich ja an mir gezeigt!
Was all mein Glück bedeuten sollte,
davon hab ich weiter nichts
als Herzensqual, die tödlich ist.
Erfüllung flieht und läßt mich sitzen!«
Während ihrer Klagerufe
kam ihr Geliebter, Riwalon,
mit weinendem Herzen herein zu ihr
und wollte von ihr Abschied nehmen.
»Herrin«, sprach er, »Euer Diener!
Ich muß zurück nun in mein Land.
Euch, Schöne, möge Gott beschützen,
bleibt stets gesund und munter!«
Und wieder schwanden ihr die Sinne,
erneut fiel sie aus Herzeleid
vor ihm in Ohnmacht, fiel wie tot
der Erzieherin in den Schoß.
Ihr lieber Gefährte der Leidenschaft,
als er das ganze Maß des Unglücks
bei seiner Herzgeliebten sah,
ließ er sie keineswegs im Stich,
er machte sich ihr Sehnsuchtsleid
aus lauter Liebe ganz zu eigen:
seine Farbe, seine Kraft
begannen nun bei ihm zu schwinden.
Wie das schwerem Leid entspricht,
nahm er Platz, in tiefem Schmerz,
und konnte kaum erwarten, bis
sie wieder so zu Kräften kam,
daß er sie in die Arme nahm
und die Frau in ihrem Unglück
an sich zog voll Zärtlichkeit,
und er küßte wiederholt
ihre Wangen, Augen, Lippen,
liebkoste sie mal so, mal so,
bis sie schließlich wieder
zu sich kam, dies mehr und mehr,
und – ohne Hilfe – aufrecht saß.
Als Blanchefleur bei Sinnen war
und den Geliebten wieder spürte,
da schaute sie ihn traurig an.
»Ach«, so sprach sie, »bester Mann,
was habe ich durch Euch erlitten!
Weshalb nur schaute ich Euch an,
und es ergab sich so viel Schmerz
des Herzens, den ich nur durch Euch,
nur wegen Euch im Herzen trage?
Falls ich das so sagen darf,
mit Verlaub, Ihr hättet Grund,
mich besser, lieber zu behandeln …
Herr, Geliebter, Euch verdank ich
viele Leiden – drei vor allem,
die unausweichlich, tödlich sind.
Das erste ist: Ich krieg ein Kind
und fürchte, daß ich die Geburt
allein mit Gottes Hilfe überstehe.
Das zweite ist belastender:
Mein Bruder und mein Herr,
wenn der bei mir das ganze Unglück,
damit für sich die Schande sieht,
so läßt er mich zugrunde gehn,
mich auf gemeine Weise sterben.
Das dritte ist die ärgste Not,
um vieles schlimmer als der Tod:
Ich weiß, selbst wenn es glimpflich
ausgeht, und mein Bruder
bringt mich nicht um, läßt mich noch leben,
so wird er mich gewiß enterben
und mir Besitz und Ehre rauben –
dann leb ich künftig ohne Würde,
mit einem Namen ohne Klang.
Außerdem muß ich mein Kindchen,
obwohl sein Vater dann noch lebt,
aufziehn ohne dessen Beistand.
Ich würde dies nicht mal beklagen,
beträf die Schande mich allein,
indem mich meine hohe Familie
und mein königlicher Bruder
mitsamt dem schweren Makel
in Ehren los und ledig würden.
Doch wenn dann alle Zeitgenossen
verbreiten, daß mein Kind
nicht ehelich geboren sei,
so ist das für die beiden Reiche
Cornwall und England
ein öffentliches Ärgernis.
Und wenn es soweit käme, ach,
daß man mich verfolgt mit Blicken,
weil wegen mir zwei Länder
Ruf und Rang verloren haben,
so wär ich besser tot – allein!
Seht Ihr, Herr, dies ist die Not,
dies ist der stete Schmerz,
an dem ich alle meine Tage
lebendgen Leibes sterben muß.
Wenn Eure Hilfe es nicht schafft,
wenn Gottes Fügung das nicht will,
so werd ich nie mehr wieder froh.«
»Liebste Herrin«, sagte er,
»bin ich schuld an Eurer Not,
hab ich die Pflicht, dies wettzumachen.
Auch muß ich dafür Sorge tragen,
von heute an, daß Euch nicht weiter
Leid und Schande wegen mir entstehn.
Was später auch geschehen mag –
ich hatte eine derart schöne Zeit
mit Euch, da wär es ungerecht,
wenn Ihr mit meiner Duldung
irgend Leid ertragen müßtet.
Herrin, laßt Euch nun mein Herz
und meine Absicht offenlegen.
Leid und Freude, Gutes, Böses
und alles, was mit Euch geschieht –
davon halt ich mich nicht fern!
An all dem nehm ich künftig teil,
wie traurig es auch immer sei.
Zwei Punkte stell ich Euch zur Wahl,
laßt hier Euer Herz entscheiden:
Soll ich fahren oder bleiben?
Denkt darüber bitte nach.
Falls Ihr wünscht, daß ich hier bleibe
und schaue, wie es Euch ergeht,
so seis. Doch falls es Euch beliebt,
mit mir von hier nach Haus zu segeln,
so werde ich Euch stets mit allem,
was ich hab, zu Diensten sein.
Ihr behandelt mich so gut,
ich möchte mich erkenntlich zeigen
mit jeder Art von Freundlichkeit.
Herrin, laßt mich bitte wissen,
was Ihr in dieser Sache wünscht.
Denn was Ihr wollt, das will ich auch!«
Sie gab zur Antwort: »Danke, Herr.
Wie Ihr sprecht und mich behandelt,
dafür mög Euch Gott belohnen!
Und ich muß Euch dafür stets
fußfällig dankbar bleiben.
Geliebter, Herr, Ihr wißt genau,
daß ich hier nicht mehr bleiben kann,
denn mein Dilemma mit dem Kindchen,
das kann ich leider nicht verbergen.
Könnte ich doch bloß verschwinden!
Wie meine Lage nun mal ist,
da wäre dies der beste Ausweg.
Helft mir raus, Geliebter, Herr!«
»Also, Herrin, folgt mir denn!
Geh ich heute nacht zum Schiff,
sorgt dafür, daß Ihr schon vorher
dort angekommen seid, geheim
(bis ich meinen Abschied nahm),
so daß ich Euch sogleich
bei der Gefolgschaft finden werde.
Macht das so! Es muß so sein.«
Er trat nach dem Gespräch
vor Marke, gab die Nachricht weiter,
die man ihm vermittelt hatte,
bezüglich seiner Landesherrschaft.
Er nahm von ihm denn Abschied,
danach von Markes Leuten.
Er löste damit Klagen aus,
wie er solch Klagen nie erlebte,
das dort und damals angestimmt.
Ihm folgten viele Segenssprüche:
Daß es Gott gefallen möge,
sein Leben zu beschützen, seine Ehre.
Als die Nacht herniedersank,
und er kam zu seinem Schiff
mit allen Sachen zum Verstauen,
traf er dort auf seine Herrin,
die schöne Blanchefleur. Und gleich
stach das Schiff in See.
Und so segelten sie fort.
Als Riwalon sein Land erreichte
und erfuhr, welch starken Druck
Morgan auf ihn ausgeübt
mit seiner Heeres-Übermacht,
da ließ er seinen Marschall kommen,
der loyal war, wie er wußte,
der seine ganze Hoffnung war,
der ihn im Herrscheramt vertrat
vor den Herren seines Landes:
es war Rual le très loyal,
ein Hort der Ehre und der Treue,
der unbeirrbar loyal blieb.
Nach seiner Kenntnis, die genau war,
berichtete er ihm,
in welch gefährliche Situation
sein Land geraten war.
»Und doch – weil Ihr zur rechten Zeit
gekommen seid, um uns zu retten
(es hat Euch Gott nach Haus geschickt!),
wird alles sich zum Guten wenden:
beste Aussicht auf Errettung,
ein Anlaß, wieder Mut zu fassen,
die Not wird sich in Grenzen halten!«
Danach erzählte ihm Riwalon
von der Liebes-aventure
mit seiner Blanchefleur.
Der Marschall freute sich von Herzen
und sagte: »Herr, ich sehe klar,
Eure Ehre wächst auf jede Weise;
Euer Rang und Euer Ruhm,
Euer Glück und Euer Glanz,
sie gehen wie die Sonne auf!
Ihr könntet in der ganzen Welt
durch keine Frau so hoch
zu Ansehn kommen wie durch sie. –
Und nun, Herr, hört auf meinen Rat!
War sie lieb und gut zu Euch,
so belohnt sie auch dafür.
Sobald die Lage hier geklärt
und die Gefahr gebannt ist,
die uns noch im Nacken sitzt,
beraumt ein großes Fest an
voller Pracht und Herrlichkeit,
und nehmt sie öffentlich zur Frau,
vor Verwandtschaft und Gefolgschaft.
Doch rate ich Euch sehr: geruht,
Euch vor dem Kampf noch in der Kirche
nach Christenbrauch vor Klerus, Laien
zu dieser Ehe zu bekennen.
Damit segnet Ihr Euch selbst.
Und Ihr könnt völlig sicher sein,
daß in Zukunft Eure Sache
formgerecht ist, ehrenhaft.«
Dies geschah, dies ward getan,
er kam dem allen völlig nach.
Sobald er sie zur Frau genommen,
übergab er sie, zu treuen Händen,
Rual le très loyal.
Der brachte sie nach Canoël,
auf das dortige château,
nach dem sein Herr, wie ich es las,
den Namen trägt: Canel-Angres
(Canel nach: Canoël).
Auf dem château mit diesem Namen
lebte dessen Ehefrau –
eine Frau, die Geist und Leib
mit weiblicher Verläßlichkeit
für die Welt geweitet hatte.
Ihr vertraute er die Herrin an,
verschuf ihr die Behaglichkeit,
die ihrem Rang entsprach, dem Namen.
Als Rual erneut beim Herrn war,
da wurden sie, in der Gefahr,
beide einig im Entschluß,
was die Lage anbetraf.
Sie schickten Boten übers Land,
die machten alle Ritter mobil –
deren sämtliche Reserven
eingebracht zum Abwehrkampf.
So kamen sie mit Heeresmacht
auf Morgan zugeritten.
Der hatte sie, mit seinen Männern,
erwartet, und das gut formiert:
sie bereiteten Riwalon
einen heißen Kampf-Empfang.
Hoho, wie wurden da Soldaten
flachgelegt und totgemacht!
Ein paar nur kamen dort davon!
Wie vielen ging es an den Kragen,
wie viele lagen dort verwundet
oder tot – in beiden Heeren!
In dieser mörderischen Abwehr
fiel auch der Beklagenswerte,
den alle Welt beklagen müßte –
falls das Klagen voller Schmerz
nach dem Tod was nützen würde …
Riwalon von Canel-Angres,
der vom ritterlichen Geist,
von der Trefflichkeit des Fürsten
auch nie fußbreit abgewichen,
der lag dort tot, beklagenswert.
Und doch: in diesem harten Kampf
schirmten ihn die Seinen ab
und holten ihn, bedrängt, heraus.
Trauernd brachten sie ihn fort;
mit ihm begruben sie den Mann,
der ihrer aller Ehre
(nicht mehr und auch nicht weniger)
mit sich nahm, ins Grab hinab.
Würde ich nun breit erzählen
von der Trauer, ihrem Jammern,
wie ein jeder heftig klagte –
was sollte das? Es brächte nichts.
Sie alle starben mit ihm weg
in ihrer Ehre, im Besitz,
in ihrer ganzen Geisteshaltung,
die guten Menschen lebenslang
Glück und Glanz gewähren sollte.
Es ist geschehn, es muß so sein:
der edle Riwalon ist tot.
Hört darüber nur noch dies:
man führte bei ihm aus,
was sich gebührt bei einem Toten.
Da bleibt nur noch dies eine übrig:
man soll und muß sich von ihm lösen.
Doch nehme Gott sich seiner an,
Der noble Herzen nie vergaß.
Wir fahren fort in der Erzählung,
wie es Blanchefleur erging.
Als die wunderschöne Frau
diese schlimme Nachricht hörte,
was sie da im Herzen fühlte –
schütze uns, Herr Gott, davor,
daß wir das selber je erleben!
Ich hege nicht den kleinsten Zweifel:
was eine Frau durch den Geliebten
je erlitt an Todes-Herzensqual,
das war nun auch in ihrem Herzen:
es war erfüllt von Todes-Leid.
Sie bewies der ganzen Welt,
daß ihr sein Tod zu Herzen ging.
Doch wurden ihre Augen niemals
feucht bei allem diesem Leid.
Ja, Gott der Herr, wie kam es nur,
daß es hier keine Tränen gab?
Ah, es war ihr Herz versteinert!
Nichts Lebendes war mehr darin
als Liebe, die lebendig blieb,
als Leid, das sehr lebendig war,
ihr, lebend, an das Leben ging.
Beklagte sie nicht ihren Mann
mit Klageworten? Nein, sie nicht!
Sie wurde stumm in dem Moment,
die Klage starb in ihrem Mund. –
Zunge, Mund, ihr Herz, ihr Geist –
sie waren ganz verloren …
Die Schöne klagte gar nicht mehr,
sie sagte weder »ach!« noch »weh!«,
sie fiel bloß nieder, und sie lag
in Qualen bis zum vierten Tag –
kein Weib war je so elend dran!
Sie wand sich und sie krümmte sich,
mal so, mal so, und hin und her
und weiter, bis sie unter Schmerzen
einen kleinen Sohn gebar.
Seht: der lebte! Sie lag tot.
Weh, der schlimme Anblick, ach,
wenn man nach Leid voll Leid
mit Leid in vollstem Leid
am schlimmsten Anblick leiden muß!
Deren Ehre ganz bei Riwalon lag,
(der sich in Ehren um sie sorgte,
solange Gott es wollte,
daß er sich um sie sorgen sollte),
deren Leid war allzu groß,
es überstieg ein jedes Leid.
Ihre Zuversicht und Stärke,
ihr Rittersinn, ihr Handeln,
ihre Ehre, ihre Würde –
alles dies lag nun darnieder.
In seinem Tod war hoher Ruhm,
in ihrem nichts als tiefer Schmerz.
Wie groß auch die Belastung wurde
für die Herren dieses Landes,
weil ihr Herr verstorben war –
es war nicht so beklagenswert,
als wenn man diese große Qual
und diesen grauenvollen Tod
erlebte bei der schönsten Frau.
Ihr Unheil, ihren Jammer
beklage jeder Mensch im Glück!
Wem eine Frau je Auftrieb gab,
wer Auftrieb je gewinnen will,
der werde sich darüber klar,
wie sehr in diesen heiklen Dingen
das Handeln edler Menschen
zum Scheitern führen kann,
wie leicht bei ihnen Lebensfreude
umschlägt in das Leid;
er bitte für die schöne Frau
Gott sehr dringlich um die Gnade,
daß Seine Güte, Seine Macht
ihr Hilfe, Schutz gewähren mögen!
Nun hören wir vom kleinen Kind
(das keine Eltern mehr besaß),
was Gott mit ihm vollbrachte.
Marschall Don Rual und seine Frau Floraite lassen das Gerücht verbreiten, das Kind sei mit der Mutter gestorben – der böse Morgan soll nichts gegen das Waisen-Baby unternehmen … Floraite täuscht eine Geburt vor; das Paar gibt den Jungen als eigenes Kind aus; während des Taufakts wird der Name gesucht und gefunden: Tristan. Vorbildliche Erziehung und Ausbildung. Mit 14