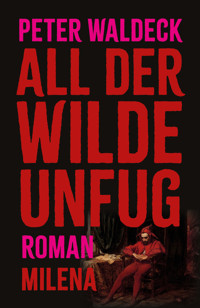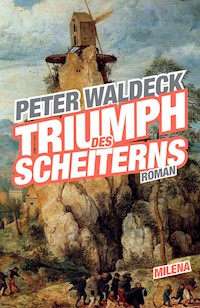
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Milena Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Caspar Orlando Tuppy befindet sich auf dem absteigenden Ast, seine weißen, alten Gedanken sind medial nicht mehr gefragt. Eine Einladung der Kult-Autorin Karina Wintertod nach Wien könnte das Ruder noch einmal umreißen … Wird Tuppy Anschluss finden in Karinas aktionistischer Gang, wird ein feministischer Text seine Karriere wieder aufrichten? – Toll beobachtet, hochkomisch und wortgewaltig. Für Caspar Orlando Tuppy, Ästhetikprofessor an der Uni Wiesbaden, läuft es nicht mehr so gut. Der Bruegel-Kenner war einst gern gesehener Gast in Talkshows, jahrelang sogar TV-Kulturmoderator, ein cooler Intellektueller mit schneeweißen Dreadlocks – doch was ist davon geblieben? Kein Hahn kräht nach ihm, Tuppy muss sich anderen aufdrängen, fürchtet um seine Würde (und finanzielle Zukunft). Inmitten seiner Bestrebungen, das Karriereruder vielleicht noch mit einem Bruegel-Kabarettprogramm herumzureißen, erreicht ihn ein Anruf von Katarina Wintertod. Katarina Wintertod, das Literaturwunder, die Wienerin mit der flapsigen Schreibe, bei der es spitzenmäßig läuft, die sich vor Lesungsanfragen nicht erretten kann und als der neue feministische Star gefeiert wird. Wintertod möchte Tuppy für ein Projekt an Bord holen, sie will einen Text schreiben über Marth Bruegel, die Ehefrau und Mutter der Maler-Dynastie. Denn auch Marth war eine talentierte Malerin, ihre Bilder sind denen ihrer Nachkommen weit überlegen und Tuppys Wissen soll in den Text einfließen. Tuppy ist von dem Angebot begeistert! Einziger Wermutstropfen: Er hat in seinem Leben noch nicht von Marth gehört. Es beginnt eine irrwitzige Odyssee, in der Tuppy endlich Karina Wintertod kennenlernt und bald in die Welt der jungen und aktionistischen Stürmer- und Drängerinnen eintaucht. Ein Höllenbruegel – ein Höllenspaß.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anmerkung 1:
Brueghel, Bruegel, Breugel, Briegel – für die Schreibweise des Familiennamens Brueghel gibt es viele Varianten. Um den Text leichter lesbar zu machen, heißt es von nun an: Brueghel.
Anmerkung 2:
Die Handlung und alle handelnden Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig.
»Schon einmal hatte mich Wien besiegt,und wenn es hart auf hart ginge,würde ich mich einfach wieder besiegen lassen.«
Inhalt
30. September 2018
Der Blumenbrueghel: Auf der schönen Wiese
1. Oktober 2018
Der Höllenbrueghel: Unter dem Mühlenrad
2. Oktober 2018
Der Bauernbrueghel: De Dans in Strasbourg
3. Oktober 2018
Der Bauernbrueghel: Die Reise nach Italien
4. Oktober 2018
Der Bauernbrueghel: Die Lügen am Stock
5. Oktober 2018
Der Bauernbrueghel: Auf der Bauernhochzeit
6. Oktober 2018
Der Höllenbrueghel: Der kleyne Dans
7. Oktober 2018
Der Bauernbrueghel: Der brennet Gustaver
8. Oktober 2018
Der Bauernbrueghel: Totenleut und Aschebrutz
9. Oktober 2018
Das Museum des Alten Mannes 10. Oktober 2018–11. April 2019
30. September 2018
ZWISCHEN ALL DEM grausamen Morden der Skelettarmee, dem Kehleaufschlitzen, dem Köpfen, dem Durchbohren, den Flammen, dem Schwingen einer Sense vom Pferde aus, den aufgedunsenen Wasserleichen, dem lodernden Horizont inmitten des Anschwellens der Toten, fällt der Blick auf die beiden fröhlichen Gerippekerlchen im linken oberen Drittel des Gemäldes, auf einem orangefarbenen Plateau, die damit beschäftigt sind, kleine dürre Bäumchen zu fällen. Da kommt man doch ins Grübeln. Da wundert man sich. Sind die beiden nur Faulpelze oder ist ihnen die Vernichtung der Menschen kein wirkliches Anliegen? »Ach, das Schlachten und Meucheln, das ist schon okay«, sagen sie vielleicht, »aber dieser dünnen Birhha gehört wirklich einmal gezeigt, wo der Pfeffer wächst!«, und ab und zu kommt ein anderes Skelett vorbei und brüllt die beiden an: »Kommt sofort her, ihr Faulpelze, und helft mit beim Köpfeschaufeln!«
»Wir kommen gleich … nur noch dieses eine Gehölz hier.«
Oder wurden die Skelette degradiert? Stellten sie sich beim Morden und Rauben so ungeschickt an, dass ihr Vorgesetzter sagte: »Uh, oh! Jungs, Jungs, lasst das mal lieber! Kümmert euch doch um die Bäume.«
Aber da stellt sich wieder die andere Frage, was kann man denn groß falsch machen beim Töten und Brandschatzen? Haben sie vielleicht Menschen ausgegraben, anstatt sie einzugraben, haben sie entzündete Zähne gerissen, anstatt das Herz, waren sie am laufenden Band gegeneinander gestolpert und hatten sich mit lautem Klackerdiklack zu einem Knochenball verknotet?
Die seltsamste Sache ist gerade passiert. Karina Wintertod rief mich an, mit einer Anfrage. Karina Wintertod. Gerade als ich an meiner Arbeit für das Projekt über Brueghels Bild Triumph des Todes schrieb, läutete es. Mein erster Instinkt war zu lachen, in den Hörer zu schnauben. Irgendetwas mit »Junge Dame« oder »Junge Frau«, wie sie denn auf die Idee komme, das müsse ein Irrtum sein; aber ein anderer Instinkt erdrückte diesen Instinkt, ein Affekt der Neugierde. Denn die Kombination Karina Wintertod, das Literaturwunder, das sogenannte Literaturwunder, also die flapsige Wienerin mit der flapsigen Schreibe, und Caspar Orlando Tuppy, der Ästhetikprofessor mit der Ästhetikprofessur, das hatte irgendwie Biss. Das war ein guter Gegensatz.
Wintertod, Wintertod. Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich das erste Mal ihren Namen gehört oder gelesen hatte. Vor drei Jahren war sie plötzlich wie aus dem Nichts aufgetaucht, Facebook, Twitter, Instagram, täglich frühmorgens mit der Aktentasche ins Internet und dort alle Register der Ich-AG gezogen. Ja, frech und laut musste man sein, das war gut, andererseits musste man aber auch wieder sehr brav sein und jeden Tag ordentlich zur Arbeit erscheinen. Besser oft und mittelgut als brillant und selten. An der Universität hatte es einen Social-Media-Berater gegeben, der mir genau erklärt hatte, wie das auf den sozialen Kanälen funktionierte. Andererseits hatte er – obwohl er einen Anzug trug – in einem Jahr nicht mehr als 700 Likes für die Universität Wiesbaden sammeln können; die Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg bekam im gleichen Zeitraum 9000 Likes – da wurde er gekündigt.
Obwohl viele sie kannten, kennen müssen musste man Karina Wintertod nicht. Das war halt was für junge Leute, die noch nicht viel gelesen hatten. Sie war ein Star, das konnte man nur noch schwer verhindern, aber ihre Texte lasen sich trotzdem so: »Heute beim Furzen lautstark zu menstruieren begonnen. Nachher Buchteln im Hawelka.« Oder so ähnlich. Ich wusste es auch nicht mehr, ich hatte da nur einmal vor Monaten reingeschnuppert. Und auch nur, weil mir ein Malheur passiert war. Ich war bei einer Podiumsdiskussion eingeladen, eine Literatursendung von Radio Niedersachsen, mit den üblichen Verdächtigen und D- und F-Promis der Kulturszene, mit denen ich in letzter Zeit – leider – immer öfter eingeladen wurde, und da poppte plötzlich ihr Name im Rahmen einer Diskussion über ein ganz anderes Buch auf, ein spröder, einsilbiger, südkoreanischer Roman über eine junge Frau, die sich in einen Supermarkt verwandelt, und ich wusste auch nicht warum, ich war eigentlich gar nicht am Wort, aber plötzlich packte es mich und ich hielt eine Brandrede über die Minderqualität der heutigen Literatur, über die vielen kleinen Dämchen und Fräuleinwunder, ich erkannte mich kaum wieder, ich konnte mich nicht bremsen, ich schimpfte und schimpfte – was hatte man mich auch zu einer literarischen Diskussion eingeladen, ich kam ja von der bildenden Kunst –, und in der Fahrt mit dem Zug zurück nach Wiesbaden am nächsten Tag fiel mir ein, dass ich Karina Wintertod eigentlich mit Ronja von Rönne verwechselt hatte. Siedend heiß presste es mich in den Bahnsitz. Ui, war mir das peinlich. Verrisse müssen doch präzise sein, um zu sitzen. Ich hatte einen Ruf zu verlieren.
Alles Mögliche ging mir durch den Kopf. Ich musste Karina Wintertod anrufen und mich entschuldigen! Einen Geschenkkorb an den Verlag senden. Vielleicht jemanden finden, der ihr eine Nachricht auf ihre Facebook-Wand schrieb. Vom Bahnhof aus lief ich gleich in die nächste Buchhandlung und kaufte mir eines ihrer Bücher (»Mein Exfreund Lurchi«). Ich setzte mich in ein Café und blätterte darin, mit den zittrigsten Händen. Ich kann meine Erleichterung gar nicht beschreiben, als ich nach wenigen Seiten herausfand, dass es sich hierbei um einen ebenso miserablen Plunder wie die Mädchenschreibe von Frau Rönne handelte. Ich lachte, ich freute mich; eine Riesenlast fiel mir von den Schultern. Den Geschenkkorb konnte ich mir sparen! Was wäre das für ein Aufwand gewesen, einen Geschenkkorb zu versenden? Das zu organisieren, auf der Post zu verschicken, in einer Schlange anzustehen! Die Formulierung des Entschuldigungsbriefs allein hätte mich vier Stunden eines köstlichen Feierabends gekostet, und wie stellt man sicher, dass das Obst bei der Anreise nicht zu faulen beginnt? Mit einem Mal war dieses dräuende Szenario verpufft, weil die Frau – was für ein Glück! – einfach nicht gut schreiben konnte. Ich bestellte mir nach dem Kaffee noch eine kleine Flasche Rotwein, die ich prompt nicht bezahlen konnte, ich hatte mein ganzes Kleingeld im Zug für Nüsse ausgegeben.
Gerade eben im Telefongespräch wollte ich es ihr beichten – zumindest die halbe Wahrheit, dass ich sie verwechselt hatte; wie ich ihren Schreibstil fand, musste ich ihr ja nicht gleich auf die Nase binden. Ich stellte mich schon darauf ein, freundlich und nebensächlich zu erzählen, wie dumm das damals von mir gewesen war, diese Verwechslung, aber ich sei ja auch ein nicht mehr ganz junger Mann, 64, mein Gehirn funktioniere nicht mehr so duktil, usw. usf., doch ehe ich mich versah, beendete sie das Telefonat und legte auf.
Sie war nicht unfreundlich gewesen, aber auch nicht übermäßig freundlich und originell, so wie ihre Postings es einem weismachen wollten. Sie wusste einigermaßen, wer ich war – das fand ich gut, so eitel bin ich gerade noch –, wobei mich aber verblüffte, was sie über mich wusste und was nicht. So hatte sie keinen blassen Schimmer gehabt, dass ich sieben Jahre lang in Wien gelebt und agiert und währenddessen sogar eine Zeit lang die Kunststücke im ORF moderiert hatte. Dafür hatte sie von meiner Begeisterung für Pieter Brueghel gehört. Während man für meinen Abstecher in den staatlichen Rundfunk Österreichs nur ein paar Zeilen in Wikipedia herunterscrollen muss, wussten von meinem Brueghel-Projekt nur die allerwenigsten. Nicht, weil ich es verheimlichte, sondern weil zu meinem allergrößten Leidwesen Sponsoren, Verleger und Theaterbühnen sich nicht dazu hinreißen ließen, es bedingungslos zu bezahlen.
Es war vielleicht nicht das schönste, feinste und wichtigste Bild aller Zeiten, aber es war das beste Bild, das ich kenne, mein Lieblingsbild: Der Triumph des Todes von Pieter Brueghel dem Älteren, 1562 gemalt. Als ich fünf Jahre alt war, hatte mir mein Großvater den Katalog einer Brueghel-Ausstellung von einer Madrid-Reise mitgebracht und da war es um mich geschehen. Es raubte mir den Atem, meine Backen begannen zu schwitzen. Wie bei einem Wimmelbild-Poster konnte man sich stundenlang in die Landschaft dieses Bilds vertiefen. Brennende Schiffe, musizierende Leichen, von Speeren durchbohrte Soldaten, juchzend glockenläutende Tote, ein von fröhlichen Skeletten besiedeltes Haus, den vorbeifahrenden Sterbenden ausgelassen winkend, und noch und noch und noch. Das Sterben war so unausweichlich und die todbringenden Skelette so motiviert bei der Sache. Sie hatten eine solche Freude!
Eine genauere Beschreibung des Bilds würde Stunden dauern, mindestens zwei, und genau das hatte ich vor: einen unterhaltsamen Abend auf einer Comedy-Bühne, auf der ich das Bild Ausschnitt für Ausschnitt durchginge und jede Szene in einen lustigen Sketch verpackte. Jahre zuvor hatte ich ein Buch über die Brueghel-Dynastie und ihren Einfluss auf John Milton Cage Junior geschrieben, das erst keiner veröffentlichen wollte und dann, als sich ein kleiner Universitätsverlag meiner erbarmte, keiner lesen wollte. Aber ich hatte so viel Arbeit in die Recherche gesteckt, nur ein Bruchteil davon war überhaupt in das Buch eingeflossen, es wäre doch zu schade, all diese Arbeit umsonst, also unbezahlt, gemacht zu haben.
Zu dieser Zeit beobachtete ich den Trend, dass Hochschulthemen wieder breitere Rezeption erfuhren, nämlich als anbiedernde Kabarettshows. Überall boomten halblustige Edutainment-Formate. Und Wissenschaftler, für die sich manche Universität in Grund und Boden schämte, wussten plötzlich nicht mehr ein noch aus vor lauter Geld, das sie auf ihren Tourneen verdienten. Es gab Wissenschaftsshows, Gesundheitsshows, ja sogar Philosophieshows, bei denen wüste Zausel mit Sprachfehler über Platon und Sokrates rappten. Man musste sich nur mit einem jungen, einigermaßen lustigen Comedian zusammentun, so schien es mir, ein paar bewegte Bilder projizieren, irgendwas mit Rauch und Explosionen, und schon sprudelte der Profit. Zum Glück konnte ich rasch Kontakt mit einem jungen Kabarettisten aufnehmen: Walter Graumann, einem fast 20 Jahre jüngeren jungen Mann, der nichtsdestotrotz mit gleich großen Sorgenfalten aufwarten konnte. Nach drei vielversprechenden Bühnenprogrammen war er mit einer eigenen Comedy-Serie im Fernsehen gescheitert. Zu seinem großen Unglück hatte er sich vor der Produktion die alleinige künstlerische Kontrolle ausgefochten, sodass er den Misserfolg niemand anderem als sich selbst anlasten konnte. Der Flop hatte ihn schwer getroffen, die große Sicherheit, mit dem Publikum geschmacklich im selben Boot zu sitzen, war weg, jetzt schwamm er regelrecht und nachdem ein vorsichtiger Versuch mit einem politischeren Programm ebenso scheiterte, war er restlos ratlos. Ein Kind war da, ein Haus gebaut, seine Frau im Streit gegangen, er brauchte Geld, er sagte zu. Sein sorgenvolles Wesen und seine Ziellosigkeit machten ihn mir hochsympathisch, ich freute mich auf die Zusammenarbeit, auch wenn es mir sehr schwer fiel, ihn nicht mit einer Nachbeurteilung seiner Lebensentscheidungen zu konfrontieren. Hätte er etwas gelernt, dann hätte er auch im Universitätsbetrieb arbeiten können, so wie ich, und die ärgsten finanziellen Löcher gestopft. Ich glaube, er wusste es.
Wir begannen mit der Arbeit an unserer Kunstgeschichteshow über Pieter Brueghel, oder Brueghel den Älteren, wie man ihn noch nannte, Bauernbrueghel war ein weiterer Name, und seine Söhne, Pieter Brueghel den Jüngeren bzw. Höllenbrueghel und Jan Brueghel, den Blumenbrueghel. Die Zusammenarbeit war überaus befruchtend, denn trotz des großen Altersunterschieds stellte ich fest, dass ich – geeicht durch meine vielen Vorträge, Vorwörter und Diskussionen – durchaus mit dem jungen Mann in Sachen Humor mithalten konnte, vielleicht war ich sogar lustiger, wer mochte das entscheiden, und vor allem: Wie sollte man es ihm beibringen, ohne dass es zu Spannungen käme? Ich hielt mich daher von Generalisierungen fern und beschloss, die Humorfrage sachlich Punkt für Punkt durchzugehen und mich in Detailfragen bezüglich bestimmter Formulierungen, die man meines Erachtens eleganter wählen könnte, durchzusetzen. Auch empfand ich das Ausmaß seiner Zwischenmoderationen beredenswert. Wer konnte denn wissen, dass mir der feine Humor so leicht von der Hand ging? Brauchte man da unbedingt immer und immer wieder einen anderen, der selbstbewusst mit knödeliger Stimme dazwischenfuhr, um einen schmutzigen Kalauer abzulassen? Dabei hatten wir in den 70er Jahren doch einen schier unerschöpflichen Pool an properen zweideutigen Witzen, viele davon waren immer noch gut – da musste man das Rad doch nicht ständig neu erfinden! Trotzdem wurde die Stimmung immer gereizter. Als ob ich etwas dafür konnte, dass seine Karriere so schlecht lief.
Walter Graumann erschien immer später zu den Proben, seine Haut wurde schlecht, er begann wieder zu rauchen, irgendwann warf er die Hände in die Luft, schüttelte den Kopf und ward nicht mehr gesehen. Dabei hatte ich gerade an jenem Tag die Rauchbombe besorgt. Ich fragte seine Kollegen und Kolleginnen, aber die waren zu feig, niemand traute sich zu, dieses gehobene Material zum Leuchten zu bringen. Ich hätte es mir durchaus zugetraut, diesen Abend allein auf die Bühne zu heben, sozusagen als Solokünstler, der Wissen und Humor in sich vereint, aber die Bühnen bzw. deren Direktoren hatten Zweifel. Sicher wäre es mir möglich gewesen, einmal einen Abend testweise zur Verfügung gestellt zu bekommen, aber ich brauchte nicht nur ein paar Sitzplätze und warme Bretter unter den Füßen. Ich benötigte einen Visual Artist, der die Gemälde animierte und aufs Wort hin punktgenau auf die Leinwand projizierte; einen Tontechniker für die Geräusche, das Stöhnen der Glocke, das Schleifen der Körper, die Speere, die in das falbe Fleisch bohren. Das kostete natürlich, aber alles andere fiele ja unter Lesung, und Lesungen können vieles sein, erhebend, aufrüttelnd, lebensbejahend, aber in den seltensten Fällen relevant Vermögen vermehrend. Leider gibt es seit den späten 80er Jahren keinen Mut mehr auf den Bühnen. Betulichkeit, Anbiederei, Angst ja, aber keinen Mut.
Ich blieb auf dem erarbeiteten Material sitzen. So viel war es schlussendlich ja gar nicht, denn Walter Graumann war es nach den ersten fruchtbaren Probetagen nur noch darum gegangen, seine Kopfschmerzen in besonders ekstatische Gesichtsausdrücke zu fassen. Ich hatte ein paar Witze über das Leben in der Renaissance, Italienreisen damals und heute, und ein paar lustige Namenskreationen weiterer fiktiver Brueghel-Verwandter.
All die Jahre kehrte ich immer wieder zu dieser Idee zurück, seufzte über das Nichtgewesene; Ach und Weh, was bloß hätte sein können? Und immer wieder stellte ich fest, dass es eine gute Idee war, sie wurde nicht schlechter.
War es nicht seltsam, dass genau in dem Augenblick, als ich mir das Projekt wieder vorknöpfte und in meinem Tagebuch Notizen dazu machte, Karina Wintertod bei mir anrief, und mich – aus all den tausenden Themen dieser Welt – gerade wegen eines Brueghel-Projekts kontaktierte?
Wenn ich das richtig verstand, war Karina Wintertod damit beauftragt worden, eine Anthologie über von der Kunstgeschichte zu Unrecht übergangene Künstlerinnen zu erstellen. Die Autoren sollten alle Autorinnen sein. Männer hätten schließlich in der Kunstgeschichte schon genug geredet.
Das sagte sie nicht, aber das musste sie auch nicht sagen. Mir waren die Gedankengänge dieser neuen Generation von Neo-Feministinnen durchaus geläufig. Dass wir Männer schon genug geredet hätten. Wenn dem bloß so wäre! Selbstverständlich mussten mehr Frauen mehr reden, aber doch nicht anstelle der Männer, sondern zusätzlich zu den Männern. Es musste doch nicht immer ein Entweder-oder sein, nein, mehr Frauen sollten reden, durchaus auch in der Kunstgeschichte! Ich war sehr gespannt auf die weibliche Blickweise. Seit Jahren war ich schon gespannt, kaum zu zählen, wie viele Frauen mir in meiner näheren und weiteren Bekanntschaft angekündigt hatten, ein relevantes wissenschaftliches oder künstlerisches Werk zu veröffentlichen. Aber irgendetwas musste den Frauen dazwischengekommen sein, sonst würde ich nicht noch heute auf ihre bahnbrechenden Werke warten müssen. Was zeigt, wie schwer Frauen es heutzutage haben. All die Anforderungen, die an sie gestellt werden – Haushalt, Erziehung, Skincare und Selbstverwirklichung –, da kann man nicht alles mit hundertprozentiger Kraft erledigen, das ist doch unmenschlich.
Vielleicht wäre die Problematik mit einem vom wissenschaftlichen Diskurs abgekoppelten eigenen geisteswissenschaftlichen Frauenlabor zu lösen, wo der Anspruch nicht darauf liegt, etwas fertigzustellen. Wo auch Unfertiges, Angerissenes, Interessant-zur-Hälfte-Gedachtes seine Berechtigung hätte. Ich denke mir, das könnte ein guter Anstoß sein, um weibliches Genie entsprechend zu pflegen. Ob das jetzt unbedingt aus denselben Budgets wie der Kunstbetrieb gefördert werden muss, ist eine andere Frage. Da war doch mittlerweile schon so wenig Geld vorhanden, das musste man nicht noch mehr belasten. Das Frauen- und Familienministerium wäre hierfür doch eine viel charmantere Lösung.
Aber natürlich war es für die Verfasserinnen der Anthologietexte nicht verboten, einen Mann als Berater hinzuzuziehen. Weshalb Karina Wintertod an mich herangetreten war. Sie hatte sich als Thema für ihren Beitrag Marth Brueghel ausgesucht. Man konnte über Karina Wintertods Texte sagen, was man wollte – es muss ja auch nicht alles immer um jeden Preis Literatur sein, genügt es manchmal nicht auch, eine amüsante Niederschwelligkeit zu bieten? –, aber das war wirklich eine saftig spannende Wahl.
Marth Brueghel also, Marth Brueghel – interessant. Die Mutter der Maler-Dynastie, die am Anfang allen Erfolgs thronte, die Mutter des Bauernbrueghel, die Großmutter des Blumenbrueghel, des Höllenbrueghel, und die Urgroßmutter des Pieter III Brueghel, dem von allen Seiten höchstmögliche Profillosigkeit attestiert wurde. Die Mutter, deren Maltechnik ihren Nachkommen bei Weitem überlegen war. Die Mutter, deren Bilder allerhöchstes Entzücken bei Professionisten aller Art erzeugte. Die Mutter, deren Bilder alle verschollen waren.
Die Mutter, von der ich noch nie in meinem Leben etwas gehört hatte.
Der Blumenbrueghel:Auf der schönen Wiese
Wie blau, wie rot, wie wunderbar das Gelb. Jan Brueghel freute sich mit einem Seufzen. Die Sonne stand gut. Sie tat ein glimpfliches Licht. Es war von einer anständigen Warmheit, aber die Hitze war bescheiden.
Wie gerne würde er sich in das Blumenfeld werfen, herzhaft springen wie die Buben in einen See. Aber die Knochen waren alt, das Fleisch um den Fuß ganz geschwollen. Er verbrachte zu viel Zeit aufrecht und nicht zu Bette. Lange Zeit suchte er nach einer Technik, zu Bett zu malen, aber es war ihm nicht möglich. Die Farbe tropfte zurück in sein Gesicht. Wenn er einschlief, zappelten seine Füße und verschmierten die schönsten Stellen. Im Stehen musste er nur einen Schritt zurückgehen, um das ganze Bild ins Auge zu nehmen. Im Liegen bedurfte es einer aufwendigen Seilkonstruktion, die schwer zu bedienen war. Oft war das Bild mit lautem Krachen auf Jan Brueghel gefallen und seine Nase war durch es hindurchgestoßen.
Am meisten aber hatte er sich davor gefürchtet, fortan der Schlafbrueghel genannt zu werden oder unter den einfachen runden Bauersleut der Schnarchbrueghel. Samtbrueghel hatten sie ihn schon genannt, Blumenbrueghel nannten sie ihn nun. Warum nicht Götterbrueghel oder Jünglingsbrueghel? Das hätte ihm besser gefallen, aber er traute sich nicht, seinen Wunsch offen auszusprechen. Aus Angst vor Spott. Nur einmal erzählte er es seiner Frau im Abendbett. Die lachte darob recht verrückt und spitz. Die Dienerschaft hetzte auf, um zu sehen, ob ein Räuber ihre Kehle schnitt. Aber sie war nur gut gelaunt über Jan Brueghels dumme Wünsche. Knurrend hatte er sich umgedreht und die Kerze schroff gelöscht mit seinen Fingern.
Ganz wehmütig stand der Jan Brueghel am Feld. Seine Brust ächzte hoch und ab, wusste nicht umzugehen mit der Blumenpracht. Um von den Tränen abzulenken, die in seinen Augen knospten, schimpfte er mit seinen Kindern. Das tat ihm stets wohl! Auch diesmal kehrte Ruhe ein, nachdem er das Rotzenpack und die Schmutzbuben und die Kreischhälse losgeworden war. Die Traurigkeit wie fortgeblasen. Nur noch Ruhe und Zufriedenheit. Er konnte hören, wie sich die Kinder hinter den Maultieren vor seinem Zorn versteckten. Die Maultiere schnauften ruhig und kauten am Stroh.
Er bückte sich zu den Blumen und beschnupperte sie mit seinen großen Nasenlöch. Aus dem Umhang nahm er das scharfe Messer. Er nahm nur die schönsten Blumen mit dem schönsten Duft. Das war das Geheimnis seiner Blumenporträts. Dass er den guten Duft immer mitmalte. Noch heute würde er den Strauß in seiner Werkstatt zu Bilde bringen.
Da! Ein Rappeln in der Nase. Welch süßliche Fäule verbirgt sich am Grunde des Blumenduftes? Eine Note des Verwesens, als ginge man über ein Schlachtfeld, am dritten Tage nach der Schlacht, und überall schwielten die Totengase in der Luft.
Erst nun bemerkte er die vielen kleinen herrischen Wurmkäfer, die auf dem Stiel der Blumen krochen. Was für eine Wut in ihrer Bewegung, was für ein Zorn! Was für ein dunkles, feuchtes Wogen! Da drehte ein Wurmkäfer seinen glitschigen Kopf. Wie viel Hass in diesen hohlen Augen steckte.
Jan Brueghel raufte sich das Haar in Stücke.
Den Angstbrueghel werden sie ihn ab nun nennen, den Schlotterbrueghel.
Jan Brueghel rief nach den Kindern. Aber die Kinder antworteten nicht. Nur das Maultier, kauend, im Abendrot.
1. Oktober 2018
Es war gut, wieder Tagebuch zu führen. In den letzten Jahren hatte ich oft das Gefühl zu verblassen, auszubleichen, durchsichtig zu werden. Man hatte mich ausgebremst.
Ich konnte mir nie sicher sein, ob ich geistig nicht stehen blieb. Wenn einem die Welt nicht mehr gefiel, gab es nicht viele Möglichkeiten. Entweder die Welt war wirklich schlechter geworden, oder man selbst wurde zum Narren. Wenn ich in meinem Tagebuch, das ich aus organisatorischen Gründen auch als Notizbuch nutzte, zurückblätterte, musste ich nicken; ich war überrascht, wie oft ich nicken musste. Wäre es das Tagebuch eines anderen und ich wäre zufällig darüber gestolpert und hätte es gelesen, ich wäre begeistert; ich meine das ganz uneitel.
Ich erinnere mich an den Rausch, in dem ich meine sechs Tagebücher schrieb; sie erschienen von 1987 bis 1994, bis mein Verleger mir mitteilte, dass seiner Meinung nach Tagebuch Nr. 6 ein unüberbietbarer Abschluss einer großartigen Reihe sei, mit den Verkaufszahlen habe das überhaupt nichts zu tun. Man müsse den Lesern zudem zutrauen, dieses Meisterstück selbst zu entdecken, diese Art durchgeistigtes Publikum sei wie scheue Rehe, und die dürfe man nicht mit leuchtender Reklame erschlagen. Er setze hier auf einen Longseller, auf euphorisches Gewisper, man könne ein Buch schließlich auch zu Tode bewerben. Vier Monate danach bekam ich das Angebot, die restliche Auflage um einen horrenden Preis aufzukaufen, sonst würde man sie zerstören.
Ob ich nach Wien – nach Wien!, ausgerechnet nach Wien! – kommen wolle, fragte mich Karina Wintertod in unserem zweiten Telefonat, um gemeinsam das Projekt durchzugehen? Fliegen würde sie nicht, das sei ökologisch nicht vertretbar, und beim Zugfahren sei ihr immer so fad. Ob ich gerade viel zu tun hätte oder ein kurzer Abstecher nach Wien vorstellbar sei?
War das schon Perfidität oder warum verknüpfte sie die beiden Fragen miteinander? Mir blieb gar nichts anderes übrig, als zu sagen, da müsse ich mit einer Pinzette an meinen Kalender gehen, so einfach sei das nicht.
Karina Wintertods Stimme überraschte mich. Ihre Texte waren so kurz und mit Bombast überladen, effekthascherisch, Konfettibomben nach jedem Beistrich. Wenn sie sprach, tat sie es hingegen lang gezogen, monoton, oft machte sie eine Pause und nach dieser Pause kam dann nach langer Zeit das Ende des vorhergehenden Gedankens. Ihre Stimme war langweilig, dabei leider in keiner Weise unterschwellig erotisch. War das eine Generationenfrage, bildete ich mir das nur ein oder beherrschten die jungen Damen (und Herren) es nicht mehr, Schwächen mit einem Schuss Erotik zu kompensieren? Vielleicht war es heutzutage auch in Ordnung, langweilig zu sein. Unvorstellbar, in den 80er Jahren eine öffentliche Person zu finden, die sich nicht auf allen Ebenen sexuell begehrenswert machen wollte.
Im Internet fand ich drei Bilder von Karina Wintertod. Auf einem sah sie freundlich, süß, aber ein bisschen pausbäckig aus; auf einem anderen hager, fertig, mit Augenringen, schlecht gelaunt, die Haare fettig. Auf dem dritten war sie unscharf vor einem Lokal in der Nacht zu sehen. Sie hielt sich an zwei Freundinnen fest, die selbst nicht gerade standfest wirkten. Sie trug einen aufgemalten blauen Hitlerbart und übergab sich in Richtung Kamera. Eben. Was diese Bilder einte, war die komplette Abwesenheit von Erotik. Wenn du in den 80er Jahren Frau warst und schlecht bis halb gut aussehend, dann versuchtest du wenigstens so dreinzuschauen, als wärst du lüstern bis obenhin. Alles war besser als Langeweile.
Ich hatte es mir zur Gewohnheit gemacht, finanzielle Angelegenheiten so schnell wie möglich anzusprechen. Es hatte ja keinen Sinn. Selbstverständlich sei eine Vergütung meiner Tätigkeiten und meiner Spesen vorgesehen; Genaueres müsse man sich für den Fall, dass ich Interesse hätte, noch ausmachen, aber alles null Problem. Damit der hundertprozentige Frauenanteil der Anthologie nicht verwässert würde, hatte eine befreundete feministische Künstlergruppe über ihren Verein ein Konto für genau diese Zwecke eingerichtet, ein sogenanntes Mansplaining-Konto. Das sei lustig, ließ ich mir erklären, und eine schnöde Abkürzung für Man explaining, also, wenn Männer Frauen die Welt erläutern wollten. Ich musste anhaltend lachen und klärte Karina Wintertod darüber auf, dass es korrekterweise Manxplaining heißen müsse, da in explaining kein S vorkommt.
Beim Gedanken, wieder nach Wien zu fahren, verspürte ich ein bitteres Gefühl. Ich hatte in den 80er Jahren sieben Jahre in Wien gelebt, als ich unter anderem die Fernsehreihe Kunststücke moderierte und als Berater für das Museum des 20. Jahrhunderts tätig war. Für einige Jahre war es eine wunderbare Zeit, dann dürfte mich das Wienerische zu sehr angesteckt haben, denn ich hatte immer öfter das Gefühl, dass mich eigentlich alle am Arsch lecken konnten. Nur eine Klitzekleinigkeit, etwas privates Unglück, das mir zugestoßen war, und schon wurden aus klatschenden Saufkumpanen grüblerische Kritiker der menschlichen Seele.
Ich war länger in Wien geblieben, als mir lieb gewesen war. Von der frühen Euphorie war nur noch Beklommenheit übrig geblieben. In meinem letzten Jahr musste ich mich jeden Morgen übergeben, in meiner Villa wechselte ich keine kaputte Glühbirne mehr aus.
Danach ging ich in den frühen 90er Jahren nach Köln, wo ich als Fernsehredakteur für ein Kulturmagazin arbeitete und für die Stadt Köln Kulturkonzepte für Stadtviertel und Festivals entwarf. Was soll ich sagen? Auch alles Arschlöcher. Ich möchte gar nicht mehr darüber reden. Zum Glück hatte ich das alles in Band 5 und 6 meiner veröffentlichten Erinnerungen niedergeschrieben, somit gab es keine Verpflichtung, meine Erinnerung daran aufrechtzuerhalten, im schlimmsten Fall konnte ich es ja nachlesen.
Ich stöberte lustlos im Internet, vielleicht würde ich ja auf etwas stoßen, das mir das Absagen leichter machte.
Interessant, Karina Wintertod besaß sogar eine eigene Homepage. Ich selber hatte Anfang der 2000er Jahre eine eigene Website publiziert, mit einem riesigen Archiv: einer Sammlung meiner Reden und Vorwörter, vielen Bildern zum Runterladen; es brachte mir wenig. Die aufsehenerregenden und gut bezahlten Auftritte dünnten aus, für kurze Zeit erlag ich der Hoffnung, ich könnte mir mit meinem bisherigen Œuvre im Internet ein saftiges Zubrot verdienen, weit gefehlt! Als mich die Universität ermahnte, dass ich meine Assistenten nicht für die Wartung meiner persönlichen Website heranziehen dürfe, ließ ich es bleiben. So waren die Journalisten, die etwas von mir brauchten, wenigstens gezwungen, mich anzurufen.
Die Website von Karina Wintertod wirkte auf mich recht überladen. Überall blinkte es, krude Zeichnungen, die sich bewegten, große Überschriften. Ich hatte nicht schlecht Lust, den Laptop zuzuklappen und Kopfweh zu bekommen. Aber eine Sache beeindruckte mich: Obwohl sie bislang nur zweieinhalb schmale Bändchen veröffentlicht hatte, war ihr Terminkalender voll, also voll voll, knackevoll. Teilweise drei Auftritte pro Tag. Lesungen, Moderationen, Premieren, Ausstellungen, Theater, Fernsehprojekte. Nein, das durfte nicht wahr sein, sie hatte sogar aktuell ein Stück im Rabenhof Theater laufen.
Was für ein Zufall. Walter Graumann hatte es mir damals empfohlen, es sei genau die richtige Bühne für unser Triumph-des-Todes-Projekt. Nachdem mich Walter im Stich gelassen hatte, meldete ich mich im Rahmen meiner Versuche, einen Produzenten für die Show zu finden, auch beim Rabenhof. Meine E-Mails wurden ignoriert und es dauerte Wochen, bis ich den künstlerischen Leiter, Herrn Tobias Manker, am Apparat hatte. Das Gespräch dauerte nicht lange, dann teilte mir Herr Manker in ungefähr diesen Worten mit: »Bitte, nicht bös sein, aber so einen Schaas bekommen wir jede Woche fünfmal angeboten. Bussi.« Das war vor etwa zehn Jahren. Wer das Theater wohl mittlerweile leitete? Vielleicht vertrat ein neuer Direktor ja eine mutigere Sichtweise? Ich öffnete neugierig die Website und sah im Impressum nach. Oje! Ich hatte es vergessen, in Wien wird man ja erst abgesetzt, wenn man mindestens drei Jahre unter der Erde liegt. Aber auf Karina Wintertods Seite waren noch viele andere Bühnen gelistet, die ihre Lesungen buchten oder ihre Texte dramatisierten. Das Hegel am Heumarkt, die Kresseschutte, das German Birmingham, die frechsten Bühnen im deutschsprachigen Raum, wie mir schien. Viele davon kannte ich gar nicht.
Hätte ich bloß nicht auf die Website geschaut. Das würde mir das Absagen umso schlimmer machen. Ich hatte eher auf etwas offensichtlich Idiotisches, mein künstlerisches Wertesystem Beleidigendes gehofft, ich weiß auch nicht, was. Dann hätte ich mal die Jugend moralisieren können. »Frau Wintertod, gerne hätte ich zugesagt, aber was ich da sehen muss, widerstrebt ja allen Regeln des menschlichen Miteinanders. Sie sind noch unbedarft, aber das! Wie stellen Sie sich vor, dass ich damit umgehen soll?« Doch leider fanden sich auf der Website nur Witzchen und Zeichentrick. Und dieser unglaublich faszinierende Kalender. Die kannte doch die Leiter all dieser Bühnen sicher persönlich.
Ich wünschte, ich könnte behaupten, ich als älteres Semester hätte mich von dem Interesse an meiner Person geschmeichelt gefühlt. Sicher war es ein fachliches Interesse, aber es gibt ja auch andere Brueghel-Spezialisten, nur sehen die eben nicht gut aus. Ich war gut gealtert, ich brauchte bloß meine gleich alten Kollegen anzusehen, um zu wissen, welches Glück ich mit meinem Aussehen hatte. Das lag nicht nur an meinen Dreadlocks, auch meine Haut spannte noch, und die Adern auf meinem Handrücken verhielten sich dezent.
Manchmal, wenn ich auf dem Universitätsgelände noch mit meinen Studentinnen im Campus-Pub ein Bier trinken ging, fragte ich sie ganz direkt – man musste sie direkt fragen, sie überraschen, sonst bekam man keine ehrliche Antwort (es war auch eine gute Gelegenheit, um das Gespräch abzuwürgen, wenn es in Richtung Nietzsche ging): »Findest du mich eigentlich attraktiv?« Schnell fügte ich dann hinzu: »Ich meine, nicht auf sexuelle Weise, das wäre ja schrecklich unangemessen, tut mir leid, so hab ich das nicht gemeint. Nein, ich meine, kann ich es auf eine dunkle erotische Art und Weise mit den hilflosen jungen Männern deiner Generation aufnehmen?« Jedes Mal machte ich mich auf ein reinigendes Feuer der Kritik gefasst, mein Körper spannte sich an, aber zu Unrecht. Die Antworten der Studentinnen waren immer positiv, und gemeinsam seufzten wir über die jungen Männer.
Ich mochte junge Frauen. Ich mochte ihre Neugierde, das unbeschriebene Gesicht, die wogenden Brüste. Ich mochte ihre Haare, gepflegt oder punkig, ich mochte die Rückseite ihrer Ohren, ich bewunderte die Lässigkeit, mit der sie Teile ihres BHs aus der Kleidung herauslugen ließen. Die Mädchen in meiner Studentenzeit hätten sich – bei aller sonstigen Freizügigkeit – erschossen, wenn ein Träger unter dem T-Shirt zu sehen gewesen wäre. Ich übertreibe, aber nicht sehr. Und trotzdem wollte sich das wohlige Gefühl, Mittelpunkt eines Jungmädchenschwarms zu sein, nicht einstellen. Irgendwie gefiel mir Karina Wintertod nicht, also optisch. Sie war zu dünn, zu kantig, zu blass. Sie trug ein kleines, kariertes Hütchen, das war ihr Markenzeichen; bei einer anderen wäre es vielleicht Audrey-Hepburn-mäßig rübergekommen, bei ihr wirkte es eher, als wäre sie das zweitbeste Opfer aus einer Agatha-Christie-Verfilmung.
Was aber nichts an der Tatsache änderte, dass sie offenbar über ausgezeichnete Beziehungen zu den wichtigsten Veranstaltern verfügte. Ihre Vorstellungen waren ausverkauft, die Direktoren hatten sicherlich ein offenes Ohr für Ideen aller Art. Brueghel schien ihr auch zu gefallen, sonst hätte sie sich nicht mit mir in Verbindung gesetzt. Warum also sollte sie nicht für meine Triumph-des-Todes-Show zu begeistern sein? Humor hatte es in der bildenden Kunst immer schwer, doch in diesem Fall konnte er kein Hindernis sein. Karina Wintertod hatte Humor bzw. irgendeinen Humor, und genügend Leute waren ja darin übereingekommen, das lustig zu finden, also konnte sie das Projekt mit der schnoddrigen Begründung »zu lustig!« gar nicht ablehnen. Es müsste ihr doch eigentlich auch gefallen, bestimmt, warum nicht? Und vielleicht hätte sie ja auch Lust, die Show zu produzieren bzw. müsste sie ja nur ihren Namen hergeben, die Ideen hatte ich ja selber. Vielleicht am Anfang und zum Schluss ein paar Worte. Man müsste dann natürlich über die Aufteilung der Einnahmen reden. Berühmter Name hin oder her, aber wenn man so wenig zu einer Show beitrug, durfte man sich auch keine unangemessene Beteiligung erwarten. Das wäre nicht redlich.
Vielleicht wollte ich es mit meinen 64 Jahren noch einmal wissen. Ich hatte mich schon einmal von einem Reichenviertel Frankfurts aus nach oben geboxt, ich konnte es auch ein zweites Mal. Nun war ich erfahrener und wusste, wie ich mit Karrietiefs umgehen konnte.
Der Höllenbrueghel:Unter dem Mühlenrad
Die Wolken in den schwärzesten Stimmungen. Draußen vor dem Fenster grollte der Himmel, ein Wind gellte. Äste bogen sich. Hunde bellten sich die Kehle wund und rissen an den Ketten. Die Spitzmäuse, die zu langsam waren, um in den Ritzen des Hauses Schutz zu suchen, wurden von der schnellen Luft erfasst und gegen die Mauern gepatzt.
Pieter Brueghel schenkte dem Sturm keine Aufmerksamkeit. Er musste malen. Sieben Bilder diesen Monat noch. Die Kaufleute waren verrückt geworden. Gerade dieses, eines der scheußlichsten Werke seines Vaters, fand so viel Entzücken.
Er stand schon zu lange in seiner Werkstatt. Wie ein Wurm kroch der Pinsel über das Bild. Mit jedem Pinselstrich, mit dem er die Dämonen auf das Holz brachte, schauderte es ihn.
Er sollte wohl eine Pause einlegen. Eine Pause wär jetzt recht. Oh, eine Pause. Es fehlten nur noch wenige Dämonen, dann wäre das Bild fertig, aber wenn das Bild fertig war, dann war das nächste leere Holz da und es fehlten wieder alle Dämonen.
Sein Bauch zitterte nach Bier. Seine Stirn presste kalte Tropfen hervor. Seine Kehle hatte eine solche Lust nach Bier.
Seit sieben Wochen hatte er schon nichts mehr getrunken. Sieben Wochen, seit die Gerdrud im Fluss ertrunken war. Unter das Mühlrad war sie gekommen, und die Fische und die Enten hatten sich an ihrem Körper genährt und ihr totes Gift hatte sich durch den Fluss verbreitet und ein paar Windungen weiter war der Bauer gestanden und hatte das Flusswasser geschöpft, um damit sein Bier zu brauen.
»Pfui!«, hatte Pieter Brueghel gedacht. »Das ist diesmal ein gar bittrer Stoff, den man mir tischt.« Mit jedem Glas, das er aus dem Fass zapfte, wurde ihm grüner im Gemüt.
Nachdem er dann die Leich unterm Mühlrad gesehen hat, spritzte es aus seinem Bauch. Ein Gewitter stob aus seinem Mund und prasselte vor seine Füße.
Die Aale borsten ihr aus der Brust. Die Haut war weich und dunkelgrün geworden. Ein Bein war fort. Ein Auge schwamm vor ihrem Mund.
Seitdem wollte ihm das Bier nicht mehr die Kehle runtergehen. Dabei hatte er noch fast ein ganzes Fasse Bier.
Sieben Wochen ohne Bier! Das ist doch kein Leben für einen fleißigen Menschen.
Ehe er sich es versah, stand er im Keller, mit einer Kerze, vor dem Fass.
Das Leichengift war doch bestimmt schon aus dem Fass verschwunden. Die anderen im Dorfe waren auch nicht gestorben, und da gab es sicher keinen, der auf sein Bier verzichtete.
Nein! Das Bier war sicher gut.
Er musste mit dem linken Arm seinen rechten Arm halten, als er die Kerze auf den Boden stellte. So groß war sein Zittern, dass sonst die Flamme erloschen wär.
Am Fass merkte man nichts, das Fass sah gut aus. Er strich über das Holz. Ein gutes Holz. Er hätte doch bestimmt schon einen unheiligen Blitz gespürt, wenn da etwas nicht richtig gewesen wäre mit dem Fass.
Er leckte sich die Lippen. Er kam ganz nah heran und wurde mutig. Er umfasste es mit beiden Händen, schmiegte sein Gesicht daran. Kein Blitz!
Was für eine schöne Freude überkam ihn. Bald würde er wieder Frieden haben mit einem Bier in seinem Schlund. Er schüttelte das Bier vor Spaße. Etwas Schweres polterte von innen gegen die Fasswand. Mit Furcht machte er einen Satz zurück. Er stieß die Kerze um. Das Licht erlosch. Nur einen kalten Strich warf ab und an ein Blitz durch das Kellerfenster.
Pitschnass war Pieter Brueghel nun vor Angst. War es der Fuß der Gerdrud, der im Bierchen schwappte? Er erinnerte sich. Vor sieben Wochen schon hatte er das Fass geöffnet und den grünen Fuß mit den schwarzen Schwaden im Bier entdeckt, aber er musste es geträumt haben. Warum hätte er denn das Bier sonst wieder in den Keller gestellt? Das muss doch ein gutes Bier gewesen sein. Er war so durstig. Der Durst machte einen Riss durch seinen Körper. Er konnte sich gar nicht mehr erinnern, warum er aufgehört hatte. Das war doch nicht vor sieben Wochen gewesen, wie die Gerdrud im Wasser gefunden worden war. Das war doch sicher eine andere Zeit gewesen. Er wusste nicht mehr, warum er aufgehört hatte, das wohltuende Bier zu meiden. Er musste wohl eines Tages einfach darauf vergessen haben, eines zu trinken und am nächsten Tag schon wieder, und am übernächsten Tag schien es ihm plötzlich wie das Üblichste, kein Bier zu trinken.
Er zündete die Kerze an und besah sich das Fass. Ein gutes Fass war das. Aus gutem Holz. Er hätte doch bestimmt schon einen unheiligen Blitz gespürt, wenn da etwas nicht richtig gewesen wäre mit dem Fass. Er stellte das Glas unter den Zapfhahn und ließ sich ein Bier ein. Er hörte das leise Schaukeln nicht im Fass. Nur sanftes Klopfen. Und wenn schon. Das sind doch bestimmt Luftblasen, die im Bier zerplatzen.
Schon hat er das Bier in der Hand, schon unter der Nase, schon rinnt es ihm die Kehle runter. Welch speierner Geschmack! So schmeckt eben Bier, wenn die Zunge entwöhnt.
Die Kerze zur Hand ging er wieder in die Werkstatt, immer wieder am Biere trinkend. Eine Würze wie aus Tod und Ei! Aber wie klar es den Kopf machte.
Pieter Brueghel wollte noch das Bild fertig malen. Der Kerzenschein reichte ihm durchaus. Mit verbundenen Augen würde er es wohl auch irgendwie hinbekommen.
Nur noch ein paar Gerippe ins Bild gesetzt, dann würde er zu Bette gehen. Auf dem Weg dorthin vielleicht noch im Keller vorbeischauen. Wäre doch gelacht, wenn er sich das faule Bräu nicht noch heute Nacht zurechttrinken könne.
Er nahm den Pinsel und setzte zwei Knochentote ins Bild, sie schlugen in einen dünnen Baum, um ihn zu Falle zu bringen.
Es scharrte. Es knirschte. Da kamen sie schon aus ihren Löchern gekrochen. Die Ratten setzten sich zur Kerze und staunten; sie schunkelten mit ihren rosa Schwänzchen.
2. Oktober 2018
Ich wollte absagen, aber dann sagte ich zu und fühlte mich so gut wie seit Langem nicht.
Ich organisierte eine Vertretung für die paar Vorlesungen der nächsten Zeit. Für zehn Tage würde ich nach Wien fahren, für zehn Tage würde ich Karina Wintertod bei ihrem Projekt begleiten und dabei alle Gelegenheit haben, sie auch für meine Idee zu entzünden.
Es traf sich sehr gut, dass dieser Tage eine Brueghel-Ausstellung in Wien gezeigt wurde. Auch ohne die vielen Leihgaben der internationalen Museen ergab es eine epochale Ausstellung – das Kunsthistorische Museum hatte eine sensationelle Brueghel-Sammlung –, aber da sogar der Prado aus Madrid den Triumph des Todes herborgte, war es mir nunmehr völlig unmöglich, nicht nach Wien zu fahren und mir dort von den kleinen Mordszenchen das Herz erwärmen zu lassen. Ich war sicher, der Eindruck des Originalbilds würde mich zu besonders lustigen Gags inspirieren.
Auf keinen Fall wollte ich die Reise allein unternehmen. Zu unsicher war ich, wie sich das Wiedersehen mit der Wiener Niedertracht auf mein Gemüt auswirkte. Die Köhlers sollten mitkommen, sie hatten mich in den letzten Jahren durch dick und dünn begleitet.
Ich fuhr zu ihnen und teilte ihnen mit, dass sie mit mir nach Wien kommen würden. August sagte: »Na gut«, Josefine zuckte mit den Schultern, dann war es beschlossen. Begeistert rief ich Karina Wintertod an und teilte ihr mit, dass ich drei Flugtickets nach Wien benötigte. Sie war irritiert, mein Anruf dürfte zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekommen sein, und sie meinte, es sei möglich, dass ich anstelle der geplanten Anreise mit dem Bus eine Karte für den Zug verrechnen könne.
So schnell konnte ich gar nicht seufzen, da hatte sie bereits wieder aufgelegt. Es gab nur eine Sache, die schlimmer war als der Zug, das war eine Reise mit dem Bus, insofern hatte ich noch Glück gehabt, aber wer bei einer Reise mit dem Zug von einer Glas-halb-voll-Situation zu sprechen in der Lage war, der konnte sich auch mit einem Tod durch Kreiselwespen anfreunden. Man konnte es drehen und wenden, wie man wollte, ein Zug war nichts, worin ein Ästhetikprofessor gut aufgehoben war. Fliegen war das Schönste. Da war der Mensch eins mit der Natur, mit den Vögeln, die durch die wunderbaren Wolken schnitten, und der anstrengende Trödel unter den Füßen zu einer erträglichen Größe geschrumpft. Schlechter als ein Flugzeug, aber besser als ein Bus, besser als ein Zug wäre eine Landschaftsfahrt mit dem eigenen Auto gewesen, aber nur an mein Auto zu denken, versetzte mir einen Stich ins Herz.
Eine Zeit lang machte ich mir den Spaß, Studentinnen, die ich betreute, auf mein Landhaus einzuladen, um dort an einem Wochenende fernab von den Ablenkungen Wiesbadens in aller Ruhe den Stoff durchgehen zu können. Genau wusste ich nicht, was ich mir beweisen wollte – ich glaube, es ging mir um den sinnlichen, vorerotischen Tanz des Ausweichens –, denn ich besaß überhaupt kein Landhaus, genauer gesagt, ich besaß es nicht mehr