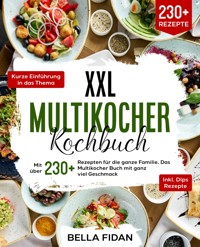Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Körber
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Alles, was wir anfangen, geht seinem Ende entgegen; vom Moment der Geburt an ist der Mensch Abschieden ausgesetzt. Ein souveräner Umgang mit dieser existenziellen Erfahrung kann uns helfen, Vergänglichkeit als Teil des Lebens anzuerkennen. Ina Schmidts Philosophie des Abschieds inspiriert zu einer ebenso wichtigen wie tröstlichen Gedankenarbeit. Die Autorin führt uns vor Augen, in wie vielfältigen, all täglichen ebenso wie außergewöhnlichen Zusammenhängen wir Abschied nehmen. Denn es sind ja nicht nur Menschen, von denen wir uns verabschieden, sondern auch Erwartungen und Empfindungen, Überzeugungen und Gewissheiten. Abschied zu nehmen heißt auch, sich der eigenen Verletzlichkeit und Sterblichkeit zu stellen. So schärft Schmidt unseren Blick für die Vielfalt von Vergänglichkeit und zeigt zugleich, dass wir in kleinen wie in großen Abschieden lernen können, dem Phänomen der Vergänglichkeit gestaltend und reflektierend zu begegnen. Das bedeutet nicht, dass Verluste automatisch leichter, Schmerz erträglicher oder Entscheidungen einfacher werden. Doch wenn wir den Abschied als kulturelle und individuelle Praxis begreifen, können wir lernen, das Ende zu akzeptieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ina Schmidt
Über die Vergänglichkeit
Eine Philosophie des Abschieds
Willst Du schon gehen?
Nein, ich wünsche mir viel Zeit,
um mich in alles zu verlieben …
Und ich weine, weil alles so schön
ist und so kurz.
MARINAKEEGAN »VERGANGENES«
Inhalt
Ein paar Worte zum Anfang
I.Wie wir Abschied nehmen
Wovon nehmen wir Abschied – und wie genau?
Das Ende im Anfang: Wann beginnt das, was vergeht?
Können wir Vergänglichkeit leben lernen?
II.Vergänglichkeit denken: Abschied von Gewissheiten
Wissen, Nichtwissen und die Grenze zum Unverfügbaren
Erstaunliches in der Wissensgesellschaft
Unverständlichkeit lässt sich nicht optimieren: Vom Erklären zum Verstehen
III.Wir sind verwundbar: Eine Ethik der Verletzlichkeit
Der verwundbare Mensch als kulturelles Mängelwesen
Angst, Untröstlichkeit und Sterbenlernen
Trauer und Transformation: Heimisch werden in neuen Bedeutungen
IV.Der Abschied des Älterwerdens: Wie lassen wir die Zukunft los?
Die Reduktion von Zukunft: Bedeutet Altern, sich zu verabschieden?
Das Vergangene gehen lassen: Raum für Erinnerungen
Ein paar Worte zum Anfang
Wer hat uns also umgedreht, dass wir was wir auch tun, in jener Haltung sind von einem, welcher fortgeht? Wie er auf dem letzten Hügel, der ihm ganz sein Tal noch einmal zeigt, sich wendet, anhält, weilt – so leben wir und nehmen immer Abschied.
RAINERMARIARILKE »DUINESERELEGIEN«
Der Blick aus dem Fenster meines Arbeitszimmers hat sich verändert – nicht durch den Wandel der Jahreszeiten oder die über die Zeit immer höher gewachsenen Bäume, nicht durch das neue Auto der Nachbarn oder den frisch gestrichenen Carport. Nach fast zwanzig Jahren brauchte es nur wenige Tage – und alles sieht anders aus. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurde ein Haus abgerissen, ein altes Haus, das schon eine Weile leer stand. Im letzten Jahr war das Fundament gebrochen, es bestand Einsturzgefahr; der Anblick aber hatte sich kaum verändert. Ein schleichender Verfall vielleicht, allmählich verwitterndes Mauerwerk, Moos auf dem Dach oder die Dachrinne, in der das Laub aus dem Herbst einfach den Winter überdauerte. Ein Ort, der ein wenig aus der Zeit gefallen zu sein schien. Eine Vergangenheit konservierend, die in keine Gegenwart mehr münden konnte und keinen neuen Anfang in sich trug. Als in den letzten Tagen die Bagger die Einzelteile des Hauses wie Spielzeug auseinanderrissen, die Treppe in einem Stück im Container landete, der Blick auf ein fast noch intaktes Badezimmer frei wurde und unweigerlich Bilder eines vergangenen Lebens in diesen Räumen vor meinem inneren Auge auftauchten, hatte diese Zerstörung etwas eigenartig Ambivalentes. Auf der einen Seite ging hier etwas auf brutale Weise zu Ende, das einmal der Rahmen für ein Leben gewesen war, und zugleich erschien dieser Ort seit Langem wieder lebendig, im Aufbruch begriffen, eine Leerstelle, offen für eine Zukunft. Nun schaue ich aus dem Fenster und sehe nicht mehr als die Anwesenheit einer Abwesenheit, einen leeren Raum für etwas, das kommen wird, ohne erkennbar zu sein. Es wirkt kahl, ein wenig traurig und trostlos, was dort zurückgeblieben ist, und gleichzeitig fast einladend, wie eine Möglichkeit, die ergriffen werden will. Am Ende ist es nicht mehr und nicht weniger als eine Baulücke, und doch verändert es meinen Blick, zumindest den aus dem Fenster.
Solche Bilder begegnen uns überall, mitten im Alltag. Oft nehmen wir sie kurz wahr und gehen weiter, manchmal aber bleiben wir stehen und schauen genauer hin, halten tatsächlich kurz inne: Wie leben wir mit der Vergänglichkeit von Dingen, Orten und Ereignissen und letztlich mit dem Wissen, dass unser ganzes Leben unvermeidlich zu Ende gehen wird? Häuser werden irgendwann abgerissen oder einstürzen, Überzeugungen geraten ins Wanken, Moden überleben sich selbst, und politische Systeme brechen zusammen. Auch wir selbst und all das, was für uns von Bedeutung ist, wird irgendwann der Vergangenheit angehören. Manches für immer, anderes wandelt sich und wird zu etwas Neuem. Darin liegt keineswegs eine überraschende Einsicht, aber so selbstverständlich sie uns erscheint, so sehr trifft sie uns manchmal in ebendieser Endgültigkeit, und es ist bei aller Selbstverständlichkeit schwer, wirklich mit ihr zu leben. Wie also verorten wir uns in diesem lebendigen Spiel aus Kommen und Gehen, aus Anfang und Ende, aus Verwundbarkeit und Heilung? Was soll bleiben und kann es dennoch nicht? – Wir bewahren Vergangenheit und erworbenes Wissen in unseren Erinnerungen, kulturellen Gepflogenheiten, Traditionen und Gedenkzeremonien, und doch wandelt sich auch diese gut gepflegte und konservierte Vergangenheit im Laufe der Jahre und Generationen.
Mit dieser Ambivalenz der Vergänglichkeit, die unser Leben bestimmt und der wir dennoch zu widerstehen versuchen, beschäftigen wir Menschen uns, seitdem wir denken können. In der griechischen Antike sah Platon die produktive Seite der Vergänglichkeit: Er hielt die Angst vor der eigenen Sterblichkeit für die wichtigste Bedingung menschlicher Schaffenskraft. Epikur hingegen war rund eine Generation später überzeugt, dass die eigene Vergänglichkeit den Aberglauben fördere und uns in der Verteidigung unserer Glaubenssätze zu den gefährlichsten und grausamsten Taten verleite. Die Not von Abschieden, Trennungen und Verlusterfahrungen ist das Thema uralter Mythen, bestimmendes Motiv in Literatur, Poesie und Musik. Und immer haben wir Menschen dem Wandel der Zeit, der eigenen Endlichkeit etwas entgegenzusetzen versucht – um mit dieser größtmöglichen Kränkung durch die eigene Vergänglichkeit einen Umgang zu finden: ein Vermächtnis und Erbe, das über uns hinausreicht und vielleicht sogar das eigene Ende hinauszuzögern vermag.
Insbesondere seit Beginn der Neuzeit streben wir nach technischem und wissenschaftlichem Fortschritt, um unser Leben länger, gesünder und bedeutsamer zu machen, mit immer neuen Höhepunkten in den jüngsten Erkenntnissen der medizinischen Forschung, smarten Lebensformen oder der fast lückenlosen Dokumentation unseres Lebens auf Social-Media-Plattformen. Wir wollen um die Vergänglichkeit wissend das Ende so wenig wie möglich mitdenken, das Leben festhalten, Veränderungen als Chance zu Wandel und Aufbruch verstehen und den letzten Abschied so lang es nur geht hinauszögern. Ganz egal, ob es dabei um ganz persönliche Einsichten, um gesellschaftliche Visionen oder faktenbezogene Prognosen geht: Das drohende Ende auszuhalten, fällt schwer.
Doch warum können wir Endlichkeit so schwer akzeptieren, bis hin zur Negation des eigentlich Unvermeidlichen? Ist die Einsicht in die Vergänglichkeit von lebendigen Prozessen wirklich so unerträglich, oder ließe sie sich nicht auch in ein erfülltes und glückliches Leben integrieren? Wäre sie vielleicht sogar die Voraussetzung dafür? – Und wenn nicht: Müssen wir uns dann vielleicht mit der Vergänglichkeit abfinden, um dem Wesen des Lebens auf den Grund zu gehen, die Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit aber soweit wie möglich vermeiden, um diese Bedrohung überhaupt ertragen zu können? So wie es schon Epikur empfahl, der sicher war, dass Tod und Leben sich ausschließen, wir im Leben also über das Leben nachdenken sollten, nicht aber über dessen Abwesenheit.
Beiden Standpunkten lässt sich im bloßen Nachdenken etwas abgewinnen, welchen wir individuell akzeptieren können, erweist sich aber oft erst an konkreten Lebensstationen. Das ist nicht nur eine Frage der ganz persönlichen Einstellung oder Haltung, denn die Offenheit eines Endes, über dessen Zeitpunkt wir nichts wissen, und die Unverfügbarkeit einer Erklärung, die die Vergänglichkeit des Lebens für uns sinnvoll und begreifbar machen könnte, überfordert jeden von uns in seiner verunsichernden Grausamkeit. Auf sehr grundsätzliche Weise will das nicht zu unseren kulturellen Denkmustern und Ansprüchen passen, die den meisten Fragen des Lebens mit einer modernen Zielstrebigkeit und Daueroptimierung begegnen.
Bei aller Kritik an einer gegenwärtigen Lebensweise, die sich diesem Denken in Gänze verschrieben hat, lassen sich aber auch gute Gründe für sie anführen: Selbstverständlich streben wir danach, unser Leben so lang und so gut wie möglich zu leben, warum auch nicht? Und wir scheinen doch einiges erreicht zu haben, um der Vergänglichkeit, der Zerbrechlichkeit und Verwundbarkeit lebendiger Zusammenhänge und Organismen, uns selbst eingeschlossen, zu begegnen. Warum sollten wir damit nicht einfach weitermachen? Schauen wir uns (in unserem westlichen, postindustriellen Umfeld) um: Die Errungenschaften in Wissenschaft und Forschung, im Gesundheitswesen und Bildungssystem ermöglichen es uns tagtäglich, ein einigermaßen sicheres Leben zu führen, Leid und Not zu lindern, Krankheiten zu heilen und sogar den Tod zumindest ein wenig hinauszuschieben. Dass wir mit diesen Errungenschaften neue Formen der Zerstörung und Ausrottung kultivieren, ist zwar eine wichtige Beobachtung, die zu neuen Fragen Anlass gibt, aber nichts an der grundlegenden Überlegung ändert, welche den einzig möglichen Einwand zu einem auf Verbesserung und Verlängerung ausgerichteten Leben darstellt. Denn selbst wenn wir den zivilisatorischen Fortschritt seinem Wesen nach als positiv ansehen, ändert der mögliche zeitliche Aufschub bzw. die Verlängerung eines einzelnen Lebens nichts an der eigentlichen Frage: Wie gehen wir mit seinem weiterhin unvermeidbaren Ende um? Und zwar als zeitliche Befristung ebenso wie im Sinne der quantitativen Grenzen des Mach- und Schaffbaren. Mit den Grenzen des Wachstums auf der globalen Ebene gilt es sich ebenso auseinanderzusetzen wie mit den Grenzen, die unserem eigenen Leben gesetzt bleiben.
Vergänglichkeit und die uns darin begegnende Endlichkeit bleibt ein Faktum: Sie ist keine Option, die wir wählen oder ablehnen könnten. An dem Ziel, Lebendigkeit festzustellen, auf Dauer festhalten zu wollen, oder jenseits der Vergänglichkeit so etwas wie Unsterblichkeit zu versprechen, können wir zumindest gegenwärtig nur scheitern. Dass wir dieses Unvermögen als Scheitern empfinden, liegt aber nicht etwa daran, dass wir uns (noch) nicht genug angestrengt haben, sondern vielmehr daran, dass wir die Endlichkeit als Wesenszug aller Lebendigkeit nur ungern anerkennen wollen. Denn trotz unserer Bestrebungen, durch Stammzellenforschung, Nanotechnologie oder bizarre Konservierungsversuche der Kryonik der eigenen Endlichkeit zu entkommen – zumindest gegenwärtig werden wir weiter mit dieser Grenze leben und ganz besonders sterben lernen müssen. Diese Einsicht könnte uns also zu dem Schluss veranlassen, dass wir doch zu einer Vermeidungsstrategie aufgerufen sind, die uns ein gelingendes und erfülltes Leben ermöglicht, ohne es durch Gedanken an die eigene Endlichkeit zu beschweren. Ändern können wir daran ja offenbar ohnehin nichts. Daran mag etwas Wahres sein, aber allein die Tatsache, dass wir auf etwas keinen Einfluss haben, bedeutet noch nicht, dass wir vor dieser existenziellen Verunsicherung die Augen verschließen sollten.
Machen wir uns klar, dass uns Vergänglichkeit umgibt, wo auch immer wir hinsehen, dann ist die Vermeidung einer Konfrontation keine leichte Aufgabe – und möglicherweise das größere Hindernis für ein Leben, das wir als erfüllt beschreiben würden. Wie aber soll ein solcher Wechsel der eigenen Perspektive gelingen, der ohne Frage Anstrengung und Schmerz mit sich bringen wird? Wie tasten wir uns an unsere Haltung zur Vergänglichkeit im Denken und Handeln heran? Dafür können wir zunächst den Blick auf das Kommen und Gehen um uns herum richten, einen Umgang mit den kleinen Endlichkeiten finden, den Verlusten, Veränderungen und Abschieden, die wir unvermeidlich annehmen und gestalten müssen. Denn der Umgang mit Vergänglichkeit beschränkt sich nicht auf die letzte und große Endgültigkeit des Todes, sondern begegnet uns beständig. Wir beziehen Vergänglichkeit in unsere Entscheidungen zum Hausbau oder zur Altersvorsorge ein oder erleben sie, wenn wir einen Job kündigen, einen Garten anlegen oder eine Freundschaft zu Ende geht, die Kinder groß und die Eltern alt werden, oder auch nur, wenn ein gutes Buch zu Ende oder unsere Lieblingstasse auf dem Küchenboden zu Bruch geht.
Der Frage, wie wir dieser spannungsgeladenen Eigenart lebendiger Zusammenhänge, von einem Anfang und einem Ende eingerahmt zu sein, begegnen können, widmet sich dieses Buch – als philosophische Spurensuche, die der Offenheit seiner Fragestellung selbst verpflichtet bleibt. Man wird nicht umhinkönnen, diese Frage, wie wir also das Leben als etwas Vergängliches verstehen und leben lernen können, auch persönlich zu nehmen, unabhängig davon, ob wir bereits mit einer konkreten Krankheit, Krise oder einem Verlust konfrontiert sind.
Dabei verlangt die Vergänglichkeit – wie schon erwähnt – einen anderen Blick als die Endlichkeit oder die konkrete Sorge um den eigenen Tod, denn ein unterschiedliches Verhältnis zu dem, was ein »Noch nicht« oder ein »Nicht mehr« bedeutet, entscheidet über die eigene Perspektive. In der Vergänglichkeit steht ein Kommen und Gehen im Vordergrund, also das Wechselspiel von etwas, das endet, aber eben auch wieder beginnen kann. Die Endlichkeit fordert uns dazu auf, ein Ende zu denken, dem aus sich selbst heraus kein Anfang folgen wird. Es mag etwas Neues entstehen, aber dieses Neue wird ein anderes sein. Der Tod hingegen ist eine besondere Form der Endlichkeit: das ganz persönliche Ende, dem wir in unserem Erleben von Vergänglichkeit ausgeliefert sind. Diese drei Begriffe werden in den folgenden Kapiteln zum Ausgangspunkt für Überlegungen, wie wir grundsätzlich mit Verunsicherung und Erschütterung umgehen bzw. uns darin üben können, sie zu vermeiden.
Dem Menschen allein scheint es gegeben, sich mit diesen Lebensfragen bewusst auseinanderzusetzen, sie zu formulieren und, bei aller Schwierigkeit, Abschied von Sicherheiten, Gewissheiten und sogar vom Leben selbst zu nehmen. Auf diese Weise einen Umgang mit der Endlichkeit zu finden, bedeutet nicht, dass Verluste leichter, Schmerz erträglicher oder eine Entscheidung einfacher wird, aber die ernsthafte Betrachtung von Wandel und Veränderung scheint unerlässlich, um einen Blick zu schärfen, der den Vorstellungen von Machbarkeit und Beherrschbarkeit in und von Lebendigkeit eine neue Perspektive hinzufügt: eine Perspektive, die dem Leiden an der Endlichkeit einen eigenen Raum zugesteht und darin den Abschied als kulturelle Praxis und soziale Zeremonie im Umgang mit Vergänglichkeit neu entdecken lernt – nicht als Lösung, sondern als einen Akt, der Halt geben und in der Welt der zu verwirklichenden Möglichkeiten Orientierung bieten kann. Ein Abschied ist dabei eine Handlung, die wir vollziehen, für die wir uns entscheiden und die innerlich einer Form der Einwilligung bedarf. Daher geht es in den folgenden Gedanken darum, den Abschied sowohl als sichtbaren Vollzug persönlicher wie gesellschaftlicher Denk- und Handlungsparadigmen zu begreifen, ihn aber gleichzeitig als inneren Aufruf zu verstehen, der zur persönlichen Lebenspraxis gehört – sofern wir uns entscheiden, einen Umgang mit der eigenen Vergänglichkeit finden zu wollen.
Die Ambivalenz und Schwierigkeit dieser Betrachtung wird dabei schnell deutlich: Denn nicht alle Formen der Vergänglichkeit lassen einen Abschied zu, der auf eine vielversprechende Zukunft ausgerichtet bleibt, einen Abschied also, mit und durch den wir lernen können. Wer einen Garten anlegt, weiß irgendwann um die zyklischen Verläufe naturgegebener Vergänglichkeit, in der Wachstum möglich wird; endet eine Beziehung, mögen sich daraus neue Begegnungen ergeben; verabschieden wir uns von einer Lebensphase, beginnt eine neue, ein Aufbruch vielleicht zu anderen Ufern. Und bei allem Empfinden von Melancholie, Verlust oder Trennungsschmerz bleibt oftmals die Möglichkeit, an etwas anzuknüpfen, was uns die Kraft zur Gestaltung einer Zukunft gibt. Die Zustimmung zur Vergänglichkeit in ihrer letzten und eindeutigsten Form aber, als Einwilligung in die Tatsache des eigenen Todes, können wir nicht nachträglich korrigieren oder revidieren. Die höchste Kunst des Abschieds bedeutet es in diesem Sinne, einen Umgang mit der Erfahrung der Unverfügbarkeit zu finden, gerade indem wir das eigene Sterben zum Thema machen und uns von dem Streben nach Kontrolle und Gewissheit verabschieden – und auf diese Weise zu leben lernen. Denn auch hier werden wir sehen, dass die Fähigkeit, sich von Gewissheiten zu verabschieden und dem Unverfügbaren Raum zu geben, schon weit vor der Begegnung mit dem eigenen Ende einsetzt.
Der erste Teil des Buches widmet sich vor diesem Hintergrund dem Versuch, herauszufinden, was ein Abschied bedeutet, warum wir Abschied nehmen und wie wir das tun. Worauf sind Abschiede innerhalb eines vergänglichen Lebens ausgerichtet, und welches Verhältnis spielt darin unser zeitliches Verständnis von Anfang und Ende? Was genau ist es, das vergeht, und was bleibt in all diesen Enden bestehen? Gelingt es uns nämlich, lebendige Zusammenhänge wie ein Gewebe aus Beziehungen zu verstehen, das sich prozesshaft erneuert, entsteht ein anderes Verhältnis zur Endlichkeit der einzelnen Fäden, die darin verwoben sind, als wenn das Reißen eines Fadens das Ende bedeutet. Endet dieser Faden, oder vergeht das Gewebe, die ganze Textur? Die eigene Vergänglichkeit nicht nur aus unserer Sterblichkeit zu begreifen, sondern auch aus der Tatsache, dass wir anfängliche Wesen sind, steht hier im Mittelpunkt der Gedanken.
Das nächste Kapitel geht der Frage nach, wie wir dennoch nach Gewissheiten suchen können und wie das Verhältnis von Wissen und Nichtwissen unser Denken prägt. Welches Wissen stiftet Orientierung und die Möglichkeit, gute Entscheidungen im Angesicht der Vergänglichkeit zu treffen? Unser Menschenbild eines selbstbestimmten und autonomen Individuums, das sich in einer immer differenzierteren Wissensgesellschaft qua Vernunftbegabung in der Lage sieht, die Welt begreifbar zu machen, ist nicht das einzig mögliche, aber es begleitet uns durch die moderne Welt und prägt unseren Umgang mit Vergänglichkeit seit Beginn der Neuzeit. Was aber bedeutet diese geistige Prägung einer rationalen, mechanistischen Machbarkeit für unseren Umgang mit dem unbegreiflichen Phänomen eines beständig präsenten Endes? Einen Zugang zur Perspektivität anderer und alternativer Deutungen zur Vergänglichkeit eröffnen insbesondere das philosophische Denken und das methodische Vorgehen der Geisteswissenschaften als Optionen eines lebensphilosophisch-hermeneutischen Verstehens in einem offenen und deutenden Umgang mit dem Leben als letztlich unerkennbarem Phänomen. Eine Philosophie des Abschieds meint vor diesem Hintergrund keine umfassende oder gar abschließende philosophisch-theoretische Untersuchung, sondern beschreibt die Möglichkeit einer philosophischen Praxis, die im Denken die Annäherung an das ermöglicht, was wir in allen lebendigen Prozessen das Unverfügbare nennen wollen – indem sie zugleich Abschied von einer bestimmten Vorstellung von Gewissheit nimmt.
Die Sehnsucht nach – wie das zweite Kapitel gezeigt haben wird: unerreichbaren – Gewissheiten erstreckt sich über das Denken hinaus, ist sie doch für jeden von uns ganz konkret erlebbar: in unserer körperlichen, seelischen und geistigen Verletzlichkeit. Ständig sind wir der Möglichkeit ausgesetzt, verwundet, verraten, enttäuscht oder geschädigt zu werden – und leben damit erstaunlich gut. So geht es in der Praxis des Abschieds nicht allein darum, diese notwendige Einsicht auszuhalten und zu ertragen und Gewissheiten loszulassen, sondern um die Überlegung, welche Denk- und Handlungsräume sich auf individueller wie gemeinschaftlicher Ebene durch die Anerkennung einer uns wesentlich innewohnenden Verwundbarkeit ergeben können. Was gibt Halt, was kann Trost spenden, wie erleben wir Linderung oder gar Heilung? Wie stellen wir uns einen guten Tod vor? Können wir selbst über unser Ende entscheiden? Und wie sähe eine Sterbehilfe aus, die wir nicht nur im Angesicht des Todes diskutieren, sondern als eine grundsätzliche Vorbereitung auf das eigene Sterbenlernen verstehen wollen? Dabei soll uns besonders das Phänomen des Trauerns als Voraussetzung für persönliche wie kollektive Transformationsprozesse beschäftigen und die Traurigkeit als menschliche Emotion betrachtet werden.
Das vierte Kapitel rückt im Anschluss daran die Erfahrungen des Älterwerdens und Reifens in den Mittelpunkt, die in jeder Lebensphase gemacht werden, die aber mit der wachsenden Reduktion von Zukunft eine immer weitreichendere Bedeutung bekommen. Wie wir diese Bedeutsamkeit ausgestalten, wird anhand verschiedener philosophischer Positionen näher ausgeleuchtet und in Bezug auf eine mögliche Praxis des Abschiednehmens hin befragt. Ein Abschied meint hier die Fähigkeit, die Begrenztheit der eigenen zeitlichen Möglichkeiten zu akzeptieren: das Loslassen der eigenen Zukunft, das in der Gegenwärtigkeit dennoch zu beständiger Selbstaktualisierung bereit ist. Damit kehren wir am Ende des Buches zum Gedanken der Anfänglichkeit zurück, verstanden als Fähigkeit, sich selbst zu ermächtigen, in dem vorgefundenen lebendigen Spannungsfeld Halt zu finden – in Bezogenheit auf den Kontext und die Gemeinschaft, in der dieses Selbst tätig werden kann. In diesem Anspruch, die eigene Handlungsfähigkeit in der Hoffnung auf etwas Kommendes zu bewahren, liegt die Möglichkeit, dem Leben für das, was es uns antut, zu verzeihen und gleichzeitig der absoluten Endlichkeit durch das Wechselspiel von Anfang und Abschied zu widersprechen: ihr etwas entgegenzusetzen, was uns die Möglichkeit eröffnet, in einem »Trotzdem« (Friedrich Nietzsche) die Kraft zu entwickeln, auf der persönlichen wie auf der gesellschaftlichen Ebene Antworten zu finden, die uns dabei helfen, ein gelingendes Leben zu führen. Das kann uns befähigen, die eigene Vergänglichkeit ebenso wie ganz konkrete Endlichkeiten auszuhalten, daran zu leiden, auch um etwas Neues zu wagen – oder für den Anfang auch nur: einen anderen Blick aus dem Fenster schätzen zu lernen.
Ina Schmidt
Reinbek, Juli 2019
I. KAPITEL
Wie wir Abschied nehmen
Ist die Absurdität erst einmal erkannt, dann wird sie zur Leidenschaft, zur ergreifendsten aller Leidenschaften. Aber zu wissen, ob man mit seinen Leidenschaften leben kann, zu wissen, ob man ihr tiefes Gesetz – nämlich das Herz zu verbrennen, das sie gleichzeitig in Begeisterung versetzen – akzeptieren kann: das eben ist die Frage.
ALBERTCAMUS »DERMYTHOS DESSISYPHOS«
Der britische Neurologe Oliver Sacks starb am 30.August 2015 nach langer Krankheit in New York. Er hatte Krebs, neun Jahre zuvor war ein Melanom in seinem Auge diagnostiziert und vermeintlich geheilt worden, aber die Krankheit war erneut ausgebrochen, und der Krebs hatte bereits Metastasen in seiner Leber gebildet. Die Ärzte gaben ihm nicht mehr als ein halbes Jahr, um sich vom Leben zu verabschieden. In nur wenigen Tagen schrieb Oliver Sacks ein Essay mit dem Titel Mein Leben.1
Der Text wurde nur wenig später in der New York Times veröffentlicht. In diesem kurzen Rückblick nimmt Sacks Abschied, von einem Leben, das ihn mit einem wesentlichen Gefühl erfüllt: mit Dankbarkeit. Ein Leben, das auch an seinem Ende, zumindest im Schreiben, nicht davon beeinträchtigt werden konnte, dass es vergänglich ist, sondern selbst unter diesen schweren Bedingungen eine gut gefüllte Zeit voller genutzter Möglichkeiten und Anfänge bleiben durfte. In einer solchen Übergangszeit, in der Sacks selbst sagt, dass er den Tod zwar vor Augen, mit dem Leben aber noch nicht abgeschlossen habe, wünscht er sich »denkbar erfüllte, kostbare, produktive« letzte Monate. Oliver Sacks berichtet, wie er sein Leben »wie aus großer Höhe« zu betrachten vermag: »als eine Art Landschaft, und mit einem vertieften Empfinden für die Beziehung zwischen allen ihren Teilen«. Und weiter: »Plötzlich sehe ich alles viel deutlicher. Mir bleibt keine Zeit mehr für Unwichtiges. Ich muss mich auf mich, meine Arbeit und meine Freunde konzentrieren.« Die Fokussierung auf diese Gegenwärtigkeit und die Abwesenheit einer planbaren Zukunft erzeugt in ihm das Gefühl, nicht mehr »so ans Leben gebunden« zu sein, ohne dabei diesem Leben gegenüber gleichgültig zu werden. Dieser Blick ermöglicht Klarheit, und auch wenn Oliver Sacks selbst nicht behaupten kann, »ohne Furcht zu sein«, so bleibt er aufrichtig dankbar: »Ich habe geliebt und wurde geliebt, ich habe viel bekommen und ein wenig zurückgegeben; ich habe gelesen und ferne Länder bereist und gedacht und geschrieben. […] Vor allem aber war ich ein fühlendes Wesen, ein denkendes Tier auf diesem schönen Planeten, und schon das allein war ein wunderbares Privileg und Abenteuer.«2
Was dem Autor dieser Zeilen in seinem Rückblick gelingt, ist ein fast zärtlicher Blick auf das, was war, auf eine Vergangenheit, die er in ein gegenwärtiges Empfinden, für das, was nicht mehr sein kann, zu übersetzen vermag. Er nimmt mit Blick auf das Vergangene Abschied von der Gegenwart – in dem Wissen, der Zukunft nicht mehr anzugehören. Die Akzeptanz und Einwilligung in eine nicht mehr hinauszuzögernde Endlichkeit ermöglicht das, was geschieht, wenn wir wahrhaft Abschied nehmen – ein Akt, der nicht notwendig nur an den finalen Abschied vom eigenen Leben gebunden ist. Aber Oliver Sacks zeigt, dass sogar das möglich sein kann: trotz aller Furcht einen Ausdruck für das zu finden, was neben der Endlichkeit des Lebens Bestand hat und von Bedeutung bleiben kann.
Aber nicht jedem ist diese Fähigkeit gegeben, und niemand weiß um das Empfinden eines Sterbenden, wenn er das Leben tatsächlich loslassen muss, mag man nun völlig zu Recht einwenden. Können wir uns in diesen Fragen überhaupt an anderen Menschen orientieren? Und was sollen wir tun, wenn wir eben nicht voller Dankbarkeit auf unser Leben zurückblicken, sondern unzufrieden sind oder einfach noch so viel vorhatten?
Der deutsche Philosoph Odo Marquard, der 2014 verstarb, hat sich in seinen späten Texten Gedanken zu einer »Endlichkeitsphilosophie« gemacht und darin zwei Illusionen beschrieben, denen wir in diesen Zweifeln und Überlegungen oft ausgeliefert zu sein scheinen: zum einen der Illusion der Endlosigkeit, in der wir sehr lange mit unserer Lebenszeit umgehen, als wäre unendlich viel von ihr vorhanden; und zum anderen der Vollendungsillusion, in der wir die Vorstellung eines vollendeten Lebens pflegen (was auch immer das genau bedeuten mag). Wir wollen oder können erst gehen, wenn wir angekommen sind oder alles erledigt haben.3 Diese Vorstellungen kommen uns möglicherweise bekannt vor, vielleicht pflegen wir diese Illusionen sogar ganz bewusst, denn sie behindern uns nicht bei der Gestaltung unseres Lebens, sondern helfen bei dem Versuch, Halt zu finden und uns selbst eine Orientierung in einer ständig fließenden Zeitlichkeit zu geben – aber sie sind und bleiben Illusionen und keine erreichbaren Ziele. Der Wunsch nach unendlich viel Zeit oder einem Leben, das wirklich an ein sauber und selbstbestimmt vollendetes Ende kommt, ist menschlich und verständlich, aber die Tatsache, dass es nicht so kommt, heißt nicht, dass unser Leben keinen Wert hat oder hatte. Unsere Zeit endet, und irgendetwas wird unerledigt bleiben. Gerade dadurch können wir den illusionären Charakter dieser Vorstellung erkennen: Man kann verstehen lernen, dass auch die Dankbarkeit eines Oliver Sacks nicht darauf beruht, wahrhaft am Ende eines vollkommenen Lebens angekommen zu sein. Vielleicht bedeutet unser Ende auch nur die Unterbrechung für den einen oder anderen Lauf der Dinge, und das, was möglicherweise liegen bleiben oder unvollendet sein wird, ändert nichts daran, dass wir für all das, was war, einen wohlwollenden Blick aufbringen und in Dankbarkeit Abschied nehmen können.
Wann aber nehmen wir tatsächlich Abschied und wann nicht? Diese Unterscheidung soll uns nicht nur aus Definitionsgründen interessieren, sondern auch, weil wir begreifen wollen, welche Situationen Übungen des Abschieds sein können. Nehmen wir von der Lieblingstasse Abschied, die unerwartet zerbricht, oder werfen wir sie einfach nur weg? Verabschieden wir uns wirklich von der Kollegin, die in eine andere Stadt zieht, oder winken wir bloß kurz durchs Bürofenster hinterher? Wie verabschieden wir uns von Denkmustern oder historischen Wahrheiten, wie ergeht es uns angesichts technischer Umwälzungen und politischer Strömungen, die uns damit konfrontieren, von alten Gewohnheiten Abschied nehmen zu müssen? Und haben diese Momente wirklich etwas mit dem zu tun, was uns bevorsteht, wenn wir unserer eigenen Endlichkeit oder der von uns geliebter Menschen begegnen?
Ja, das haben sie, denn auch wenn es inhaltlich schwerfällt, hier Gemeinsamkeiten auszumachen, ist der Akt des Abschieds derselbe, wir bewerten ihn nur unterschiedlich. Ein Abschied ist nichts, was uns zustößt oder passiert; er ist etwas, das wir nehmen müssen: ein bewusster Entschluss, der dem, was vergeht oder endet, Raum gibt und in dessen Endlichkeit wir im Moment des Abschieds einwilligen. Das Abschiednehmen ist also die Handlung, die folgen kann, wenn uns etwas zustößt oder in seiner Endlichkeit begegnet – und die glücken, aber auch misslingen kann. Das mag etwas pathetisch klingen, wenn wir an die zerbrochene Tasse oder den Ausstand der Kollegin denken. Aber es geht nicht darum, was oder wen wir verabschieden wollen, sondern um die Frage, was wir tun, wenn wir die Entscheidung treffen, uns wahrhaftig zu verabschieden – sei es in den kleinen, eher nebensächlichen ebenso wie in den großen, lebensverändernden Momenten.
Wir alle kennen diese Augenblicke: Manchmal trifft uns die plötzliche Gewissheit, dass wir uns von einer Idee, einer Vorstellung, einem Lebensentwurf verabschieden müssen. Das romantische Bild einer Großfamilie auf dem Land etwa ist ein schöner Entwurf, aber keine der dafür notwendigen Bedingungen ist realistisch. Also verabschieden wir uns still und leise von diesem Bild, trauern möglicherweise eine Zeit lang und versuchen ein neues, anderes Bild zu realisieren. Vielleicht bringt uns die Beförderung eines Kollegen zum Abschied von der Idee, in diesem Unternehmen Karriere zu machen; vielleicht macht die Diagnose einer chronischen Krankheit uns klar, dass wir uns von unserer bisherigen Lebensweise verabschieden müssen. In diesen Momenten, in denen wir uns der Gewissheit stellen, dass etwas zu Ende ist, und mit ihr umgehen, entsteht Veränderung. Veränderung, mit der wir weiterleben können, wollen oder müssen, in sehr vielen Spielarten und Schwierigkeitsgraden: von zersprungenen Tassen über geplatzte Träume bis hin zur Diagnose einer schweren Krankheit. Immer gilt es, Abschied von etwas oder jemandem zu nehmen – oder es eben nicht zu tun.
In den meisten Fällen verbinden wir mit Abschieden dunkle und traurige Stunden voller Schmerz und Verlustangst. Es gibt aber auch Abschiede, die uns leichtfallen, die das Leben wirklich erleichtern, eine Last von uns nehmen und überfällig waren, um weiterziehen zu können – endlich ist die Abschlussprüfung geschafft oder wagen wir, uns von einem längst nicht mehr geliebten Partner zu trennen.
Solche Prozesse enden nun nicht immer mit einem Abschied, aber sie schließen ihn auch nicht aus – wir treffen die Entscheidung, ein Ende zu setzen. Abschied zu nehmen, scheint also zunächst nicht mehr und nicht weniger als eine Handlungsmöglichkeit zu sein, die je nachdem, worauf sie gerichtet ist, schmerzhaft, vielleicht aber auch erleichternd sein oder sogar Abenteuerlust in uns auslösen und uns motivieren kann. Es gibt notwendige Abschiede, freiwillige, heroische und romantische; Abschiede voller Hoffnung auf ein Wiedersehen und finale Abschiede, die ein endgültiges Ende besiegeln. Angesichts dieser so zahlreichen Facetten und Ausdrucksformen dessen, was wir einen Abschied nennen, wollen wir zunächst klären, was wir eigentlich genau tun, wenn wir uns verabschieden.
Wovon nehmen wir Abschied – und wie genau?
Der Abschied kennt nur ein transitives Verb: nehmen. Und diese Fügung zeigt, dass wir darunter einen Akt, eine Handlung verstehen, die nicht dasselbe meint, wie einen Verlust zu erleiden oder eine Trennung zu ertragen. Es gibt verschiedenste Zeremonien und Rituale, mit denen wir einen Abschied feiern oder begehen oder einfach nur das Ende z.B. einer Jahreszeit in Mittsommer- oder Silvesterbräuchen markieren. Es gibt Zeremonien, die Trennungen und Abschiedsmomente begleiten: Seien es Initiationsriten, die die Zeit der Kindheit verabschieden und Jugendliche in der Welt der Erwachsenen begrüßen wie die christliche Konfirmation oder Firmung; feierliche Hochzeitsreden, in denen Eltern ihre Kinder in ein eigenes Leben verabschieden; aber auch aufwendige Beerdigungen oder Trauerreden; Orte und Stätten des Gedenkens, an denen wir Abschied nehmen, an die Toten erinnern und ihnen eine gute Reise oder ihren Frieden wünschen.4 Diese Rituale und Zeremonien wandeln und verändern sich beständig: Wurde z.B. noch bis vor wenigen Jahrzehnten im Kreise der Familie gestorben, ist das Ende heute vielfach ein einsamer Moment im Krankenhaus. Abschied nehmen wir umgeben von technischem Gerät, das zu blinken aufgehört hat, bevor der Gestorbene möglichst rasch das Sterbebett räumen und in die Pathologie gebracht werden muss. Die Toten in unseren Wohnzimmern aufzubahren oder sie auf ihrem letzten Weg durch das Dorf zu tragen, ist eine Tradition, die sich kaum noch mit modernen Lebensformen in Einklang bringen lässt.5 Und damit wandeln sich auch Trauerorte und -rituale: Bestattungen auf See oder in Ewigwäldern nehmen zu, weil der Lebensmittelpunkt der Familie nicht mehr eindeutig zu benennen ist, das Grab nicht mehr von den Kindern gepflegt werden kann oder sich schlicht niemand dafür zuständig fühlt.
Dennoch bleiben die Symbole und Bilder, die wir im Umgang mit der Vergänglichkeit pflegen, ähnlich und durchziehen selbst die unterschiedlichsten Kulturen. Abschiedsrituale knüpfen an natürliche Prozesse von Werden und Vergehen an und nehmen Bezug auf die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde, wie sie u.a. von den antiken Naturphilosophen Thales und Heraklit in ihrer Suche nach dem »Urstoff« bestimmt wurden – und dabei immer von Wandel und Veränderung begleitet waren. Wir streuen die Asche der Verstorbenen in fließende Gewässer oder ins Meer, begraben unsere Toten in der Erde oder verbrennen sie, um die Seele von ihrer sterblichen Hülle zu befreien. Seit der Antike wird in unserem Kulturkreis die Seele als ein flüchtiges »Geistwesen« gedacht, das auch sprachlich mit Bildern wie Atem oder Windhauch assoziiert wird. Und spätestens seit Heraklit wissen wir, dass wir nie zweimal in denselben Fluss steigen können und uns im sprichwörtlichen Fluss des Lebens beständig mit der Frage nach dem Abschied von Gewohntem auseinandersetzen müssen.6
Das zeigt sich in unterschiedlichen Kulturen zu unterschiedlichen Zeiten auf sehr vielfältige Art – ganz besonders im Hinblick auf Abschiedsrituale nach dem Tod: In Deutschland z.B. besteht eine Sargpflicht, wenn wir unsere Toten in der Erde begraben, während der Islam vorschreibt, den Leichnam nur in ein Tuch gewickelt zu begraben; bei den Buddhisten ist sowohl Erd- als auch Feuerbestattung denkbar; im Hinduismus werden die Toten oft noch öffentlich verbrannt, um die Asche dann der Natur zu übergeben, ohne ihr also einen festen Ort der Erinnerung für die Angehörigen zuzuweisen. Auch ist es heute eine für uns reizvolle Vorstellung, schnell und vielleicht sogar ganz unerwartet zu sterben, im Mittelalter dagegen war dies die schlimmstmögliche Form, die sich ein gläubiger Christ vorstellen konnte, hätte er so doch keine Gelegenheit, die Sterbesakramente zu erhalten und sich auf das bevorstehende Ringen von »Gut« und »Böse« um den Verbleib der eigenen Seele vorzubereiten. So entstand im 15. Jahrhundert eine eigene Literaturgattung, die die »Kunst des Sterbens«, die ars moriendi7 schon zu Lebzeiten, erörterte, damit ein jeder Christ auf die Verlockungen des Teufels vorbereitet sei – auch wenn es keine Zeit mehr für kirchlichen oder familiären Beistand geben würde. Über die Jahrhunderte zeigt sich so ein veränderter Umgang mit dem Tod: von der Akzeptanz des Todes als gefürchtetem und dennoch vertrautem Begleiter des Lebens hin zu immer stärkeren Versuchen, den Tod aus dem Leben zu verdrängen. Der französische Kultursoziologe Philippe Ariès hat in den 1970er Jahren eine umfassende Geschichte des Todes verfasst, in der er diesen Übergang als den Wandel von einem »gezähmten« zu einem »wilden« Tod beschreibt, der heute in den Krankenhäusern des 21. Jahrhunderts zu einem einsamen Sterben unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt hat.8 Dieser unterschiedliche Umgang mit der eigenen Sterblichkeit spiegelt aber nicht nur religiöse oder spirituelle Glaubensformen, eine kulturelle oder soziale Praxis wider, sondern betrifft uns gerade im Wegfall festgefügter Traditionen und Rituale als persönliche Frage – in aller Regel lange bevor wir uns mit dem eigenen Sterben befassen müssen.
Kommen wir also zurück auf die Vielfältigkeit möglicher Abschiedspraktiken – mitten im Leben. Jeder Abschied bringt die Entscheidung zum Ausdruck, etwas gehen zu lassen, was wir nicht auf- oder festhalten können. Eine Entscheidung ist es, weil es eben nicht nur darum geht, im Fluss des Lebens schwimmen zu lernen oder sich den natürlichen Transformationsprozessen auszuliefern, sondern darin als bewusste und handelnde Subjekte tätig zu werden, Endpunkte zu setzen und sich auf die eigenen Grenzen hin zu befragen. Wenn wir uns verabschieden, dann haben wir uns den Anlass möglicherweise nicht ausgesucht, aber wir trennen uns bewusst von etwas oder jemandem, von einem Bild, einer Vorstellung oder einem Gedanken, von Weltbildern und Überzeugungen. Oft zeigt erst der Moment, in dem wir den Kopf wenden und die Perspektive verändern, dass wir gerade Abschied nehmen – und wie bedeutsam dieser Schritt ist.
Die Bedeutsamkeit eines solchen Aktes wird aber auch dann spürbar, wenn kein Abschied möglich ist: »Ich konnte mich gar nicht verabschieden« – dieser Satz bringt unsere Hilflosigkeit zum Ausdruck, wenn Menschen plötzlich verschwinden, in Kriegen, Katastrophen und bei Verbrechen. Die Ungewissheit, die damit leben lernen muss, nahestehende Menschen »für tot erklären« zu müssen, ohne um ihr Schicksal zu wissen, sehnt das Ende ebendieses Nichtwissens herbei, die Möglichkeit, wahrhaft Abschied nehmen zu können. Dieses Gefühl, kein »Ende gesetzt« zu haben, wiegt schwer, manchmal so schwer wie die Trennung selbst, und darin zeigt sich, dass wir es sind, die in diesem Abschied sichtbar werden – als die, die bleiben oder gehen, die mit Veränderung und Wandel umgehen und hin und wieder all unseren Mut zusammennehmen müssen, um das loszulassen, was war, damit etwas anderes kommen kann. Wie aber machen wir das, wie schaffen wir diesen Spagat, der so manchen Abschied in einer Ambivalenz aus Gehen und Bleiben begleitet, der Veränderungen bedeutet und in meisten Fällen eben nicht mit einem Händeschütteln oder einem lässigen »Wir sehen uns« erledigt ist?
Wenn wir Abschied nehmen, dann tun wir dies, um zum einen der Vergänglichkeit zuzustimmen, ihr aber gleichzeitig etwas entgegenzusetzen: die Bedeutung, die wir einem Menschen, einer Sache oder einem Ereignis in unserem Leben geben wollen, sei es in Anwesenheit oder auch Abwesenheit des zu Verabschiedenden. Im Fall eines letzten Abschieds auf dem Sterbebett geht es um die grundsätzliche Bedeutsamkeit, die wir einem Leben zusprechen, das zu Ende geht, einem Leben, das wir zum Abschied würdigen, um uns aber auch dem eigenen Leben wieder zuzuwenden – weil wir es wollen oder weil wir dazu gezwungen sind. In diesem letzten Sinne verabschieden wir uns am Ende eines Lebens nicht nur in aller Trauer von einem Menschen, sondern auch von einem Leben, in dem dieser Mensch eine Rolle gespielt hat. Den Platz, den die Erinnerung an ihn einnehmen wird, können wir nicht mit lebendigen Erlebnissen oder einem gegenwärtigen Austausch füllen. Wir müssen uns mit vergangenen Bildern begnügen und werden die Gegenwärtigkeit des Lebens und lebendiger Beziehungen auf andere Weise entdecken müssen. Und auch wenn wir es im Moment der Trauer erst mal nicht wahrnehmen, sind wir es, die entscheiden, wie wir uns dazu verhalten wollen.
Betrachten wir also noch einmal genauer die verschiedenen Situationen, in denen wir von Abschied sprechen. Der Abschied von einem Menschen ist wahrscheinlich die konkreteste und erste Situation, die uns einfällt – und schon hier reicht die Bandbreite von einem leichtherzigen »Auf Wiedersehen« bis hin zu einem Abschied für immer. Wir können aber auch von einem Ort Abschied nehmen: von einer Wohnung, aus der man auszieht; von Plätzen, die neu bebaut werden – bis hin zu einer Flucht, um Leib und Leben zu retten. Wir verabschieden uns von einer Lebensphase, indem wir älter werden oder selbst den Beschluss fassen, unser Leben anders zu gestalten. Oder vom Leben selbst, vielleicht schwer krank das Ende herbeisehnend oder aus eigenem Willen es herbeiführend.
Sei es unter leichten oder schweren Umständen, die Einsicht in die jedem lebendigen Prozess, Phänomen oder Lebewesen innewohnende Vergänglichkeit bleibt ein Teil des Abschiedsprozesses, der nur dadurch begründet werden kann, dass wir Wesen sind, die Bedeutsamkeit stiften und zusprechen können. Wir nehmen nicht zufällig oder aus Versehen Abschied, sondern immer findet sich darin der menschliche Versuch einer Antwort auf eine Veränderung, die aus einer Trennung bzw. einem Verlust hervorgeht. Manche Abschiede sind Fügungen in unveränderbare Zustände, andere beschreiben Heldentaten, die das eigene Leben einem höheren Zweck widmen, wieder andere sind schmerzvolle Erfahrungen, die ein Weiterleben unmöglich erscheinen lassen – und doch sind all diese mehr oder weniger tragischen Szenen dadurch gekennzeichnet, dass sie das eigene Handeln begründen und in die Zukunft weisen sollen. Diese Versuche und Praktiken scheinen ein uns innewohnendes menschliches Bedürfnis abzubilden – das seit Tausenden von Jahren in mythischen, literarischen und philosophischen Narrationen zum Ausdruck kommt.
Im 8.Jahrhundert vor Christus beschreibt Homer in der Ilias (VI 405–493) den Abschied des trojanischen Helden Hektor von seiner leidgeprüften Frau Andromache und dem gemeinsamen Sohn, bevor er erneut in die Schlacht zieht. »Trautester Mann, dich tötet dein Mut noch!«, klagt sie, mit Worten, die uns vielleicht fremd geworden sind, aber deren Inhalt vertraut ist über die Jahrhunderte. »Und du erbarmst dich / Nicht des stammelnden Kindes noch mein, des elenden Weibes. / Ach, bald Witwe von dir! Denn dich töten gewiss die Archaier, / Alle daher dir stürmend! Allein mir wäre das beste, / Deiner beraubt, in die Erde hinabzusinken; denn weiter / Ist kein Trost mir übrig, wenn du dein Schicksal vollendest, / Sondern Weh!«