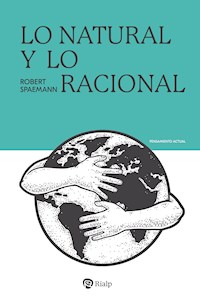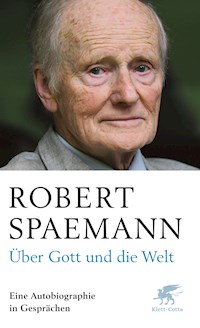
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Mutter war Tänzerin bei Mary Wigman, sein Vater Kunsthistoriker. Seine Eltern waren links, atheistisch und lebten in der Berliner Bohème der Zwanziger Jahre. 1942, nach dem Tod seiner Mutter, wird der Vater zum katholischen Priester geweiht. 1944 ist Spaemann bei einem Bauer untergetaucht, er ist Deserteur im eigenen Land. Entdeckt man ihn jetzt, wird er sofort erschossen. Heute ist Robert Spaemann der bedeutendste konservative Philosoph im In und Ausland. In einem langen Gespräch mit Stephan Sattler resümiert er sein Leben, ganz unter der Maxime der Suche nach dem, »was in Wahrheit ist«. Spaemann ist der bedeutendste konservative Philosoph im In- und Ausland und bekennender Gegner der Nutzung der Atomkraft und der Genmanipulation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Robert Spaemann
Über Gott und die Welt
Eine Autobiographie in Gesprächen
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.de
Klett-Cotta
© 2012 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH,
gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Fotomechanische Wiedergabe nur mit Genehmigung des Verlags
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
Unter Verwendung eines Fotos von © Marijan Murat
Datenkonvertierung: Koch, Neff & Volckmar GmbH, KN digital – die digitale Verlagsauslieferung Stuttgart
Printausgabe: ISBN 978-3-608-94737-3
E-Book: ISBN 978-3-608-10311-3
Inhalt
Vorwort
WAS IMMER IST – Kindheitserinnerungen
1 JUGEND IM DRITTEN REICH – Leben in zwei Welten und Hinwendung zur Philosophie
Indianerspiele
Hayingen
Ich wäre Gärtner geworden
Sein und Schein
2 STUDIUM IN DER NACHKRIEGSZEIT – Münster, Joachim Ritter und die Folgen
Ende und Anfang
3 UM DAS JAHR 1950 – Existenzialismus, das Interesse für Frankreich und die Dissertation über de Bonald
Die Bombe
4 RÜCKKEHR AN DIE UNIVERSITÄT MÜNSTER – Fénelon, der Freund der Mystik
5 PROFESSUREN IN STUTTGART UND HEIDELBERG – Selbstbehauptung in den unruhigen sechziger Jahren
Stuttgart
Die 68er Jahre
Ein Fronleichnamsbesuch bei Heinrich Böll
6 ANKUNFT IN MÜNCHEN – Die Wiederentdeckung des teleologischen Denkens
7 DAS BEWUSSTSEIN DER ZEIT ... – ... aus einem Horizont begreifen, der nicht durch dieses Bewusstsein definiert ist
8 ÜBER GLÜCK UND WOHLWOLLEN – Das Gewissen ist kein lästiger Störenfried
Zweimal Castel Gandolfo
9 NACH DER EMERITIERUNG: Eine Philosophie der Personen
Ostern auf dem Athos
10 DIE ZWEI INTERESSEN DER VERNUNFT
GLOSSAR
AUSGEWÄHLTE HAUPTWERKE VON ROBERT SPEAMANN
Informationen zum Autor
Das Sichzusammenschließen der vielen Momente des Lebens zu einem Ganzen ist nicht ein objektives Geschehen jenseits und außerhalb dieser Momente, sondern es geschieht wiederum in Augenblicken, die ihrerseits einen Teil des Lebens bilden. Das Ganze wird so zum Teil seiner selbst. Wir erinnern uns, und wir integrieren das Erinnerte, indem wir seine Bedeutung stets aus einem Entwurf des Künftigen neu bestimmen. Dieser Entwurf ist seinerseits wieder bestimmt durch die erinnerte und nicht erinnerte Vergangenheit.
Robert Spaemann: »Die Zweideutigkeit des Glücks«
VORWORT
von Stephan Sattler
Wie ist Robert Spaemann der Philosoph geworden, der er heute ist? Er zählt zu den wenigen deutschen Denkern der Gegenwart, deren Stimme über die akademische Welt hinausreicht. Mit seinen Büchern und Vorträgen fand er schon immer international Beachtung.
»Über Gott und die Welt« zeigt nun Lebensstationen des Philosophen auf und die ihn bestimmenden Gedanken. Zu seinem Leben hat sich Robert Spaemann bislang nur zurückhaltend geäußert; er hält den Gedanken für abwegig, das Ausbreiten der eigenen Vita könne Wesentliches über den Inhalt seines Philosophierens aussagen. Wenn Philosophie – hier zitiert er Hegel – »wirkliche Erkenntnis dessen, was in Wahrheit ist« bedeutet, dann geht es dabei um Einsichten, von denen man meinen könnte, es sei nur Zufall, dass sie nicht schon von den Lesern selbst gedacht wurden; von der eigenen privaten Lebensgeschichte allein sind sie nicht abzuleiten.
Nun schildert Robert Spaemann, eingebettet in zehn Kapitel mit Gesprächen, die ich mit ihm führte, Episoden, Erfahrungen und Begegnungen, die ihn nachhaltig prägten. Beides, Dialog und Episode, bilden ein Buch, in dem Robert Spaemann seine Lebensstationen und seine Denkwege erzählt. Biographisches und Philosophisches mischen sich, und das Erzählen – typisch für diese und viele andere Gespräche mit Robert Spaemann – weitet sich und mündet ins Weiterdenken. Dabei ist ein bilder- und gedankenreiches Panorama aus Lebensstationen, Porträts, Diskussionen und Positionen entstanden, das Spaemann-Kenner freuen und alle anderen Leser, die ihm noch nicht begegnet sind, in Spannung versetzen wird. »Die zwei Interessen der Vernunft«, ein Text, der in nuce Robert Spaemanns Denken der letzten Jahre zusammenfasst, bildet den Schlusspunkt und Ausklang dieser knappen Gedankenbiographie in Gesprächen.
Über Kindheit und Jugend von Robert Spaemann in Berlin, Köln, Dorsten und Münster wusste man bislang kaum Näheres: die Konversion seiner Eltern zum katholischen Glauben, den frühen Tod seiner Mutter, seine frühe Haltung und innere Widerständigkeit gegen den Nationalsozialismus, die ihn mit 17 Jahren veranlassen, sich im Reichsarbeitsdienst dem »Eid auf den Führer« und danach dem Gestellungsbefehl der Wehrmacht zu entziehen. Schon in Jugendjahren offenbaren sich sein Hang zur Eigenständigkeit und die Bereitschaft zum Dissidententum. Mit dieser Vita im Dritten Reich unterscheidet er sich von allen, die wie Robert Spaemann um 1927 geboren sind und das geistige Leben der alten und der wiedervereinigten Bundesrepublik bis heute gestalten.
Es fällt auf, dass Spaemann sich in der Nachkriegszeit zunächst ganz gegensätzlichen Gruppierungen und Ideen zuwandte. Da ist einmal sein starkes Interesse am christlichen Leben und dann seine Neigung zu linken und sozialistischen Vorstellungen, mit denen er nach einem abenteuerlichen Aufenthalt Ende der vierziger Jahre in Ostberlin für immer bricht. Die Schriften Carl Schmitts wie auch die »Dialektik der Aufklärung« von Horkheimer und Adorno faszinieren ihn gleichermaßen. Thomas von Aquin und Hegel gelten ihm ein Leben lang als Lehrer des Denkens.
In Joachim Ritter, dem Philosophen, der ab 1946 in Münster lehrt, findet er die Lehrerpersönlichkeit, die ihn endgültig für die Philosophie gewinnt, wobei er für theologische Fragen stets offenbleibt. Mehr als 20 Jahre später tritt er bei den Auseinandersetzungen mit zu Revolten neigenden Studenten zwischen 1967 und 1971 als ein Mann auf, der an einmal gewonnenen Einsichten festhält und sich nicht einschüchtern lässt. Er sucht in Stuttgart und Heidelberg das Gespräch mit den jungen Leuten und wird von ihnen wegen seiner klaren, für jeden nachvollziehbaren Diktion geachtet, obwohl er unmissverständlich und nicht selten eine Gegenposition vertritt. An allen wichtigen Debatten der jungen Republik hat sich Robert Spaemann seit den fünfziger Jahren bis heute beteiligt: In der Frage der Atombewaffnung sieht man ihn an der Seite Heinrich Bölls. In seinem Buch »Grenzen« ist der Brief an Heinrich Böll vom Ende der siebziger Jahre nachzulesen, in dem er seine Parteinahme für die sogenannte Nachrüstung begründet. Als es um die Bildungsreform geht, tritt er zusammen mit Hermann Lübbe auf, der das schöne Wort »Verblüffungsresistenz« geprägt hat.
Auf Robert Spaemann passt Goethes Wort: »Wer philosophiert, ist mit den Vorstellungen seiner Zeit nicht einig.« Seine Moral- und Naturphilosophie sind große Gegenentwürfe zu den heute herrschenden Ideologien, vor allem der »wissenschaftlichen Weltanschauung«, die mit imperialem Gestus verspricht, alle Wünsche der Neuzeit und der Moderne zu erfüllen. Und doch ist er kein Wissenschaftsgegner, ganz im Gegenteil. Wer sich mit ihm über physikalische und biologische Fragen unterhält, ist gelegentlich verblüfft über seine Kenntnisse auf diesen Gebieten. Sein Begriff des »Lebens«, seine Philosophie der »Personen« sind gründlich durchdachte Plädoyers für den Menschen wie er »geht und steht« und wie er sich auch selbst versteht, gegen alle Versuche, den Menschen als »Ding« hinzustellen, das beherrscht und manipuliert werden kann und muss.
Descartes’ Diktum vom Menschen als »Herrscher über die Natur« ist ambivalent. Denn »Herrschaft über die Natur« und »Beheimatung in der Natur« stehen in einem dialektischen Verhältnis zu einander. Warum aber verhält es sich so? Darauf gibt der Aufsatz »Zwei Interessen der Vernunft« eine Antwort. Aber eigentlich kreist das ganze Buch um diese wichtige Grundfrage: Wir beobachten Robert Spaemann beim Verfertigen seiner Gedanken, beim Denken mit seiner sanften, aber beharrlichen Überzeugungskraft. Er ist katholischer Christ und Philosoph, kein katholischer Philosoph, wie seine Kritiker behaupten, um ihn abzuwerten. Auch die Bezeichnung »Linkskatholik« in den fünfziger Jahren hat er immer abgelehnt. Seine politischen Überzeugungen waren einmal »links«, sein Katholizismus nie. Sein Philosophieren ist authentisch, argumentierend, nie nur antithetisch. Den Gegner so genau wie möglich zu verstehen, dieses Ethos steht am Anfang seiner kritischen Bemühungen. Die gemeinsame Vernunft zwingt ohne Zwang allmählich zur Einsicht – mit diesem Eindruck verlässt man Robert Spaemann nach einem zweistündigen Gespräch mit ihm »Über Gott und die Welt«. Für ihn ist Philosophie eine ars longa, die nie zum abgeschlossenen System gelangt, solange das Fragenstellen möglich ist. Erst der Tod setzt ihm ein Ende.
Wie kam es überhaupt zu diesem Buch? Ich schätze Spaemann seit dem Jahr 1972, als ich den Aufsatz »Die Utopie der Herrschaftsfreiheit« im »Merkur« las. Darin durchmusterte er in jargonfreier Sprache die gängigen politischen Theorieangebote, angefangen von Habermas über Dahrendorf und Luhmann, und brachte Platon und Nietzsche luzide zum Sprechen. Mir gefiel dieses von den »Modetönen des Zeitalters« (Kant) unbeeindruckte Denken, vor allem der Nachweis, wie unhintergehbar der Begriff des Guten für die gesamte Ethik und Politik ist.
1987 lernte ich Robert Spaemann in Frankfurt kennen, als er die Laudatio auf Hans Jonas bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels hielt. Seine souveräne Apologie einer teleologischen Naturphilosophie, seine Aktualisierung des Begriffs »Natur« und die Reflexion darüber, was wir meinen können, wenn wir von »natürlichen Dingen« reden, hinterließ bei mir einen starken Eindruck.
In den neunziger Jahren traute ich mich dann als Kulturredakteur des »Focus«, Spaemann um ein Interview zu bitten, und rechnete mit einer Absage. Doch es kam anders. Das Interview fand statt, sogar der Anklang in der Redaktion blieb nicht aus. Danach folgten noch einige Interviews und vor allem längere Telefonate. Aber erst 2006 kamen wir uns näher: längere Spaziergänge durch die schattigen Laubwälder um das Schloss Solitude in Stuttgarts Westen. Es dauerte dann noch bis Dezember 2010, dass ich den Mut aufbrachte, Spaemann zu überzeugen, einen Gesprächsband über seine geistige Biographie mit mir herauszugeben. Wir hatten immer häufiger über Ereignisse aus seinem Leben gesprochen. Er erzählte mir, er habe einige »kleine« Episoden aus seiner Vergangenheit niedergeschrieben, die aber eigentlich nicht zur Veröffentlichung bestimmt seien. Bei mir dagegen verstärkte sich beim Zuhören immer mehr die Überzeugung, gerade diese Erinnerungen, gerade ein Gespräch über seine Vita müssten publiziert werden – ein Gedanke, den, wie Spaemann mir sagte, Michael Klett schon vor Jahren geäußert hatte. Es war die Freude, mit Spaemann zu reden, ihn zu befragen, mit ihm zusammen zu sein, die mich antrieb, andere mit einem Buch daran teilnehmen zu lassen. Schließlich gab er meinem Mitteilungsbedürfnis nach und willigte in das anfangs keineswegs sichere Unternehmen ein, unsere Gespräche zu veröffentlichen.
Zwölf Sitzungen im Jahr 2011, die lange Abschrift daraus, viele Kürzungen und Gespräche über Streichungen folgten. Dieses Buch kam zustande und ist nun, wie ich meine, die beste Einführung in das Philosophieren Robert Spaemanns. Ich habe eine wichtige Erfahrung im Zusammenhang dieses Buches gemacht: Es besteht kein kleiner Unterschied zwischen dem umfangreichen und kompetenten Sich-Auskennen in der Philosophie, wie sie seit Platon betrieben wird, und dem Philosophieren selbst.
Dem Autor bin ich zu tiefem Dank verpflichtet, dass er meine Fragen mit großer Geduld hingenommen, mit nie nachlassender Konzentration beantwortet hat und bereit war, seine »Episoden«, Texte, die so viel über ihn offenbaren, einzufügen. Erst sie geben dem Buch sein eigentliches Gewicht.
Frau Susanne Held, die das druckfertige Manuskript unermüdlich engagiert erstellt und unsere Arbeit durch kluge Vorschläge zur Kürzung und Korrektur begleitet hat, sei vielmals gedankt. Auch dem Lektor Johannes Czaja, der Korrektorin Frau Renate Warttmann und dem Verlag Klett-Cotta gebührt – natürlich nicht zuletzt – mein bester Dank.
München, im März 2012
Stephan Sattler
WAS IMMER IST
Kindheitserinnerungen
Nächst Gott verdanke ich, wie mein Vater mir erzählte, meine Existenz der Malerin Käthe Kollwitz. Sie muss den genialischen jungen westfälischen Kunstgeschichtsstudenten, Dichter und Bauhaus-Schüler Heinrich Spaemann als Mitarbeiter der legendären »Sozialistischen Monatshefte« kennengelernt und gemocht haben. Mein Vater war dort zuständig für Film und Varieté, also damals zum Beispiel für Charlie Chaplin, Buster Keaton, Sergej Eisenstein, Josephine Baker und den Mozart der Jongleure, Rastelli. Ich besaß als Kind einen der Bälle, die Rastelli nach der Vorstellung ins Publikum geworfen hatte.
Die aus dem Schwäbischen stammende Tänzerin und Mary-Wigman-Schülerin Ruth Krämer mochte Käthe Kollwitz auch und fand, die beiden sollten einander kennenlernen. Sie stiftete den älteren Freund und Mentor meines Vaters, den Psychologen Alexander Mette (später Präsident des Psychologenverbandes der DDR), dazu an, die beiden zusammen einzuladen. Sie hatte Erfolg.
In Mettes Haus allerdings ereignete sich später (es war der letzte Besuch) auch die Wende im Leben meiner Eltern, der Blutsturz meiner Mutter, der ihrer tänzerischen Laufbahn ein Ende setzte. Dass sie im Himmel wieder würde tanzen können, war ihr gewiss. Dies und ein gleichzeitiger Anfall dämonischen Wahnsinns bei Mette war der Beginn einer gänzlichen Neuorientierung meiner Eltern, die, beginnend mit der Lektüre Rousseaus über Jean Cocteaus Briefwechsel mit Maritain schließlich zum Weggang von Berlin nach Münster und am Ende in den Schoß der katholischen Kirche führte. So viel zur Vorgeschichte meiner Erinnerungen.
Ergänzend ist nur noch zu sagen, dass mein Vater sich Jahre nach dem Tod meiner Mutter entschloss, Priester zu werden. Er wurde 1942 vom Bischof von Münster, Graf Galen, geweiht.
Den Bericht aus diesen Erinnerungen sollte ich beginnen mit dem Vers des Psalms Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi: In domum Domini ibimus. Meine früheste Kindheitserinnerung ist die Erinnerung an die Freude, von der in diesem israelitischen Wallfahrtslied die Rede ist – die Erinnerung an ein unbeschreibliches Wohlbehagen des Dreijährigen, der auf dem Schoß seiner Mutter liegend aufwacht beim Psalmodieren der Mönche, das ihn auch schon in den Schlaf gesungen hatte. Die Eltern meinten, es sei nun genug, und wollten aufbrechen. Aber ich bettelte sie an, noch zu bleiben. Ich konnte mich von dem Gesang mit seinen endlosen Wiederholungen nicht trennen (und kann es bis heute nicht). Es war in der Benediktinerabtei St. Josef im münsterländischen Gerleve, wo meine Eltern in die Kirche aufgenommen wurden und wo sie mich als Dreijährigen hatten taufen lassen.
Mein Taufpate war der alte, bärtige Klosterbruder Radbod, der mich früh in die Geheimnisse seiner Bienenzucht einweihte, während meine Eltern im Klosterladen ihren Honigbedarf deckten. Später begleitete ich gelegentlich als Ministrant einen Mönch auf dem »Versehgang« zu einem der umliegenden Bauernhöfe, wo es dann nach stattgehabter Zeremonie ein reichliches Frühstück gab, reichlicher, als das im Kloster üblich war.
Die Verbindung zur Abtei überdauerte die Übersiedelung meiner Eltern nach Köln im Jahr 1932. Ostern feierten wir fast immer dort. 1943 wurden die Mönche vertrieben. Ich schrieb damals mein erstes Sonett in einem etwas pathetischen, von Reinhold Schneider inspirierten Stil, in dem ich mein Land dem Untergang preisgegeben sah, weil es die zehn Gerechten ausstößt, deretwegen Gott sogar Sodom und Gomorrha verschont hätte:
Gerleve 1943
Das Volk, das seine Beter feig verriet, / die Erstgeborenen aus seinen Söhnen, / den eignen heiligen Namen, würd es wähnen, / den Namen selbst zu retten? Doch es flieht // aus seiner Mitte das geweihte Lied, / das seinen Namen trug und unter Tränen / den Segen Gott abrang. Nur dumpfes Stöhnen / dringt aus dem Abgrund noch und schaudernd sieht // ein Engel, wie sein Volk die zehn Gerechten / ausstößt, um derentwillen Gott vergeben / und Sodoma selbst freigesprochen hätte. // Nun ist es rettungslos den finstern Mächten / und namenlos und nackt dahingegeben. / Nur du bleibst noch, mein Gott, du komm und rette.
Ein pathetischer Augenblick war für mich das Osterfest 1943. Meine Mutter war sieben Jahre zuvor gestorben. Ich verbrachte das Fest, wie meistens, in Gerleve, diesmal einquartiert bei einem Bauern. Das Kloster war inzwischen in ein Lazarett verwandelt. Die Bauern hatten mit der Drohung von Lieferstreik die Öffnung der Abteikirche und regelmäßige Gottesdienste darin erzwungen. So fand an jenem Tag das Osterhochamt statt. Die Kinder von der Gerlever Volksschule sangen, ja schmetterten die gregorianischen Gesänge: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Dei in der besonderen österlichen Melodie.
Ihr Lehrer hatte es mit ihnen geprobt, und es erscheint mir immer als lächerlich, wenn die Liturgiereformer später verbreiteten, es hätte dieser Reform und der Abschaffung des Lateins bedurft, um eine aktive Teilnahme der Gläubigen an der Liturgie zu erreichen. Pathetisch war der Augenblick für mich, weil ich ganz allein den vertriebenen Mönchschor zu vertreten hatte durch den Sologesang des sogenannten »Proprium«, eines der reichen, melismatisch komponierten gregorianischen Ostergesänge, Gesänge, die zu den schönsten des Jahres gehören und die von Rechts wegen Sache einer kleinen Mönchsschola waren.
Die kleine Terz, mit der das »Resurrexi« beginnt, ist so ganz anders als die Pauken und Trompeten, die in späteren Jahrhunderten für diesen Text mobilisiert wurden. Der verhaltene Jubel der kleinen Terz drückt die Stille aus, in der sich die Morgenröte eines neuen Äons ereignet. Adressat des Psalmworts »Ich bin auferstanden und immer bei Dir« sind nicht wir. Es ist eine Zwiesprache des Auferstandenen mit dem Vater.
Zwei Jahre später kamen die Mönche zurück. Dass ich in ihre Gemeinschaft eintreten wollte, ist nach all dem verständlich. Und auch, dass der ehrwürdige alte Abt, so wie es die Benediktinerregel vorschreibt, meinen Enthusiasmus bremste und mich erst einmal an die Universität zurückschickte. Da ich ohnehin über beide Ohren verliebt war, blieb (womit ein weiser Abt immer rechnet) dieses Anklopfen an der Klosterpforte Episode. Ein älterer, aus dem Krieg heimgekehrter Freund und Mitstudent, der mit mir angeklopft hatte, trat dann bald darauf wirklich ein, wurde Mönch, ein guter Mönch, später Novizenmeister, und ist schon lange am Ziel dieses Unternehmens angekommen.
Mein Kontakt zur Abtei wurde spärlich. Erst viele, viele Jahre später entdeckte ich in der Provence, am Fuß des Mont Ventoux, die neue Abtei Ste Madeleine in Le Barroux, in der ich das Mönchtum meiner Jugendzeit, die herrliche römische Liturgie, die strenge monastische Observanz, den frühen Tagesbeginn, das strikte Schweigen wiederfand und jenen Gehorsam, der das Lebenselement des Benediktinermönchs ist, ihn zum Ruhen in sich bringt und die Mönchsgemeinde zu einer brüderlichen Gemeinschaft von Einsiedlern macht.
Entstanden ist diese Abtei durch einen Mönch, der zur Zeit der Verwirrung und Aufweichung der klösterlichen Disziplin nach dem 2. Vatikanischen Konzil mit Erlaubnis seines Abts sein Kloster verließ und in der Provence bei einem leerstehenden steinernen Kirchlein als Einsiedler zu leben begann, die alte Messe las und die monastischen Tagzeiten rezitierte. Bald sammelten sich junge Leute um ihn, und sie begannen zusammen eine neue Mönchsgemeinde zu bilden, bauten dann in Le Barroux ein großes Kloster. Zwei Kilometer entfernt entstand ein ebensolches Frauenkloster.
Als dann das päpstliche Verbot durch päpstliche Gunstbeweise abgelöst wurde, stand dem inneren Frieden und der äußeren Entfaltung und Ausstrahlung nichts mehr im Weg.
Ich muss, wenn ich über mein Leben schreibe, zuerst von dem sprechen, was gar nicht mein Leben ist. Ich bin kein Mönch. Aber mein Leben ist eine vorübergehende Episode im Universum. Wichtig ist, was immer ist. Die Mönche bezeugen durch ihren Gesang und durch die Form ihres Alltags das, was immer ist. Sie bezeugen es als den, der immer ist. Ohne das, was sie bezeugen, wäre das, was jetzt ist, also auch die Episode dieses Lebens, ebenso wie des Lebens aller anderen, ohne Bedeutung. Es hätte, wenn die Erinnerungen erloschen sind, nicht einmal mehr den Status der Vergangenheit.
Ernst Bloch, dem ich sonst nichts verdanke, schreibt einmal von dem, »was uns allen in die Kindheit scheint und wo noch keiner war: Heimat«. Ja, in die Kindheit ist mir wohl so etwas geschienen: die heitere, zärtliche, strenge Liebe meiner kranken, jungen Mutter. Was mir blieb, war, was meine Mutter mir mitgegeben hat: Glaube und Hoffnung auf die »wahre Heimat«, von der der Apostel Paulus schreibt, dass sie im Himmel ist. Ich kann mich nicht erinnern, von meiner Mutter später geträumt zu haben.
Erst vor einem Jahr träumte ich, dass ihr Besuch mir unmittelbar ins Haus stünde. Ich wunderte mich zwar, weil ich doch gedacht hatte, sie sei gestorben, und weil sie, wenn sie lebte, doch eigentlich sehr alt sein müsste. Aber das änderte nichts daran, dass dieser Traum die reine Euphorie war. Ich hatte das Gefühl: Nun werden sich alle Fragen beantworten, alle Probleme lösen, alles, alles würde gut sein. Natürlich konnte ich auch im Traum das Gesicht meiner Mutter nicht wieder hervorrufen. Ich wachte also auf, ehe sie an die Haustür kam.
Bei dieser Gelegenheit fällt mir ein anderer Traum ein, den ich als Kind hatte und in dem meine Mutter auch eine entscheidende Rolle spielte, obgleich sie persönlich gar nicht auftrat. Mir träumte, auf einer Dorfstraße lief aus der Ferne eine Hexe mir nach. Ich rannte in panischer Angst weiter, um nach Hause zu kommen, aber die Hexe kam immer näher. Die Situation wurde verzweifelt.
Aber in diesem Augenblick schoss es mir durch den Kopf: Meine Mutter hatte mir gesagt: Es gibt keine Hexen. An dem, was meine Mutter sagte, zweifelte ich nie. Sie sagte immer nur die Wahrheit und hatte auch kein Verständnis dafür, wenn jemand, und sei es ein Kind, nicht die Wahrheit sagte.
Aber gegen die Wahrheit der Worte meiner Mutter stand nun die eigene unmittelbare Erfahrung: Hier ist eine Hexe. Sie sieht aus wie eine Hexe und sie droht, mich gefangenzunehmen. Es gab nur eine Lösung dieser Frage: Es muss sich um einen Traum handeln. Die Hexe muss geträumt sein. Das Problem war nun nur noch: Wie schaffe ich es, aufzuwachen, ehe die Hexe mich fängt? In diesem Augenblick warf ich mich, im unbedingten Vertrauen auf die Wahrhaftigkeit meiner Mutter, vor der Hexe auf die Straße und wälzte mich hin und her, um aufzuwachen, was mir dann auch gelang.
Mir war später diese Geschichte immer ein Bild für den unbedingten Glauben an die göttliche Offenbarung entgegen dem Augenschein, für den vernünftigen Glauben gegen abergläubische Empirie.
Ein dritter Traum hatte die umgekehrte Struktur. Er wehrte sich gegen die Entlarvung als Traum, und das jahrzehntelang. In ihm ging es um meinen Jugendfreund Martin Bongartz. Wir waren schon als Kinder enge Freunde, waren zusammen Ministranten, wir gingen zusammen zur Schule. Er stotterte. Er war witzig. Ich nicht. Aber ich lachte gern über seine Späße.
Im letzten Kriegsjahr wurde er noch zum Militär eingezogen und blieb in Ungarn verschollen. Vermutlich zwei Tage vor seinem Tod schrieb er mir noch bei einem Glas Tokayer einen langen Brief, ein wundervolles Dokument unserer Freundschaft, das dann leider selbst im Bombenkrieg verbrannt ist.
Danach träumte ich jahrzehntelang, dass er wiedergekommen sei und wir ein großes Fest des Wiedersehens feierten. Nach der etwa zehnten Wiederholung dieses Traums fing ich an, mich im Traum zu erinnern, dass ich das alles schon früher einmal oder mehrmals geträumt hatte, und nun kamen mir zunehmend Zweifel, ob es sich nicht auch diesmal wieder nur um einen Traum handelte. Aber alles war doch so real. Und ich sagte zu meinem Freund: »Denk dir, ich habe schon so oft geträumt, du seist wiedergekommen. Und dann war es immer nur ein Traum. Ich hätte nicht gedacht, dass du nun tatsächlich doch noch wiederkommen würdest.« Und dann, am Ende, war es wieder nur ein Traum.
Später versuchte ich mich dann empirisch zu vergewissern, indem ich alle möglichen Experimente anstellte, die dazu dienen sollten, mir während des Traums Klarheit zu geben. Aber alle Kriterien, die es erlauben sollten, Realität von Illusion zu unterscheiden, schienen erfüllt zu sein. Bis ich dann schließlich wieder aufwachte und alles nur ein Traum war. Es gibt in der Tat keinen Test, der uns eine absolute Gewissheit verschaffen könnte, dass wir nicht träumen. – Nachdem sich alle Tests als unzureichend erwiesen hatten, kehrte der Traum nicht wieder.
KAPITEL 1
JUGEND IM DRITTEN REICH
Leben in zwei Welten und Hinwendung zur Philosophie
Herr Professor Spaemann, erinnern Sie sich noch, wann Ihr Interesse für Philosophie geweckt wurde?
Man kann, glaube ich, nicht genau sagen, wann man zur Philosophie gekommen ist. Philosophie ist ja nur die intensivere und systematischere Fortsetzung normalen Denkens. Also müsste man eigentlich fragen: Wann haben Sie angefangen zu denken? Und diese Frage kann man natürlich erst recht nicht beantworten.
Aber was die Philosophie im engeren Sinne betrifft, insofern es sich um eine bestimmte Disziplin handelt, um eine Disziplin, die eine lange Geschichte hat, da kann ich die Frage schon beantworten. Es war ein Lehrer am Kölner Dreikönigsgymnasium, Dr. Anton Klein, der mein Interesse für Philosophie weckte. Er unterrichtete die drei Bildungsfächer Latein, Griechisch und Deutsch. Und unlängst habe ich in einem alten Tagebuch von mir aus den Jahren 1941/42 zweimal den Eintrag gefunden: »Heute hat er wieder philosophiert«, und das hieß, er hat angefangen, über den Stoff, den er uns gerade vortrug, eigene Überlegungen anzustellen. Es waren oft nur wenige, knappe Sätze, die bei mir auf fruchtbaren Boden gefallen sind.
Ein Beispiel, das ich zufällig in diesem Tagebuch gefunden habe, betraf Polybios. Polybios war zwar kein Philosoph, sondern Historiker, aber er entwickelte politisch-philosophische Gedanken über den Kreislauf der Verfassungen, Gedanken, die Platon nahestehen. Mein Lehrer knüpfte an die Lektüre eine Bemerkung über das Ziel des Staates: Das bestehe nicht in der Macht, sondern, wie ich als Junge damals notierte, in der »Veredelung des Menschen«.
Übrigens gab er uns 15-jährigen Schülern auch eine Einführung in die Ideenlehre Platons. Die Welt, die wir sehen, sei nicht das Ganze, sondern ihr lägen Ideen zugrunde. Eingeprägt hat sich mir noch seine kommentarlose Bemerkung zur Theorie vom Aufgang und Niedergang der Staaten: »Christliche Staaten brauchen nicht zu sterben. Sie haben die Kraft, sich von innen heraus zu erneuern.« Mich hat das fasziniert; meine Mitschüler, glaube ich, eher gelangweilt.
Erhielten Sie von Ihrem Elternhaus philosophische Anregungen?
Eigentlich nein. Meine Eltern waren gebildet, aber nicht philosophisch. Als ich neun Jahre alt war, starb meine Mutter. Ihr Einfluss auf mich blieb prägend. Aber es war dann vor allem mein Vater, bei dem ich aufwuchs und der maßgebend war für das, was mir an Bildung vermittelt wurde. Philosophie spielte dabei keine spezielle Rolle. Bei uns zu Hause war die religiöse Prägung sehr stark.
Für meine Eltern war nach ihrer Konversion der christliche Glaube zum Hauptlebensinhalt geworden. Meine Mutter war Tänzerin, mein Vater war als Kunsthistoriker und Kulturredakteur der »Sozialistischen Monatshefte« tätig, daneben spielte also auch die Welt der Künste eine große Rolle. Eine Zeit lang studierte er im Bauhaus, unter anderem bei Paul Klee, aber vor allem bei Moholy-Nagy. Mit Philosophie hatte das alles nicht direkt zu tun. Aber ich wuchs in einem Klima auf, in dem das Geistige von zentraler Bedeutung war. Materiell bewegten wir uns auf der Leiter unten.
Wussten Sie denn als Schüler schon, was Philosophie sein könnte?
Was ich bei meinem Lehrer »Philosophieren« nannte, war mir jedenfalls klar. Ein Beispiel. Wir lasen die Novelle »Kalkstein« von Adalbert Stifter. In meinem Tagebuch notierte ich dazu: Am Beispiel des armen Pfarrers macht der Lehrer deutlich, worin eigentlich der Wert des Menschen besteht. Und das hat nichts mit dem zu tun, was heute propagiert wird.
Unser Lehrer, schrieb ich, redet nie über Nationalsozialismus. Tatsächlich immunisierte er unsere Klasse dagegen. Einmal kam ein Schüler von außen in unsere Klasse und meinte: »Ihr seid ja alle vollkommen konterrevolutionär.« Das Wort »konterrevolutionär« für die Gegner der Nationalsozialisten überraschte mich nicht. Es war für mich ein Ehrentitel: Ich war konterrevolutionär.
Der Nationalsozialismus erschien mir als Bruch mit einer 2000-jährigen, übrigens von mir natürlich sehr idealisierten europäischen Gesittung.
Welche Rolle spielte damals für Sie der nationalsozialistische Zeitgeist?
Er zwang mich, in zwei Welten zu leben, eine Situation, die für meine Hinwendung zur Philosophie sicher wichtig war. Da war einmal die offizielle Welt. In ihr durfte man gewisse Dinge nicht sagen, ja es war klug, möglichst wenig zu sagen. Und es gab die dazu konträre Welt, in der ich aufwuchs. Es war im Wesentlichen die christliche. Wenn man genötigt wird, die Welt auf zwei Weisen anzuschauen, sich mit einer zu identifizieren und die andere abzulehnen – die Nationalsozialisten waren ganz einfach die Feinde –, regt das natürlich zum Nachdenken an: Warum haben wir recht und sie unrecht?
Waren die NS-Jugendorganisationen ein Teil der offiziellen Welt, wie Sie es nennen?
Gewiss. Zum so genannten Jungvolk hatte ich zu erscheinen. »Die Hitler-Jugend« ab dem 14. Lebensjahr konnte ich irgendwie umgehen. »Irgendwie« – das heißt, ich weiß nicht mehr, wie. Mich erreichte nie eine Aufforderung, dieser Organisation beizutreten.
Davor kam das sogenannte »Jungvolk«. Das hieß vor allem marschieren. Es war der reine Stumpfsinn. Die anderen Kinder trugen alle eine Uniform, nur ich nicht. Meine Eltern hatten mir keine gekauft. Zur Strafe musste ich immer ganz am Schluss hinterher marschieren. Geschämt habe ich mich nicht, eher war ich stolz, keine zu besitzen.
Wenn mich der Fähnleinführer anschnauzte, warum ich noch immer keine Uniform hätte, antwortete ich: »Meine Eltern können das nicht bezahlen.«
Mussten Sie Parteiparolen auswendig lernen?
Nein, es blieb beim Marschieren, beim Absingen von Liedern und allerlei Lauf- und Turnübungen. Die Fähnleinführer spielten sich wie Unteroffiziere auf, schimpften und kommandierten uns herum. Es war äußerst abstoßend. Eigentlich geschah da nichts, was Kinder für den Nationalsozialismus hätte gewinnen können.
Empfanden Sie keine Gemeinschaftsgefühle in der Gruppe Gleichaltriger?
Doch, aber in einer anderen Gruppe, einer Gruppe der Gegenwelt. Ich war Mitglied im Bund Neudeutschland, einem 1919 von Jesuiten gegründeten Schülerverband. Dort hatte ich meine Kameraden. Dort fühlte ich mich beheimatet.
Als er verboten wurde, machten wir trotzdem Wanderungen in den Wäldern, immer auf der Hut, dass die Polizei uns nicht auf die Schliche kam. Das war viel aufregender als die Übungen beim Jungvolk.
INDIANERSPIELE
Wie alle Jungen zu meiner Zeit habe ich Indianer gespielt. Und irgendwann habe ich mir das Spiel kaputtgemacht. Natürlich schlugen wir uns in die Büsche, je unwegsamer und urwaldmäßiger, desto besser. Die großen Wege dachten wir weg. Und dann kam der GAU: Ich wollte, dass alles so echt indianisch sein sollte wie möglich. Aber was würden denn wirkliche Indianer tun, wenn sie im Wald auf einen breiten und ebenen Weg stießen? Sie würden natürlich auf diesem Weg gehen und sich nicht durch das Unterholz quälen. Also ging ich auf dem Weg. Aber was war denn nun noch das Indianermäßige? Um weiter Indianer zu spielen, musste ich aufhören, zu denken, wie ein echter Indianer in dieser Situation denken würde. Das Bemühen um Authentizität zerstört sich selbst.
Und das blieb mein Lebensthema: Unmittelbarkeit und das vergebliche Bemühen um Unmittelbarkeit und Authentizität. Gewollte Unmittelbarkeit ist eben nicht mehr Unmittelbarkeit.
In meinem Fénelon-Buch »Reflexion und Spontaneität« habe ich diese einfache und übrigens nicht originelle Entdeckung – ohne Indianer – zur Sprache gebracht. Begleitet hat mich die Sache lebenslang. Als ich später Kleists Schrift »Über das Marionettentheater« las, fand ich genau das thematisiert, worin ich ein Grundmotiv meines Denkens zu sehen glaube.
Die ersten sich durchhaltenden Denkmotive sind ja nicht selbst Resultate diskursiven Denkens. »Sympathie und Antipathie sind die ersten Akte der Vernunft«, heißt es bei Gómez Dávila – Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies und Trauer über die Unmöglichkeit einer Rückkehr – außer für kurze Momente der Überwältigung durch das Schöne, das nicht von dieser Welt ist und von außen in die Welt hineinragt.
HAYINGEN
Ein Traum vom Paradies war für mich der erste Besuch im Sommer 1938 bei meiner Großmutter, die damals gerade in ein altes Häuschen in Hayingen gezogen war, einer Stadt mit 600 Seelen auf der Schwäbischen Alb. Ich war elf Jahre alt und kannte bisher kein Landleben. Nach den Ferien musste ich einen Schulaufsatz über die Ferien schreiben. Ich schrieb über die erste Begegnung mit diesem Leben, und mir ist dieser Aufsatz in Erinnerung als mein erstes nach meinen eigenen Maßstäben gelungenes Stück Poesie. Ich versuchte, etwas von der Schönheit einer Welt wiederzugeben, die mir im Rückblick als letzte Präsenz eines jahrtausendealten bäuerlichen Lebens erscheint, die letzte Präsenz einer Welt, die es definitiv in unserem Land nicht mehr gibt.
Zwei Jahre später nahm ich für ein halbes Jahr an diesem einfachen Leben teil, arbeitete beim Bauern, erhielt vom Dorflehrer und vom Pfarrer für die ausgefallene Schulzeit Privatunterricht in Mathematik und Latein. Fürs Griechische musste ich jede Woche zwei Stunden zu einem jungen Pfarrer eines anderen Dorfes laufen. Im Winter ließ er mich bei sich übernachten. Ich feierte die Feste und Sonntage des Dorfes mit, organisierte mit Gleichaltrigen eine Theatergruppe. Am Wochenende amüsierten wir die Dorfleute in einer Scheune mit unseren kleinen Sketchen.
Ich bilde mir ein, dass das Hayinger »Naturtheater«, das heute in der ganzen Region bekannt ist, auf diese kleine Initiative zurückgeht. Die Hayinger Buben hatten einfach Geschmack am Theaterspielen gefunden. Und die Sonntage! An den Sonntagen gackerten sogar die Hühner anders als werktags. Alles war anders. Zur Messe ging fast das ganze Städtchen. Die Männer allerdings blieben vor der Kirche stehen und plauderten, bis die Predigt vorüber war, und die heilige Handlung begann. Im Sommer verkündete der Pfarrer von der Kanzel eine allfällige Dispens vom Verbot der Sonntagsarbeit, wenn aufgrund der Wetterverhältnisse Eile beim Ernten geboten war. Dass der Pfarrer darüber entschied, hatte den Vorteil, dass die Gemeinde sich nicht spaltete in die Frommen und die weniger Frommen und den Leuten Gewissenskonflikte erspart blieben.
Und bis jetzt bleibt für mich die Erinnerung an eine untergegangene Welt. Jeder hatte in ihr seinen Platz. Da waren die beiden armen Frauen, die sich die Ähren lesen mussten für das tägliche Brot. Der Bauer, dem ich bei der Ernte half, wies mich an, beim Zusammenrechen der Ähren genug für diese Frauen liegenzulassen. Da war der alte, von Geburt blinde Aurele, den seine ledige Schwester zu Hause versorgte und dem ich manchmal etwas vorlas. Manchmal führte ich ihn auf den Kirchturm, wo ihn das Klappern der Glockenapparatur vor dem Stundenschlag in immer neues Entzücken versetzte. Ich sehe ihn noch vor mir, die Hände reiben und in sich hineinkichern. An Jahrmarktstagen putzte ihn seine Schwester heraus mit dem Sonntagsstaat samt Krawatte fürs Betteln mit Hinhalten des Hutes. Seine großen Augenblicke waren Todesfälle. Ich erinnere mich an den Tod eines Schäfers, der vom Blitz erschlagen wurde. Drei Tage lang versammelten sich das Dorf und die Schäfer der umliegenden Dörfer zum Rosenkranzgebet in der Friedhofskapelle, und Aurele waltete seines Amtes als Vorbeter. Und da war die ehemalige Spielkameradin meiner Mutter, die als Kind mit ihrer Mutter in Hayingen Ferien machte – eine schöne Frau, sie und ihre Schwester ledige Töchter der hochangesehenen Inhaberin des Gasthauses »Bierhalle«. Da war der junge ledige Bauer mit seinen zwei Kühen, der jeden Abend vor seiner Haustür saß und Französisch lernte, und zwar mit einem Wörterbuch und ohne je etwas von Grammatik oder Ausspracheregeln erfahren zu haben. Sein großer Augenblick schien gekommen, als die französischen Kriegsgefangenen ins Städtchen kamen. Aber leider erwies sich, was er gelernt hatte, als völlig ungeeignet für irgendeine sprachliche Kommunikation.
Und da waren diese Kriegsgefangenen, die anstelle der eigenen Söhne bei den Bauern arbeiteten und dort auch wie die eigenen Söhne gehalten wurden. Manche besuchten sie nach dem Krieg ihre damaligen »Gastfamilie«. Ich habe, was Marx die »Idiotie des Landlebens« nennt, für eine kurze Zeit mitgelebt. Hätte ich wirklich dazugehört, so hätte es mich bald in die Welt hinausgetrieben. Aber ich hätte auch gewusst, wohin ich gehen müsste, wenn ich nach Hause wollte.
Diese Welt ist nicht mehr. Und besser der Untergang als die museale Perpetuierung. Der in der »Ritter-Schule« – vor allem von meinem Freund Hermann Lübbe – gepflegte Gedanke blieb mir fremd, ja zuwider, auch die Musealisierung sei eine volle und legitime Weise der Präsenz der Herkunft. So konnte ich mich nach dem Krieg in Münster nicht mit dem Wiederaufbau des Marktplatzes zwischen Rathaus und Lamberti-Kirche anfreunden. Die Giebelhäuser, die wieder erstanden, waren eben doch, wenn man genauer hinsah, nur Attrappen. Die riesigen Schaufenster lockten in Geschäfte, deren größter Teil gar nicht mehr unter dem Dach Platz hatte, sondern aus den Häusern, ohne dass man das unmittelbar wahrnahm, hinten wieder herausquoll. Ich war dagegen Partei für das neue Stadttheater, das vom alten zerstörten keine Reminiszenz aufbewahrte außer, als Zitat, der Ruine der alten Mauer im Innenhof.
Mein Plädoyer für die Moderne wurzelt in der Verehrung des Untergehenden. Tief bewegt hat mich immer das Motiv, mit dem die Athener ihre Demokratie begründeten. Der letzte König, Kodros, hatte sein Leben für Athen geopfert, und niemand wurde für würdig erachtet, sein Nachfolger zu sein. Es ist für mich die schönste Begründung der Demokratie, die ich kenne.
Zur Musealisierung eine schöne Geschichte. Grünewalds Stuppacher Madonna war vor wenigen Jahren von der Gemeinde Stuppach – nicht ohne Widerstand und Bedenken – für einige Wochen an die Stuttgarter Staatsgalerie ausgeliehen und an prominenter Stelle aufgehängt worden: so eine Art Stuttgarter Mona Lisa. Kurze Zeit nach ihrer Aufhängung im Museum kam eine Abordnung der Gemeinde Stuppach und ließ sich vom Direktor »ihre« Madonna zeigen. Der Direktor geriet in eine Mischung von Verlegenheit und Rührung, als die Besucher sich spontan niederknieten und ein Marienlied sangen.
Ähnlich hatte Papst Paul VI. sich im Juli 1967 zum Entsetzen seiner laizistischen türkischen Begleitbeamten am Eingang der zum Museum gewordenen Hagia Sophia in Konstantinopel vor dem Christusmosaik niedergekniet, gebetet und so dem Bild für einige Minuten seine wahre Bestimmung zurückgegeben.
Die früheste Erinnerung an eine schmerzlich wahrgenommene Musealisierung war ein Besuch bei meinem Onkel in Nürnberg, der mich durch die schöne alte Stadt führte und mir zu den gesehenen Dingen viel zu erzählen wusste. Was mich aber abstieß und mir den Besuch fast verleidete, waren die Schildchen, die an den alten Häusern und Monumenten angebracht waren und den Touristen über Herkunft, Bestimmung und Geschichte des jeweiligen Gebäudes informierten. Diese Schildchen verdarben mir die Freude. Sie erschienen mir wie lauter Anführungszeichen, mit denen die Stadt sich selbst einklammerte. Wer wissen will, wer dieses Haus einmal bewohnte oder welchem Zweck es diente, der sollte es sich erzählen lassen, so dachte ich, eben wie ich von einem Onkel, oder aber er konnte es in einem Stadtführer nachlesen. Mir schienen diese Häuser in gewisser Weise schon zerstört, ehe sie einige Jahre später von den Bomben real vernichtet wurden.
So schrieb Proust einmal, dass er die Kathedralen Frankreichs lieber zerstört sähe als ihrem gottesdienstlichen Zweck entfremdet. Schafft museale Vergegenwärtigung Gegenwart? Die Frage stellt sich mir auch, wenn ich die Musikberieselung in französischen Kathedralen über mich ergehen lassen muss. Nachdem man aus dem Gottesdienst den gregorianischen Choral rigoros eliminiert hat, soll nun die Gregorianik aus der Konserve eine gewisse weihevolle Stimmung erzeugen, die sich mit diesem Gesang verbindet. Ich empfinde diese »Virtualisierung« als blanken Hohn.
So empfand ich schon als Kind, ohne diesem Empfinden Ausdruck geben zu können. Vollkommen ausgedrückt fand ich das, was ich von früh auf empfand, als ich im Zusammenhang mit meinem Buch über de Bonald Charles Péguys Kritik am Antimodernismus der französischen Konservativen las. Für Péguy waren die Leute der Französischen Revolution noch Menschen des alten Frankreich, weil sie an Gerechtigkeit glaubten, weil sie überhaupt glaubten. Modernismus aber definierte Péguy als »nicht glauben, was man glaubt«; Funktionalisierung aller unmittelbaren Überzeugungen für politische Zwecke.
Als Modernist ist mir dann später Richard Rorty erschienen mit seiner entschiedenen Absage an so etwas wie »Wahrheit« und seiner Definition eines heute allein möglichen Bildungsziels: Ironie, ein ironisches Weltverhältnis. Die Setzung der »Welt« in Anführungszeichen. Und daraus folgt, was der gegenwärtige Papst als »Tyrannei des Relativismus« bezeichnet.
Es gibt eine unscheinbare, penetrante Unart, die in unserem Land offenbar alle als intellektuell geltenden Menschen ergriffen hat: der inflationäre Gebrauch des Wörtchens »sozusagen« durch den größten Teil aller sogenannten gebildeten Menschen. Gerade auch unter Philosophen ist das Ausmaß dieses Gebrauchs schon grotesk geworden. Und er ist inzwischen auch in den Medien angelangt und zu Ladenverkäuferinnen durchgedrungen. Er beschränkt sich auch nicht mehr darauf, gegenüber irgendeiner These eine gewisse Vorsicht zum Ausdruck zu bringen. Wenn man drei Sätze lang dieses Wort nicht mehr benutzt hat, kann man es nicht mehr zurückhalten und sagt notfalls sogar: »Heute regnet es sozusagen.«
Wären Sie zur selben Einstellung gelangt, wenn Sie zum Beispiel in einem liberalen Elternhaus aufgewachsen wären?
In einer Gegenwelt zu leben wäre mir wohl mit einer liberalen Erziehung schwerer gefallen. Denn dazu bedarf es einer fundamentalen Überzeugung, wie es für mich die Welt des christlichen Glaubens darstellte, die mir in der frühkindlichen Prägung durch meine Mutter und später durch meinen Vater zwanglos vermittelt wurde. Worum ging es bei meiner Erziehung? Die erste Frage im katholischen Katechismus lautete damals: »Wozu sind wir auf Erden?« Meine spätere Frau beantwortete die Frage: »Damit wir lernen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden.« Das sagt auch der Katechismus, nur dass er noch dazusagt, was das Wichtigste ist. Diese Unterscheidung wird am besten gelernt, wenn gute Eltern einen jungen Menschen auf kind- und jugendgemäße Weise teilnehmen lassen an dem, was ihnen selbst wichtig ist. Und das taten meine Eltern. Wichtig ist, was immer ist. Was immer ist, heißt: »Gott«. »Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Alles Übrige wird euch nachgeworfen werden«, lautet ein Jesuswort. Die Freunde der Familie – darunter vor allem Künstler – waren überwiegend Leute, denen dasselbe wichtig war. Dazu gehörte das Leben in und mit der Kirche. Und Vergegenwärtigung des Wichtigen in der Liturgie der Kirche, die damals schön und unter aktiver Teilnahme der Gemeinde gefeiert wurde. Das gehörte zu den Selbstverständlichkeiten in meinem Elternhaus. Man definierte sich nicht primär als politischen Gegner des NS-Regimes. Man gehörte eben einfach einer anderen Welt an. Mein Vater war eher unpolitisch, auch in jungen Jahren, als er die Sparte »Film, Ballett und Varieté« im Feuilleton der »Sozialistischen Monatshefte« betreute. Meine Mutter war der Politik ebenso wenig zugeneigt. Als ich als Kind einmal das in der Schule eingeübte Lied »Deutsch ist die Saar« vorsang – damals stand die sogenannte Rückholung des Saargebiets in das Deutsche Reich bevor – und schließlich die Stelle »Lasst uns in den Himmel schrei’n, wir wollen immer Deutsche sein« zum Besten gab, machte meine Mutter ein indigniertes Gesicht und meinte: »In den Himmel schreit man nicht.«
Ihre Eltern konvertierten zum katholischen Glauben. Aus welchen Gründen?
Der unmittelbare Anlass zu einer Neuorientierung im Leben war der Blutsturz meiner Mutter. Von da an hatte sie jahrelang mit der Tuberkulose zu kämpfen, an der sie dann auch 1936 starb. Der Schock über die Erkrankung veranlasste meine Eltern, über ihr Leben nachzudenken. Bei meinem Vater kamen noch intellektuelle Einflüsse hinzu. Wie er mir später erzählte, gab ihm die Lektüre Rousseaus einen wichtigen Impuls. Er ging auf Distanz zur Großstadtkultur, zum Berliner Kunstleben, in dem er und meine Mutter bis dahin gelebt hatten. Sie begannen zu zweifeln. Besonders beeindruckt hat meinen Vater damals auch der Briefwechsel zwischen Jacques Maritain und Jean Cocteau. 1930 traten dann meine Eltern der katholischen Kirche bei. Um auch einen äußeren Wechsel der Lebenswelt vorzunehmen, zogen sie 1932 nach Münster. Dort studierte mein Vater bei dem Kunsthistoriker Martin Wackernagel, nachdem er zuvor schon bei Heinrich Wölfflin studiert hatte. Durch Wackernagel lernte er die Benediktinerabtei in Gerleve in Westfalen kennen. Die Begegnung mit diesem Kloster, das Erlebnis der Mönchsliturgie, hat ihn, wie er später erzählte, stark beeindruckt. Noch ein anderes Erlebnis kam hinzu, das Chorgebet der Domherren im Dom zu Münster: Lauter gestandene Männer in wichtigen kirchlichen Leitungsfunktionen versammeln sich zum Chorgebet. Alle haben Wichtiges zu tun, aber das Chorgebet ist ihnen noch wichtiger. Dieser Maßstab für das, was wirklich wichtig ist, hatte es ihm angetan. Natürlich sangen die Domherren nicht so schön wie die Benediktinermönche im Kloster Gerleve. Genauer gesagt: Sie sangen überhaupt nicht schön.
Gab es in Ihrer Jugend jemals so etwas wie eine Versuchung, mit der »neuen Zeit« zu gehen?
Ich komme auf das Wichtige und Unwichtige zurück. Wenn man tief überzeugt ist, dass das ewige Leben, dass die Gottesbeziehung das Wichtigste im Leben ist, dann erzeugt das eine gewisse Standfestigkeit, eine Haltung, die einem ein weltliches liberales Elternhaus, wie ich meine, kaum vermitteln kann. Ich habe das um mich herum gesehen. Eltern hielten ihre politische Reserve gegenüber dem Regime vor ihren Kindern geheim, um ihnen Loyalitätskonflikte zu ersparen. So etwas lag meinen Eltern vollkommen fern. Wo die Alternative so abstoßend ist wie der Nationalsozialismus, da entsteht kein echter Konflikt. Eine Versuchung ist eigentlich nie ernstlich zu mir gedrungen. Da vielleicht mitzumachen kam schon deswegen nicht in Frage, weil für mich das Regime in seiner Verachtung der 2000-jährigen europäischen Gesittung zu abstoßend war. Ein anderer Grund war die Art und Weise, wie man die Juden behandelte. Das war so widerlich, dass es keiner besonderen Leistung, keiner Anstrengung bedurfte, um sich davon abzuwenden. Es gab wohl Momente, in denen ich kurz so etwas wie Stolz empfand, etwa als die deutschen Truppen in sechs Wochen die Franzosen zur Kapitulation zwangen. Das hat in jedem Deutschen kurz den Reflex ausgelöst: Donnerwetter, das ist schon toll. Aber dann kam bei mir sofort der Gedanke: Wenn das so weitergeht, verewigt das dieses Regime. Für mich war eben der Sieg Deutschlands untrennbar verbunden mit dem Sieg Hitlers. Das Gefühl des Stolzes verwandelte sich schnell in Niedergeschlagenheit.
Wie haben Sie die Bombenangriffe erlebt?
Ich habe das brennende Köln erlebt, kurz bevor wir 1942 nach Dorsten zogen. Wenn man jung ist, kann man nicht zwei Feinde haben. Man braucht klare Freund-Feind-Verhältnisse: Die Feinde meiner Feinde sind meine Freunde. Darum habe ich die alliierten Bomber nicht als Feinde betrachtet. Ich habe das alles Hitler in die Schuhe geschoben und erst viel später eingesehen, dass es sich da um kapitale Kriegsverbrechen handelte und dass die Verantwortlichen dafür eigentlich schwerste Strafen verdient hätten. So zu denken lag mir damals fern. Im Keller zitterte ich natürlich um mein Leben, aber in Augenblicken, als gerade mal keine Bomben fielen, keine Flakgeschütze dröhnten, hörte ich einen Chor von Nachtigallen. Es war Mai. Sie haben mich getröstet. Ich sagte mir: Die werden sie nicht zum Verstummen bringen. Der Hitler kann nichts machen, und die Bomber können nichts machen. Wir werden vielleicht in zwei Minuten alle tot sein, aber die Nachtigallen werden weiter singen. Dass man auch sie zum Schweigen bringen kann, überstieg meine damaligen Horrorvisionen.
ICH WÄRE GÄRTNER GEWORDEN …
Mein Leben war und ist reich an schönen Augenblicken. Was der schönste Augenblick war, kann ich nicht sagen. Außerdem ginge es niemanden etwas an.
Der dunkelste aber war ein öffentlicher Augenblick: die Zeitungsnachricht am 21. Juli 1944 vom gescheiterten Attentat auf Hitler. Die Befreiung vom Tyrannen hatte also vor der Tür gestanden, und nun hieß es, alle Hoffnung fahren lassen. Würde sich das Reich des Bösen tatsächlich über ganz Europa ausdehnen und unsere Zukunft bestimmen?
Meine Absichten für diesen Fall standen schon fest. Ich wollte Gärtner werden. In der Universität – mit NS-Studentenbund oder gar NS-Dozentenbund – wäre für mich kein Platz. Gärtner braucht man immer. An der vegetativen Natur endet der politische Totalitarismus.
Mein Vater aber, ein frommer Mann, nahm mich beiseite und schlug vor, etwas zu tun, das er sonst nie getan hatte, was aber fromme Leute in der Vergangenheit öfter taten: die Bibel auf gut Glück aufschlagen und mit dem Stift blindlings auf einen Satz tippen. Mein Vater schlug auf, ich tippte. Der Satz, auf den wir stießen, Kap. 16, Vers 20 des Römerbriefs lautet: »Der Gott des Friedens wird den Satan in Bälde unter euren Füßen zertreten.« Ich glaubte dem Orakel nur zu gern. Es passte zu meiner tief verwurzelten Sicht der Dinge: Le pire n’est pas toujours sûr. Dann war der Heldentod der Attentäter vielleicht doch nicht vergeblich. Und wenn vergeblich, so doch nicht sinnlos. Er rettete die Ehre meines Vaterlandes, das ich liebte und für das ich mich schämte – patriotische Gefühle, die meinem Vater eher fremd waren.
Wenige Tage später hörte ich den Direktor meines Gymnasiums in kleinstem Kreise äußern, das Attentat habe scheitern müssen. Die Niederlage Deutschlands hätte es nicht mehr aufhalten können. Aber es hätte den Grund gelegt für eine neue Dolchstoßlegende. Das Volk hätte die Schuld an der Niederlage und an allem Elend in ihrem Gefolge den Attentätern zugeschoben und Hitler zum Märtyrer gemacht.
Übrigens war dieser Direktor, Dr. Feil, Parteimitglied und sonderte an nationalen Feiertagen, an denen er vor versammelter Schule zu reden hatte, so plumpe Sprechblasen ab, dass kaum jemand annehmen konnte, diese Phrasen hätten irgendetwas mit ihm zu tun. Sie hatten nichts mit ihm zu tun. Er war eben kein Held.
Aber er hat mir einmal das Leben gerettet. Das war im Frühjahr 1944. Das Gymnasium Petrinum in Dorsten in Westfalen, das ich damals besuchte, teilte sich die Räume mit dem Dorstener Mädchengymnasium. Vormittags die Buben, nachmittags die Mädchen. An einem Vormittag ging ich während der Pause in den Zeichensaal, zeichnete an die Tafel eine Hitlerkarikatur, schrieb darunter: »Achtung! Totengräber Deutschlands!« und verließ unbemerkt den Saal.
Am Morgen des nächsten Tages verzögerte sich der Unterrichtsbeginn wegen einer improvisierten Lehrerkonferenz. Vom Hausmeister erfuhr ich, im Zeichensaal habe sich ein schlimmer Vorfall ereignet, über den er schweigen müsse, aber über den gerade beraten werde. Mir war klar, worin dieser Vorfall bestand. Die Sache endete indessen wie das Hornberger Schießen. Kurz nach Ende des Krieges erfuhr ich, was geschehen war. Der Direktor, den ich damals auf der Straße traf, sprach mich an: »Sagen Sie mal, Spaemann, das waren doch Sie damals im Zeichensaal, das Führerbild und so weiter.« Ja, gewiss, ich war’s.
Dass ich noch lebe und nicht stattdessen eine Straße nach mir heißt, kam so: Die Zeichenlehrerin der Mädchen entdeckte das Bild und holte die Direktorin, eine echte Nationalsozialistin, die sofort den Direktor anrief, ihn herbeizitierte, ihm die Tafel zeigte und verlangte, umgehend die geheime Staatspolizei herbeizurufen, um den Täter ausfindig zu machen. Der Direktor nahm daraufhin einen Schwamm und wischte das Corpus delicti aus, ehe sich’s die Dame versah, die empört etwas von Strafvereitelung sprach. Der Direktor fuhr sie an: »Frau Kollegin, ich kann nicht zulassen, dass unsere und Ihre Schüler dieses bösartige Produkt der Feindpropaganda zu Gesicht bekommen. Sofort weg damit!«
Wie war der Direktor auf mich als Täter gekommen? Er hatte auf meinem Platz in der Klasse unverfängliche Karikaturen ähnlicher Machart entdeckt und daraus seine Schlüsse gezogen. Ohnehin hätte er auf mich getippt. Übrigens verlor Dr. Feil ein Jahr später durch die Entnazifizierung sein Amt. Die Direktorin nicht. Sie sank viele Jahre später, ausgezeichnet mit staatlichen und kirchlichen Orden, ins Grab.
Mein Elternhaus war unpolitisch. Dass die Nationalsozialisten die Bösen und die geheime Staatspolizei der Feind war, bedurfte keiner Worte. Es gehörte zu den Hintergrundüberzeugungen, mit denen ich aufgewachsen bin und die sich mir empirisch nur bestätigten. Ich kannte damals keine sympathischen Nationalsozialisten, wohl aber sympathische Menschen, die von den Nationalsozialisten verhaftet, gedemütigt oder beruflich benachteiligt wurden.
Außerdem gab es sympathische Opportunisten, wie den Vater meines Jugendfreundes, der mit der Parteimitgliedschaft die Anstellung als Chef einer wichtigen städtischen Behörde bezahlte, obwohl er die Nationalsozialisten ebenso verabscheute wie der Vater der siebenköpfigen Kölner Familie, die mich – meine Mutter war gestorben – während des Theologiestudiums meines Vaters drei Jahre lang als »Pflegesohn« aufgenommen hatte. Der Mann blieb von 1933 bis 1945 Inspektor bei der Stadt Köln und wurde, weil er sich weigerte, der Partei beizutreten, von jeder Beförderung ausgeschlossen. Natürlich sah man in dieser Familie mit einer milden Verachtung auf die opportunistischen, gleichfalls praktizierend katholischen Nachbarn herab. Aber niemand hinderte mich daran, in dieser Nachbarsfamilie meines Freundes freundschaftlich aus- und einzugehen.
Den Heldentod wollte ich auch nicht sterben. Aber ebenso wenig den Tod als Soldat des Führers in einem Krieg, der dessen Herrschaft über Europa für lange Zeit zementieren sollte. Ich hoffte zunächst, dass mir die Entscheidung darüber erspart bliebe durch das Ende des Krieges vor meiner »Wehrmündigkeit«.
Unterdessen bildete sich mein »politisches Weltbild« heraus. Es war ein katholisch-konservatives Weltbild. Ich sympathisierte