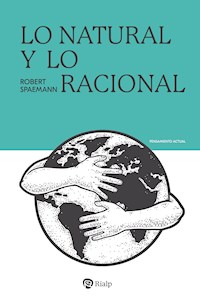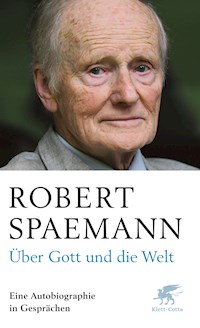35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein philosophisches Plädoyer für einen ganz anderen Umgang mit der Natur Die neuzeitliche Naturwissenschaft beginnt mit dem Verzicht auf die Frage nach der Zielgerichtetheit natürlicher Prozesse. Naturbeherrschung setzt dann ein, wenn in natürliche Prozesse eingegriffen wird und dies auf Grund der Einsicht in kausalgesetzliche Bedingungszusammenhänge geschieht. Dem neuzeitlichen Typus von Wissenschaft entspricht diese Naturbeherrschung: »Eine Sache kennen, heißt wissen, was man mit ihr machen kann, wenn man sie hat«, schreibt Thomas Hobbes. Aber ist die Natur eine Sache? Kennen wir nicht einen ganz anderen Umgang mit der Natur? Primär ist Natur kein Herrschaftsobjekt, sondern unser Zuhause. Natürliche Lebewesen sind kein Verwertungsmaterial, sondern Mitgeschöpfen – sie selbst sind zeitlebens auf etwas aus. Überhaupt gehört die Sicht, dass die Natur zielgerichtet ist, zur Menschlichkeit des Menschen, und hat eine lange philosophische Geschichte. Die Kenntnis dieser Geschichte ist geeignet, szientistische Vorurteile zu zerstören und der natürlichen Naturbetrachtung ihr Gewissen zurückzugeben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Robert Spaemann
Natürliche Ziele
Geschichte und Wiederentdeckung des teleologischen Denkens
Unter Mitarbeit von Reinhard Löw
KLETT-COTTA
GESAMMELTE SCHRIFTEN IN EINZELBÄNDEN
AUSGABE LETZTER HAND
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Reflexion und Spontaneität:
Studien über Fénelon/Robert Spaemann.
1. Aufl. im Verl. Kohlhammer, Stuttgart
Zugl.: Münster, Univ., Habil.-Schr. 1963
2., erw. Aufl. – Stuttgart: Klett-Cotta, 1990.
© 1963, 1990, 2019 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
Datenkonvertierung: Eberl & Koesel Studio, Kempten
Printausgabe: ISBN 978-3-608-96225-3
E-Book: ISBN 978-3-608-12257-2
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Einführung
Die Frage »Warum?«
Die Antworttypen auf die Warum-Frage
1. Die Wiederherstellung des Vertrautseins durch den Nachvollzug einer intentionalen Struktur: Verstehen
2. Die Wiederherstellung des Vertrautseins durch Angabe einer Gesetzmäßigkeit: Erklären
3. Vorläufiges zum Verhältnis der beiden Antworttypen
Die Warum-Frage im Bereich des Lebendigen
I. Platons Konzept der Teleologie
1. Teleologie und platonische Ideenlehre
2. Platons Lehre von der Bewegung
3. Teleologie und platonische
Eros
-Lehre
4. Teleologie und politische Philosophie
II. Aristoteles
1.
Dynamis
und
ousia
als Konstituentien der aristotelischen Theorie der Bewegung
2. Die aristotelische Lehre von der Bewegung
a) Die Antizipationsstruktur der Bewegung: Teleologie im weiteren Sinn
b) Die Orientierung der natürlichen Bewegung am Prinzip des Besten: Teleologie im engeren Sinne
c)
Teleologie und Teleonomie
3. Immanente und transzendente Teleologie
III. Die Ausweitung der Teleologie in der Spätantike und ihre onto-theologische Fundierung in der Scholastik
1. Die Universalteleologie im stoischen Denken
2. Die Vollendung der teleologischen Weltsicht: Thomas von Aquino (1225–1274)
a)
Die Intellektualisierung der teleologischen Weltsicht
b)
Der Beweis für Teleologie in der Natur
c)
Teleologie und Theologie
d)
Die Stufungen der Strebensinhalte
e)
Die Realisierung der repraesentatio des Göttlichen durch das Endliche
3. Höhepunkt und Peripetie des teleologischen Denkens
IV. Krise und Entmachtung des teleologischen Denkens bis zur Frühneuzeit
1. Die Krise der Naturteleologie im Hochmittelalter und der Frühneuzeit. Argumente und Motive bei Buridan, Bacon, Descartes
a)
Teleologie und Theologie
b)
Teleologie und Nominalismus: Die Unerkennbarkeit des
telos
c)
Teleologie und praktische Argumentation
d)
Qualitative und quantitative Naturbetrachtung
2. Die Inversion des teleologischen Denkens
a)
Politische Philosophie
b)
Moraltheologie
c)
Philosophische Ethik
3. Nietzsches Angriff auf die invertierte Teleologie (Vorgriff)
V. Vermittlungsversuche zwischen Teleologie und Universalmechanik bei Leibniz, Wolff und Kant
1. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716)
2. Christian Friedrich Wolff (1679–1754)
3. Immanuel Kant (1724–1804)
a)
Der kritische Ansatz in der Zeit der »Kritik der reinen Vernunft« (1781) [KrV] und der »Metaphysische(n) Anfangsgründe der Naturwissenschaft« (1786) [MAdN]
b)
Die Analyse des Zweck-Begriffes in der »Kritik der Urteilskraft« (1790) [KU]
4. Die verschiedenen Formen der Zweckmäßigkeit bei Kant
a)
Subjektive, formale, ästhetische Zweckmäßigkeit
b)
Subjektive, formale, logische Zweckmäßigkeit der Natur
c)
Objektive, formale Zweckmäßigkeit
d)
Objektive, materiale, äußere Zweckmäßigkeit (auch relative Zweckmäßigkeit, Zuträglichkeit)
e)
Objektive, materiale, innere Zweckmäßigkeit (auch: absolute Zweckmäßigkeit, Natur-Zweckmäßigkeit)
5. Das Verhältnis von kausalmechanischer und teleologischer Naturinterpretation
6. Die ontologische Dimension des Teleologieproblems
7. Die praktisch-philosophische Dimension des Teleologieproblems
8. Das Teleologieproblem im Werk des späten Kant (nach 1796)
VI. Teleologie im Deutschen Idealismus: Fichte, Schelling, Hegel
1. Johann Gottlieb Fichte (1762–1814)
2. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775–1854)
a)
Schellings Begriff der Natur
b)
Materie und Leben
c)
Teleologie und Natur
3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831)
a)
Der endliche und der anschauende Verstand
b)
Objektivität und Mechanismus
c)
Teleologie als Wahrheit des Mechanismus
d)
Teleologie in der Geschichte
e)
Teleologie und Kultur
VII. Die Radikalisierung und Zerstörung der Erhaltungsteleologie im 19. Jahrhundert
1. Arthur Schopenhauer (1778–1859)
2. Friedrich Nietzsche (1844–1900)
a)
Nietzsches Kritik an der Teleologie der Selbsterhaltung
b)
Nietzsches Kritik an der herkömmlichen Teleologiekritik
c)
Übermensch und Ewige Wiederkehr des Gleichen – Nietzsches ateleologische Teleologie
d)
Hegel in Nietzsche
VIII. Die Vollstreckung des Antiteleologismus durch die Naturwissenschaft des 19. und 20. Jahrhunderts
1. Grundlagen des biologischen Darwinismus
2. Evolutionstheorie und Teleologie
3. Die Ausweitung der Evolutionstheorie auf das gesamte Gebiet der Wissenschaft
Haeckels Monismus
4. Die entteleologisierte Wirklichkeit
IX. Kritik am Antiteleologismus
1. Gegenkritik an der Evolutionstheorie
a)
Innerbiologische Kritik am Evolutionsprogramm
b)
Philosophische Kritik am Evolutionsprogramm. Die Analyse einiger zentraler Begriffe
2. Gegenkritik an der wissenschaftstheoretischen Analyse des Teleologieproblems
a)
Die analytische Kritik am teleologischen Denken
b)
Ziele und Zwecke als Kategorien der Selbsterfahrung
X. Die wiederentdeckte Teleologie
1. Zum symbolischen Charakter der Sprache
2. Das Misslingen der »Entanthropomorphisierung«
3. Der neue Status der Evolutionstheorie
4. Zur »Notwendigkeit« teleologischen Denkens
5. Teleologisches Denken und Beweislast
6. Teleologie und Interesse
7. Der ontologische Status der Teleologie
XI. Teleologie und Teleonomie
Anmerkungen
Einführung
I. Platons Konzept der Teleologie
II. Aristoteles
III. Die Ausweitung der Teleologie in der Spätantike und ihre onto-theologische Fundierung in der Scholastik
IV. Krise und Entmachtung des teleologischen Denkens bis zur Frühneuzeit
V. Vermittlungsversuche zwischen Teleologie und Universalmechanik bei Leibniz, Wolff und Kant
VI. Teleologie im Deutschen Idealismus: Fichte, Schelling, Hegel
VII. Die Radikalisierung und Zerstörung der Erhaltungsteleologie im 19. Jahrhundert
VIII. Die Vollstreckung des Antiteleologismus durch die Naturwissenschaft des 19. und 20. Jahrhunderts
IX. Kritik am Antiteleologismus
X. Die wiederentdeckte Teleologie
XI. Teleologie und Teleonomie
Verzeichnis der verwendeten Literatur (Auswahl)
Personenregister
Vorwort
Dieses Buch ist die lange Vorrede zu einem kürzeren, streng systematischen Buch, das noch nicht existiert und vielleicht gar nicht existieren kann. Denn – kann man streng systematisch über Teleologie reden? Platon(1) benutzte die Metapher des Überredens, um die Einwirkung der Vernunft auf die Notwendigkeit und deren Orientierung am »Besten« zu charakterisieren. Und so könnte es ja sein, dass zur Anerkennung einer solchen Wirksamkeit auch nur überredet werden kann, wenngleich mit besseren Gründen als zum Gegenteil. So sah es zum Beispiel Kant(1): Zum einzig vernünftigen, nämlich teleologischen Gebrauch der Urteilskraft angesichts lebendiger Organismen kann niemand genötigt werden. Ein solcher Gebrauch wird uns nur durch die Wirklichkeit dringend nahegelegt.
Im Wintersemester 1976/77 habe ich einen solchen Versuch der Überredung zum Naheliegenden gemacht. Der größte Teil desselben bestand in einer Präsentation der Geschichte des Problems, ohne deren Kenntnis die Debatten der Gegenwart unter ein längst erreichtes Niveau zurückfallen und das Rad immer von neuem erfinden. Der Niederschlag dieses Versuchs, die Tonbandnachschrift einer frei gehaltenen Vorlesung für Hörer aller Fakultäten in München, lag ein paar Jahre in der Schublade, bis Reinhard Löw(1) mir die Nachschrift entlockte, um auf ihrer Basis ein Buch zu machen – ohne Beseitigung der für eine Vorlesung charakteristischen Redundanzen, unter Hinzufügung einiger Abschnitte, so unter anderem über Schelling(1), unter Weiterführung der Überlegungen zur Evolutionstheorie und unter Anfügung zahlreicher Anmerkungen. Ich selbst habe für die zweite Auflage den Vortragstext »Teleologie und Teleonomie« beigefügt. Er kann auch als Resümee oder Kurzfassung dessen gelesen werden, wozu ich überreden möchte.
Das Buch soll dazu anregen, über ein der Wissenschaft liebgewordenes Vorurteil noch einmal von vorne an nachzudenken – das Vorurteil, Sinn sei eine Variante von Unsinn, Vernunft eine Variante von Unvernunft, und der Mensch selbst sei ein Anthropomorphismus.
»Natürliche Ziele« ist der neue, deutlichere Titel des Buches »Die Frage ›Wozu?‹«, das ich mit meinem früh verstorbenen Schüler und Kollegen Reinhard Löw(2) 1981 erstmals veröffentlicht habe und für dessen erneute Herausgabe ich dem Verlag Klett-Cotta danke.
Stuttgart, im Sommer 2005
Robert Spaemann
Einführung
»Die Betrachtung natürlicher Prozesse unter dem Aspekt ihrer Zielgerichtetheit ist steril, und wie eine gottgeweihte Jungfrau gebiert sie nichts«, hat Francis Bacon(1) geschrieben, einer der Herolde jener »tapferen neuen Welt«, in der gottgeweihte Jungfrauen keinen Platz haben.[1] Die Frage, ob auf Dauer für Menschen darin Platz bleiben werde, wäre Bacon wohl ganz unverständlich gewesen. Nutzenmaximierung durch wissenschaftliche Naturbeherrschung schien ihm ein eindeutiges Ziel und wichtiger als der unbedingte Respekt vor den Wesen, um deren Nutzen allein es gehen kann. Dem Anwalt der Krone waren peinliches Verhör, Folter und Rechtsbeugung im Dienste des entstehenden Absolutismus ebenso legitim wie die Reduktion des Umgangs mit der Natur auf das peinliche Verhör.[2] Die Frage, wozu etwas gut sein muss, um gut zu sein, ist nicht nützlich. Aber wie wollen wir wissen, was nützlich ist, wenn wir diese Frage unbeantwortet lassen?
Dass etwas geschieht, weil es zu etwas gut ist, das ist offensichtlich dann der Fall, wenn wir selbst etwas aus diesem Grunde tun. Es ist die heute noch herrschende Ansicht, es sei nur dann der Fall. Die teleologische Betrachtung anderer Prozesse als menschlicher Handlungen sei aus naturwissenschaftlichen, logischen und sprachanalytischen Gründen unzulässig, weil prinzipiell teleologische in nicht-teleologische Theorien, teleologische in nicht-teleologische Sprechweisen überführbar seien. Dieser Ansicht soll im Folgenden widersprochen werden. Schon prima facie kommen dem, der die einschlägige Literatur liest, Zweifel. Der Zweifel richtet sich erstens auf die niemals diskutierte Beweislastverteilung. Gesetzt den Fall, es sei wahr, dass teleologische Rede sich prinzipiell in nicht-teleologische übersetzen ließe, so würde auch das Umgekehrte gelten. Es gibt jedoch ein stillschweigendes Einverständnis, dass die eine Sprache vor der anderen den Vorrang habe und dass nicht etwa die nicht-teleologische, sondern die teleologische Sprache im Falle ihrer Übersetzbarkeit eliminiert werden oder doch auf den Status einer uneigentlichen Rede herabgesetzt werden müsse. Dabei wird unterstellt, dass der »Teleologe« etwas Sonderbares und Unwahrscheinliches behauptet, wenn er von einer prinzipiellen Ähnlichkeit menschlicher Handlungen mit anderen Arten des Geschehens ausgeht. Wo für diese Ähnlichkeit der Beweis nicht erbracht werden könne, müsse vielmehr die Unähnlichkeit als das »Normale« für bewiesen gelten. Wenn wir bedenken, dass Aristoteles(1) den Anaxagoras(1) als ersten »Nüchternen unter irre Redenden« bezeichnete, weil er gegenüber den ionischen Naturphilosophen finale Deutungen in die Natur eingeführt habe, dann hatte er offenbar einen anderen Begriff von Normalität und von dem, was im Zweifelsfalle der Begründung bedürftig sei und was nicht. Ohne über das »Interesse der Vernunft bei diesem ihrem Widerstreite« (Kant(2)) zu sprechen, das heißt hinter diese Paradigmendifferenz zu schauen, ist das Teleologieproblem gar nicht entscheidbar. Es sei denn, es ist durch eine definitorische Immunisierungsstrategie im vorhinein entschieden. Dass dies häufig geschieht, ist der zweite Primafacie-Grund dafür, an der angeblich definitiven Erledigung des Teleologieproblems zu zweifeln. Dass Zwecke »gesetzt« werden, dass solche Setzung nur durch einen bewussten Willen geschehen kann, dass als solcher zwecksetzender Wille nur der menschliche Wille infrage komme, all das wird in der Regel erst einmal als selbstverständlich vorausgesetzt, um dann in umständlichen Verfahren zu zeigen, dass so verstandene Zwecke in der außermenschlichen Natur nicht »vorkommen«.[3] Eine andere Immunisierungsstrategie besteht darin, dass man einen Begriff von Erklärung einführt – zum Beispiel das sogenannte Hempel(1)-Oppenheim(1)-Schema –, der auf eine deterministische Abhängigkeit bestimmter Ereignisse von Antecedensbedingungen abhebt. Natürlich folgt daraus, dass der Begriff einer »teleologischen Erklärung« aus empirischen und logischen Gründen zu verwerfen ist.[4] Aber was ist mit einer so trivialen Einsicht gewonnen?
Aufgabe der Philosophie ist nach einem Worte Hegels(1) »Erkenntnis dessen, was in Wahrheit ist«. Im Unterschied zu Disziplinen, die sich mit spezielleren Interessen der Wirklichkeit nähern, kann Philosophie nicht das Raster von Nominaldefinitionen an die Wirklichkeit herantragen. Sie würde dabei zwar bestimmte Antworten auf bestimmte Fragen erhalten, aber sie wüsste nicht, ob sie die richtigen Fragen gestellt hat. Was sind richtige Fragen? Was sind richtige Fragen, wenn wir Menschen »kennenlernen« wollen? Wir können viele Aspekte an sie herantragen, Aspekte der Haar- und der Hautfarbe, der Tierkreiszeichen oder des Intelligenzquotienten. Wir können ihre Handlungsweisen statistisch untersuchen, wir können einen Selbstmordversuch in Relation setzen zu statistischen Selbstmordraten in bestimmten Jahreszeiten – sie sind bekanntlich im Sommer höher als im Winter – oder zu dem Land, in dem der Mensch lebt.
»Was in Wahrheit ist«, erfahren wir freilich nur, wenn wir mit dem Menschen selbst sprechen. Was er selbst denkt, meint, fühlt und will, erfahren wir nur, wenn wir, ehe wir über ihn sprechen, mit ihm gesprochen haben. Mit ihm sprechen heißt nicht nur: ihn Fragen beantworten lassen, die wir ihm stellen. Das kann genügen, wo uns ein spezifisches Erkenntnisinteresse leitet, wo wir z. B. die Eignung als Filialleiter oder Pilot testen wollen. Wo es uns darum geht, ihn »als ihn selbst kennenzulernen«, müssen wir unsere Interviewbogen zur Seite tun und uns in Umgang und Gespräch einlassen, in welchem nicht wir allein mehr »Herr des Verfahrens« sind.
Gibt es ein analoges »Kennenlernen der Natur«? Wir können, so scheint es, nicht mit der Natur reden, sondern nur über sie. Und wenn wir schon die Analogie des Sprechens verwenden wollen, so scheint doch eher Kant(3) mit dem Bild des Richters recht zu haben, der die Zeugen im Zeugenstand verhört, oder Goethe(1), der sagt, dass wir die Natur auf die Folter spannen, um Aussagen zu erpressen, ungeachtet dessen, dass die so Erpresste vielleicht von sich aus ganz anderes mitzuteilen hätte.[5]
Genau dies ist das Problem der Teleologie. Die These, die am Vorabend der neuzeitlichen Wissenschaft steht, besagt, dass solches Reden in bezug auf die Natur nutzlos, empirisch unausweisbar und sinnlos ist.[6] Diese These beendete die fast zwei Jahrtausende währende Vorherrschaft der aristotelischen(2) Ansicht, dass wir die Natur nur erkennen können, wenn wir sie aus sich selbst heraus zu verstehen versuchen. Warum kommt es zu dieser Wende?
Die Philosophie als das Bemühen, die Wirklichkeit zur Sprache zu bringen, muss zunächst an solche Fragen ohne nominal-definitorische Vorentscheidungen herantreten.
Die Frage »Warum?«
Eine der ersten und bleibenden Fragen, mit denen wir uns in der Welt bewegen, ist die Frage nach dem Warum eines Ereignisses. Die Antwort: »um … zu« ist eine von mehreren möglichen Antworten. Wenn man sich diese Antwort prinzipiell versagt, so besteht die Möglichkeit, dass man selbst durch alle anderen Antworten nicht das erfährt, was man eigentlich wissen wollte. Aber warum fragen wir »warum«? Was wollen wir eigentlich wissen, wenn wir so fragen? Die Frage entsteht immer dann, wenn ein normaler Ablauf unterbrochen wird. Ihr Ziel ist die Wiederherstellung des normalen Ganges. Ohne den Begriff der Normalität lässt sich gar nicht verstehen, wann und warum man »warum« fragt. Es kommt ja keinem in den Sinn, in bezug auf Alles und Jedes »warum« zu fragen. Wir fragen genau dann »warum«, wenn etwas geschieht, was wir nicht als normal betrachten, bzw. was wir nicht erwartet haben.
Wenn jemand mittags zum Essen geht, fragen wir nicht: »Warum gehst du essen?«, denn wir unterstellen, dass man mittags hungrig wird und zum Essen geht. Wenn er nicht zum Essen geht, dann fragen wir ihn vielleicht am Abend danach, das heißt wir fragen nicht nur nach nicht-normalen Ereignissen, sondern auch nach Nicht-Ereignissen, die dann zu Ereignissen werden, wenn wir an ihrer Stelle normalerweise ein anderes Ereignis erwartet hätten.
Hinter der Warum-Frage steht der Versuch, Neues in Bekanntes zu integrieren.Freilich könnte man das Neue auch auf sich beruhen lassen. Doch normalerweise tun wir das nicht,[7] sondern versuchen, es so mit dem Gewohnten und Bekannten zu vermitteln, dass es zu einem Bestandteil der uns vertrauten Welt wird.
Somit lassen sich zwei Voraussetzungen für die Warum-Frage angeben:
Ein Zustand der Vertrautheit mit der Welt muss vorausgesetzt werden, für welchen eine Antwort als Antwort erscheinen kann. Wenn jemand von einem fremden Stern auf die Erde käme und ihm alles, was hier geschähe, gänzlich unvertraut wäre, dann hätte die Warum-Frage überhaupt keinen Sinn, weil jede Antwort genauso unverständlich wäre wie das Ereignis, auf das sich die Frage bezog.
Dieser Zustand der Vertrautheit muss gestört sein, denn eine vollständig vertraute Welt würde ebenfalls keine Warum-Frage aufkommen lassen.
Als Basis für jedes intakte Weltverhältnis haben Psychologen das »Urvertrauen« des Kindes bezeichnet.[8] Dieses Vertrauen bildet sich in einem allmählichen Aneignungsprozess. Vertraut sind zunächst Brust und Stimme der Mutter. Dann spielt das kleine Kind mit seiner Hand, sieht, wie sie sich bewegt, und findet das erheiternd. Langsam merkt es, dass es selbst diese Hand bewegt, dass die Hand ihm gehört. Die Aneignung des eigenen Körpers ist der Beginn der fortschreitenden Aneignung der Welt.[9] Fremdes hört auf, fremd zu sein. Diesen Vorgang nannten die Stoiker oikeiosis, das Einhausen und Sich-zugehörig-Machen der Welt.
Beim Kind folgt nach der Phase des sinnlichen Vertrautwerdens mit der Welt die sprachliche Manifestation desselben Phänomens: die Periode des penetranten und unausgesetzten Warum-Fragens, wodurch immerzu Neues in die oikeiosis einbezogen wird. Das Neue soll in das Vertraute integriert, die Verstehbarkeit der Welt ständig neu wiederhergestellt werden. Denn Verstehen heißt Vertrautsein, heißt Aufhebung der Fremdheit des Begegnenden.
Die Antworttypen auf die Warum-Frage
Es gibt zwei verschiedene Richtungen, das Vertraute mit dem Unvertrauten zu verknüpfen. Diesen beiden Richtungen entsprechen die beiden Typen von Antworten, die auf die Warum-Frage gegeben werden können. Der erste Typus bildet Sätze, die sich in einer Konstruktion des »Um … zu« darstellen lassen, der zweite Typus gibt Antecedensbedingungen und Gesetze an.[10] Wir wollen zunächst diese beiden Typen herausstellen und ihr Verhältnis in den letzten beiden Kapiteln diskutieren.
1. Die Wiederherstellung des Vertrautseins durch den Nachvollzug einer intentionalen Struktur: Verstehen
Wir richten die Warum-Frage an einen Menschen, der etwas für ihn oder uns Ungewöhnliches tut. Wenn jemand nicht zu Mittag isst und wir ihn fragen, warum er es nicht tut, so mag er zum Beispiel antworten, dass er eine Schlankheitskur macht. Das können wir verstehen, denn es leuchtet ein, dass jemand aus medizinischen oder ästhetischen Gründen nicht beliebig dick werden will. Aber es könnte auch sein, dass wir ihn schon für dünn genug halten. Dann fragen wir weiter, bis wir eine Antwort erhalten, die es uns erlaubt, das Ereignis so zu verstehen, dass wir es in eine Normalsituation einfügen können. Da hört das Weiterfragen auf. Wenn wir etwa als Antwort erhielten: »Ich möchte einige Pfund leichter werden, weil ich mich dann besser fühle«, und wir würden weiter fragen: »Warum willst du dich denn besser fühlen?«, dann bekämen wir zurecht zur Antwort: »Warum fragst du so dumm?« Die Antwort auf die erste Frage könnte auch lauten, er esse nichts, weil Fastenzeit sei; und das könnte wiederum einleuchten, wenn wir etwa derselben Religionsgemeinschaft angehören oder von unserer eigenen Erfahrung her wissen, was fasten heißt. Andernfalls werden wir weiterfragen, was denn die Fastenzeit für einen Sinn hat. Auch hier aber hört das Fragen auf, wenn wir sein Verhalten so einfügen können, dass wir seine Gründe, bei entsprechendem Verändern der Randbedingungen, als solche verstehen, die auch uns selbst motivieren könnten.
Auf diese Weise lernen wir mit anderen Menschen »umzugehen«. Sicherheit im Umgang setzt gegenseitige Verständlichkeit der Handlungen voraus. Würde der Partner in jedem Augenblick völlig Unerwartetes tun, so hörte alle Gemeinsamkeit auf. Er schiede aus jedem möglichen Interaktionszusammenhang aus. Wer etwas verspricht und das Versprechen nicht hält, als Grund aber nicht irgendwelche Hindernisse angibt, sondern zurückfragt: »Warum soll ich denn ein Versprechen halten?«, der bricht aus der normalen Situation und damit aus dem Interaktionszusammenhang aus. Wichtig ist das vor Gericht. Wenn die Motive eines Täters gänzlich unverständlich sind, wenn sich keiner der am Prozess Beteiligten überhaupt einen Reim darauf machen kann, warum der Täter so gehandelt hat, dann wird dieser nicht bestraft – auch Strafe ist eine Form der Interaktion –, sondern in eine Klinik eingewiesen.
Wenn eine Handlung keine nachvollziehbare intentionale Struktur besitzt, dann bezeichnen wir sie nicht als Handlung, sondern als Geschehen. Dann kann die Warum-Frage auch nicht mehr auf ein »Um … zu« zielen, sondern nur noch auf den zweiten Typus (s. u.), das heißt wir fragen nach den Ereignissen, Kindheitserlebnissen oder nach den endogenen Faktoren, die das Geschehene durch eine Erklärung ganz anderer Art verständlich machen, nämlich durch Einfügung in die Normalsituation eines kausalgesetzlichen Zusammenhangs. Die Warum-Frage, an Menschen gerichtet, zielt auf eine nachvollziehbare, intentionale Struktur des Handelnden, eine Wollensstruktur. Dieses Wollen ist der Handlung nicht äußerlich, sondern es qualifiziert eine Handlung erst als Handlung. Alle anderen Gründe – vorhergegangene Ereignisse etc. – sind dem Handelnden äußerlich, sind Randbedingungen. Zu Handlungsgründen werden sie erst, wo sie im Bewusstsein des Handelnden zu Prämissen für eine praktische Folgerung werden.
Handlungen unterscheiden sich von anderem Geschehen durch ihre symbolische Natur, durch ein Moment nachvollziehbarer Allgemeinheit. Für Unterlassungen gilt das nicht minder; schon in ihrem Begriff ist die Abweichung von einer Normalität enthalten, die sie von beliebigem Nicht-Handeln unterscheidbar macht und der Begründung bedürftig erscheinen lässt. Einen Grenzfall, der für die künftigen Überlegungen wichtig sein wird, bildet das Vergessen. Wir werfen unter Umständen jemandem Vergessen vor. Wir fragen: »Warum hast du das vergessen?« Die Frage scheint, so wie sie gestellt ist, nicht beantwortbar zu sein. Dass jemand etwas vergisst, heißt ja gerade, dass er etwas, was man von ihm erwartete, ohne Grund unterlässt, sodass man eigentlich nur nach kausalen Ursachen des Vergessens fragen dürfte. Wenn wir dennoch Vergessen jemandem vorwerfen, dann deshalb, weil wir es in einem größeren Praxiszusammenhang sehen und weil wir den Vergesslichen unter Umständen für die Haltung verantwortlich machen, aus der dann das Vergessen resultierte. So werfen wir ihm zum Beispiel vor, dass er der Sache, die er vergaß, zuvor, als er noch an sie dachte, nicht die ihr zukommende Wichtigkeit gegeben, oder dass er gegen seine eigene, ihm bekannte Vergesslichkeit nicht hinreichende Vorkehrungen getroffen hat. Die Psychoanalyse spricht sogar von einem unbewusst-absichtlichen Vergessen, der »Verdrängung«. Die psychoanalytische Rede vom Unbewussten hat insofern den Bereich teleologischen Verstehens längst über den Bereich bewusster »Zwecksetzung« hinaus ausgedehnt. Was denn eine »unbewußte Absicht« eigentlich heißen könne, wäre aber näher zu erörtern.[11] In allen Warum-Fragen an handelnde Menschen erscheint uns eine Antwort nur dann als befriedigend, wenn sie eine uns nachvollziehbare, intentionale Struktur aufweist. Wir können die Antwort »verstehen«. Letztlich befriedigend ist die Antwort freilich erst, wenn die intentionale Struktur »unendlich« ist, das heißt, wenn sie nirgendwo zu ihrer Erklärung des Verweises auf eine ihr selbst äußerliche Struktur faktischer Kausalgesetzlichkeit bedarf. Wir können auch sagen: wenn ihr Zweck ein Selbstzweck oder wenn die sie definierende Normalität ein absoluter, das heißt in sich stehender Sinnzusammenhang ist.
Verstehen hat immer die perfektische Form des Verstanden-Habens. Verstehen ist keine Methode oder Operation,[12] die man mit dem Erklären im Sinne des Hempel(2)-Oppenheim(2)-Schemas parallelisieren könnte, sondern Verstehen ist allenfalls das Resultat von Erklärungen. Es ist eine Art des Nicht-mehr-Weiterfragens, weil das Stadium der Vertrautheit wiederhergestellt ist.
2. Die Wiederherstellung des Vertrautseins durch Angabe einer Gesetzmäßigkeit: Erklären
Die Warum-Frage wird nicht nur an handelnde Menschen gerichtet. Wenn wir danach fragen, warum es blitzt und donnert, und wenn wir davon ausgehen, dass es auch hier darum geht, die Vertrautheit gegen das Fremde wiederherzustellen, dann ist dies nicht im Sinne des Sich-Identifizierens mit Personen gemeint.[13] Hier wird die Vertrautheit wiedergefunden durch die Angabe eines gesetzmäßigen Zusammenhanges bzw. durch die Erzählung, wie es dazu kam. Die Erzählung berichtet Begebenheiten vor dem zu erklärenden Ereignis. Solche Begebenheiten können verstehbare Handlungen sein oder aber irgendwelche anderen Zustände und Ereignisse.
Nehmen wir an, eine Brücke ist eingestürzt. Was wollen wir denn wissen, wenn wir fragen, warum sie eingestürzt ist? Der erste Typ von Antworten wäre: es war Sabotage (Handlung), oder man hat versäumt, die richtigen Prüfungen vorzunehmen (Unterlassung). Der zweite Typ besagt: es war ein Materialschaden, oder die Belastung war zu stark. Sowohl die Sabotage als auch der Materialschaden sind Antecedensbedingungen, die aufgrund von Naturgesetzlichkeiten mit jenem zu erklärenden Ereignis verknüpft sind. Der Unterschied beider liegt nur darin, dass die Handlung definiert ist durch ihre Absicht, eben jenes Ereignis hervorzubringen, zu dessen Erklärung sie dient, das nicht-handlungsartige Ereignis hingegen nicht. Es ist mit dem zu erklärenden Ereignis durch jene Gesetzmäßigkeit verknüpft, aufgrund derer erfahrungsgemäß stets Ereignisse von der Art A bei Vorliegen bestimmter Randbedingungen Ereignisse von der Art B zur Folge haben. Wenn wir die Handlung, die zu B führt, verstehen wollen, müssen wir von B sprechen. Für einen Genossen des Terroristen oder einen, der das Kriegsziel kennt, bedarf es keiner weiteren Erklärung, um »das Ganze« zu verstehen. Ein anderer bedürfte noch einiger weiterer Schritte des »Um … zu«, bis der Anschluss an die ihm nachvollziehbare Normalität hergestellt ist. Vielleicht gelingt dieser Anschluss auch gar nicht, und er muss irgendwo auf die Suche nach Antecedensbedingungen »naturaler Art« gehen.
Diese Suche, die im zweiten Falle der Erklärung des Brückeneinsturzes schon von Anfang an beginnen muss, schließt sich nie zu einem vollständigen Kreis des Verstehens, da ja kein Antecedensereignis per definitionem mit dem zu erklärenden Ereignis verknüpft ist. Jede auf die Antecedensbedingungen zielende Warum-Frage kann nur wieder auf frühere und noch umfassendere Bedingungen verweisen. Wenn wir die Gesetzmäßigkeit und die Randbedingungen zur Erklärung angegeben haben, so erhebt sich sofort die Frage, warum denn die Randbedingungen vorlagen. Hierfür muss nun auf neue Gesetze und neue Randbedingungen rekurriert werden usf. Auch hier wird das Ereignis, das von der Normalität abweicht, durch Rekurs auf eine übergeordnete Normalität erklärt. Diese besteht in einem Naturgesetz. Aber die Randbedingungen sind ihrerseits der Erklärung bedürftig, denn sie sind in der übergeordneten Normalität noch nicht enthalten. Hier wird somit kein Kreis der Vertrautheit hergestellt, der ein Weiterfragen als unsinnig erscheinen lässt, sondern hier erhalten wir eine Verknüpfung von Wenn-dann-Beziehungen, die wesentlich unabgeschlossen ist, im Zeitrücklauf unendlich offen. Pragmatisch hört das Fragen zwar irgendwo auf – so genau wollten wir es gar nicht wissen –, aber das Ende wird willkürlich von uns bestimmt und liegt nicht in der Sache selbst. Deswegen wird auch nicht eigentlich Vertrautheit – also Verstehen – hergestellt, sondern eher Sicherheit. Beim Gravitationsgesetz gibt es nichts zu verstehen, sondern es gibt etwas zu konstatieren:
Wir haben gemessen, und die Messungen haben sich bestätigt. Wenn es anders wäre, würden wir dies auch zur Kenntnis nehmen. Wir können nicht verstehen, warum G* gerade den Wert 6,67 × 10–1 m3/kg s2 hat; es hat ihn eben.[14] Anstelle des Vertrauens in die Verstehbarkeit der Natur tritt ein Vertrauen in ihre Beherrschbarkeit, in die Sicherheit unseres Eingreifen-Könnens in ihre Abläufe.
3. Vorläufiges zum Verhältnis der beiden Antworttypen
Die intentionale Antwort auf die Warum-Frage schließt dann, wenn man die intentionale Struktur nachvollziehen kann, die Frage nach dem Ereignis ab. Die kausale Erklärung schließt sie nicht ab, sondern sie verschiebt die Frage im Grunde nur, da sie angibt, worauf etwas folgte. Wenn man sagt: B geschah, weil A vorherging, so bedeutet das »weil«: immer dann, wenn A geschieht, geschieht anschließend B. Wie kann etwas, das eigentlich nur Antwort auf das Woher eines Ereignisses ist, auch als Antwort auf das Warum akzeptiert werden? Erstens deshalb, weil wir tatsächlich im Alltagsbewusstsein »Ursachen« eben doch nach Analogie von Handlungssubjekten verstehen. Im Begriff der Ursache stecken in Wirklichkeit selbst noch teleologische Implikationen, wie wir später sehen werden. Die konsequente Entteleologisierung hat deshalb auch den Begriff der Kausalität beseitigt und durch den der Gesetzmäßigkeit ersetzt, bei der es gar nichts mehr zu verstehen gibt außer den Worten, mit denen das Gesetz formuliert wird.[15] Verstehen im Sinne eines Nicht-mehr-weiter-Fragens bleibt hier ein unendliches Ideal: das Ideal einer sogenannten Weltformel, die das Ganze erklären und damit alle einzelnen Warum-Fragen beantworten würde, sodass auf den intentionalen Antworttypus ganz verzichtet werden könnte. Die Antizipation der Möglichkeit einer solchen Formel dient als Verstehensersatz. Jedes Stück Woher enthält das geheime Versprechen, dem totalen Verstehen näherzukommen. Dabei setzen wir freilich voraus, das totale Woher sei, weil es keine weiteren Fragen zuzulassen scheint, auch das totale Warum; absolute Beherrschung der Wirklichkeit fiele mit dem absoluten Verstehen derselben zusammen, vollständige Sicherheit wäre gleichbedeutend mit vollständiger Vertrautheit. Aber ist das wahr?
Es gibt zwei Arten von Sicherheit; diejenige des Menschen im Kreise seiner vertrauten Freunde und diejenige des Herrschers, der über alle Instrumente der Beherrschung verfügt. Die zweite Art der Sicherheit ist nach Platon(2) (Politeia IX) von ganz anderer Art als die erste: die Jagd nach ihr wird mit dem Verlust des Besten im Leben bezahlt und ist doch prinzipiell vergeblich. Es hülfe dem Tyrannen nichts, dass er die ganze Welt beherrschte, er muss sich doch auf seine Leibwachen verlassen, die ihn stürzen, seine Ärzte, die ihn ermorden können. Er muss täglich neu und expansiv seine Sicherheitsvorkehrungen überdenken. Es gibt keinen Ersatz für die Geborgenheit des Menschen im Kreise seiner Freunde. Freunde aber hat nach platonisch(3)-aristotelischer Überzeugung nur der Gute.
Die absolute Beherrschung der Wirklichkeit erscheint nicht nur als ein nichterreichbares, sondern auch als ein nicht-wünschenswertes Ziel. Wir stoßen schon hier auf die noch zu diskutierende Vermutung, dass wir von der Frage nach dem theoretischen Verhältnis der beiden Antworttypen letztlich zu einer praktischen Fragestellung gelangen: ob die Vertrautheit im Kreise der Befreundeten wünschenswerter ist als die Sicherheit durch progressive Beherrschung des Fremden.
Die Warum-Frage im Bereich des Lebendigen
Wenn wir einmal von der durchschnittlichen Ansicht ausgehen, dass die teleologische Perspektive bei menschlichen Handlungen, die kausale bzw. die Gesetzesperspektive bei physikalischen Prozessen angemessen ist, so bleibt der Bereich der lebendigen Natur als eigentliches Problemfeld des teleologischen Denkens. Beide Antworttypen können hier offensichtlich verwendet werden. Auf die Frage: »Warum läuft der Hund zum Fressnapf?«, kann man antworten: »Weil er Hunger hat.« Damit ist eine nachvollziehbare intentionale Struktur angeboten. Man kann auch mit einer Summe von chemisch-physiologischen Gesetzmäßigkeiten und vorliegenden Randbedingungen antworten. Und erneut gilt, dass die kausale Antwort immer weiter zurückverweist, ohne einen Kreis des Verstehens herzustellen. Wo mit Bezug auf das Lebendige die kausalgesetzliche Betrachtungsweise als einzig zulässige gilt und Teleologie als »Teleonomie« in diese Betrachtungsweise zurückübersetzt wird, da bleibt das nicht folgenlos für das Selbstverständnis des Handelnden. Unter Voraussetzung der Evolutionshypothese lässt sich nämlich auch nicht mehr begründen, warum teleologische Antworten im Bereich des menschlichen Handelns etwas anderes sind als eine façon de parler bzw. ein systematisches Selbstmissverständnis, durch das allein Handeln sich von anderen Geschehensformen unterscheidet. Dieser Gedanke wird uns im letzten Kapitel ausführlich beschäftigen. Es ist sicher für die Weise, wie wir als Menschen auf der Erde leben, von der einschneidendsten Bedeutung. Die Existenz gottgeweihter Jungfrauen, die nicht gebären, ist eben keineswegs folgenlos.
Die Betrachtung natürlicher Prozesse unter dem Aspekt ihrer Richtung ist zweifellos rein kontemplativ, ist kein Herrschaftswissen, nicht geleitet vom Eingreifen-Wollen in natürliche Prozesse, und sie lehrt auch nicht, wie dies zu machen ist. Ihr Interesse ist es, die Natur als Vertraute so anzueignen, dass wir unsere Zugehörigkeit zu ihr realisieren können, ohne zugleich unser Selbstverständnis als handelnde Wesen aufzugeben.
Das Selbstverständnis des Menschen im Ganzen der Wirklichkeit heißt Philosophie. Von Anfang an stand das Teleologieproblem im Mittelpunkt philosophischen Nachdenkens. Die »Riesenschlacht um das Sein«, von der Platon(4) spricht (Soph 246a), kann ebenso als Riesenschlacht um das »Um … willen«[16] interpretiert werden. Es geht hier nicht um die Frage nach Existenz oder Nicht-Existenz eines anfänglich definitorisch Gesetzten, sondern um ein adäquates Verständnis von Sein, in welchem die Erfahrung, die sich im Wort telos – als Ziel, Zweck, Ende und »Um … willen« – ausspricht, unverkürzt aufgehoben ist. In der Vergegenwärtigung einiger zentraler Positionen der Philosophiegeschichte[17] sollen Voraussetzungen gewonnen werden, den Begriff des telos erst einmal angemessen zu fassen. Damit soll für eine systematische Diskussion des Teleologieproblems der Boden bereitet werden.
I. Platons(5) Konzept der Teleologie
Die Anfänge des Nachdenkens über die Natur bei den frühen ionischen Naturphilosophen sind – man muss dies deutlich sehen – nicht teleologisch. Aristoteles(3) hat das Denken der ionischen Naturphilosophen als antiteleologisch und materialistisch verstanden. Und so muss man es wohl verstehen, wenn man an die Ionier Fragen stellt, wie sie Aristoteles stellte. Sie selbst hatten so nicht gefragt. Sie hatten sich abgewandt von einer mythologischen Betrachtung, für welche die natürlichen Prozesse Resultate von göttlichen Handlungen waren, die Welt selbst ein Spielball in der Hand der Götter. Sie haben nach dem der Welt zugrunde liegenden Einen gefragt und dieses als das präsente Göttliche verstanden. »Auch hier nämlich sind Götter« – mit diesen Worten bat Heraklit(1) die staunenden Besucher in seine Küche[1]. Das göttliche Eine ist das, woraus die Dinge entstehen und in das sie wieder vergehen – so Anaximander(1). Nicht nach einem der Natur äußeren Woher und Wozu fragten die Ionier, sondern nach dem wesentlichen Was. Diese Frage aber war für sie gleichbedeutend mit der nach dem Woraus und dem Wie.
Philosophische Teleologie, wie sie erstmals bei Anaxagoras(2), dann aber vor allem bei Platon(6) und Aristoteles(4) auftritt,[2] ist dem gegenüber etwas Zweites. Sie ist Reflexion auf das, was in diesem anfänglichen »wissenschaftlichen« Denken verlorenging, und der Versuch, den entstandenen »Phänomenverlust«[3] philosophisch wieder einzuholen. Teleologisch erklären heißt bei Platon(7) und Aristoteles(5): etwas »durch das Beste erklären«, das heißt zeigen, dass etwas geschieht, weil es so am besten ist. Darauf aber ist das Woraus und das Wie der Naturphilosophen gerade nicht gerichtet. Die Alten, so schreibt Aristoteles im 1. Buch der Metaphysik, haben nur eine Form der arche, des Anfangs gekannt,[4] – die Frage nach der Ursache des Guten und Schönen haben sie nicht gestellt.[5] Sie kannten nur materielle archai; es gab für sie kein Entstehen und Vergehen substanzieller, in sich stehender Strukturen und Formen, sondern nur akzidentelle Veränderungen des einen Substrats. Die Welt bestand nur aus den jeweils verschiedenartigen Aggregats- und Verdichtungs-/Verdünnungszuständen der einen zugrundeliegenden materiellen Wirklichkeit, sei diese nun Wasser, Luft oder das »Unbegrenzte«, das apeiron.
Das moderne Denken ist in vielfacher Hinsicht zum vorsokratischen Denken zurückgekehrt,[6] auch die moderne Logik. Aristoteles(6) unterschied Begriffe, die wesentlich Subjektbegriffe sind, von solchen, die wesentlich Prädikatbegriffe sind. Wenn wir sagen: »Eben sang der Vogel, jetzt schweigt er«, so bleibt der Vogel doch ein Vogel, auch wenn er gerade nicht singt. Hört er aber auf, ein Vogel zu sein, dann sagen wir nicht: »Er verlor die Eigenschaft, ein Vogel zu sein«, sondern wir sagen: »Er existiert nicht mehr.« Subjektbegriffe sind diejenigen, die einem Wesen nicht abgesprochen werden können, ohne dass ihm zugleich die Existenz abgesprochen wird. Die moderne Logik macht diese Unterscheidung nicht. Sie drückt den Satz: »Der Vogel singt« aus als: »Es gibt ein x, für das gilt: x ist ein Vogel, und x singt.« Das heißt, Vogelsein und Singen werden als Prädikate grundsätzlich gleichrangiger Art einem x zugesprochen.[7] Dieses x war bei den Alten inhaltlich bestimmt, zum Beispiel bei Thales(1) als Wasser. Diese eine universelle arche existiert in verschiedenen Aggregat- bzw. Verdichtungs-/Verdünnungszuständen, sodass man sagen kann: einmal ist das Wasser ein Vogel und singt, einmal ist es eine dahinziehende Regenwolke, einmal ist es ein Philosoph und denkt.
Wenn Entstehen und Vergehen nur die akzidentellen Veränderungen des einen Substrats darstellen, dann kommt man mit der Frage nach der Ursache der Veränderungen in Schwierigkeiten.[8] Es gibt ja nur das eine Substrat und dessen Zustandsänderungen. Worin sollten diese begründet sein? Man kann ja nicht von verschiedenen, aufeinander einwirkenden Dingen sprechen. Wenn aber echte Verschiedenheit Schein ist, dann ist auch alle Veränderung Schein. Diese Konsequenz hat die eleatische Schule gezogen. Parmenides(1) fasst »Sein« als obersten Gattungsbegriff. Zu der Gattung des Seins kann es aber keine spezifische Differenz geben. Denn alles, was man außer dem, dass sie ist, von einer Sache noch sagen könnte, fällt wiederum unter den Begriff des Seins – alle Differenzen sind also, sofern sie sind, eben gerade keine Differenzen. Sie sind nur Schein.
Mit solcher Reflexion hat sich die Philosophie aufs Äußerste von unserer Erfahrung und unserem normalen Denken entfernt. Demgegenüber bestimmt Aristoteles(7) als Aufgabe der Philosophie die »Rettung der Phänomene«. Denn das eleatische Denken gewinnt seine Plausibilität für das Denken durch die Leugnung derjenigen Phänomene, um deren Begreifen es zu tun wäre. Die von Zenon(1) aus Elea, einem Schüler des Parmenides(2), entwickelten Paradoxa[9] sind von äußerstem Scharfsinn. Seine Schlussfolgerungen laufen indes immer aufs gleiche hinaus: das, was wir sehen, lässt sich nicht denken – also kann es nicht sein. Falsches Denken aber kann auch nicht sein, denn falsches Denken wäre Denken von Nichtseiendem. Und Nichtseiendes kann nicht gedacht werden.
Die extrem entgegengesetzte Position des Heraklit(2) machte eine Naturphilosophie nicht minder unmöglich. Wenn alles bewegt ist, wenn es im Fluss der Wirklichkeit nichts Bleibendes zu unterscheiden gibt, dann lässt sich ein Wissen von der wirklichen Welt gar nicht gewinnen: kaum gedacht oder gesprochen, ist es schon wieder falsch. Platon(8) wird in seiner Lehre von der Bewegung an beide Positionen anknüpfen, wenn er sagt: vom Bewegten gibt es im strengen Sinne keine Wissenschaft. Anaxagoras(3) aus Klazomenai wird von Aristoteles(8) das Verdienst des ersten »Teleologen« zugesprochen. Er habe als erster entdeckt, dass in der ganzen Natur der nous (Vernunft) der Grund von kosmos (Schönheit) und taxis (Ordnung) sei: »Anaxagoras war der erste Nüchterne unter Irreredenden.«[10]
Uns fällt für eine teleologische Sprache nicht gerade das Prädikat »nüchtern« ein. Aber was Aristoteles(9) meint, lässt sich am Beispiel eines Gedichtes, das in einzelnen Buchstaben vor uns am Boden liegt, leicht illustrieren. Wenn einer sagt, er hätte die Buchstaben aus einem Sack einfach so hingeworfen, und das Gedicht hätte sich dabei ergeben, so sind wir wenig geneigt, ihn als einen Nüchternen zu bezeichnen im Vergleich zu dem, der sagt, er habe die Buchstaben absichtlich so arrangiert. Ebenso hat der wissenschaftliche Versuch, das Laufen des Hundes zum Fressnapf ohne das Wort »Hunger« und sein Gebell bei der Heimkehr des Herrn ohne das Wort »Freude« zu interpretieren, immer etwas Phantastisches, ebenso wie die Herleitung des Sokrates(1) aus dem Urknall. Vor allem deshalb, weil wir bei ateleologischen Erklärungen zu einem unendlichen Regress in der Kausalforschung genötigt werden. Der unendliche Regress aber ist für Aristoteles das Unvernünftige schlechthin.
Die Wirklichkeit, so wie sie Parmenides(3) oder Heraklit(3) erklärten, ist radikal unvertraut und fremd. Anaxagoras(4) holt sie in die Vertrautheit zurück, wenn er sagt, dass die Ursache des Schönseins zugleich der Grund der Wirklichkeit – arche ton onton – selbst sei.
Doch Platon(9) wie Aristoteles(10) werfen Anaxagoras(5) vor, er habe den nous nur als ein allgemeines metaphysisches Prinzip eingeführt, das jedoch für jede konkrete Erklärung folgenlos bleibe. Es bleibe sozusagen »ein Rad, bei dessen Drehung sich nichts mitdreht« (Wittgenstein(1)).
Sokrates(2) verlangt im »Phaidon«, dass Anaxagoras(6) das Prinzip des Vernünftigen und Besten auf wirkliche Gegenstände tatsächlich anwende.[11] Das aber überfordert den Anaxagoras und sein Prinzip. Doch mit den materiellen Gründen ist Sokrates nicht zufriedenzustellen. Wenn aber der Königsweg, die Ordnung der Welt unmittelbar durch den nous zu begreifen, verwehrt ist, so will Sokrates das Problem durch die zweitbeste Möglichkeit, den deuteros plous, die »zweite Fahrt«, lösen (Phaidon, 99c).
1. Teleologie und platonische(10) Ideenlehre
Warum flieht Sokrates(3) nicht aus dem Gefängnis? Auf diese Frage ist es keine befriedigende Antwort: weil sich seine Sehnen und Knochen nicht bewegen. Befriedigend ist: weil er den Gesetzen Athens gehorchen will. Das ist für Platon(11) die Ursache des Nichtfliehens. Im »Phaidon« führt Platon die wesentliche Unterscheidung zwischen Ursache und notwendiger Bedingung ein, zwischen causa und conditio sine qua non. Wenn Sokrates fliehen wollte und er wäre gelähmt, so würde ihn sein Fluchtwille freilich nicht aus dem Gefängnis bringen. Aber die Bewegung von Sehnen und Knochen ist nur Bedingung; was seine Flucht als Flucht, also als begründetes Handeln, qualifizieren würde, wäre das, was den Willen zur Flucht begründet.
Diese Unterscheidung würde aber, so schreibt Platon(12), von den meisten, die Theorie treiben,[12] allenfalls zugestanden, wo es um menschliches Handeln geht. Aber wie ist es in der Natur? Was ist die Ursache für Schönheit und Ordnung in ihr? Des Anaxagoras(7) erste Antwort: »Das Schöne ist durch die Vernunft schön« ist misslungen; sie bleibt leere Behauptung. Die zweite Antwort ist die Platons: »Das Schöne ist durch das Schöne – das heißt durch die Schönheit – schön.« (Phaidon, 100 c)
Dieser Satz erscheint zunächst als eine bloße Tautologie.[13] Was aber macht ein Bild zu einem schönen Bild, einen Menschen zu einem schönen Menschen? Nicht spezifische, materielle Details,[14] sondern die bestimmte Ordnung, die wir schöne Ordnung nennen. Diese lässt sich nicht aus den Elementen herleiten, aus denen sie besteht, auch nicht aus der psychischen Veranlagung dessen, der sie schön nennt.[15] Und die bestimmte Verteilung der Elemente in Raum und Zeit, durch die uns etwas schön erscheint, können wir nicht noch einmal durch eine andere Eigenschaft charakterisieren als eben durch jene, schön zu sein. George Edward Moore(1) hat gezeigt, dass das Prädikat »gut« nicht durch irgendwelche anderen Prädikate ersetzt oder mit deren Hilfe rekonstruiert werden kann, und er hat alle solche Versuche als »naturalistic fallacies« bezeichnet.[16] Es ist dies eine durchaus platonische(13) Argumentation. »Everything is what it is, and not another thing« (Bischof Butler(1)) – das ist die Grundeinsicht der platonischen Philosophie. Weder das Woraus der Ionier noch der universalteleologische nous des Anaxagoras(8), sondern das Wesentliche einer Sache ist hier Thema, das eidos, die Idee. »Alles übrige«, sagt Sokrates(4), »würde mich nur verwirren« (Phaidon 100 d). Die Entstehungsbedingungen des Schönen ändern nichts daran, dass der Grund des Schönen allein in der Idee des Schönen liegt.
Die Ideenlehre enthält Platons(14) Antwort auf das bis heute aktuelle Problem des Zusammenhangs von Genesis und Geltung. Die faktische Entstehung eines Phänomens erklärt weder sein Sosein noch seine Geltung. Es ist umgekehrt: die Entstehungsbedingungen lassen Gegenstände einrücken in schon bereitstehende Formen. Nicht Formen werden hervorgebracht, sondern Dinge. Etwas entsteht, indem es ein solches oder ein solches wird. Das Sosein, in das die Dinge einrücken, ist nicht selbst Resultat der Entstehungsprozesse.
Platon(15) verdeutlicht dies am Verhältnis von Mathematik und Physik. Die Mathematik entsteht nicht aus der Physik, sondern an physikalischen Prozessen lassen sich mathematische Strukturen ablesen. Natürliche Vorgänge lassen Gegenstände in mathematische Strukturen einrücken, die ihrerseits von jenen Prozessen unabhängig sind und gelten. Worüber wir reden, wenn wir über die Wirklichkeit reden, ist nicht der ständige Fluss der Veränderungen, sondern es sind die unveränderlichen Strukturen. Diese allein beharren in aller Bewegung der Dinge, und nur von ihnen ist strenge Wissenschaft möglich.
Hiergegen wird Aristoteles(11) polemisieren: Platon(16) hebe alle Wissenschaft von der Natur auf, wenn er nur die Mathematik als Wissenschaft zulasse. Er komme nur zu einer angewandten Mathematik, aber nie zu einer Physik. Die Mathematik kann Strukturen interpretieren, aber nicht die Frage beantworten, warum natürliche Prozesse Gegenstände in identische mathematische Strukturen einrücken lassen. Geometrische Figuren können sich nicht bewegen,[17] so lautet Aristoteles’ einfache Begründung für seine These, dass die Mathematik ungeeignet ist, um über natürliche – und das ist: bewegte – Dinge zu sprechen. Aristoteles dehnt diese Kritik auf die ganze Ideenlehre aus: »Die Betrachtung der Idee reicht nicht aus, um einen Kranken zu heilen.«[18] Zwar ist der Arzt von dieser Idee geleitet, aber davon allein ist er nicht Arzt.[19] Dazu muss er nämlich wissen, wie man jemanden heilt, und dieses Wissen stammt nicht aus der kontemplativen Betrachtung der Idee der Gesundheit. Die eigentliche Frage ist die nach der Idealität, der »Kunstmäßigkeit« von Prozessen. Platons Satz, das Schöne sei durch die Schönheit schön, enthält keine Belehrung darüber, wie denn Schönes zustande kommt, und keine Anweisung, wie man es zustande bringt.
Diese Polemik, so wirkungsvoll sie uns auf Aristoteles(12)’ eigene Ansicht von der Natur vorbereitet, sieht freilich davon ab,[20] dass Platon(17) diese Problematik wohl sah und daher auch in zwei Büchern – den »Gesetzen« und dem »Timaios« – von der Bewegung gehandelt hat. Die Rede von der Kunstmäßigkeit von Bewegungen wird jedoch ausdrücklich nicht in der gleichen Strenge vorgetragen wie die Ideenlehre oder die Mathematik. Wenn wir von Bewegtem sprechen, so Platon, dann erzählen wir Geschichten und äußern mehr oder weniger wahrscheinliche Meinungen, doxai. Dass Bewegung selbst mathematisch fassbar sein könnte, das kommt Platon ebensowenig in den Sinn wie Aristoteles.[21]
In den »Gesetzen« setzt Platon(18) sich mit antiteleologischen Lehrmeinungen (vermutlich denen Demokrit(1)s) auseinander, die er ausdrücklich »gescheit« nennt.[22] Nach diesen Theorien werden die größten und schönsten Dinge – Weltkörper, Tiere, Pflanzen – von Natur und Zufall hervorgebracht. Atome mit Haken und Ösen bringen durch richtungslose Bewegung im Weltraum zufällig bestimmte Gestalten hervor. Kunstmäßige natürliche Prozesse, so fährt Platon fort, müssen göttlich sein. Die Leugnung des Göttlichen ist gleichbedeutend mit der Leugnung der Kunstmäßigkeit in der Natur. Das Problem spitzt sich zu auf die Frage nach der Priorität von Kunst oder Natur. Muss die Kunst aus der Natur erklärt werden, sodass sie – natürliche wie menschliche – letztlich in Nicht-Kunst gründet? Wenn Kunst die sterbliche Erfindung eines nur-natürlichen Wesens ist, dann – so Platon – hat sie keine Wahrheit. Sie macht dann nicht offenbar, wie die Wirklichkeit von sich her ist, sondern sie ist Epiphänomen. Die Kunst kann die Wahrheit der Natur nur enthüllen, wenn diese selbst nicht bloß ein kunstloses factum brutum ist.
Die Alternative ist für Platon(19) aber kein theoretisches Gedankenspiel, sondern sie ist von entscheidender Bedeutung in der Gesetzgebung und der Staatskunst, und deswegen muss sie auch in den »Gesetzen« verhandelt werden. Die Staatskunst kann nur wahrheitsfähig sein, wenn man voraussetzt, dass diejenigen, die Gegenstand dieser Kunst sind, selbst teleologisch verfasst sind; dass sie also schlechter oder besser sein können. Nur dann lässt sich sagen, die Kunst werde den Menschen gerecht oder nicht gerecht. Wenn die Natur des Menschen zufällig ist, dann hat es keinen Sinn, von Gerechtigkeit zu sprechen. Ob es also Gerechtigkeit gibt, hängt für Platon davon ab, ob wir die natürlichen Prozesse teleologisch interpretieren oder nicht.[23]
Wenn die Staatskunst wirklich Kunst ist, dann kann sie die Regierten zu ihrer Selbstverwirklichung bringen. Bei einer nicht-teleologischen Interpretation der natürlichen Prozesse überformt die sogenannte Staatskunst das Material, mit dem sie es zu tun hat, und bringt nur die Regierenden zu ihrer Selbstverwirklichung. Das war die sophistische Position, wie Platon(20) sie in den Figuren des Kallikles(1) im »Gorgias(1)« und des Thrasymachos im »Staat« vorführt. Gegen sie macht er freilich geltend: Wenn die Regierten kein telos haben, dann auch die Regierenden nicht. Auch für sie gibt es dann nichts, was den Namen der »Selbstverwirklichung« verdiente. Alles ist nur, wie es ist. Staatskunst und Gerechtigkeit sind Worte ohne Bedeutung. Wenn die Natur kunstlos ist, dann ist die Wahrheit der Kunst die Natur; dann gibt es kein »Um … willen« und kein »Sollen« in der Natur (und im Menschen), dann sind auch die Götter nur ein Werk der (nur so genannten!) Kunst. Alles läuft daher auf die Frage hinaus: wer schafft wen? Die Götter den Menschen oder der Mensch die Götter?
Wenn die natürlichen Bewegungen nicht als gerichtet interpretiert werden, dann gibt es auch keinen Maßstab, an welchem die Handlungen gemessen werden können. Das höchste Recht ist das der kunstlosen Natur, und das ist das mechanische Recht des Stärkeren. Damit beantwortet Platon(21) auch gleich die Frage nach dem »Interesse der Vernunft bei diesem ihrem Widerstreite« (Kant(4)). Das Interesse ist ein eminent politisches.
»Die Götter vor allem, behaupten diese Leute, existierten nur durch Kunst, nicht von Natur, sondern durch gewisse Gesetze, und seien deshalb an verschiedenen Orten immer wieder andere, je nachdem die einzelnen bei der Aufstellung ihrer Gesetze unter sich übereinkommen. Insbesondere sei auch das Schöne etwas anderes von Natur und etwas anderes nach dem Gesetz. Das Gerechte liege ohnehin gar nicht in der Natur; darüber seien die Menschen unter sich fortwährend im Streit und machten ewige Änderungen daran. Was sie dann umändern, und wann, das gelte nun allemal, beruhe aber auf Kunst und den gemachten Gesetzen, keineswegs irgend auf der Natur. Dies alles, liebe Freunde, sind Ansichten der gescheiten Leute, die sich vor der Jugend so aussprechen und in Prosa oder Poesie behaupten, das höchste Recht sei, was einer mit Gewalt durchzusetzen vermöge. Daher kommen dann bei jungen Leuten so viele Handlungen der Gottlosigkeit, als gäbe es keine Götter; und dann kommen daraus innere Zwistigkeiten, indem sie die Leute zu einem Leben hinziehen, das nur nach der Natur richtig ist und in Wahrheit darin besteht, dass man über die anderen ein Herr sei, nicht seinem Nächsten dient nach dem Gesetze.«[24] In der Gegenwart hat wohl Michel Foucault(1) den von Platon(22) hier kritisierten Gedanken am radikalsten erneuert. Wenn es, wie er sagt, stimmt, dass »jeder Diskurs den Dingen Gewalt antut«, wenn also Vernunft nur eine Form von Gewalt unter anderen ist, dann freilich gibt es nur das Recht des Stärkeren.
Kehren wir jedoch zur theoretischen Dimension des Bewegungsproblems zurück. Platon(23) schließt sich, wie wir sahen, seinen Vorgängern insoweit an, als er festhält, dass es vom Bewegten kein im strengen Sinne wissenschaftliches Wissen gibt. Dieses kann sich nur auf identische Strukturen beziehen: über Dreiecke kann man etwas wissen, unabhängig davon, wie die wirklichen Dreiecke an wirklichen Tafeln beschaffen sind. »Die Sätze der Geometrie sind unabhängig vom Kreidevorrat der Welt« (Heinrich Scholz(1)). Obwohl wissenschaftliche Rede nur in bezug auf solche Strukturen möglich ist, kann man dennoch sinnvoll auch über Bewegung sprechen. Dies ist möglich, weil Bewegung nicht schlechthin der Idee entgegengesetzt ist, sondern selbst im Verhältnis zu Strukturen steht. Die Rede über sie ist deshalb in jenem Zwischenbereich zwischen Wissen und Nichtwissen angesiedelt, den Platon(24) Meinung, doxa, nennt. Rede in diesem Medium ist nicht wissenschaftlicher Beweis, sondern Unterredung durch Plausibilitätsargumente und unter Zuhilfenahme von Begriffen, die nicht scharf definiert sein können. Platon bedient sich einer bildhaften, metaphorischen, teilweise auch mythologischen Ausdrucks- und Argumentationsweise. Solche Redeweise kann nicht noch einmal präzisiert oder entmythologisiert werden. Der Gegenstand der Rede, die Bewegung und das Bewegte, ist nicht in der Weise »bestimmt«, dass auf eine bestimmte Weise davon gesprochen werden könnte.
2. Platons(25) Lehre von der Bewegung
Vom Bewegten theoretisch sprechen heißt für Platon(26), es aus den Kategorien einer Philosophie des Immerseienden »rekonstruieren«. Die beiden fundamentalen, nicht mehr aufeinander reduzierbaren Konstitutionsprinzipien der Wirklichkeit sind Einheit und Vielheit.[25] Aus diesen beiden resultiert das zweite Begriffspaar: Identität und Andersheit. Auf den ersten Blick scheint dieses dasselbe wie das erste Gegensatzpaar auszudrücken. Man kann sich leicht klar machen, dass dies nicht zutrifft. Denn das Eine ist zwar mit sich identisch. Im Verhältnis zur Vielheit aber wird das Eine selbst zum Anderen.
Genau das hatte Parmenides(4)nicht realisiert. Er hatte gefordert, man müsse den Schein der Vielheit und so der Bewegung aufheben, um zum Einen zu gelangen. Gerade damit aber ist zugestanden, dass es etwas anderes gibt als das Eine: nämlich den Schein. Und auch, wenn die Bewegung Schein ist, so ist dieser gegenüber dem Einen ein Differentes, und das Eine ist selbst ein Differentes gegenüber dem Schein.
Ebenso steht es mit dem Prinzip der Vielheit. Auch das Viele partizipiert an der Identität, denn es kann nur ein Vieles von untereinander Unterschiedenen sein, die jeweils mit sich identisch sind. Vielheit kann erst zur Wirklichkeit kommen, wenn sie am Prinzip der Identität teilhat. Auf der Ebene der unvermittelten Entgegensetzung gegen das Eine ist Vielheit, gefasst als reines Prinzip, das me on, das Nicht-Seiende. Als solches hatte es Parmenides(5) bezeichnet, aber für Platon(27) ist das Viele nicht schlechthin Nicht-Seiendes. Vermittelt durch die Dialektik von Identität und Andersheit hat das Viele vielmehr am Einen teil. Es ist Vielheit von Einheiten. Die Einheit von Einheit und Vielheit, die Identität von Identität und Andersheit ist die bestimmte, gerichtete Bewegung, das Werden. Von ihm muss bei Platon deutlich unterschieden werden die ungerichtete Bewegtheit, die reine kinesis.
Die ungerichtete Bewegtheit ist dem Reich der Ideen schlechthin entgegengesetzt; sie entspricht dem »Fluß« des Heraklit(4)ismus. Wenn man Bewegung als Fluss beschreibt, dann hat sie schon Teil an Struktur und Idee. Der Bereich der heraklitischen Bewegtheit ist erst angemessen erfasst als ein pures Ineinanderübergehen von allem in alles. Hier kann gar nicht ein Gegenstand als ein sich verändernder bestimmt werden; es gibt gar nicht Einheit und damit Identität eines »sich Verändernden«.[26]
Dieser Zustand der Entropie, der vollkommenen Ungeordnetheit der gesamten Wirklichkeit kann gar nicht mehr als »Wirklichkeit« gedacht werden. Daher spricht Platon(28) auch vom Nicht-Seienden. Aber wir müssen dieses in aller konkreten Wirklichkeit als »Substrat« voraussetzen, weil Wirklichkeit ja nie reine Struktur ist. Das Konkrete ist strukturiert, aber es ist nicht selbst die Struktur. Wir müssen stets ein Material hinzudenken, das von der Struktur strukturiert wird. Der Bereich des puren Vielen, des erst zu Ordnenden, des Materials ist dem Bereich des Einen und Guten schlechthin entgegengesetzt. Wenn das Konkrete sich zu erhalten strebt, so heißt das gerade nicht, dass es sein Material erhalten will, sondern seine Gestalt bei wechselndem Material. Die Gestalt ist daher für jedes Ding das Gute.
Die zweite Bedeutung von kinesis bei Platon(29) ist die der gerichteten Bewegtheit, des »Werdens« von etwas. Etwas hat teil an bestimmten Ideen dadurch, dass es sich in einem bestimmten, geordneten Zustand befindet. Die Bewegung, die auf den Gewinn dieser Struktur und Einheit abzweckt, bedarf der Begründung, sie ist nicht selbstverständlich. Die richtungslose Bewegtheit, kinesis im ersten Sinn, bedurfte einer Begründung ebensowenig wie der Bereich der Idee. Das Eine ist das, was sich von sich selbst versteht; wer in das Eine eingegangen ist, der fragt nicht mehr.[27] Der Zustand der vollkommenen Ungeordnetheit bedarf ebenfalls keiner Erklärung, oder besser: er ist gar keiner Erklärung fähig. Für das schlechthin dem Sinn Entzogene kann es nicht noch einmal eine sinnvolle Begründung geben. Christliche Autoren sagten später: Gott kennt den Grund des Bösen nicht. Warum? Weil es da nichts zu kennen gibt.[28]
In der gerichteten Bewegung jedoch findet eine Vereinigung der beiden Prinzipien statt, die von sich selbst her einander entgegengesetzt sind. Diese Vereinigung ist kontingent und zufällig, einer Warum-Frage zugänglich und einer Erklärung bedürftig.
Die Sätze der Geometrie können zwar abgeleitet werden, aber sie sind letzten Endes nicht noch einmal einer Erklärung zugänglich in dem Sinne, dass man nach dem Grund der Grundprinzipien der Geometrie fragt. Die Grundprinzipien sind es ja erst, die so etwas wie geometrische Begründung ermöglichen. Sie werden eingesehen oder nicht eingesehen, angenommen oder nicht angenommen. Wenn irgendwo Gegenstände ungeordnet herumliegen, so bedarf die Unordnung auch keiner Begründung; die Frage, warum eine Müllhalde gerade diese ihre Konstellation habe, ist unsinnig. Aber wenn ein Dreieck an der Tafel steht, so kann man sinnvoll fragen, warum es dort steht.
Das Strukturierte, aber zufälligerweise Strukturierte ist für Platon(30) der Erklärung bedürftig. Die Idee kann nicht der Grund dafür sein, dass etwas an ihr teilhat, vor allem aber nicht für die Entstehung eines Dinges, das an der Idee teilhat.
Die Idee des Dreiecks ist nicht der Grund dafür, dass jemand Dreiecke an die Tafel malt. Der Grund ist, dass jemand es für »gut« hält, sich oder anderen mit Hilfe dieser Zeichnungen etwas zu verdeutlichen. In diesen und ähnlichen Fällen ist das Gute ein der dargestellten Figur Äußerliches, Akzidentelles. Aber die Gestalt, die den Dingen »von Natur« zukommt, ist Resultat eines auf Herstellung und Bewahrung dieser Gestalt gerichteten Strebens. Sein Sosein ist für jedes Seiende das Gute.
Die Idee des Guten ist für Platon(31) konstitutiver Grund dafür, dass die Ideen Konkretes strukturieren. »Das Gute« begründet die universale Struktur aller wirklichen Dinge: die des Gerichtetseins auf ein »Um … willen«. Dinge sind, modern gesprochen, Systeme, und jedes System ist dadurch definiert, dass die Bewegungen, die sich in ihm abspielen, funktional sind mit Bezug auf die Reproduktion einer bestimmten Struktur.
Die Idee des Guten repräsentiert die universelle Struktur alles Wirklichen in seinem Gerichtetsein. Das universale Ziel der endlichen Wesen ist Sein, Dauer, Einheit in einem bestimmten Sosein. Das in der Zeit existierende, endliche Wesen muss danach streben, sein Sein, das es in diesem Augenblick hat, auch im nächsten Augenblick zu haben. Zeitlichkeit der endlichen Dinge bedeutet, dass sie fundamental durch Mangel an Sein bestimmt sind. Ihr Dasein ist daher Sorge, Streben nach Sein. Platon(32) spricht im »Symposion« von eros, dem Ausdruck der Bedürftigkeit endlicher Wesen nach Sein, nach Autarkie. Gründend im me on, dem nicht-seienden Unbegrenzten, der ungerichteten Bewegtheit, erscheint ihre Teilhabe an der autarken Ruhe des Einen als Synthese von Einheit und Bewegtheit in Form von gestalteter und gerichteter Bewegung.
Während der Gott alle ihm möglichen Zustände gleichzeitig besitzt, muss im Bereich des Endlichen Sukzession stattfinden. Die Planeten führen die edelste Bewegung aus, die Kreisbahn. Sie durchlaufen alle ihnen möglichen Zustände nacheinander. Bei den Lebewesen wird dieser Prozess nur in der Gattung verwirklicht. Das einzelne Individuum kann sich nur für eine Weile im Sein halten.
Die gerichtete Bewegung setzt für Platon(33) ein aktives Prinzip voraus, kraft welchem die Richtung auf das Eine und Gute genommen und gehalten wird. Dieses Prinzip nennt er Seele, psyche. Wo sie fehlt, gibt es nur Passivität, und alle Bewegung ist dort nur beliebige Folge von äußerlichem Gestoßenwerden. (Lebewesen werden nicht einfach gestoßen; sie können selbst ihre Wahrnehmungsschwellen gegenüber der Außenwelt verändern und reagieren auf Reize mit spezifisch-lebendigen Antworten.)[29] Die Seele als das Prinzip der Selbstbewegung ist der Grund aller gerichteten Bewegung. Selbst im Anorganischen werden die Bewegungen, die niemals ganz ungerichtet sind, zurückgeführt auf das organische Prinzip der Weltseele, die das ganze Weltall durchwaltet.[30] Die Seele ist mit Vernunft, nous, ausgestattet, und mit ihr lenkt sie gleichsam wie mit einem Kompass die Bewegung in die Richtung auf das Gute hin. Im platonischen Spätdialog über die Kosmologie, dem »Timaios«, wird die Verfertigung[31] der Welt dargestellt als das Werk eines Gottes, des Demiurgen. Der Demiurg ist gewissermaßen ein Handwerker, der aus vorgegebenem Material – hier dem richtungslos bewegten Vielen – sein Werkstück schafft. Als Mittler und Hersteller gibt der Demiurg, indem er auf die Ideen schaut, der Welt eine schöne Gestalt.
Man könnte fragen: ist der Demiurg nicht eher eine mythologische Gestalt, eine Adhoc-Hypothese, als eine philosophische Antwort? Platon(34) würde vermutlich die Frage abweisen mit der Bemerkung, dass hier über die Bewegung und ihren Ursprung gesprochen werde. Wer hier nach Gründen fragt, kann keine strengen Prinzipien erwarten, sondern nur Metaphern. Man kann versuchen, den Demiurgen mit der Idee des Guten zu identifizieren.[32] Aber wie »wirkt« das Ziel? Das Ziel wirkt durch seinen Anblick, durch den Hinblick auf es.[33] Um so zu wirken, bedarf es eines Blickenden. Die Rede vom handelnden, aufs Gute und die Ideen blickenden Demiurgen spricht zwar nicht in wissenschaftlicher Weise vom Grund der Bewegung, aber nach Platon kann man genauer über sie nicht sprechen. Erst die Neuzeit wird den Versuch unternehmen, über Bewegung exakt zu sprechen, aber, wie es scheint, um den Preis, dass die natürlichen Dinge sich nicht mehr bewegen (s. u.).
Das Gute ist für Platon(35) nicht allmächtig. Das me on, das Nicht-Seiende, bleibt dem Einen, das Substrat des Strukturierten der Struktur stets gegenüber. Es gelingt dem Guten nicht, die Wirklichkeit so zu durchdringen, dass die Welt zu einem vollkommenen Kunstwerk würde, zur adäquaten Darstellung der Idee. In ihr wäre das Stadium des Nicht-Mehr-Weiterfragens erreicht, das man dem vollkommenen Kunstwerk, auch dem Schönen in der Natur gegenüber einnimmt, von welcher Angelus Silesius(1) schreibt:
»Die Ros ist ohn warum,
Sie blühet, weil sie blühet.«
Die Wirklichkeit ist ein Gemisch von Sinnvollem und Sinnlosem, sodass wir beständig nach deren Warum fragen müssen. Der Gott verursacht die Bewegung der Gestirne als die Grundbewegung des Wirklichen, die alles weitere trägt und bestimmt. Aber er zieht sich periodisch aus der Welt zurück.
Wenn man den »Politikos« als eine geschichtsphilosophische Theorie liest, so stellt sich der Verlauf der Welt als eine Abfolge von Perioden der Gottnähe und Gottferne dar. Der Vergleich von Konrad Gaiser(1)[34] mit einem Kreisel, der immer dann einen neuen Schlag erhält, wenn er wackelnd ganz aus dem Gleichgewicht zu geraten droht, illustriert die Theorie treffend. Ihr entspricht auch die Abfolge in den Zuständen des Staates: vom lichten Tag des Geistes der republikanischen Gesinnung, wie sie in der idealen Polis verwirklicht ist, über die Dämmerung der Zerfallsperioden, wo materielle Einzelinteressen vorrangig werden, bis zur Nacht, von der es am Ende der Rhein-Hymne bei Hölderlin(1) heißt:
»Bei Nacht, wenn alles gemischt
Ist ordnungslos und wiederkehrt
Uralte Verwirrung.«
Das me on, der Bereich der ungeordneten Bewegung, wirkt der Kraft des Guten entgegen. Aber wie kann es wirken, da es im Bereich des rein Passiven keine Spontaneität, keine Kraft, auch keine »Richtung auf eine Idee des Schlechten« gibt? Platon(36) antwortet: Das Schlechte wirkt in der Kraft des Guten. Die Wirklichkeit ist in vielen, aufeinander bezogenen Ebenen teleologisch strukturiert – aber auch das Prinzip des Vielen reproduziert sich auf jeder dieser Ebenen.