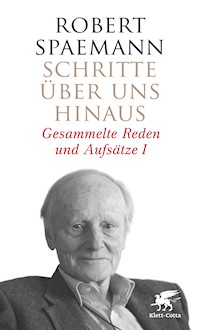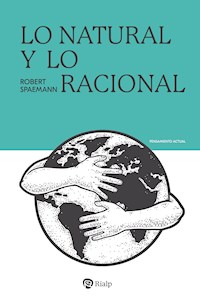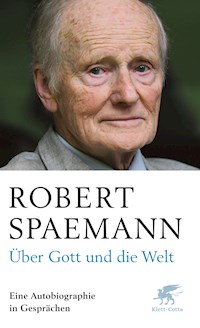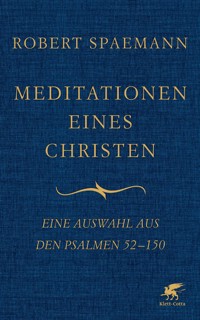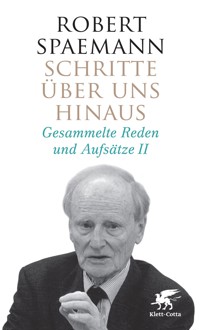
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Schritte
- Sprache: Deutsch
»Wir tun niemals einen Schritt über uns hinaus«, so charakterisierte David Hume pointiert die »moderne Weltanschauung«, deren Schattenseiten Robert Spaemann entfaltet. Meisterhaft setzt er dieser Haltung Kunst und Kultur, Philosophie und Religion entgegen. Sie geben uns im Leben, in der Welt und zu unseren Mitmenschen Orientierung und Halt. Anders gesprochen: Wir können gar nicht anders, als uns zu überschreiten – und damit letztlich auch das Dogma der Moderne.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
ROBERT SPAEMANN
SCHRITTEÜBER UNSHINAUS
Gesammelte Reden und Aufsätze II
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.de
Klett-Cotta © 2011 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart Alle Rechte vorbehalten Cover: buero-jorge-schmidt.de Abbildung: © Hanns-Gregor Nissing, 2007 Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell Printausgabe: ISBN 978-3-608-94249-1
Inhalt
Sein und Gewordensein
Antinomien der Liebe
Anmerkungen
Über die Bedeutung der Worte »ist«, »existiert« und »es gibt«
1. Heidegger: Die Frage nach dem Sein und ihre Bedeutung
2. Aristoteles: Wissenschaft vom »Seienden als solchen« – eine Suche nach dem Grund von Wirklichkeit
3. Descartes: Sein als Vorkommen in einem das Subjekt übergreifenden Horizont
Anmerkungen
Ähnlichkeit
Nähe und Ferne
Anmerkungen
Sein und Gewordensein.Was erklärt die Evolutionstheorie?
1. Widerstand gegen Tatsachen?
2. Drei Weisen der Reaktion auf die Trivialisierung der Welt
3. Die Herausforderung durch die Evolutionstheorie: Genesis versus Geltung
4. Die Unableitbarkeit der Negativität
5. Evolution und Selbstverständnis
Zum Begriff des Lebens
Anmerkungen
Menschenwürde und menschliche Natur
Die Unvollendbarkeit der Entfinalisierung
Anmerkungen
Seelen
1. Wo sprechen wir von Seelen?
2. Leben als Selbstsein
3. Zur Einheit von Seele und Geist im Menschen
Hirnforschung und Willensfreiheit
Die Zweideutigkeit des Naturbegriffs im 18. Jahrhundert
Anmerkungen
Wirklichkeit als Anthropomorphismus
1. Ein Kriterium für das Wirkliche?
2. Die wirkliche Welt ist die gemeinsame Welt
3. Subjekte und Objekte
4. Anthropomorphismus und Anthropozentrismus
5. Das Verschwinden der Person
6. Der intentionale Charakter der Gefühle
7. Das Mitsein der materiellen Welt
8. Die Beziehung als eigentlich Wirkliches
9. Das Eigentümliche des Menschen
Wie konntest du tun, was du getan hast? Rede über Scham und Schamlosigkeit
1. Mit welchem Gesicht?
2. Geld, Sexualität
3. Das Neue
4. Geist und Körper
5. Selbstliebe
Zur Frage der Notwendigkeit des Schöpferwillens Gottes
Das Schöne und die Kunst
Schönheit und Zweckmäßigkeit in der Natur
Anmerkungen
Perspektive und View from nowhere
Anmerkungen
Das Unsichtbare gestalten
Das Gezeugte, das Gemachte und das Geschaffene
Was heißt: »Die Kunst ahmt die Natur nach«?
1. Technische Simulation
2. Ästhetische Simulation
3. Symbolisierung der Natur
Anmerkungen
Über den Autor
SEIN UND GEWORDENSEIN
Antinomien der Liebe
(2007)
»We never advance one step beyond ourselves.« Mit diesem Satz hat David Hume den Kern der modernen Weltanschauung ausgesprochen. Vielleicht wird dieser Umstand noch klarer, wenn wir den Satz von Thomas Hobbes hinzufügen, der sagt, eine Sache erkennen heiße »to know what we can do with it when we have it«. Bedenken wir, dass das hebräische »Jadah«, also das Wort für Erkennen, in der Bibel zum ersten Mal vorkommt, wo es heißt: »Adam erkannte sein Weib, und sie gebar ihren ersten Sohn.« Der Satz des Aristoteles Intelligere in actu et intellectum in actu sunt idem (wirkliches Erkennen und wirklich Erkanntes sind dasselbe) lebt auch noch von dieser Sicht: Erkennen als Einswerden mit dem Erkannten, bei welchem Einswerden das Erkannte zu sich selbst kommt.
Die cartesische Sicht ist anders. Prototyp der Erkenntnis ist die fensterlose Helle des bei sich bleibenden Subjekts, das seine Herrschaft sichert. Aber der Satz Humes sagt: Das Subjekt bleibt sowieso bei sich selbst, und alles Außer-sich-Sein ist Illusion. Es ist hier nicht meine Aufgabe, den logischen Widersinn dieses Satzes aufzuzeigen. Wenn er wahr wäre, dann wäre es nämlich unmöglich, dies zu wissen und es auszusprechen. Mir kommt es nur darauf an, darauf aufmerksam zu machen, dass dieser Satz den Mainstream des modernen Bewusstseins kennzeichnet. Das heißt nicht, dass die meisten Menschen so denken. Der common sense kann so nicht denken. Aber der common sense findet sich nicht mehr wieder in dem, was die offiziellen Interpreten der Wirklichkeit uns glauben machen wollen. Sie wollen uns glauben machen, dass wir nicht sind, wofür wir uns halten. Sie wollen uns glauben machen, dass es das nicht gibt, was wir unter Wahrheit verstehen, und das nicht, was das Wort »Liebe« meint.
Aber meint dieses Wort überhaupt etwas Eindeutiges? Ist Liebe eine clara et distincta perceptio? Tatsächlich gibt es doch kein Wort – außer dem Wort »Freiheit« vielleicht –, das ein solches Sammelsurium von Bedeutungen in sich vereinigt, und zwar von einander diametral entgegengesetzten Bedeutungen, wie das Wort »Liebe«. Es bezeichnet Gefühle, die Eltern ihren Kindern, Kinder ihren Eltern, Freunde ihren Freunden entgegenbringen. Aber auch und vor allem das berühmte und nie genug gerühmte Gefühl, das einen Mann und eine Frau miteinander verbindet und das in den heiligen Büchern der Juden und der Christen ebenso wie bei vielen Heiligen als Metapher zur Beschreibung des Verhältnisses zwischen Gott und seinem Volk oder zwischen Gott und dem Frommen dient. Und dann sprechen wir von Vaterlandsliebe. Wenn einer unserer früheren Bundespräsidenten, auf seine Vaterlandsliebe angesprochen, antwortete: »Ich liebe meine Frau, nicht den Staat«, so hieß das, die Frage verdrehen. Niemand muss den Staat lieben, um seine Heimat und sein Vaterland zu lieben, und zwar bis zur Opferung des eigenen Lebens. Aber das Wort »Liebe« benutzen wir auch, um das pure sexuelle Begehren und dessen Befriedigung zu bezeichnen. Die Zweideutigkeit dieses Wortes wird hier am offenkundigsten. Denn der gleiche Akt der sexuellen Vereinigung kann als tiefster Ausdruck von Liebe erfahren werden und als pure Instrumentalisierung im Dienste des krassesten Egoismus. Aber die Sache ist in Wirklichkeit noch weit subtiler. Auch das enthusiastischste Gefühl der Liebe kann ein bloßes Mittel zur Steigerung des eigenen Lebensgefühls sein und der Andere ein Mittel, dieses Gefühl zu erleben, geliebt also nur, solange diese Droge wirkt. Und wenn ein Treueversprechen dadurch gebrochen wird, absolviert die Intensität der neuen Liebe alles, wie der alte Schlager sagt: »Kann denn Liebe Sünde sein?«
Aber hier muss ich die am Anfang gegebene Bezeichnung der Liebe als Gefühl in Frage stellen.
Einerseits scheint sie ein Gefühl zu sein. Wenn eine Frau ihren Mann fragt – oder vice versa –, ob er sie noch liebt, und er würde antworten, dass er sie liebt, aber dass er nichts für sie empfindet, dann würde die Frau – oder der Mann – das mit Recht sehr sonderbar finden. Dennoch – niemand würde sagen, er hätte heute Vormittag seine Frau nicht geliebt, weil er nämlich den ganzen Vormittag keine Zeit hatte, an sie zu denken. Der Liebende ist dadurch ein Liebender, dass er, wenn er an den geliebten Menschen denkt, mit dem Gefühl der Liebe an sie denkt. Daraus folgt, dass er gern an sie denkt, und daraus folgt, dass er oft an sie denkt und dass er gern in ihrer Nähe ist. Genau das ist es aber, was Aristoteles eine hexis und die Lateiner einen habitus nennen. In diesem Sinne ist zum Beispiel Wissen ein habitus. Man muss nicht immer an alles denken, was man weiß. Aber wenn man daran denkt, dann mit jener Art von Überzeugung, die man Wissen nennt. Wobei allerdings beim Wissen noch etwas hinzukommt, was überhaupt nicht als bloß mentaler Zustand beschrieben werden kann. Denn es gehört zwar zum Wissen, dass man sich in einem bestimmten mentalen Zustand befindet, das heißt, dass man überzeugt ist zu wissen. Aber diese Überzeugung kann ein Irrtum sein. Wissen liegt nur dann vor, wenn die Dinge tatsächlich so sind, wie ich denke, dass sie sind. Mit der Liebe verhält es sich anders. Ich kann mich zwar auch hier täuschen. Ich kann glauben zu lieben, während ich tatsächlich nicht liebe. Aber diese Täuschung ist nicht eine Täuschung über Tatsachen der Welt, sondern über mich selbst.
Noch in einer anderen Hinsicht unterscheidet sich der Habitus der Liebe von dem des Wissens. Ich weiß etwas, wenn ich das Gewusste durch Gründe einfügen kann in alles andere, was ich weiß, wenn ich es mit der Gesamtheit meiner Überzeugungen so verknüpft habe, dass es zu einem Teil meiner Identität geworden ist. Auch dann allerdings kann es sich noch um einen Irrtum handeln. Die Relation, die eine Überzeugung zum Wissen macht, also die Wahrheitsrelation, ist eine rein objektive, die den mentalen Zustand des Glaubens, dass ich weiß, gar nicht tangiert und modifiziert. Insofern gilt hier in einem gewissen Sinn tatsächlich das Wort Humes: »We never advance one step beyond ourselves.« Aber wir möchten diesen Schritt tun. Und der mentale Zustand des Glaubens zu wissen ist der Glaube, diesen Schritt tatsächlich zu tun. Descartes hat gezeigt, dass wir diesen Glauben immer wieder in Frage stellen können, dass wir aber in einem Fall gewiss sein können, dass wir diesen Schritt wirklich getan haben, nämlich dann, wenn wir den Satz Humes denken oder aussprechen. Wir beanspruchen nämlich Realität für das »ourselves«. »Ich denke« bedeutet zugleich: »Es wird gedacht.« Das heißt: Ich denke nicht nur, dass ich denke, sondern mein Denken findet in einem Raum statt, der größer ist als mein Bewusstseinsraum und in dem mein Denken als objektive Tatsache vorkommt. Es ist die Gottesidee, die diesen Raum eröffnet. Und die Idee Gottes ist es auch, die mich glauben lässt, es gebe so etwas wie eine Wahrheitsrelation meines Denkens. Einen direkten Weg zum Anderen meiner selbst gibt es nicht, also nicht so etwas wie eine wirkliche Berührung. Und es gibt sie auch nicht für die Leibniz’sche Monade, wenn sie träumt, beim Andern zu sein. Wir alle träumen lebenslang von Gott koordinierte Träume.
Mit der Liebe scheint es sich anders zu verhalten. Was das Wort »erkennen« meint, scheint nur durch die Liebe eingelöst zu werden. Ubi amor, ibi oculus heißt es bei Richard von St. Viktor: »Wo Liebe ist, da ist Auge.« Ob es sich bei einem bestimmten intentionalen Zustand um Erkenntnis handelt, kann nicht durch Beobachtung dieses Zustandes entschieden werden, sondern nur durch Umstände, die diesem Zustand ganz äußerlich sind. Ob es sich um Liebe handelt, ergibt sich einzig aus der Art eines bestimmten Gemütszustandes.
Aber bedeutet das nicht, dass Liebe eben gerade nicht mit Erkenntnis und Wissen auf eine Stufe gestellt werden kann, also mit mentalen Zuständen, die sich selbst transzendieren, sondern mit mentalen Zuständen, zu deren Definition solche Transzendenz nicht gehört? Amor oculus est heißt es bei Richard von St. Viktor. Aber der Volksmund sagt das Gegenteil: Liebe macht blind. Der Verliebte macht sich ein Bild von der Geliebten, das die späteren Tests der Erfahrung nicht aushält. Andererseits transzendiert personale Liebe alle Bilder, alle Qualitäten der Geliebten und geht auf die Person jenseits dieser Qualitäten. Die Qualitäten sind es, an denen sich die Liebe entzündet. Aber wenn sie einmal entzündet ist, dann lässt sie die Qualitäten hinter sich. Wer auf die Frage, warum er diesen Menschen liebt, eine Antwort geben kann, der liebt noch nicht wirklich. Der Liebende ist deshalb bereit, sich auf alle künftigen Wandlungen des geliebten Menschen einzulassen und die eigenen Wandlungen, die eigene Biografie mit der des Anderen unabänderlich, auf Gedeih und Verderb zu verknüpfen. Eine der Antinomien, über die ich sprechen möchte, liegt hier. Die Bedingungslosigkeit der Hingabe, d. h. das Versprechen der Treue, ist konstitutiv für die Liebe. Aber wieder stoßen wir auf eine Antinomie. Denn der Fall, dass das Versprechen nicht gehalten wird, ist sehr, sehr häufig. Und zwar wird es nicht gehalten, weil der Andere sich mehr geändert hat, als der Liebende es verkraftet, oder weil dem Liebenden seine Liebe abhanden kommt »wie ein Stock oder ein Hut«. Weil die Bedingungslosigkeit und die Perspektive der Unabänderlichkeit aber konstitutiv für die Liebe ist, darum erscheint es dem ehemals Liebenden im Rückblick so, als habe er eigentlich gar nicht wirklich geliebt. Und dies vor allem dann, wenn eine neue Liebe die alte ihres Glanzes beraubt. Und in der Tat: Es gehört zur katholischen Lehre von der Gottes- und Nächstenliebe, dass niemand mit Sicherheit wissen kann, ob er sie besitzt oder nicht.
Nun kann man natürlich sehr wohl wissen, ob man verliebt ist oder nicht. Es ist in dieser Glaubenslehre daher nicht von Verliebtheit die Rede, sondern von dem Habitus des amor benevolentiae, der wohlwollenden Liebe.
Hier stoßen wir nun auf den Kern aller Antinomien, die im Zusammenhang mit dem Begriff der Liebe auftreten. Das Wort scheint tatsächlich zwei ganz verschiedene Dinge zu bezeichnen, zwei Haltungen, die Aristoteles schon unterscheidet, wenn er von den drei Formen der Freundschaft spricht: jener, die um des Vergnügens willen gepflegt wird, jener um des Nutzens willen und jener deshalb, weil der Freund es wert ist, um seiner selbst willen geliebt zu werden.
Die Tradition hat dann von amor concupiscentiae und amor benevolentiae gesprochen. Das Neue Testament nennt die Freundschaft um des Freundes willen agape, caritas – wobei für den, der Gott in Freundschaft verbunden ist, potentiell jeder Mensch Freund ist. Auch hier allerdings schleicht sich schon wieder ein Widerspruch ein: Wenn jeder Mensch Freund ist, bräuchten wir ein neues Wort, um das Phänomen exklusiver Freundschaft zu bezeichnen, das ja im Christentum nicht verloren geht und das in der Bibel zudem das Modell abgibt für die besondere Beziehung zwischen Gott und dem Volk Gottes. Andererseits scheinen amor concupiscentiae und amor benevolentiae so entgegengesetzte Phänomene zu bezeichnen, dass es Wunder nimmt, wenn für beide das Wort Liebe gebraucht wird. Das eine muss mit dem anderen zu tun haben. Und dass sie miteinander etwas zu tun haben, ist ja wohl auch die wichtigste Botschaft in der Enzyklika Benedikts XVI. »Deus caritas est«, in der der amor concupiscentiae dadurch aufgewertet wird, dass er Gott selbst zugeschrieben wird: Gott erscheint bei den Propheten als eifersüchtiger Liebhaber seiner Braut, des Volkes Israel. Und in der Inkarnation begibt sich Gott sogar in die Lage dessen, der der Liebe anderer bedürftig und auf sie angewiesen ist.
Nichtsdestoweniger ist die Tradition der inneren Gegensätzlichkeit im Liebesbegriff dadurch aus dem Weg gegangen, dass sie einfach zwei Arten der Liebe unterschieden hat, ohne nach deren innerer Zusammengehörigkeit zu fragen. Friedrich von Spee unterscheidet in seinem von Leibniz hochgeschätzten »Güldenen Tugendbuch« die »begierliche Liebe« und die »Liebe der Gutwilligkeit«, die er auch Liebe der Freundschaft nennt. Mit Bezug auf Gott identifiziert er den amor concupiscentiae mit der Tugend der Hoffnung, ähnlich wie später Fénelon, wenn er schreibt: »En perdant l’espérance on retrouve la paix.« Für Spee ist von Liebe im vollen Sinn eigentlich nur die Rede, wenn beide zusammenkommen. So schreibt er:
Dass oft beide zusammen sind, nimm dieses Exempel: Ein Bräutigam liebt seine Braut mit beiden diesen Lieben, denn er liebt sie mit der Liebe der Begierlichkeit, indem er sie für sich begehret und herzlich umfängt, als welche ihm behaglich und, wie er vermeinet, sein Heil und seine Lust ist. Er liebt sie auch mit der Liebe der Gutwilligkeit oder der Freundschaft, indem er ihr auch von Herzen wohl will und ihr alles Gute wünscht und begehrt.
Zum anderen: Dass auch oft man etwas liebt allein mit der Liebe der Begierlichkeit und nicht mit der Liebe der Gutwilligkeit oder der Freundschaft, nimm dieses Exempel: Es liebt mancher böse Mensch ein Weibsbild nur allein mit der Liebe der Begierlichkeit; weil er sie seiner Wollust und ihrer Schönheit halben umfängt, da er doch sonst ihr nichts Gutes gönnt noch wünscht, sondern wohl leiden möchte, sie wäre wo der Pfeffer wächst, wenn er nur seiner Begierden ein Genüge hätte. Da liebt er sie dann mit der Liebe der Begierlichkeit und nicht mit der Liebe der Gutwilligkeit oder Freundschaft, da er ihr nichts Gutes gönnt. Gleich auch ich eine gute Speise, Apfel oder Rose liebe mit einer Liebe der Begierlichkeit allein, nicht aber mit einer Liebe der Gutwilligkeit oder der Freundschaft.1
An anderer Stelle stellt er die »reine Liebe«, die reine Freundschaft ohne Begehren vor. Dazu wählt er, ähnlich wiederum wie Thomas von Aquin und wie später Fénelon, Beispiele aus dem politischen Raum. Thomas spricht von der Vaterlandsliebe, Fénelon – bezeichnenderweise – von der Liebe der Bürger zur antiken Republik, Spee von der Liebe zum Kaiser, »unserem gnädigsten Herrn Ferdinandum II, den ich nicht sonderlich liebe mit einer Liebe der Begierlichkeit, aber doch liebe ich ihn mit einer starken Liebe der Gutwilligkeit«; und diese Liebe wird dann ausgemalt als ein Beispiel uneigennütziger Liebe, denn von dem Glück des Kaisers, seinen gewonnenen Schlachten usw. hat der Untertan keinen unmittelbaren Gewinn, und er kann sich nicht einmal am Anblick seines Triumphes ergötzen, denn der Kaiser ist weit weg.
Aber die politischen Beispiele zeigen, dass der amor benevolentiae ohne alles Begehren ebenfalls nicht jene vollkommene Liebe exemplifiziert, die von Person zu Person geht. Es muss einen inneren, einen konstitutiven Zusammenhang zwischen amor concupiscentiae und amor benevolentiae geben. Philia, amor amicitiae ist etwas anderes als die bloß zufällige Addition zweier Elemente unserer Gemütsverfassung. Eher müsste man von einer Dialektik der Liebe sprechen. Leibniz hat eine Definition der Liebe vorgeschlagen, die ihm dann später auch als geeignet erschien, den berühmten amour-pur-Streit zwischen Bossuet und Fénelon zu schlichten, eine Konkordienformel sozusagen. Die Definition lautete: delectatio in felicitate alterius, Freude am Glück des Anderen. In dieser Definition ist beides enthalten: erstens dass Liebe eine Gemütsverfassung des Liebenden ist, eine delectatio. Das widersprach Fénelons Jansenismuskritik. Die Jansenisten sprachen ja von der »delectation supérieure«. Sie hatten sich das Trahit sua quemque voluptas Vergils zu eigen gemacht. Ob jemand ein Kind der Gnade ist oder nicht, das zeigt sich daran, woran er seine Freude hat. Für Fénelon erweist sich das desintéressement der Liebe dagegen in der festen Ausrichtung des Willens auch dort, wo die Seele in der Berührung mit den göttlichen Dingen gar nichts empfindet, also im Zustand jener Trockenheit, der für die Schüler des heiligen Augustinus ein Zeichen der Verlorenheit war. Liebe hat es mit delectatio zu tun, darauf insistiert Leibniz. Aber der Inhalt dieser delectatio ist das Glück des Anderen. (Nebenbei fällt auf, dass Leibniz als Beispiel für die so definierte Liebe die Freude nennt, die jemand im Anblick eines Bildes von Raphael empfindet, auch wenn er dieses Bild weder besitzen noch irgendeinen Vorteil daraus ziehen will. »Interesseloses Wohlgefallen«, so definiert dann Kant, im Gefolge von Leibniz, das ästhetische Gefühl. Den Einwand, das Beispiel sei schlecht gewählt, Bilder könnten ja nicht glücklich sein, weist Leibniz mit dem Hinweis darauf zurück, dass delectatio nur die subjektive Erlebnisform einer objektiven Vollkommenheit sei, so dass man Liebe auch definieren könne als delectatio in perfectione alterius, als Freude an der Vollkommenheit des Anderen. Diese aber könne eben auch einem Bild von Raphael gelten. Übrigens eine unbefriedigende Antwort. Denn personale Liebe gilt einem Jenseits aller wahrnehmbaren Qualitäten, während die Freude an dem Bild nur den Qualitäten gilt und deshalb auch kein Versprechen der Treue durch alle eventuellen Veränderungen des Bildes hindurch enthält.)
Delectatio in felicitate alterius. Die Definition lautet nicht delectatio per felicitatem alterius. Das ist entscheidend. Wenn das Ziel die eigene Freude ist und das Glück des Anderen nur ein Mittel, um solche Freude zu genießen, dann kann von Liebe nicht die Rede sein. Delectatio in felicitate alterius, das heißt: Die delectatio ist nicht ein bloßer Zustand des Subjekts, sondern sie hat einen intentionalen Gehalt, durch den sie qualifiziert wird. In diesem Zusammenhang lohnt es sich, eine kleine Schrift des großen Arnauld zu lesen, die »Dissertation sur le prétendu bonheur des plaisirs des sens«. In dieser Schrift insistiert Arnauld, mitten im 18. Jahrhundert, auf dem intentionalen Charakter der Freude. Freude hat nicht nur Wirkursachen, was ja z. B. auch Psychopharmaka sein können. Freude hat einen Inhalt, durch den sie spezifisch qualifiziert wird. Die Freude an den blühenden Apfelbäumen im Mai, die Freude über das Wiedersehen mit einem lieben Menschen oder die Freude an einer bestimmten Musik haben nicht nur verschiedene Ursachen, sie sind verschiedene Freuden. Arnauld nennt den Inhalt der delectatio ihre causa formalis im Gegensatz zur causa efficiens. In der Sache geht es um dasselbe, wenn Thomas von Aquin die beatitudo formalis unterscheidet von der beatitudo obiectiva. Die Gottesliebe liebt Gott nicht, weil er in uns einen mentalen Zustand des Wohlbefindens bewirkt, sondern Gott ist der objektive Inhalt dieses Glücks, so dass es in der Gottesliebe nicht darum geht, Gott als Mittel zu einem ihm äußerlichen Zweck zu instrumentalisieren, sondern es geht einzig um Gott selbst. Aber in dieser Selbsttranszendenz der Liebe liegt zugleich die Erfüllung des eigenen Wesens. Fénelon sah bei Bossuet eine solche Instrumentalisierung Gottes für ein im Kern endliches Glück. Er selbst beschrieb dagegen die reine Liebe als Sterben, als Tod der endlichen Natur, während Thomas geschrieben hatte, dass von Natur jedes Wesen Gott mehr liebt als sich selbst, so wie der Teil das Ganze mehr liebt als sich selbst. Wieder ist es die Vaterlandsliebe, die hier als Paradigma dient.
Im 17. Jahrhundert sind indessen Ontologie und Psychologie so weit auseinandergetreten, dass von der einen keine Brücke mehr zu der anderen führt. Die Akzeptanz der eigenen Verdammnis, wenn sie im Willen Gottes liegt, ist ontologisch bedeutungslos, aber sie ist ein Stadium auf dem Weg der Reinigung des Herzens von jeder egoistischen Reflexion. Die Reflexion findet in der Tat keine Unschuld, sie kann jeden Antrieb uneigennütziger Tätigkeit als von subtiler Eigenliebe motiviert entlarven. Das war ja auch Luthers Problem. Gerade im sexuellen Umgang ist das offenkundig. Die Lust des Anderen ist ein wesentlicher Teil der eigenen: Delectatio in felicitate alterius. Ist das Interesse an der Lust des Anderen also egoistisch? Sollte die Dame, der ich einen Blumenstrauß mitbringe, ihn mit der Bemerkung annehmen: »Wie schön, dass Sie sich die Freude gemacht haben, mir einen so schönen Strauß zu schenken«? Wir wären wohl etwas frustriert über diese Reaktion. Aber wir könnten uns natürlich rächen durch die Antwort: »Ach, wissen Sie, mich lässt es eigentlich ganz kalt, ob Sie sich freuen oder nicht. Aber ich finde es einfach richtig, also moralisch gut, einem anderen Menschen Freude zu machen, obwohl es mir selbst gar keine macht.« So können wir uns das Vergnügen subtil und gründlich verderben, das des Schenkens und das des Beschenktwerdens.
Dass die Reflexion immer nur auf Eigenliebe, auf amour propre stößt und nicht auf Liebe, das hat schon La Rochefoucauld bemerkt, aber Fénelon hat den Grund dafür aufgedeckt: Die Reflexion selbst entspringt der Eigenliebe. Sie selbst ist es, die die Unschuld zerstört und deshalb bei ihrer Durchsuchung des eigenen Inneren immer nur auf Eigenliebe stoßen kann. »Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat schon die Ehe mit ihr gebrochen«, heißt es im Evangelium. Es heißt nicht, »wer eine Frau ansieht und begehrt«, sondern »wer sie ansieht, um sie zu begehren«. Das »Um-zu« ist es, durch das die Angeschaute nicht mehr selbst Gegenstand des amor concupiscentiae ist, sondern das Begehren zum Zweck und der begehrte Mensch zum Mittel wird, das Begehren zu erleben. Das ist der Bruch der Ehe, und zwar auch dann, wenn es sich um die eigene Frau handelt. Unschuld hat etwas mit Unmittelbarkeit zu tun. Heinrich von Kleist hat in seinem Essay über das Marionettentheater geschildert, wie durch einen unmerklichen Schritt der Reflexion die Unschuld der Unmittelbarkeit zerstört wird. Wiederhergestellt werden kann sie nur, so schreibt Kleist, wenn »das Bewusstsein durch ein Unendliches gegangen ist«. Denn durch ein unmittelbares Anstreben kann die Unmittelbarkeit nicht zurückgewonnen werden. Im Gegenteil – wo Unmittelbarkeit, Spontaneität zur Berufungsinstanz wird, um Verletzung der Treue und Bruch eines Versprechens zu entschuldigen – »Kann denn Liebe Sünde sein?« –, da ist es schon um sie geschehen: Corruptio optimi pessima.
Aber der Mensch ist nun einmal ein Wesen der Reflexion, das seine anfängliche Unschuld immer schon verloren hat. Und ihre Rückgewinnung geschieht gerade nicht durch das Geltendmachen jener Spontaneität, die im Geltendmachen ja schon verloren ist, sondern im Verzicht auf alle derartigen Schliche und die schlichte Antwort: »Nein. Liebe ist nie Sünde. Aber die Verletzung eines Menschen ist es, die Verletzung der Treue ist es, und der Bruch eines Versprechens ist es.« Und die Redensart: »Ich bin eben so, und du musst mich akzeptieren, wie ich bin«, ist eine Unverschämtheit, auch wenn sie sich theologisch mit dem unsäglichen Unsinn rechtfertigt, Gott akzeptiere uns, wie wir sind. Wenn das der Fall wäre, dann gäbe es keine Verzeihung. Dem Anderen, der mir gegenüber schuldig geworden ist, sagen: »So bist du eben«, ist das Gegenteil von Verzeihung. Verzeihen heißt, den Anderen nicht festlegen auf das, was er ist, ein Feigling, ein Lügner oder ein Verräter, sondern ihm erlauben, dieses Sosein zu distanzieren und neu anzufangen. Das zu können, ist ja das, was die Person ausmacht. Und weil die Liebe auf die Person geht, darum kann sie auf das »So bist du eben« verzichten und dem Anderen erlauben, sich von sich zu distanzieren und neu anzufangen.
Jemanden akzeptieren, wie er ist, ist die äußerste Form von Resignation. Die Botschaft Jesu beginnt nicht mit den Worten: »Gott nimmt euch, wie ihr seid«, sondern mit den Worten: »Kehrt um. Seid anders, als ihr jetzt seid.« Die Liebe gibt der geliebten Person die Möglichkeit, Person zu sein, und zwar auf eine einmalige, unverwechselbare Art Person zu sein. Und es sind die Augen des Liebenden, die diese Einzigartigkeit wahrnehmen, eine Einzigartigkeit, die mehr ist als die Kombination empirischer Qualitäten. Nicolás Gómez Dávila schreibt: »Jemanden lieben heißt den Grund verstehen, den Gott hatte, diesen Menschen zu erschaffen.« In diesem Sinn macht Liebe sehend: Ubi amor, ibi oculus. Sie lässt den Geliebten in einem Glanz erscheinen, den niemand sonst wahrnimmt. Und wenn der Glanz in der Alltäglichkeit zu verblassen beginnt, dann heißt das nicht, dass nun langsam die Wirklichkeit so erscheint, wie sie ist, sondern im Gegenteil. Der Liebende wird die Erinnerung an den gesehenen Glanz bewahren, wie die drei Apostel die Erinnerung an die Verklärung Christi, und er wird wissen, dass ihm damals die eigentliche Wirklichkeit gezeigt wurde, das »Ding an sich«, das, wie Kant sagt, das Ding ist, wie es dem intellectus archetypus erscheint. Auch der liebevolle Erzieher braucht diesen Blick, der den Grund verstehen lehrt, warum ein junger Mensch, der ihm anvertraut ist, existiert.
Aber indem ich rede, gehe ich über eine weitere Antinomie hinweg, oder eine weitere Doppeldeutigkeit im Begriff der Liebe. Das sogenannte Liebesgebot des Evangeliums erstreckt sich auf alle Menschen. Jeder Mensch ist eine Imago Dei, und wer ihm sein Leben opfert, tut nie etwas Sinnloses. Mutter Teresa suchte sich die Leute nicht aus, für die sie da war. Aber sie war für sie da. Aber es gibt einen ordo amoris. Es gibt das kreatürliche Verhältnis von Nähe und Ferne, das durch das Gebot der Nächstenliebe nicht aufgehoben wird. Peter Singer meint, wenn zwei Kinder am Ertrinken sind und ich kann nur eines retten, dann dürfte für die Frage, welches ich retten soll, die Tatsache keine Rolle spielen, dass eines dieser Kinder meines ist. Ich müsste das Kind retten, das wegen seiner hohen Begabung und seiner besonderen Qualitäten die Welt in einem größeren Maße zu optimieren verspricht. Das ist der Versuch, den Gottesstandpunkt einzunehmen und die kreatürlichen Beziehungen zu entwerten – so als wüssten wir, wodurch die Welt optimiert wird. Sie wird es sicher nicht durch Menschen, die sich eine Verantwortung für das Weltall imaginieren.
Nein, die Liebe ist ihrer Natur nach ungleich verteilt. Es gibt Freundschaftsbeziehungen, die ihrer Natur nach exklusiv sind. Wenn der heilige Benedikt in seiner Regel private Freundschaften zwischen Mönchen verbietet, dann deshalb, weil er die Mönchsgemeinde von vornherein als eine solche Gemeinde von Freunden versteht. Der Verzicht auf exklusive Zweierbeziehungen muss auf einer Linie mit dem Verzicht auf die Ehe gesehen werden, auf jene exklusive Beziehung eines Mannes und einer Frau, die ebenso wie die Freundschaft normalerweise zum guten Leben des Menschen gehört. Warum?
Lassen Sie mich, um die Frage zu beantworten, kurz ausholen. Eine Definition der Liebe findet sich in einer Schrift von Valentin Tomberg. Sie lautet: Liebe ist das Wirklichwerden des Anderen für mich. Erkenntnis subsumiert das Andere immer unter allgemeine Begriffe. Etwas kann nur als Dies-da identifiziert werden, indem es als ein So-und-so identifiziert wird. Das Individuum als solches ist ein Ineffabile, und die Referenz auf es bleibt immer, wie Quine gezeigt hat, unbestimmt. Es bleibt für mich immer unwirklicher, als ich für mich selbst bin. Die Zahnschmerzen des Anderen sind für mich einfach weniger real als meine eigenen. Der Buddhismus lehrt einen Weg, wie wir uns selbst so unwirklich werden, wie uns die Anderen sind. Das Christentum lehrt – als Religion der Liebe –, dass die Anderen umgekehrt so wirklich sind wie wir selbst. Es lehrt, sich zu freuen mit den Fröhlichen und zu weinen mit den Weinenden. Die Unbestimmtheit der Referenz verschwindet, wenn die Referenz mit dem Wort »Du« hergestellt wird. Ich kann mich zwar über das Sosein einer anderen Person täuschen. Aber die Identität der Person ist nicht eine qualitative, sondern eine numerische. Und wer als Du angesprochen wird, kann dem Sprechenden antworten und damit bestätigen, dass er eben dieser Jemand ist, der angesprochen wurde.
Wenn wir aber mit vielen Menschen umgehen, dann geht das nicht anders als über Verallgemeinerungen, über Begriffe. Das Ineffabile der individuellen Person kann mir nicht in dem emphatischen Sinne wirklich werden, von dem ich vorhin sprach. Es kann nicht über jedem für mich der Glanz liegen, der auf dem geliebten Menschen liegt. Die große Menge der Menschen wird von mir nur unter bestimmten Gesichtspunkten und Begriffen wahrgenommen. Der Einzigartigkeit jeder einzelnen Person kann niemand gerecht werden außer Gott. »Nur für Gott ist jeder von uns unersetzlich«, schreibt wiederum Dávila. Nur für Gott verschwindet der Einzelne nicht in der großen Menge. Wirklich werden als dieser unverwechselbare einzigartige Eine kann für mich jemand nur in einer exklusiven Form der Freundschaft und der Liebe. Niemand kann geben, ohne zu nehmen. Die Liebe, die der Einzigartigkeit der Person gerecht wird, kann nur verteidigt werden, wenn die Exklusivität verteidigt wird. Darum gehört zum amor amicitiae die Eifersucht. Pawel Florenskij hat in seinem Hauptwerk »Die Säulen und Grundfesten der Wahrheit« den letzten seiner 22 Briefe der Verteidigung der Eifersucht gewidmet. Völliges Fehlen von Eifersucht bei gegebenem Anlass ist eine Beleidigung des geliebten Menschen, der dadurch zu einem unter anderen herabgesetzt wird. Darum spricht vor allem das Alte Testament oft von der Eifersucht Gottes mit Bezug auf sein Volk. Keine fremden Götter neben ihm zu haben, ist das erste der Zehn Gebote – ein Ausdruck der Eifersucht. Der exklusive amor amicitiae aber steht tatsächlich nicht in Konkurrenz zu dem Gebot der Nächstenliebe gegen jeden, der durch die Umstände mein Nächster wird. Er gibt dieser Nächstenliebe vielmehr erst ihre Tiefe. Jeder nämlich hat Anspruch darauf, als wirklich wahrgenommen zu werden. Und zwar wirklich als diese einmalige Person. Was jeder Mensch ist, das wird für uns real erfahrbar an einem Menschen in der exklusiven Beziehung der Freundschaft. Und es wird nur erfahrbar für den, der sich mit Bezug auf einen Menschen in diese Beziehung begibt und sein Geschick mit dem des Anderen auf Gedeih und Verderb verbindet. Der amor amicitiae lässt den Gegensatz von Begehren und Wohlwollen hinter sich. Beides ist für ihn unzertrennlich. Wer einem Menschen wirklich aus vollem Herzen wohl will, der lässt ihn spüren, dass er, der Liebende, den Anderen braucht. Wer nur der Gebende sein will, der gibt nicht genug. In der christlichen Lehre ist das Äußerste, was Gott gibt, dass er sich dem Menschen gegenüber zum Empfangenden macht. Wer einem Menschen zu verstehen gibt, dass er alles für ihn zu tun bereit ist, aber dass ihm selbst an Gegenliebe gar nicht gelegen ist, der demütigt den Anderen. Der amor benevolentiae ist nur Liebe, wenn er zugleich amor concupiscentiae ist. Und dasselbe gilt vice versa. Wer wirklich den Anderen begehrt, kann nur bekommen, wonach ihn verlangt, wenn er zu geben bereit ist. Das gilt schon für das sexuelle Begehren, das eine wirkliche Erfüllung nur findet, wenn der Andere sie auch findet. Aber es gilt auf jeder Ebene des Lebens. Epikur zeigt auf unvergleichliche Weise, dass ein glückliches Leben nur möglich ist für den, der einen guten Freund hat. Einen guten Freund aber kann man nur haben, wenn man selbst ein guter Freund ist. Ein wirklich guter Freund ist aber der, der bereit ist, sein Leben für den Freund zu geben. Wer also glücklich und zufrieden leben will, der muss bereit sein, sein Leben für den Freund zu geben. Die Weisheit des Hedonisten mündet also letzten Endes bei einem Satz des Evangeliums, falls der Hedonist nämlich die Dialektik des amor concupiscentiae verstanden hat.
Ich komme zu einer letzten Paradoxie im Begriff der Liebe, zur Paradoxie menschlicher Sexualität. Dass es zu den Aufgaben des Menschen gehört, seine Sexualität in personale Liebe zu integrieren, und dass das oft schwer gelingt, ist ein Topos der Moral. Es wird hier nämlich scheinbar Widersprechendes verlangt. Höchster Ausdruck personaler Liebe soll ausgerechnet das Unpersönlichste sein, das es gibt, der sexuelle Umgang. Der animalische Trieb, der dazu drängt, wird sogar mit gänzlich Unbekannten im Bordell befriedigt. Es ist ein Untertauchen im anonymen Strom sich perpetuierenden Lebens. Hier legt der Mensch die persona im antiken Sinn der sozialen Rolle ab. Darum verbirgt er sich dabei in der Regel vor den Augen Dritter. Und oft möchte er eine Barriere errichten zwischen dieser Sphäre und der bürgerlichen Welt. Was er hier sagt, schwört und verspricht, darf man nicht ernst nehmen. Es zählt nicht in der sozialen Welt. Und oft möchten Männer und Frauen, die miteinander »intim waren«, draußen nicht miteinander gesehen werden. Die europäische Antike war sexuell vergleichsweise freizügig. Aber zugleich hatte die antike Philosophie für diese Sphäre meistens eine gewisse Verachtung. Als Sphäre der Selbstvergessenheit ist sie dem Ideal vernunftbestimmten Lebens entgegengesetzt. Die Idee der Person im christlichen Sinn, die ihre höchste Verwirklichung in der Selbsttranszendenz der Liebe findet, war noch nicht geboren. Die Perversionen des Sadismus und des Masochismus leben von dieser Idee und finden ihre Lust darin, sie zu zerstören. Sie stürzen sich nicht selbstvergessen in den Rausch der Sinne, sondern zelebrieren die Verdinglichung und Entpersönlichung als Mittel für den Selbstgenuss des Ego.
Diese teuflischen Mysterien sind der extremste Gegensatz zum Fest der triumphalen Durchbrechung der Schamschranke durch die Liebenden. Dieses Fest der Liebe macht noch einmal die Paradoxie sichtbar, von der ich spreche. In ihm enthüllt sich auf besondere Weise das Wesen der Person. Personalität ist nicht identisch mit Vernunftbestimmtheit. Vernunft bildet zusammen mit der Triebnatur jene menschliche Natur, in der die Person zur Erscheinung kommt. Die personale Weise, eine Natur zu haben, ist die Vernunftbestimmtheit des Lebens. Das Eintauchen in den vorpersonalen Strom des Lebens kann und soll zum Symbol der Selbsttranszendenz werden, in der Personen sich verwirklichen. Die vorübergehende Aufgabe der Vernunftbestimmtheit, die im Deutschen sehr schön als »Beischlaf« bezeichnet wird, ist dann nicht Entpersönlichung, wenn sie eingebettet ist in jene bedingungslose, irreversible und exklusive gegenseitige Übereignung zweier Personen. Und zwar solcher, deren verschiedengeschlechtliche Physis bereits auf ein solches Einswerden hingeordnet ist. Personalität gibt es nur im Plural. Personsein heißt einen Platz einnehmen in der universalen, zeitübergreifenden Personengemeinschaft. Eingebettet in eine solche personale Einheit wird der Untergang des Selbst im Beischlaf zur symbolischen Realisierung personaler Selbsttranszendenz. Die Paradoxie ist das Kennzeichen der Überwindung der Abstraktion. Nur das Abstrakte unterliegt der Identitätslogik. Darum wird Gott im Christentum nicht als Person, sondern als Personengemeinschaft verstanden. Nur so hat der Satz »Gott ist Liebe« einen verständlichen Sinn. In der konkreten Einheit der Liebe verschwinden die Liebenden nicht, sondern steigern sich zu ihrer höchsten Möglichkeit. Und so auch wird die Gottesliebe im Christentum nicht verstanden als Aufgehen der Person in Gott wie der Tropfen im Meer. In dieser Metapher wird Gott nur als Substanz gedacht, in der alles Endliche verschwindet. Gewiss, wir vergleichen die Liebe mit dem Tod. Fortis ut mors dilectio, stark wie der Tod ist die Liebe, heißt es im Hohen Lied. Von Selbstüberwindung, Selbstverleugnung ist die Rede, und vom »Sterben mit Christus«. Fénelon hat diese Redeweise verteidigt, indem er zugleich verlangte, Psychologie und Ontologie zu unterscheiden. Was psychologisch als Selbstverleugnung erlebt wird, ist ontologisch Selbstverwirklichung und Steigerung der Person. Das Evangelium drückt die Paradoxie so aus: »Wer seine Seele retten will, der wird sie verlieren, wer sie aber verloren gibt, der wird sie retten.« Aber diese Selbsttranszendenz schließt die Bereitschaft auch zum wirklichen Tod ein. »Niemand hat eine größere Liebe, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde.« Leben lebt vom Opfer des Lebens.
Rede vor der Lumen Christi-Foundation München am 29. 6. 2007
Anmerkungen
1 Friedrich von Spee: Güldenes Tugendbuch, hrsg. v. Th. van Oorschot, München 1968, S. 27.
Über die Bedeutung der Worte »ist«, »existiert« und »es gibt«
(1980/81)
1. Heidegger: Die Frage nach dem Sein und ihre Bedeutung
Vor einer Erörterung der Frage, was wir denn mit den Worten »ist«, »existiert«, und »es gibt« meinen, und vor der Suche nach einem Leitfaden zur Beantwortung dieser Frage sollte man versuchen, sich erstens darüber zu verständigen, was die Frage eigentlich meint, d. h. was man eigentlich zu wissen wünscht, wenn man so fragt. Um sich darüber zu verständigen, ist es zweitens notwendig, sich klar darüber zu werden, warum man sich diese Frage stellt. Und schließlich wäre zu fragen, unter welchen Umständen wir bereit wären, eine Antwort als zufriedenstellende Antwort gelten zu lassen.
Was die Verständigung über die Bedeutung der Frage betrifft, so wäre natürlich jetzt eigentlich zunächst zu erörtern, was wir überhaupt wissen wollen, wenn wir fragen, was jemand meint, wenn er etwas sagt, insbesondere was er mit bestimmten Worten meint. Ich will das jetzt nicht im Allgemeinen erörtern, sondern nur in Bezug auf unser Thema. Und da stellt sich natürlich die Frage: Mit Hilfe welcher Worte will man ein Wort erklären, dessen Gebrauch uns allen geläufig ist, und dessen Bedeutung – wie Aristoteles sagt – die allerbekannteste ist?1 Was können wir eigentlich zu verstehen hoffen, wenn wir nicht immer schon verstanden haben, was das Wort »ist« bedeutet und was ein Kind wissen will, wenn es fragt, ob es Einhörner wirklich gibt, oder was der insipiens des Psalmisten meint, wenn er sagt, non est Deus? Was wollen wir eigentlich wissen, wenn wir fragen, was hier »ist« eigentlich heißt? Warum stellen wir die Frage? Warum haben die Griechen sie gestellt? Und: Haben sie sie überhaupt gestellt? In dem Sinne, in dem wir sie stellen? Heidegger hat bekanntlich mit Bezug auf die Bedeutung des Wortes »Sein« folgende Thesen vertreten:2
a. Die Selbstverständlichkeit der Bedeutung des Wortes »Sein« beruht auf einem Vergessen, nämlich auf dem Vergessen eines ursprünglichen Reichtums an Konnotationen, der überhaupt erst so etwas wie einen Verstehenshorizont eröffnete. Unser durchschnittlicher Seinsbegriff ist ein aufs Äußerste – nämlich auf das bloße »Vorhandensein« – reduzierter. Diese Selbstverständlichkeit dessen, was Vorhandensein meint, beruht allerdings darauf, dass es hier gar nichts mehr zu verstehen gibt. Wie kann das sein, dass etwas ganz selbstverständlich und ganz unverständlich ist? Die Antwort Heideggers ist: Beim Begriff des Vorhandenseins handelt es sich um das caput mortuum einer Verstehens- und Vergessensgeschichte. Ziel der Heidegger’schen Bemühung ist die Aufklärung dieser Geschichte, Anamnesis. Dies geschieht durch eine Hermeneutik desjenigen Seienden, das vom Sein spricht und nach der Bedeutung dieser Rede fragt, weil diese Bedeutung der Vergessenheit anheimgefallen ist.
b. Heideggers zweite These ist: Die Geschichte dieses Vergessens ist alt. Zwar schwingen bei den Griechen noch ursprüngliche Konnotationen des Wortes mit, aber gerade sie werden nicht thematisch. Die Metaphysik, die das Seiende als Seiendes thematisiert, ist zugleich von Anfang an eine Verdrängung des ursprünglich Gemeinten. Sie fragt eigentlich nie nach dem, was es heißt, dass etwas ist, sondern sie fragt nach dem, was allen Seienden gemeinsam ist. Sie fragt nach dem, was etwas als etwas charakterisiert, und insofern ist die antike Metaphysik trotz ihrer größeren Nähe zu der anfänglichen Fülle des im Wort »Sein« Gedachten ein erster Schritt auf dem Wege, dessen Ende durch Quines Formel bezeichnet wird: »To be is to be the value of a variable«.3
c. Heideggers dritte These zielt auf das Interesse, das uns leitet bei der Frage nach der Bedeutung von »Sein«. Heidegger geht davon aus, dass erst von diesem Interesse her der Sinn der Frage aufzuklären ist und eine Antwort versucht werden kann. Die Frage entspringt dem Interesse jenes Wesens, das vor der Situation steht: »To be or not to be, that is the question.«4 D. h. des Wesens, das durch Sorge bestimmt ist, durch Sorge um sein eigenes Sein. Und zwar nicht bloß im Sinne der Erhaltung dessen, was es ohnehin schon ist – d. h. kraft Natur oder physei –, sondern das in seiner Selbstbehauptung zugleich in jedem Augenblick darüber entscheidet, was es ist, als was es sich behauptet. Die Seinsfrage stellt sich ihm angesichts der Antizipation des eigenen Nichtseins, des Todes. Hierdurch aber wird für ihn nun auch sein So-Sein zu einer Frage. Ein Wesen hat nur ein So-Sein, insofern es Einheit besitzt. Für ein sich zeitigendes und sein Ende antizipierendes Wesen ist Ganz-Sein nicht eine unmittelbare, von außen konstatierbare Qualität, sondern, etwa analog zu der Ganzheit eines Musikstückes, eine bestimmte Weise der Integration, eines über die Zeit erstreckten Lebens. Angesichts der Endlichkeit dieses Lebens und der damit gegebenen Unmöglichkeit, alle »Möglichkeiten« zu realisieren, wird die Frage nach dem spezifischen So-Sein des Menschen, die Frage nach seinem Ganz-sein-Können, zu einer Frage, deren Beantwortung nicht ohne eigene Entscheidung möglich ist.5 In jedem Falle hat Sein für dieses Wesen, den Menschen, den Charakter eines Um-zu.6
d. Heideggers vierte, die sog. Kehre charakterisierende These geht davon aus, dass das Wort »Sein« mit unseren sonstigen Worten überhaupt inkommensurabel ist. Es bezeichnet den äußeren Horizont unseres Welt- und Selbstverständnisses. Es eindeutig in seinem semantischen Gehalt fixieren, hieße, sich selbst und die Welt endgültig verstanden haben. Es hieße, dass die Geschichte zu Ende wäre und der Mensch auch. Das ist natürlich ein Missverständnis, das in Wirklichkeit das Äußerste der Seinsvergessenheit markiert, einen szientistischen Anthropozentrismus, der Seiendes nur noch als Gegenstand menschlicher Subjektivität kennt, den Menschen selbst schließlich auch unter die Gegenständlichkeit subsumiert und so die Herrschaft einer seinslosen Subjektivität errichtet, des Nihilismus. In Wirklichkeit kann die Bedeutung des Wortes Sein gar nicht analog zu anderen Wortbedeutungen behandelt werden, bei denen es darum geht, sie durch eindeutige Zuordnung zu einem semantischen Gehalt oder zu einer Leistung des Sprechers festzulegen. Vielmehr übergreift der Sinn des mit diesen Worten Gemeinten den Sprecher und die Sprache, so dass Heidegger hier das Verhältnis von Sinn und Bedeutung, wie Frege es verstand, umkehrt: Der Sinn von Sein ist seine Bedeutung. Aber dieser Sinn ist nicht ein mit Bezug auf uns festgelegter intentionaler Gehalt, sondern umgekehrt, die Sprache ist das Sich-Geltendmachen des Sinnes, also des Seins. Was Sein heißt, kann gar nicht innerhalb der Sprache begriffen werden, sondern nur wenn wir begriffen hätten, was Sprache ist, hätten wir begriffen, was Sein ist. Besser aber sagen wir es umgekehrt, denn jeder Versuch, die Sprache vom Subjekt her als ein Mittel seiner Selbstverständigung zu begreifen, geht am Wesen der Sprache vorbei. Die Nähe Heideggers zur sprachanalytischen Philosophie ist nicht von ungefähr: Beide gehen von einem Primat der Sprache vor der Subjektivität aus. Allerdings tendiert die sprachanalytische Philosophie dahin, Sprache selbst noch einmal naturalistisch, z. B. behavioristisch zu interpretieren. Die Frage: Was ist Sprache? scheint nicht noch einmal mit den Mitteln der sprachanalytischen Philosophie beantwortbar zu sein, und insofern ist der Anspruch derselben, die Stelle der prima philosophia einzunehmen, nicht einlösbar. Heidegger ist hier radikaler. Seine Rede von der Sprache als dem »Haus des Seins«7 geht aus von der Unhintergehbarkeit der Metaphorik und sieht das Schicksal des Sinnes von Sein nicht als Sache der intersubjektiven Verständigung einer Kommunikationsgemeinschaft an, die sich über die Verwendung ihrer Termini einigt, sondern als ein Geschehen, innerhalb dessen das Auftauchen von Sprache und damit erst die Ermöglichung von Subjektivität selbst – als ein Ereignis des Sich-Zeigens – verstanden werden muss. Die Versuche, sich über die Natur dieses Ereignisses bzw. über die Bedeutung des Wortes Sein zu verständigen, sind Stadien dieses Ereignisses selbst und sind umso adäquater, als sie sich nicht als Vergegenständlichungen dieses Ereignisses für ein Subjekt verstehen. Wir sind dieses Gespräch und »führen« es nicht.8 Die Verständigung über die Sprache selbst kann deshalb auch nicht wissenschaftlich, sondern nur die eines dichterischen An-Denkens sein: »Dichterisch wohnet der Mensch.«9 Der Horizont, aus dem wir uns verstehen, steht nicht zu unserer Disposition.
2. Aristoteles: Wissenschaft vom »Seienden als solchen« – eine Suche nach dem Grund von Wirklichkeit
Wie steht es mit Heideggers These von der Seinsvergessenheit der griechischen Metaphysik? Und zwar fragen wir mit Bezug auf Aristoteles. Was will Aristoteles eigentlich wissen, wenn er das on he on thematisiert? Im ersten Kapitel des Buches der »Metaphysik« deutet Aristoteles die Perspektive der Frage an. Es geht – im Unterschied zu jenem späteren Verständnis von Ontologie, auf das Tugendhat Bezug nimmt – nicht um Formalwissenschaft, sondern um Prinzipienwissenschaft. »Wir suchen«, so heißt es in 1003 a 26, »die ersten archai und die obersten aitiai.«
Nun argumentiert Aristoteles so: Etwas kann per accidens Grund sein und per se. So ist Feuer per se Grund der Erwärmung dessen, was in seine Nähe kommt, per accidens aber ist es Grund dieser bestimmten Brandkatastrophe – oder als Sonnenwärme Grund des Blühens der Blumen. Jeder Ursache per accidens liegt ein Ursache-Verhältnis per se zugrunde. Wer nach den ersten Ursachen fragt, muss also nicht nach einem Verhältnis fragen, durch das dieses oder jenes Seiende in seinem So-Sein konstituiert wird, sondern nach dem, was Seiendes als Seiendes konstituiert.
Die Frage nach dem on he on bei Aristoteles ist nicht eigentlich die Frage nach dem, was wir meinen, wenn wir sagen, etwas ist – das setzt Aristoteles in der Tat als das gnorimotaton, als das Allerbekannteste voraus –,10 sondern es ist die Frage, wodurch und warum das ist, was ist. Wir könnten versucht sein, es kantisch als Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit zu übersetzen. Aber diese Frage ist nicht die aristotelische. Die Bedingung der Möglichkeit ist nämlich, so wiederholt Aristoteles immer wieder, die Wirklichkeit. Möglichkeit ist ein teleologischer Begriff. Möglichkeit ist etwas am Wirklichen, und zwar etwas, das in seiner Art, wenngleich nicht an diesem Wirklichen, entweder selbst schon wirklich oder einem schon Wirklichen verwandt sein muss, um überhaupt möglich zu sein. Die Frage, warum das ist, was ist, ist daher die Frage nach dem Grund seiner Wirklichkeit.
Es erscheint mir zunächst wichtig, Folgendes festzuhalten: »Seiendes« ist für Aristoteles nicht so etwas wie ein Gegenstand überhaupt, ein gegen seine Existenz sozusagen indifferentes Etwas, sondern es meint in erster Linie wirklich existierende individuelle Dinge, Substanzen, in zweiter Linie dann jene wirkliche Konstellation der Welt, jenes Ganze von Sachverhalten, die seiend eben deshalb heißen dürfen, weil sie etwas an diesen individuellen Substanzen sind und in ihnen allein ihre Wirklichkeit haben. Die Frage des Aristoteles nach den ersten Gründen des Seienden als des Seienden ist also die Frage nach den Gründen für das Sein der individuellen Substanzen. Für ihr So-Sein oder für ihr Dasein? Aristoteles unterscheidet diese beiden Fragen ausdrücklich nicht: »Es ist Sache derselben Überlegung, zu zeigen, was etwas ist und ob es ist.« (Metaph. VI 1, 1025 b 17 f.) Zur Interpretation dieses Satzes ist es notwendig, den Kontext heranzuziehen. Es geht um die Abgrenzung der prima philosophia von den besonderen Wissenschaften. Diese haben es allesamt nicht mit der ousia, sondern mit bestimmten Gattungen (genae) von Dingen zu tun, deren wesentliche Merkmale sie behandeln, z. B. mit der Gesundheit oder mit der Ausdehnung. Sie leiten diese Merkmale nicht aus einer Realdefinition der ousia ab, sondern nehmen sie entweder empirisch oder axiomatisch auf. Und nun fährt Aristoteles fort: »Und ebenso lassen die Wissenschaften die Frage beiseite, ob das genus, mit dem sie es zu tun haben, existiert oder nicht. Denn es gehört zur selben Art des Denkens, zu zeigen, was es ist und ob es ist.«11
Was soll das heißen? Erst sagt Aristoteles, die Wissenschaften behandeln nur ein bestimmtes »was« und nicht das »dass«. Dann sagt er, Was und Dass können nur zusammengedacht werden. Das ist wohl nur so zu verstehen, dass es die erste Philosophie mit dem wesentlichen Was zu tun hat, mit der ousia als solcher, d. h. mit dem, was ein einzelnes individuelles Ding zu dem macht, was es ist. Dies aber ist für Aristoteles gar nichts anderes als das Prinzip, wodurch es ein Seiendes ist. Quia unumquodque habet suum esse per quidditatem, wie Thomas sehr genau die aristotelische Sicht wiedergibt.12 Von Eigenschaften kann man in abstracto sprechen und ihnen dann das Vorkommen an einer individuellen Substanz zu- oder absprechen. Von der individuellen Substanz macht es keinen Sinn zu sagen, sie sei oder sie sei nicht. Was sie zur individuellen Substanz macht, macht sie zu einem Seienden. Insofern würde also Aristoteles der modernen These zustimmen, dass negative Existenzaussagen sich nie auf Individuen beziehen können, wenn diese Aussagen im Sinne von »es gibt« gebraucht werden. »Es gibt keinen Pegasus« ist keine Aussage über die individuelle Substanz des Pegasus, sondern, so stellen wir den Sachverhalt heute dar, eine Aussage über Pferde. (Allerdings macht es für die klassische Tradition sehr wohl einen Sinn zu sagen »Sokrates existiert«, und diese Aussage ist keineswegs eine Aussage über Menschen, sondern über Sokrates, wie wir noch sehen werden). Aristoteles hat hier den Begriff der zweiten ousia zur Hand. Wirklich ist eine individuelle Substanz. Aber sie ist als individuelle Substanz nur als Instantiierung einer allgemeinen ousia. So liegt es nahe, Aristoteles in die Nähe zu Quine zu rücken: Sein heißt: Instantiierung eines generellen Terminus sein.13
Aber diese Formulierung bringt gerade nicht zum Ausdruck, was Aristoteles sagen will. Sie verwechselt Logik und Sprachanalyse mit Ontologie. Sie unterscheidet nämlich nicht Prädikatausdrücke und Subjektausdrücke, oder wie Aristoteles sagt: Substanzbegriffe. In dem Satz »x (x ist ein Löwe und x brüllt)« werden »Löwe« und »brüllt« in gleicher Weise als Prädikatoren von einem x ausgesagt. D. h. es wird ausgesagt, dass beide Prädikate in Verbindung miteinander instantiiert sind. Aber diese Sicht fragt nicht, was Instantiieren eigentlich bedeutet und ermöglicht. Diese Sicht bleibt im vorstellenden Denken befangen. Für Aristoteles unterscheiden sich diese Begriffe dadurch voneinander, dass der Substanzbegriff »Löwe« das Sein des Löwen bezeichnet. Wenn er aufhört, ein Löwe zu sein, ist er nicht mehr. Wenn er aufhört zu brüllen, hat er nur aufgehört zu brüllen. Rein logisch lässt sich das natürlich umkehren. Wir können sagen: Das Brüllende ist ein Löwe! Und dann folgern, das Brüllende ist nicht mehr. Ja, aber es ist eben doch noch ein Löwe. Können wir also vielleicht sagen: Substanzbegriffe bezeichnen fundamentalere Prädikate, mit deren Wegfall auch die anderen wegfallen? Aber wie ist es dann mit dem Satz: Das Schwein wiegt 3 Zentner? Und nun ist das Schwein geschlachtet und sein Fleisch verarbeitet: Das Gesamtgewicht beträgt weiterhin 3 Zentner. Aber wo ist das Schwein?
Nein, der aristotelische Begriff eines wesentlichen Was, das zugleich Grund des »Dass« ist, hat seinen Ursprung nicht in der Logik. Er hat seinen Ursprung in der Erfahrung von Lebendigem, die ihrerseits die Selbsterfahrung eines Wesens voraussetzt, dem es, um mit Heidegger zu sprechen, in seinem Sein um dieses selbst geht.14 Die aristotelische erste Philosophie reflektiert dies nicht. Sie geht nicht vom Subjekt aus. Sie fasst vielmehr das Subjekt selbst als natürliche Substanz, die allerdings ausgezeichnet ist durch ein nicht natürliches, sondern göttliches Prinzip: den nous poiêtikos. Was ist das Eigentümliche dieses Prinzips? Das Eigentümliche wird in »De anima« 430 a 14 als die Fähigkeit bezeichnet, alle Dinge zu »machen«, und zwar so zu machen, dass der menschliche Geist selbst sie werden kann: »Wirkliches Erkennen ist identisch mit seinem Gegenstand.« Eben insofern der nous gerade nicht eine natürliche Substanz ist, kann er alle natürlichen Substanzen erkennen, und zwar als sie selbst.
Ich sagte, Aristoteles versteht den Menschen als natürliche Substanz. Die Zweiteilung der Wirklichkeit in Subjekt und Objekt hat noch nicht stattgefunden. Aber das bedeutet gleichzeitig, dass der Begriff der Substanz im Ausgang von der Selbsterfahrung des Lebendigen gebildet ist, d. h. desjenigen Seienden, dessen Sein nicht Vorhandensein ist für ein Subjekt, sondern dessen Sein den Charakter des Selbstseins hat, dem es »um etwas geht«. Worum geht es diesem Seienden? Es geht ihm darum, zu sein. Und zwar nicht irgendwie zu sein, sondern als dieses Bestimmte zu sein, dieses bestimmte eidos zu verwirklichen. Sein ist für Aristoteles – wie für Platon – jene Bewegung und Anstrengung, in der sich aus dem mê on der hylê ständig Gestalten aktualisieren und diese substanziellen Gestalten wiederum um ihrer eigenen Selbstverwirklichung willen tätig sind. Warum drängen die Dinge zum Sein? Selbsterhaltung wird von Aristoteles in »De Anima« ausdrücklich als Streben nach Methexis, Teilhabe am Göttlichen bestimmt.15 Gott ist reine energeia‚ Leben. Denn: »Leben ist die Wirklichkeit des Denkens«;16 Leben aber ist der Selbstvollzug, das Sein des Lebendigen. Vivere viventibus est esse.17
Das lässt uns jetzt verstehen, warum für Aristoteles das »wesentliche Was«, die substanzielle Form selbst bereits mit dem Sein, mit der Aktualität einer individuellen Substanz gleichgesetzt wird: Einheit ist gleichbedeutend mit Aktualität. »Einheit hat mehrere Bedeutungen, ebenso wie ›ist‹, aber die fundamentalste Bedeutung beider ist vollendete Wirklichkeit (entelecheia)« (»De Anima« II 1, 412 b 8 f.), d. h. die »Beziehung einer energeia zu dem, wovon es die energeia ist«.18 Einheit ist also Resultat einer Einigung von Mannigfaltigem. Aber Einigung von gegebenem Mannigfaltigem ist nur möglich durch ein Wesen, das selbst in diesem Sinne Einheit, Einigung seiner selbst besitzt. Solche Einigung geschieht durch die Seele. »Sie ist Substanz in dem Sinne, der der definitiven Formel des Wesens eines Dinges entspricht. D. h. sie ist die ›wesentliche Washeit‹ eines Körpers von dem genannten Charakter« (d. h. eines, der Ernährung und Selbstbewegung besitzt).19 Das »wesentliche Was« ist also zugleich der Vollzug des Dass. So schreibt Aristoteles, wenn die Axt ein natürlicher Körper wäre, dann wäre ihr wesentliches Was ihre ousia und damit ihre Seele (412 b11 – 13). »Und wenn die Seele schwände, dann würde sie aufhören eine Axt zu sein – ausgenommen ihr Name.« (vgl. a. a. O., 412 b 20 f.)
Nun sind für Aristoteles nicht alle Dinge beseelt. Die sog. natürlichen Körper besitzen kein Prinzip der Selbstbewegung und Ernährung. Dennoch besitzen sie in ihrer Form eine »Natur«, und d. h. ein Prinzip der Bewegung und der Ruhe, eine Tendenz zu dem ihnen gemäßen Ort und Zustand. Diese Form ist ihre energeia, und das heißt: Ihr Sein ist ebenso wie das Sein des Lebendigen ein Vollzug, eine aktive Synthesis, die von einem Umwillen geleitet ist, dem Ziel, sich in dieser bestimmten Form im Sein zu erhalten, diese Form aktiv weiterzugeben und auf diese Weise am Göttlichen teilzuhaben. Natürliche individuelle Dinge können wir gar nicht anders verstehen. Wir verstehen sie heute als Systeme im Verhältnis zu einer Umwelt. Auch das Atom ist ein System. Aber kein System ist, was es ist, als ein gegen seine Realisierung indifferentes So-Sein. Es ist vielmehr sein Vollzug, und zwar in der Zeit. Unterhalb einer bestimmten Mindestzeitdauer gibt es sozusagen gar nichts, gibt es kein to ti ên einai, sondern nur die pure Möglichkeit.
Aristoteles war sich dieser Herkunft des Begriffes energeia vollkommen bewusst. Im 3. Kapitel des IX. Buches der »Metaphysik« schreibt er: »Das Wort energeia, das wir mit vollständiger Realität verbinden, ist ausgeweitet worden von Bewegungen zu anderen Dingen. Denn energeia im strikten Sinne ist identisch mit Bewegung. Und so wird Bewegung nie von nichtexistierenden Dingen ausgesagt, obwohl man ihnen andere Prädikate beilegt. Z. B. sagt man, dass nichtexistierende Dinge Gegenstände des Denkens und des Begehrens sind, aber nicht, dass sie bewegt sind. Und zwar deshalb, weil sie aktuell existieren würden, wenn sie bewegt wären. Denn von nicht-existierenden Dingen existieren einige potentiell; aber sie existieren nicht, weil sie nicht in vollendeter Wirklichkeit existieren.« (1047 a 30 – b2) Natürlich ist dieser Text nur verständlich, wenn wir Bewegung hier wieder nicht als sukzessives Einnehmen von Raumstellen verstehen, sondern als »Wirklichkeit des Möglichen als solchen«,20 und dieser Begriff ist wieder aus der Selbsterfahrung des aktiven Selbstvollzuges gewonnen: Darum sind die Beispiele, die Aristoteles in diesem Zusammenhang gibt, aus dem Bereich menschlicher Praxis genommen, also z. B. Laufen oder Aufstehen und Hinsetzen. Der Gedanke ist im Grunde ganz einfach: Menschen können wirklich sein oder bloß möglich. Wenn sie wirklich sind, können sie laufen oder nicht laufen. Aber um zu laufen, müssen sie sein. Und ihr Sein ist bereits Vollzug nach Analogie des Laufens. Ihr Sein ist selbst Praxis.
Aber nun stellt sich doch die Frage, was denn eigentlich das Wort »Sein« leistet? Sein im vollen Sinne, reine energeia, ist das seiner selbst bewusste Leben Gottes. Aber um dieses zu charakterisieren, brauchen wir das Wort »Sein« gerade nicht.
Wenn wir den Begriff Gottes bilden, extrapolieren wir vielmehr ein Moment unserer Selbsterkenntnis bzw. Erfahrung, wie dies Meister Eckhart schreibt: »Es ist in der Seele etwas, das, wenn die Seele es ganz wäre, bedeuten würde, dass die Seele ungeschaffen und ungeschöpflich«,21 d. h. dass die Seele wie Gott wäre. Wenn wir den Begriff des Seins bilden, scheinen wir umgekehrt zu verfahren. Wir abstrahieren aus der Erfahrung des bewussten Lebensvollzuges jenes Moment, das uns sozusagen zu einem Element der Allklasse macht, und nennen dies »Sein«. Aber was ist es denn, was wir da abstrahieren? Und was wir dann dem Denken als ein von ihm Voraus- und ihm Entgegengesetztes gegenüberstellen? Denn hier scheint doch ein Paradox vorzuliegen. Im Begriff der Substanz spricht Aristoteles allen natürlichen Dingen ein Selbstsein nach Analogie der Identität eines selbstbewussten Lebensvollzuges zu. Den selbstbewussten Lebensvollzug spricht er ihnen aber nicht zu. Er abstrahiert aus diesem vielmehr ein allgemeineres Moment, das er »Sein« nennt und nach Analogie des Lebens interpretiert. Was ist aber hier das Analogon?
Aristoteles hat diese Frage nicht gestellt. Je nachdem, wie wir sie beantworten, werden wir das Verhältnis des Seins zum Denken bestimmen: als Inbegriff des dem Denken Entgegenstehenden, als Gegenständlichkeit, als das das Denken selbst noch Umgreifende, oder – wie Hegel in seiner Logik – als erstes Moment im Prozess der Selbstvermittlung des absoluten Denkens, das dann als ärmste Bestimmung in diesem endgültig aufgehoben ist.
3. Descartes: Sein als Vorkommen in einem das Subjekt übergreifenden Horizont
Um die Frage zu verdeutlichen, bitte ich den Satz des Descartes zu vergegenwärtigen: »Ich denke, also bin ich.« Was fügt das »ich bin« dem »ich denke« hinzu? Es soll sich ja nach Descartes nicht um einen Syllogismus handeln, sondern um eine unmittelbare Evidenz. Was ist da evident? Warum genügt es Descartes nicht zu sagen: »Ich denke«? Warum abstrahiert er aus dem »Ich denke« das »Ich bin«, und mit welchem Recht? Man muss, um diese Frage zu beantworten, zuvor fragen, was denn Descartes’ Ausgangsfrage, was sein Interesse ist. Das Interesse ist die Überwindung des Skeptizismus: die Suche nach Gewissheit, nach Überwindung des Zweifels. Worauf bezieht sich der Zweifel? Darauf, ob die Dinge so sind, wie sie uns scheinen. Aber was heißt hier »sind«? Warum sagen wir nicht mit dem Bischof Berkeley: Esse est percipi? Was unterscheiden wir da von dem, als was die Welt sich zeigt? Die Antwort, die einzig mögliche Antwort, wie mir scheint, lautet: Der Grund der Unterscheidung liegt darin, dass mein Bewusstsein nicht den ganzen Bewusstseinsraum konstituiert, dass es nicht das einzige Bewusstsein ist. Ich meine nun aber nicht die Differenz verschiedener Bewusstseine im Blick auf eine von allen anvisierte Sache, so dass »Sein« nichts anderes wäre als der Konvergenzpunkt aller Perspektiven oder der Fluchtpunkt der systematischen Kohärenz aller Aussagen. Der Genius malignus könnte uns ja eine kohärente Welt vorspiegeln. Und außerdem könnte er allen Menschen die gleiche vorspiegeln, so dass die Täuschung nie zu durchschauen wäre. Man könnte antworten: Was soll dann noch Täuschung heißen? Was soll das Wort »ist« heißen, wenn es jeden Bezug auf eine mögliche Wahrheit verloren hätte? Fichte hat mit Recht auf dieser Frage immer wieder insistiert. Auf sie ist nun Folgendes zu antworten:
Der Genius malignus selbst hat offenbar ein von seinen Opfern unterschiedenes Bewusstsein. Er sieht die Sache anders, als er sie die Opfer sehen lässt. Und offenbar ist er es, der sie richtig sieht. Descartes aber kommt zu dem berühmten Schluss, dass mindestens an einem Punkt er, Descartes, sie auch so sehen muss, wie sie ist, nämlich wo er sich seines Bewusstseins bewusst wird. Aber warum hier der Begriff »Sein«? Warum begnügt er sich nicht mit dem einer noêsis noêseôs? Darum, weil ich als endliches Bewusstsein mich selbst nicht sozusagen als einen absoluten Bewusstseinsraum konstituiere, sondern mein Bewusstsein als Faktum in dem übergreifenden Raum vorkommt, der gerade nicht durch mein Bewusstsein konstituiert ist. Das wird darin deutlich, dass ich selbst ja mögliches Objekt einer mir selbst nicht bewussten Täuschungsoperation bin, von Seiten des Genius malignus, dessen Bewusstsein gerade nicht mein Bewusstsein ist. Hinsichtlich der Gegenstände der Welt waren wir nun zunächst davon ausgegangen, dass das Bewusstsein des Genius malignus, oder aber, wenn es ihn gibt, Gottes, Maßstab der Wahrheit wäre: Sie sind so, wie sie ihm erscheinen. Ihr esse ist das percipi
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: