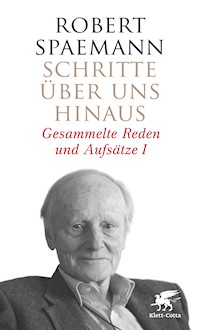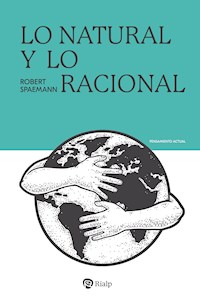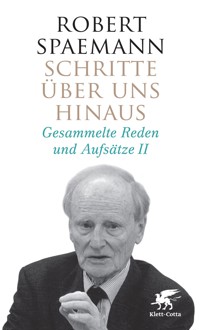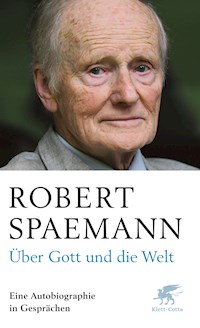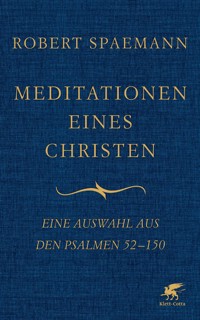31,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Philosoph der Restauration und Vater der Soziologie; gläubiger Christ und Ahnherr eines atheistischen Positivismus - diese Ambivalenz kennzeichnet die ebenso entscheidende wie wenig bekannte Rolle des Vicomte de Bonald in der Geschichte der Gesellschaftslehre. Zwar ging es dem Begründer des »Traditionalismus« vor allem um die Bewahrung der theologisch-metaphysischen Tradition; seine Sprachphilosophie, seine Theorie der Souveränität und der Legitimität zeugen davon. Im Ergebnis aber hob Bonald die alte Metaphysik radikaler auf, als die atheistischen Materialisten des achtzehnten Jahrhunderts es getan hatten; denn er machte Philosophie und Religion zu Funktionen der Gesellschaft. So weit klafften Absicht und Wirkung bei diesem oft als erzkonservativ angesehenen Denker auseinander. Deshalb konnten sich auch so verschieden gerichtete Geister wie Lamennais, mit dessen tragischem Geschick die Anfänge einer »christlichen Demokratie« verbunden sind, und Charles Maurras auf Bonald berufen, der, von Comte herkommend, aus einer Verquickung von Positivismus und Katholizismus ein totalitäres System abzuleiten suchte. Es war Charles Péguy, der dann als erster sah, daß der moderne intellektuelle Konservatismus einen radikaleren Bruch mit der abendländischen Tradition darstellte als die Französische Revolution und die Philosophie ihrer geistigen Wegbereiter. Ein Wortführer aus einer uns heute ferngerückten Zeit erweist sich durch all diese Tatsachen und Bezüge als überaus aktuell. Spaemanns glänzend geschriebenes Buch erschien 1959 zum erstenmal und wird hier, gerade auch im Hinblick auf den Stand der Soziologie nach rund vierzig Jahren, wieder vorgelegt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Robert Spaemann
DER URSPRUNG DER SOZIOLOGIE AUS DEM GEIST DER RESTAURATION
Studien über L.G. A. de Bonald
KLETT-COTTA
GESAMMELTE SCHRIFTEN IN EINZELBÄNDEN
AUSGABE LETZTER HAND
Robert Spaemann, geboren am 5. Mai 1927 in Berlin, studierte Philosophie, Romanistik und Theologie in Münster, München und Fribourg. 1952 promovierte er bei Joachim Ritter in Münster und habilitierte sich 1962 in den Fächern Philosophie und Pädagogik. Von 1962 bis 1992 lehrte er Philosophie an den Universitäten in Stuttgart, Heidelberg und München. Spaemann hatte weltweit Gastprofessuren inne und erhielt mehrere Ehrendoktorwürden. 2001 war er Träger des Karl-Jaspers-Preises. Spaemanns Werke wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Sie beschäftigen sich mit der Ideengeschichte der Neuzeit, mit Naturphilosophie und Anthropologie sowie Ethik, politischer Philosophie und der geistigen Situation der Kirchen. Er griff über 50 Jahre lang in öffentliche Grundsatz- und Wertedebatten ein und äußerte sich unter anderem zur Nutzung der Kernenergie, der Abtreibungs- und Euthanasiegesetzgebung sowie zu Sloterdijks Vorschlägen zur Menschenzüchtung. Kritisch stellte er in seinem Werk die »europäischen Werte« infrage. Am 10. Dezember 2018 starb Robert Spaemann, der bedeutendste konservative Philosoph im deutschsprachigen Raum.
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Das vorliegende Buch ist die überarbeitete Neuausgabe im Rahmen
der »Gesammelten Schriften in Einzelbänden« von Robert Spaemann:
»Der Ursprung der Soziologie aus dem Geist der Restauration.
Studien über L.G.A. de Bonald.«
1. Auflage im Kösel Verlag München
Überarbeitete Neuausgabe im Verlag Klett-Cotta, Stuttgart
© 1998, 2021 by J.G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
Datenkonvertierung: Eberl & Kœsel Studio GmbH, Krugzell
Printausgabe: ISBN 978-3-608-96224-6
E-Book: ISBN 978-3-608-11639-7
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort zur Neuauflage 1998
Vorwort zur I. Auflage 1959
Biographische Vorbemerkungen
Die Philosophie und die wahre Philosophie
Der Ausgangspunkt der metaphysischen Gesellschaftslehre: das Faktum der Sprache
Die Theorie der Sprache als Angelpunkt des »Traditionalismus«
Die natürliche Konstitution der Gesellschaft
Die natürliche Konstitution der Gesellschaft: das Problem der Macht
Das Wesen des Politischen
Die Religion
Vernunft und Aufklärung
Die Geschichte als Reich der Vernunft
Der abstrakte Humanismus der Revolution
Die Idee der Restauration
Lamennais und die Wandlung des Traditionalismus (Charles Péguy)
Das Dilemma des Traditionalismus: Saint-Simon – Comte – Maurras
Bemerkungen zur Würdigung und Kritik
Der Traditionalismus und das Vatikanische Konzil
Nachwort
Anhang
Bibliographie
Register
Vorwort zur Neuauflage 1998
Zu meiner Überraschung wird seit einiger Zeit diesem kleinen, vor fast einem halben Jahrhundert geschriebenen Buch erneut Interesse entgegengebracht, in Italien, in Spanien und auch in Deutschland, sodass ich das Angebot des Verlages Klett-Cotta zur Aufnahme einer Neuausgabe in sein Programm dankbar annehme, ohne die Sicht des damals 24-jährigen noch einmal zu kommentieren. Weit habe ich mich von ihr nicht entfernt. Inzwischen ist der mythische Nimbus der Revolutionen verblasst. Wir haben gelernt, deren Selbstinterpretation nicht mehr unbesehen zu übernehmen, sondern eher ihren Preis zu bedenken. De Bonald ist ein Revolutionskritiker besonderer Art. Seine Kritik der französischen Revolutionen von 1789 und 1792 unterscheidet sich von der zeitgenössischen englischen und deutschen durch ihren antiromantischen Charakter. Sie tritt im Namen von Vernunft gegen Sentimentalität auf, im Namen der volonté générale gegen den Aufstand der Subjektivität, im Namen der verfassten Gesellschaft gegen den »Menschen«, im Namen des Fortschritts gegen den Rückfall in vermeintlichen Neubeginn. Fortschritt heißt für de Bonald vor allem Kontinuität. Dass die kontinuierliche Entwicklung rationaler Institutionen in Frankreich seit dem 12. Jahrhundert irgendwann ihre Fortsetzung finden würde, daran hatte er keinen Zweifel. Er glaubte wirklich, was sein Gegner Rousseau(1), dem er das begriffliche Arsenal seiner Theorie entlieh, geschrieben hatte: »Wenn der Gesetzgeber sich über seinen Gegenstand täuscht und ein Prinzip zugrunde legt, das der Natur der Dinge nicht entspricht, . . . dann wird man erleben, daß die Gesetze unmerklich ihre Kraft verlieren, daß die Verfassung sich ändert und daß der Staat nicht zur Ruhe kommen wird, bis er zerstört oder ein anderer geworden ist und die unbesiegbare Natur die Herrschaft wieder ergriffen hat.« Rousseau hatte in Wirklichkeit in dieser Hinsicht alle Hoffnung fahrenlassen. Die Polis ist unwiederbringlich dahin. Christentum und moderner Flächenstaat machen ihre Wiedergeburt unmöglich. So ist der »Contrat social« ein Abgesang. Der Reaktionär de Bonald ist kein Nostalgiker antiker Bürgertugend. Der moderne Massenstaat ist für ihn kein Grund zur Resignation, die Entzweiung von öffentlicher und privater Sphäre ein Fortschritt und das Christentum die geistige Macht, die das Entzweite zusammenzuhalten vermag.
An Bonalds Revolutionskritik interessierte mich seinerzeit, dass hier erstmals eine streng funktionalistische Theorie der Gesellschaft mit dem Anspruch der prima philosophia auftritt. Diesen Faden habe ich später nicht weiter verfolgt, wohl aber die zentralen philosophischen Motive dieser damals äußerst rasch niedergeschriebenen Arbeit, so den Gedanken der neuzeitlichen Inversion der Teleologie, den dann Hans Blumenberg ins Apologetische wendete. Das gute Leben mit der Unterordnung unter die Bedingungen seiner Erhaltung gleichzusetzen erschien mir immer als eine Form des Nihilismus, des Nihilismus der Rechten. Auch meine Kritik an der funktionalistischen Religionsbegründung liegt auf der gleichen Linie.
Vieles ist mir an dem bis zur Pedanterie gründlichen Systematiker der Restauration zum ersten Mal deutlich geworden. Vielleicht verhilft dieses kleine Buch immer noch dem einen oder anderen zu der einen oder anderen Entdeckung. Zum Beispiel zur Entdeckung eines der wichtigsten Vorläufer des linguistic turn der modernen Philosophie. Und vielleicht fasst sogar ein Verlag den Mut, die »Théorie du pouvoir« mehr als 200 Jahre nach ihrem anonymen Erscheinen in Konstanz in deutscher Übersetzung zugänglich zu machen.
Stuttgart im Januar 1998Robert Spaemann
Vorwort zur I. Auflage 1959
Diesem Buch liegt eine Arbeit zugrunde, die im Jahre 1951 von der Philosophischen Fakultät der Universität Münster als Dissertation angenommen wurde.
Dem Bedürfnis, die behandelten Gegenstände in das Licht zu rücken, in dem sie sich mir heute darstellen, habe ich u. a. durch ein Nachwort Rechnung getragen, das auch als Ergänzung der Einleitung gelesen werden kann. Die Bonald-Zitate sind den in der Bibliographie angeführten »Œuvres complètes« entnommen.
Aufrichtig zu danken habe ich Herrn Professor Dr. Joachim Ritter für vielfache Anregung und Förderung. Sein Einfluss auf die Fragestellungen dieses Buches wird dem Kundigen nicht verborgen bleiben. Mein Dank gilt ferner der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die mir einen kurzen Studienaufenthalt in Paris ermöglichte, und schließlich dem Kösel-Verlag, der sich bereitgefunden hat, die Arbeit zu veröffentlichen.
Biographische Vorbemerkungen
De Bonald gilt als Begründer des sogenannten »Traditionalismus«. Als solchem scheint ihm nur noch ein antiquarisches Interesse zuzukommen. Der Traditionalismus, eine fast vergessene philosophisch-theologische Richtung, gilt als widerlegt oder auch als »überholt«. Solcher Beurteilung einer philosophischen Theorie könnte ein unangemessener Maßstab zugrunde liegen; vielleicht ist er weniger unangemessen gegenüber einer Philosophie, die die Autorität zur »höchsten Vernunft« erklärt und von ebendieser Autorität desavouiert wird. Das geschah durch die kirchliche Verurteilung des Traditionalismus im 19. Jahrhundert.
Es ist aber die Frage, ob man Bonald dadurch gerecht wird, dass man ihn als »Begründer des Traditionalismus« zum Haupt einer erkenntnistheoretischen Schulmeinung und damit zu einer Episode der Philosophiegeschichte macht. Näher bei seinem eigenen Selbstverständnis liegt es, ihn als »maître de la contrerévolution« zu charakterisieren und seine Philosophie der französischen Restauration von 1814 bis 1838 zuzuordnen. Als Theoretiker der Restauration steht er allerdings – weniger für die Zeitgenossen als für die Nachwelt – im Schatten jenes Joseph de Maistre(1), der an Bonald schrieb: »Ich habe nichts gedacht, was Sie nicht geschrieben, und nichts geschrieben, was Sie nicht gedacht hätten«, und der doch genau das war, was Bonald nicht war und nicht sein wollte, ein bel esprit.
Bonald gilt als »Scholastiker« und als trocken. Er selbst hat diese Trockenheit bewusst gepflegt: »Ich überlasse das Kolorit dem Verfasser des ›Emile‹; seine Paradoxe haben es nötig« (I 743). Bonald ist Philosoph und Schriftsteller wider Willen. »Herrschaft der Philosophie« ist für ihn gleichbedeutend mit Revolution, diese aber bedeutet das Ende jener Herrschaft der Vernunft, die im Frankreich des 17. und 18. Jahrhunderts zu ihrer vollendeten Gestalt gekommen war. Erst diese Situation macht es notwendig, der geschichtlich inkarnierten Vernunft auch jenen theoretisch angemessenen Ausdruck zu verschaffen, der sie instand setzt, es mit der revolutionären Philosophie aufzunehmen. Die tiefgreifende Wandlung, die der traditionelle Philosophiebegriff bei diesem Versuch, die Tradition zu bewahren, erfahren hat, ist einer der Gegenstände, die im Folgenden zu behandeln sein werden. Es handelt sich um den Übergang von der Metaphysik zur Theorie der Gesellschaft, zur Soziologie, als deren Vorläufer, ja Begründer der Vicomte de Bonald angesehen werden kann. Das gegenrevolutionäre Denken wird zur Vollendung des revolutionären, der traditionalistische Katholizismus führt über Comte(1) zum atheistischen eines Charles Maurras(1).
Der gleiche Bonald aber, auf den sich die royalistischen Kampftrupps des 20. Jahrhunderts beriefen, war auch der Lehrer des Abbé Lamennais(1), mit dessen tragischem Geschick die Anfänge einer »christlichen Demokratie« auf dem europäischen Kontinent im 19. Jahrhundert verknüpft sind. Diese Zusammenhänge werden in einigen kleinen Kapiteln mehr angedeutet, als dass sie im Einzelnen verfolgt werden. Zunächst und vor allem ist es darum zu tun, das, was bei Bonald selbst philosophisch geschieht, möglichst genau zu vergegenwärtigen und in seiner Bedeutung wie in seiner unaufhebbaren Ambivalenz sichtbar zu machen.
Louis-Gabriel-Ambroise Vicomte de Bonald wurde am 2. Oktober 1754 zu Millau im Rouergue als Sohn einer alten Adelsfamilie geboren. Im Alter von vier Jahren verlor er seinen Vater. Bis zu seinem elften Lebensjahr wurde er zu Hause unterrichtet und von seiner Mutter in einer mehr als nur traditionellen Frömmigkeit erzogen.
Von 1765 an absolvierte er die üblichen Studien der alten Sprachen, der Rhetorik und Philosophie, erst in Paris, später in dem berühmten Oratorianerkolleg in Juilly. Dorther stammt wohl vor allem seine Vertrautheit mit der Philosophie Malebranches(1), der ja selbst den Oratorianern angehörte.
Nach Abschluss der Studien und des Militärdienstes kehrte er 1776 in seine Heimatstadt zurück. 1785 wurde er zum Bürgermeister gewählt; 1790, also schon unter der Herrschaft der Nationalversammlung, wählten ihn die Bürger seiner Stadt in das Direktorium des Departements Aveyron, welches ihn wiederum zum Präsidenten der Departementverwaltung machte.
Diese wenigen Daten sind gerade in ihrer Kargheit aufschlussreich; sie zeigen uns einen Mann, der im Rahmen einer festgefügten oder doch anscheinend festgefügten Ordnung für einen begrenzten Bereich Verantwortung trägt, und dies offenbar in einer Weise, die durch Umsicht, Sachkenntnis und Gewissenhaftigkeit hervorsticht. Weiter nichts. Der Name des Bürgermeisters Bonald wurde nur einmal – in einem Ausnahmezustand sozusagen – bekannt und in der Pariser Nationalversammlung genannt; das war im Sommer 1789, als das Gerücht von umherziehenden Banden zahlreiche Städte und Landstriche beunruhigte. Damals ergriff Bonald, noch als Bürgermeister, die Initiative zur Organisation einer gemeinsamen Selbstverteidigung der Städte des Departements, was ihm ein Lob der Nationalversammlung eintrug.
Bonald ist kein Romantiker. 35 Jahre hat er das Dasein, das er später mit der Feder verteidigte und dann mit Gewalt wiederherzustellen versuchte, einfach gelebt, und zwar an einer Stelle, wo es am ehesten noch als ein substantielles Dasein zu erleben war. Wenn er später die Privilegien des Adels rechtfertigte, indem er sie streng aus der gesellschaftlichen Funktion des Adels ableitete, so war es nicht das Bild des Pariser Hofadels, das ihm vor Augen stand, sondern sein Bürgermeisteramt in Millau und seine Departementsverwaltung in Aveyron.
Es ist für den Charakter der ganzen nun folgenden literarischen Tätigkeit Bonalds tief bezeichnend, dass das erste Schriftstück, das er veröffentlichte, der Brief an das Direktorium des Departements war, in dem er diesem die Niederlegung seines Mandates mitteilte. Anlass war die neue, von der Nationalversammlung beschlossene und vom König unterzeichnete Zivilkonstitution der Kirche und vor allem die dem Klerus abgeforderten Eide auf die neue Regelung des Verhältnisses von Kirche und Staat, die im Grunde eine Krönung der alten gallikanischen »Freiheiten« war. Als Angehöriger der Departementregierung wäre Bonald für die Durchführung dieser Dekrete mitverantwortlich gewesen. Wenn auch sein Amt als Verwaltungspräsident ihm erlaubt hätte, persönlich den betreffenden Sitzungen fernzubleiben, so hielt er es doch für seine Pflicht, aus einer »zweideutigen Abwesenheit oder einem furchtsamen Schweigen« herauszutreten. Das Schweigen des Papstes, die Ablehnung der Dekrete durch die Mehrzahl der Bischöfe sind für ihn ein hinreichendes Argument. »Ich vermag die Achtung, die ich meiner Religion schulde, nicht von der Achtung zu trennen, die sie mir für ihre Diener vorschreibt« – ein Satz, den er später wiederum theoretisch gerechtfertigt hat. »Ich würde meine Religion entehren, wenn ich ihre Priester in den Konflikt zwischen dem Gewissen einerseits und dem Interesse, dem Meineid und der Würdelosigkeit andererseits brächte . . . Nein, nein, meine Herren, nein; die Humanität ebenso wie die Religion erheben sich gegen diese Gedanken.« Dieser Brief, der im eigentlichen Sinne des Wortes die Einleitung seiner neuen Existenz als Emigrant und Schriftsteller darstellt, zeigt uns nicht einen theoretisierenden Politiker oder einen persönlich geschädigten Aristokraten, sondern er zeigt einen Menschen, der sich unmittelbar in seiner religiösen Substanz getroffen findet. Aus diesem Getroffensein entsprang für ihn die Notwendigkeit einer systematischen und umfassenden Auseinandersetzung mit den Prinzipien der Philosophie des 18. Jahrhunderts.
Bonald zog sich zunächst auf seinen Landsitz zurück, um jedoch bald darauf zu emigrieren und in die Fürstenarmee einzutreten. Nach seiner Beurlaubung ließ er sich in Heidelberg nieder und widmete sich dort ganz der Erziehung seiner beiden Söhne. Bonald war kein Weltbürger; er blieb auch in der Emigration leidenschaftlicher Franzose und hätte wohl nie, wie de Maistre(2), seine Dienste einem ausländischen Staat zur Verfügung gestellt. Am Schicksal der französischen Gefangenenkolonnen, die durch Heidelberg geführt wurden, nahm er persönlichen Anteil. Seine Anklage gegen die Revolution ist immer wieder, dass durch sie Frankreich aufgehört habe, die erste unter den christlichen Nationen zu sein.
In Heidelberg entstand sein erstes historisch-philosophisch-politisches Werk, die »Théorie du pouvoir«, das im Ansatz bereits alles enthält, was er später in gedrängterer, systematischerer Form geschrieben hat.
Als Literatur benutzte er dabei nichts anderes als die »Histoire universelle« Bossuets(1), einige Bände seines Lieblingsschriftstellers Tacitus(1) sowie den »Esprit de lois« Montesquieus(1) und den »Contrat social«. Die Bekämpfung dieser beiden Werke war sein eigentliches Ziel. Die »Théorie du pouvoir« wurde in Konstanz von einer Emigrantendruckerei gedruckt; fast die gesamte Auflage, die nach Paris geschickt worden war, wurde auf Befehl des Direktoriums beschlagnahmt. Bonald hat das Buch zu seinen Lebzeiten nie wieder auflegen lassen, obgleich Napoleon(1) sich bereits als erster Konsul erbot, eine Neuauflage zu finanzieren.
Nachdem Bonald eine Zeitlang am Bodensee gelebt hatte, kehrte er im Frühjahr 1797 zu Fuß über Bern, Fribourg, Lausanne heimlich nach Frankreich zurück und blieb zwei Jahre verborgen in Paris, wo er drei weitere seiner Hauptwerke verfasste: »Du divorce considéré au XIXe siecle«, den »Essai analytique« und die »Législation primitive«. Nach dem Sturz des Direktoriums durch Bonaparte(2) kehrte er in seine Heimat zurück, wo seine Frau einen kleinen Teil seiner verschleuderten Besitzungen zurückgekauft hatte. Er widmete sich der Veröffentlichung der in Paris entstandenen Werke und arbeitete mit Chateaubriand(1) an der Redaktion des »Mercure de France« und später des »Conservateur«. Aus dieser Zeit stammen zahlreiche bedeutende Artikel aus seiner Feder. Von 1806 an versuchte Napoleon(3) wiederholt, ihn zur Mitarbeit zu gewinnen. Er ließ ihm die Direktion des »Journal de l’Empire« anbieten und ernannte ihn 1808 zum Universitätsrat. Bonald nahm zunächst nicht an – wie er überhaupt gegenüber Napoleon immer in einer gewissen Reserve blieb. Aber Napoleon ließ seinen Posten nicht anderweitig besetzen und erwiderte auf irgendwelche Vorstellungen in dieser Richtung: »Cette place est réservée à M. de Bonald.«
1810 gab Bonald dem Drängen seiner Freunde nach, nahm das Amt an und begab sich wieder nach Paris, nachdem er die sehr freundschaftliche und vertrauensvolle Bitte von Napoleons(4) Bruder Louis Bonaparte(1), dem König von Holland, Erzieher und Lehrer seines Sohnes zu werden, bedauernd abgelehnt hatte.
Nach dem Sturze Napoleons(5) stellte er seine Dienste uneingeschränkt der Restauration, die er vorausgesagt und erhofft hatte, zur Verfügung. Sein Eintritt in die große Politik könnte als eine bloße Rückkehr erscheinen, eine glanzvolle Rückkehr unter Überspringung einer abgebrochenen Karriere. Aber es handelt sich doch um etwas Neues. Nicht nur, dass Bonald der Begriff der Karriere überhaupt fremd war und für ihn wachsende Verantwortung nicht etwa zugleich wachsende persönliche Befriedigung bedeutete – seine neuen Funktionen waren auch qualitativ anderer Natur als die Bürgermeisterei in Millau vor der Revolution. Bonald kehrte nicht aus dem Dasein des Theoretikers in den unmittelbaren praktischen Dienst an einer nach seinen Begriffen noch intakten Gesellschaft zurück, sondern er kehrte zurück im Bewusstsein des Philosophen, dem nun die universelle Aufgabe zufällt, an der Überwindung einer metaphysischen Desorganisation praktisch-politisch zu arbeiten, deren Gründe er seit zwei Jahrzehnten theoretisch analysiert hatte und deren Wesen sich für ihn auf die einfache Formel bringen lässt: Herrschaft der Philosophie.
Zunächst wurde Bonald Mitglied des königlichen Rates für öffentlichen Unterricht, 1815 Deputierter seines heimatlichen Departements Aveyron in der französischen Abgeordnetenkammer, von 1821 bis 1822 Vizepräsident des Parlamentes und 1823 Mitglied der Pairskammer mit dem Titel eines Staatsministers sowie – ausnahmsweise auf königliche Order – Mitglied der Académie Française. Im Parlament entfaltete er seine ganze Energie und seine viel bewunderte Rednergabe für die Ziele der Wiederherstellung des ancien régime, gegen die Ehescheidungsgesetze, die er für einen zentralen Punkt der Auflösung hielt und deren Abschaffung im Wesentlichen tatsächlich sein Werk wurde, sowie gegen die Pressefreiheit, um derentwillen er sogar mit Chateaubriand(2) auseinandergeriet. Im Jahre 1827 wurde er, ohne sein Zutun, von Karl X.(1) zum Präsidenten der neuerrichteten Zensurbehörde ernannt. Er nahm diesen, übrigens unbesoldeten, Posten an, obgleich es auf ihm nichts zu gewinnen gab als eine Unzahl von Feinden, und wohl schon in dem Bewusstsein, dass es ein verlorener Posten war. Bonald war der letzte, der in Frankreich eine derartige Stellung bekleidete. Der Ausbruch der Julirevolution veranlasste ihn, sein Amt sofort niederzulegen, ohne mit der neuen Regierung überhaupt erst in Verbindung zu treten.
Er zog sich von da an für die letzten zehn Jahre seines Lebens auf seinen Landsitz zurück, schrieb von Zeit zu Zeit noch kritische Artikel, die bewiesen, dass seine Aufmerksamkeit den Zeitereignissen gegenüber nicht geschwunden war.
Im Übrigen widmete er sich der Bestellung seines Landgutes. Die patriarchalische Landarbeit schien ihm eine gültige Form jenes Menschseins, um dessen Bewahrung er politisch vergeblich gekämpft hatte. Von einem solchen Landgut sagt er einmal: »Das ist eine wirkliche Familie, deren Haupt – Besitzer oder Bauer – der Vater ist. Er tut dieselbe Arbeit wie seine Knechte, er ißt dasselbe Brot und oft am selben Tisch.
Dieser Betrieb ernährt alle, die er geboren werden läßt. Er hat Arbeit für alle Altersstufen und für beide Geschlechter; und die Greise, die keine schwere Arbeit mehr tun können, beenden ihre Laufbahn, wie sie sie begonnen haben, und behüten ums Haus herum die Kinder und die Herden« (I. XXIII f.).
Der Vicomte de Bonald starb am 23. November 1840 im Alter von 86 Jahren.
Die Philosophie und die wahre Philosophie
Die Zweideutigkeit der Philosophie
»Ob die Philosophie nützlich sei für die Regierung der Gesellschaft« (III 529) – diese Frage steht über einem kurzen Aufsatz de Bonalds aus dem Jahre 1810. Und um das Problem deutlich zu machen, konfrontiert er Platons(1) Idee von den Philosophenkönigen mit einem Wort Friedrichs(1) des Großen, in welchem dieser versichert, »wenn er eine Provinz bestrafen wollte, so würde er ihr einen Philosophen schicken, sie zu regieren«. »Beide Ansichten können wahr sein«, schreibt Bonald, »und ihre Entgegensetzung beweist nur, daß die Philosophie Platons(2) eine andere Philosophie war als diejenige, von der Friedrich(2) hat sprechen wollen, und die Gesellschaft damals eine andere Gesellschaft als heute.«
Die Frage, die Bonald hier aufwirft, ist keine akademische Frage. Ihre zentrale Bedeutung gewinnt sie für ihn durch die Revolution von 1789. Die Tatsache, dass Bonald im Alter von 40 Jahren mit philosophischen Publikationen beginnt, hat ihren Grund im Faktum der Revolution. Hegel(1) hat es als das Unerhörte dieser Revolution bezeichnet, dass hier der Mensch sich zum ersten Mal »auf den Gedanken gestellt und die Wirklichkeit nach diesem erbaut hat«.1 Darin aber scheint sich erstmals der Platonische(3) Gedanke des Königtums der Philosophie verwirklicht zu haben. Dies muss als der Hintergrund der Frage Bonalds gesehen werden.
Dass in der Revolution nicht irgendein philosophisches Problem zur Sprache kommt, sondern die Philosophie selbst zum ersten Mal seit der Patristik zum Problem wird, dies in aller Schärfe gesehen zu haben, macht die Relevanz der konterrevolutionären Antithesen des Vicomte de Bonald aus.
In den »Recherches« von 1818 schreibt er: »Es ist heute ein Glaubensartikel, daß die Philosophen des 18. Jahrhunderts mit unseren Katastrophen nichts zu tun haben . . . Was auch daraus folgen mag, ich jedenfalls würde zur Ehre der Philosophie nicht nur, sondern auch der Nation es vorziehen, beiden etwas mehr Schuld zu geben, als auf solche Weise die Nichtigkeit der einen und die Leichtfertigkeit, Unbedachtheit, ja Stupidität der anderen zuzugestehen. Diese Art der Rechtfertigung gleicht allzusehr der Methode, die vor Gericht üblich ist, wenn man einen Angeklagten, um ihn zu retten, für unzurechnungsfähig erklärt« (III 40).
Die Philosophie soll ernster genommen werden, als sie sich selbst nimmt, wenn sie sich dadurch ein Alibi zu geben sucht, dass sie die revolutionären Theorien einfach als »falsche Philosophie« desavouiert. »Ich habe in dieser Unterscheidung schon immer den Scharfsinn der Fakultät bewundert« (III 533). Die zeitgenössische Philosophie hat mit dieser Unterscheidung das eigentliche Problem noch gar nicht begriffen, welches gerade darin liegt, dass eine solche Unterscheidung gemacht werden kann und muss. Denn es erweist sich darin die Abstraktheit des Begriffes der Philosophie überhaupt, der »Meinung«, wie Bonald auch sagt. Philosophie, von den Griechen im Gegensatz zur »Meinung« (δóξα) konzipiert, sinkt in den Augen der antirevolutionären Kritik selbst zur doxa herab. Es gibt richtige und falsche Meinungen, richtige und falsche philosophische Theorien, aber gerade aus dieser Unbestimmtheit der Philosophie folgt, dass sie, um konkret, um zu einer bestimmten »Meinung«, zu einer bestimmten Philosophie zu werden, aufhören muss, bloße Philosophie zu sein. Sie vermag sich ihre Bestimmtheit nicht selbst zu geben. So wird die Philosophie nach dem Geschmack der Zeit in der allegorischen Fabel »La Philosophie et la Révolution« als Frau dargestellt (III 535). Als solche erhält sie ihren Namen und damit ihre Bestimmtheit erst aus der Verbindung, die sie eingeht, der Verbindung mit Religion oder Atheismus als den eigentlichen Realitäten, den echten Zuständlichkeiten der Gesellschaft (I 628).
Die Idee der Vernunftherrschaft ist dialektisch wie die Vernunft selbst. Dieser in Abhebung von Verstand (intelligence), Geist (esprit) und Meinung (opinion) konzipierte Begriff der Vernunft (raison) steht in bemerkenswerter Nähe zum Vernunftbegriff des deutschen Idealismus. Vernunft ist nicht ein subjektives Vermögen, sondern sie ist wesentlich Erkenntnis der »Wahrheit«, »der durch die Wahrheit aufgeklärte Geist« (I 1171). »Der Mensch hat also nur Vernunft, wenn er die Wahrheit erkannt hat« (I 1172). Vernunft ist wesentlich das verwirklichte Vermögen, die aufgehobene Subjektivität. (Im Französischen ebenso wie im Lateinischen, Spanischen usw. liegt dieser Doppel-Sinn bereits im Sprachgebrauch des Wortes raison; z. B. im Ausdruck »avoir raison« – Recht haben.) Aber gerade weil Vernunft nicht »bloße Vernunft« ist, sondern der Zustand der Unterwerfung des subjektiven Vermögens unter die Wahrheit, darum ist der Begriff der Vernunftherrschaft zweideutig. Bedeutet er Herrschaft des subjektiven Raisonnierens, der opinion, so ist es gerade nicht Vernunft, die herrscht, sondern die Affekte, die »passions«, die sich des Verstandes allsogleich bemächtigen, sobald er sich von der Wahrheit abkehrt und aufgehört hat, »vernünftig« zu sein. Herrschaft der Vernunft im positiven Sinne wäre Herrschaft der Wahrheit über das Meinen, welche Herrschaft durch das von der Subjektivität der Leidenschaft hin und her geworfene Meinen, also durch »bloße Vernunft«, nicht hergestellt werden kann. »Die Vernunft des Menschen ist nichts anderes als die gebändigte Leidenschaft, deshalb genügt die Vernunft allein nicht, um die Leidenschaft zu bändigen« (III 406). – In einem solchen Satz liegt der Ansatz einer Überwindung bloßer Verstandes- und Reflexionsphilosophie beschlossen.
Wenn aber Philosophie nicht abstrakt, vom philosophierenden Vermögen her, definiert wird, dann ergibt sich, was Philosophie jeweils ist, erst aus dem besonderen Verhältnis, in dem sie sich als »Suche nach der Wahrheit« (I 1054) zu der geschichtlichen Form der Anwesenheit oder Abwesenheit der Wahrheit und Sittlichkeit in einer Gesellschaft bestimmt, das heißt aus ihrer gesellschaftlichen Funktion, und diese kann sehr verschieden sein.
Schon am Anfang der Philosophie, den Bonald im Orient sucht, tritt ihr Doppelcharakter hervor. Die Philosophie wird geboren zugleich aus dem Bedürfnis und aus der Unkenntnis der religiösen Lehren. »Sie nahm ihren Anfang an der Seite der Religion, sozusagen in deren Hürde, und als sie sich von ihr trennte, behielt sie eine gewisse unklare Idee ihrer ersten Lehren« (III 6).
In diesem Ursprung der Philosophie liegt der Grund ihrer künftigen Zweideutigkeit. In einer Gesellschaft wie der griechischen, deren öffentlicher Glaube in den Augen Bonalds – wie schon in denen Bossuets(2) – aus Absurditäten bestand, deren Religion ohne Moral war und wo als »eitler Luxus des Geistes« (I 1056) alle die philosophischen Theorien entstanden, die die Geister bis heute verwirren, dort erinnerte sich in Sokrates(1) und Platon(4) die Philosophie der in der öffentlichen Religion verlorengegangenen ursprünglichen moralischen Wahrheiten, jenes »natürlichen Gesetzes, das den ersten Familien anvertraut worden war und nun überall verdunkelt, aber doch nirgends gänzlich ausgelöscht war. Sie (diese Philosophen) suchten in der Vernunft des Menschen die Ordnung und Regel, die sie in einer Gesellschaft nicht mehr fanden, welche als öffentliche Institutionen nur noch Spiele hatte« und in der die Macht dem Kampf der Parteileidenschaften überantwortet war (III 531). In der Heillosigkeit der Zeit wird Philosophie zur bewahrenden Erinnerung an eine ursprüngliche Wahrheit.
So musste die Philosophie zur einzigen Religion der Weisen des Heidentums werden (III 532). Aber die Philosophie bleibt im Unterschied zur Religion notwendig ein »Kabinettstück« (III 536). »Sokrates(2) hätte gewiß die sittliche Wahrheit auf Erden befestigt, wenn der Geist eines Menschen, wer er auch sei, für den Menschen eine Autorität und damit eine Garantie für die Gesellschaft sein könnte« (III 7).
Dass das nicht möglich ist, hat die alte Philosophie nicht verstanden, weil sie, »auch wo sie die besten Gedanken über den Menschen anstellte, das Wesen der Gesellschaft doch niemals begriffen hat« (III 53).
Die Philosophie kann allenfalls einen Machthaber zur Tugendhaftigkeit erziehen, und in einem Staat wie dem antiken, wo »der Mensch alles und die Gesellschaft nichts ist« (III 53), hängt ja das Glück der Völker weitgehend von der Tugendhaftigkeit der Machthaber ab. Aber diese individuelle Tugendhaftigkeit stiftet keine dauerhafte Ordnung der Gesellschaft, sie kann nie die soziale Institution ersetzen. Was die Alten nicht verstanden haben, ist der qualitative Unterschied zwischen dem Menschen und der Gesellschaft. Auch ein ganzes Volk von Philosophen würde nicht die sittliche Wahrheit zur Darstellung bringen, die sich in der gesellschaftlichen Institution verkörpert. »Ein Volk von Philosophen wäre ein Volk von Suchern, und ein Volk muß bei Strafe des Untergangs wissen und nicht suchen« (III 38). Zu diesem Wissen aber reicht die Verstandesphilosophie nicht aus; es ist erst möglich und wirklich durch die geoffenbarte Religion des Christentums, die, obgleich oder gerade weil sie durch bloße Vernunft nicht abgeleitet werden kann, die einzige Religion der Vernunft ist, nicht nur dem Inhalt, sondern auch der Form nach, denn sie ist »ausgestattet mit der einzigen Autorität, die den Menschen befehlen kann, und zwar allen Menschen« (III 532).2
Darum aber ist die Stellung der Philosophie in der christlichen Gesellschaft fragwürdig. »Die Philosophie war die einzige Religion der Weisen des Heidentums, die Religion muß die einzige Philosophie der Christen sein« (III 532). Die Religion hält die Menschen an, an ihrem Platz ihre Pflicht zu tun. Wenn diese Plätze richtig angewiesen sind, dann bleibt für die Philosophie kein Platz übrig (III 534). Zu einer starken Regierung, einer gerechten Justiz, einer geordneten Administration, einer klugen Diplomatie, einem disziplinierten Heer und einem frommen Klerus bedarf es keiner Philosophie.
In der christlichen Gesellschaft hat daher »die Maxime Platons(5), die im Jahrhundert Ludwigs XIV.(1) vergessen war und heute erinnert wird, gar keinen oder aber einen falschen und gefährlichen Sinn« (III 532).
Die Argumentation Bonalds gegen die Philosophie steht in einer merkwürdigen Analogie zu Platons(6) Angriff gegen die Dichter im »Staat« und kann von daher noch erläutert werden. Homer(1), sagt Platon(7), hat weder Kriege gewonnen noch praktische Dinge erfunden noch die Menschen besser gemacht. Die Dichter bestärken den niederen Seelenteil, die Leidenschaften, so dass »die Empfindungen von Lust und Unlust im Staat das Szepter führen statt des herkömmlichen Gesetzes und stattdessen, was allgemein zu allen Zeiten als das Beste gegolten hat: statt der Vernunft«.3
Für Bonald, dem die christliche Gesellschaft als die Realisierung der platonischen Idee der Herrschaft der Vernunft gilt, können die Philosophen gegen diese Herrschaft immer nur die unterdrückten Leidenschaften, die passions de I’homme, auf den Plan rufen.
Nun war aber Dichtung für Platon(8) offenbar zweideutig. Als Erfindung von unfrommen Göttergeschichten, als sentimentale Poesie sollte sie aus dem Staat verwiesen werden. Als »Lobgesang auf die Götter aber und als Preis auf die tüchtigen Männer« sollte sie Hausrecht haben. Ebenso wird die Philosophie Pascals(1), Malebranches(2), Fénelons(1) und Leibniz(1)’, den Bonald den Platon des Nordens nennt, als »religiöse Philosophie« ausdrücklich von Bonalds Verdikt über die Philosophie ausgenommen. Er hat für diese Männer immer nur Worte des Lobes und der Verehrung. Die Revolution hat die Zweideutigkeit der Philosophie zutage gebracht.
Diese Zweideutigkeit, diese Homonymität aber ist von solcher Art, dass »der prunkvolle Name« (III 535) Philosophie zunächst im eigentlichen Sinne der modernen, unreligiösen Philosophie gilt, demgegenüber die »wahre Philosophie« als die Ausnahme erscheint, ganz ähnlich wie bei Platon(9) nicht einfach die unfrommen Dichter vertrieben werden, sondern die Dichter ganz allgemein – mit Ausnahme der frommen. Nicht gute und schlechte Dichtung, wahre und falsche Philosophie stehen sich gegenüber; (reine) Dichtung und »wahre Dichtung«, (reine) Philosophie und »wahre Philosophie« lauten vielmehr die Antithesen, die das Problem als philosophisches in Gang bringen.
Madame von Staël(1) hat von ihrem entgegengesetzten Standpunkt aus diese Antithesen begriffen, wenn sie den Vicomte de Bonald bei einer persönlichen Begegnung in ebenso charmanter wie pointierter Weise »den philosophischsten aller Schriftsteller mit der wenigsten Philosophie« nannte. Bonald, der diese Episode berichtet, fühlt sich versucht, dieses zweifelhafte Kompliment umzukehren, in gleicher Weise wie sie die Worte philosophe und philosophie in einem doppelten Sinn zu nehmen und ihr zu erwidern, »daß sie sehr wenig philosophisch sei mit viel Philosophie« (III 595 f.).
Das Wesen der modernen Philosophie
Die moderne Philosophie unterscheidet sich für Bonald nicht primär dadurch von einer anderen Philosophie, dass sie neue Theorien entwickelt. Diese anderen Theorien sind vielmehr Indizien für »eine andere Methode zu philosophieren« (I 1060). Dass diese Methode von Bonald im Gegensatz zu derjenigen Platons(10) mit der aristotelischen(1) identifiziert wird, ist ein Faktum von weitreichender philosophiegeschichtlicher Bedeutung, auf das in anderem Zusammenhang noch einzugehen sein wird.
Da aber Philosophie als ein Geschäft des partikularen Verstandes als solche abstrakt ist, so sind die Bestimmungen, durch welche sie zu dem je Besonderen wird, als das sie in Wirklichkeit vorkommt, nicht wiederum »rein« philosophischer Natur.
Religion und Atheismus, von denen jede Philosophie lebt und in deren Dienste sie jeweils steht, sind selbst nicht in ihrem Ursprung philosophische Theorien. In der erwähnten Fabel »La Philosophie et la Révolution«, in der die Philosophie als eine etwas leichtsinnige Frau erscheint, lässt Bonald sie sich mit dem Atheismus verbinden und aus dieser Verbindung die Revolution hervorgehen. Durch dieses doppelte Verhältnis ist jenes Denken gekennzeichnet, das bei ihm »philosophie moderne« heißt. Die moderne Philosophie ist »wesentlich atheistisch in der vollen Bedeutung des Wortes« (III 471). Der Atheismus ist nicht ein zufälliges Resultat ihrer Spekulation, sondern sie ist in ihrem Ansatz durch ihn definiert. »Die moderne Philosophie ist nichts anderes als die Kunst, alles zu erklären und zu regeln ohne die Mitwirkung der Gottheit«, »die Kunst, sich der Religion zu entledigen« (l’art de se passer de la religion; III 29). Und da Atheismus für Bonald nicht ein bloßes philosophisches Hirngespinst ist, sondern der reale Zustand der Abwesenheit Gottes in der Gesellschaft und für die Gesellschaft (»l’athéisme est l’absence de la Divinité«; III 474), so muss auch der Deismus in diesem Sinne, ungeachtet seiner eigenen Intentionen, als atheistisch gelten. Denn der Gott des Deismus ist ja »abwesend«, »ein völlig abstraktes und ideales Wesen« (III 475), »eine reine Abstraktion« (III 487). Darum ist »ein Deist jemand, der in seinem kurzen Leben nicht genug Zeit hatte, Atheist zu werden« (III 1348). In solcher Argumentation ist der Boden der traditionellen philosophischen Diskussion verlassen. Die objektive Bedeutung einer Philosophie fällt mit dem, was der Philosoph subjektiv jeweils zu sagen intendiert, nicht mehr notwendig zusammen. Sie wird politisch und theologisch bestimmt.
Die radikale Position Bonalds lässt das differenzierte Bild der Aufklärungsphilosophie in einer grandiosen perspektivischen Vereinfachung erscheinen. Aber diese Vereinfachung ist nicht naiv. Die Vielfalt der Theorien wird nicht übersehen, sondern selbst als Phänomen gedeutet, als ein Zeichen für die Willkür und Ortlosigkeit des abstrakten Philosophierens. Es gibt in Bezug auf jedes Seiende ein einziges wahres, angemessenes und notwendiges Verhältnis. Die nicht notwendigen Bezüge hingegen sind immer unendlich zahlreich (I 628). Aber diese zahllosen willkürlichen Positionen, die glauben, ohne eine reale geistige Heimat sich auf eigene Faust bestimmen zu können, haben keinen Bestand. Sie tendieren notwendig zu äußersten Entscheidungen: Atheismus und Anarchie. »In letzter Analyse gibt es kein Mittleres zwischen Katholizismus und Atheismus« (I 628) – ein Satz, den später Kardinal Newman(1) wiederholt hat.
So lag es in der Logik der Sache, dass die Verfassung von 1789 bis 1793 von der Jakobinerverfassung abgelöst wurde (III 483) und die Gemäßigten das Schafott bestiegen. Nur der Inhaber absoluter Macht kann es sich leisten, »gemäßigt« zu sein.
Für Bonald gilt es, die Abstraktheit der mittleren, »unparteiischen« Positionen zu erkennen und zu zeigen, wie unausweichlich sie der radikalen Negation der überlieferten Ordnung dienen. Er hat – ganz wie später Donoso Cortés(1) in Spanien und wie von der revolutionären Seite her Marx(1) – den Liberalismus als bloße Übergangsform zur totalitären Diktatur begriffen. Und er hat darüber hinaus die später moderne Idee eines unausweichlichen persönlichen Engagements entwickelt, wenn er etwa schreibt: »Man darf nicht vergessen, daß der Mensch immer damit beschäftigt ist, die Gesellschaft zu erhalten oder sie zu zerstören« (I 608).
Die Gegnerschaft gegen das »neutrale« Denken ist für Bonald zentral. Die Revolution als solche bedarf keiner Widerlegung. Sie hat sich selbst widerlegt, inhaltlich durch den Terror, mit dem sie die Herrschaft der Philanthropie errichtete, geschichtlich durch das schnelle Ende, das sie sich in Napoleon(6) selbst bereitete.
Für Bonald gilt es, das Alibi zu zerstören, das die scheinbar unparteiische Philosophie sich nachträglich zu geben bemüht, indem sie ihr legitimes Kind verleugnet (III 539).
Von hier aus muss Bonalds Stellung zu Montesquieu(2) gesehen werden, der so oft in seinen sozialphilosophischen Schriften als Gegner ausdrücklich und unausdrücklich im Hintergrund steht, so dass man Bonald als den eigentlichen Gegenspieler Montesquieus(3) hat bezeichnen können.4 Montesquieus »Esprit des lois«, dieses »Orakel der Philosophen der großen Welt« (I 1091), ist für Bonald darum besonderer Aufmerksamkeit wert, weil es das »tiefgründigste aller oberflächlichen Werke« ist (III 487). Die Oberflächlichkeit liegt darin, dass Montesquieu(4) über politische Konstitutionen handelt, ohne auf das Wesen des Politischen einzugehen, und darum, ohne sich auf echte inhaltliche Antithesen einzulassen. Er wendet sein Interesse auf völkerpsychologische, klimatische und sonstige Erklärungen der »Motive« und des »Geistes« dessen, was sich irgendwo findet, anstatt nach den Prinzipien der Gesellschaft zu fragen als nach einem Maßstab, an dem, was jeweils ist, gemessen werden kann (I 129). So werden die Probleme der Politik und der Religion auf »meteorologische Probleme« reduziert (I 198). Bonald will den Schein solcher Neutralität zerstören. »Ein Werk, das trotz oratorischer Vorbehalte und zweideutiger Phrasen im Resultat darauf hinausläuft, daß der Breitengrad über Religion und Regierungsform entscheidet, ist ein antireligiöses und antipolitisches Werk, ein antisoziales Werk« (I 129).
Wenn auf diese Weise Staat und Religion in ihrer inhaltlichen Bestimmtheit auf Psychologie und Geographie zurückgeführt werden, so bleiben für die eigentliche Analyse ihrer Struktur nur noch ganz formale, gewissermaßen politisch »entschärfte« Gesichtspunkte. Die Theorie von der Teilung der Gewalten – »das Grunddogma der modernen Politik« (I 380) – ist eine solche formalistische Theorie. Indem sie die faktische Einheit der Macht und die Notwendigkeit einer letztgültigen Entscheidung in jedem politischen System im Dunkeln lässt, dient sie der Auflösung jener Staatsform, in der allein die Einheit der Macht sichtbar in Erscheinung tritt und die Entscheidung verantwortlich übernommen wird, der Monarchie. Darum gehört Montesquieu(5) nicht weniger als Rousseau(2), der ein »Romantiker« ist und fortwährend wider bessere Einsicht »die Gesellschaft dem Menschen opfert, die Geschichte der Meinung und das Universum der Stadt Genf« (I 130), zu den Wegbereitern von Anarchie, Atheismus und Terror, und sei es nur deshalb, weil seine Anhänger den Angriff der Rousseauisten(3) auf die Grundlagen der alten Sozialordnung »nur mit jener Schwäche und Unentschlossenheit zu verteidigen vermochten, welche die Folge einer zweideutigen Doktrin und eines furchtsamen und unentschiedenen Lehrers sind« (I 1092). Weil die Schwäche der legitimen Macht der Gesellschaft die erste und entscheidende Ursache dafür ist, dass sich gegen diese Macht die immer latente Macht der Menschen erhebt, darum ist Montesquieu(6) durch seine theoretische Aushöhlung des Begriffes der Macht Wegbereiter der Revolution. Sein Formalismus ist illusionär. Er ist nur das Vehikel, mittels dessen sich die Macht des Menschen über den Menschen etabliert. Darum ist Montesquieu(7) ein Übergang.
»La philosophie moderne« – das ist jene Philosophie, die in ihrem Ansatz darauf geht, die Einheit des Universums in Natur, Mensch und Gesellschaft nicht als ursprüngliche, übergeordnete, göttliche Einheit zu begreifen, sondern sie von unten, von den Elementen her allererst sich konstituieren zu lassen und zu legitimieren. »Die moderne Philosophie verwechselt im Menschen den Geist mit den Organen; in der Gesellschaft den Souverän mit den Untertanen; im Universum Gott mit der Natur, überall die Ursache mit ihren Wirkungen. Und sie zerstört jede allgemeine und besondere Ordnung, indem sie dem Menschen jede reale Gewalt über sich selbst nimmt, den Staatsoberhäuptern die reale Gewalt über das Volk, Gott selbst die über das Universum« (I 1060). Materialistische Anthropologie, sensualistische Erkenntnislehre, demokratische Politik und atheistische Metaphysik erscheinen in einer grandiosen Parallelität. »Philosophie moderne« – das sind Locke(1), Hume(1), Voltaire(1) und La Mettrie(1), Condillac(1) vor allem und die Enzyklopädisten sowie die Theoretiker der Revolution, St. Lambert(1), Condorcet(1) und andere.
Es kann sich bei dieser umfassenden, alle Lebensgebiete umgreifenden Bewegung nicht um irgendwelche theoretischen oder moralischen Irrtümer handeln. »Materialismus und Atheismus sind nicht moralische Irrtümer, sondern die Abwesenheit und Negation der Moral« (III 394), sofern nämlich Moral etwas anderes ist als ihr Gegenteil, die »wohlverstandene« Befriedigung der Neigungen, der »passions de l’homme«, mit welcher die moderne Philosophie – einschließlich Adam Smith(1) – sie zu identifizieren sucht (I 23). Der Eudämonismus des modernen selfish system verfällt bei Bonald dem gleichen Verdikt wie bei Kant(1).
Die Identifizierung von Vernunft und Neigung wie überhaupt das ganze moderne System der unvermittelten Identifizierungen ist für Bonald nur zu begreifen als der Triumph einer Philosophie, deren eigentlicher Antrieb eben diese Neigungen und das »Interesse« des Menschen sind. Nur der Mensch kann eine derartige Verwirrung anstiften, weil in ihm allein der Widerstreit von Vernunft und Neigung statthat. Autorität der Vernunft aber bedeutet konkret nichts anderes als die Vernünftigkeit der Autorität in der Gesellschaft, in welcher der Mensch sein Dasein hat (III 1361). Und so stellt sich der Widerstreit von Vernunft und Neigung dar als der fortgesetzte Widerstreit des »Menschen« und seiner Neigung mit der vernünftigen Form seines Daseins, mit der religiös-politischen Gesellschaft. »Denn auch der gerechteste Mensch – in seiner abstrakt-sinnlichen Form als Individuum – macht eine unablässige Anstrengung, sich in irgendetwas der Regel zu entziehen und sich von der Gesellschaft zu isolieren. Er kann und will nichts anderes, als die Gesellschaft zu zerstören, um an ihre Stelle eine andere zu setzen, deren Gesetzgeber und Machthaber er selbst ist« (III 134).
In der modernen Philosophie hat sich dieser Aufstand des »Menschen« theoretisch, in der Revolution praktisch vollzogen. Allen Meinungen dieser Philosophie liegt ein Interesse zugrunde (I 623), das Interesse des Menschen an der Befriedigung seiner ungeordneten Neigungen, seines Willens zur Macht, den er mit Freiheit verwechselt. Von den modernen Philosophen heißt es wiederholt, dass sie immer »den Menschen« und nie die Gesellschaft im Auge haben.