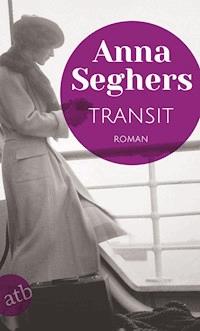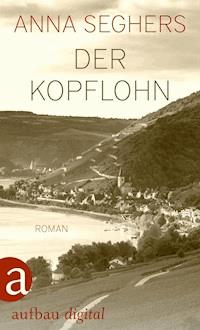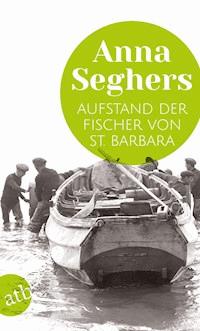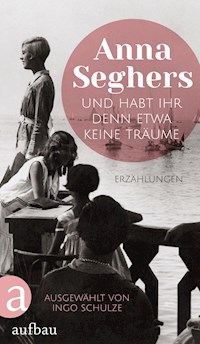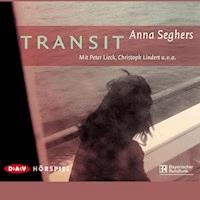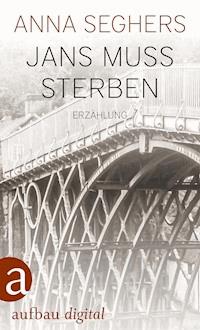8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für eine Überfahrt lang, von Brasilien nach Deutschland, hat der junge Tropenarzt Ernst Triebel einen aufmerksamen Zuhörer seiner sonderbaren, verwickelten Lebensgeschichte gefunden. In Santos war ihm eine Frau begegnet, die ihn schmerzhaft an das Mädchen erinnerte, mit dem sein Leben einmal unlösbar verbunden war. Triebels Rückkehr nach Europa ist ein weiter, verlustreicher Weg. Er löst sich von den Träumen seiner Jugend und akzeptiert den Schmerz, der zum Leben gehört.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über Anna Seghers
Netty Reiling wurde 1900 in Mainz geboren. (Den Namen Anna Seghers führte sie als Schriftstellerin ab 1928.) 1920-1924 Studium in Heidelberg und Köln: Kunst- und Kulturgeschichte, Geschichte und Sinologie. Erste Veröffentlichung 1924: „Die Toten auf der Insel Djal“. 1925 Heirat mit dem Ungarn Laszlo Radvanyi. Umzug nach Berlin. Kleist-Preis. Eintritt in die KPD. 1929 Beitritt zum Bund proletarisch- revolutionärer Schriftsteller. 1933 Flucht über die Schweiz nach Paris, 1940 in den unbesetzten Teil Frankreichs. 1941 Flucht der Familie auf einem Dampfer von Marseille nach Mexiko. Dort Präsidentin des Heinrich-Heine-Klubs. Mitarbeit an der Zeitschrift „Freies Deutschland“. 1943 schwerer Verkehrsunfall. 1947 Rückkehr nach Berlin. Georg-Büchner-Preis. 1950 Mitglied des Weltfriedensrates. Von 1952 bis 1978 Vorsitzende des Schriftstellerverbandes der DDR. Ehrenbürgerin von Berlin und Mainz. 1978 Ehrenpräsidentin des Schriftstellerverbandes der DDR. 1983 in Berlin gestorben.
Romane: Die Gefährten (1932); Der Kopflohn (1933); Der Weg durch den Februar (1935); Die Rettung (1937); Das siebte Kreuz (1942); Transit (1944); Die Toten bleiben jung (1949); Die Entscheidung (1959); Das Vertrauen (1968). Zahlreiche Erzählungen und Essayistik.
Informationen zum Buch
Für eine Überfahrt lang, von Brasilien nach Europa, hat der junge Tropenarzt Ernst Triebel einen aufmerksamen Zuhörer seiner sonderbaren, verwickelten Lebensgeschichte gefunden. In Santos war ihm eine Frau begegnet, die ihn schmerzhaft an das Mädchen erinnerte, mit dem sein Leben einmal unlösbar verbunden war. Triebels Rückkehr nach Europa ist ein weiter, verlustreicher Weg. Er löst sich von den Träumen seiner Jugend und akzeptiert den Schmerz, der zum Leben gehört.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Anna Seghers
Überfahrt
Eine Liebesgeschichte
Inhaltsübersicht
Über Anna Seghers
Informationen zum Buch
Newsletter
Text
Impressum
»Mit einer Abfahrt ist nichts zu vergleichen. Keine Ankunft, kein Wiedersehen. Man lässt den Erdteil endgültig hinter sich zurück. Und was man dort auch alles erlebt hat an Leiden und Freuden, wenn die Schiffsbrücke hochgezogen wird, dann liegen vor einem drei reine Wochen Meer.« –
Ich sagte nichts zu meinem jungen Mitreisenden. Wahrscheinlich hatte er seine Gedanken nur vor sich selbst ausgesprochen. Ich kannte ihn erst seit zwanzig Minuten. Ich hatte hinter ihm gewartet bei der Kontrolle unserer Papiere. Dabei hatte ich festgestellt, dass er wie ich unser polnisches Schiff, die »Norwid«, in Rostock verlassen würde. Er war Arzt – das hatte ich gleichfalls bei der Kontrolle mitbekommen. Sein Spezialfach war Innere Medizin. Er studierte auch Tropenmedizin, in einzelnen Kursen. Daher war er zu einem Kongress nach Bahia gefahren. Der Purser hatte ohne Beanstandung gleichgültig genickt.
Was meinem Mitreisenden offenbar Spaß machte, die lange Seefahrt, die uns bevorstand, war mir zuwider. Ich hätte gern so rasch wie möglich meine Familie wieder gesehen. Man hatte mich aber nun mal für diese Reise gebucht. Mit dem Flugzeug war ich gekommen. Die Reparatur, der Zweck meiner Fahrt nach Rio Grande do Sul, war schnell erledigt gewesen. Senhor Mendez, der voriges Jahr meiner Firma die Landmaschinen abgekauft hatte, stand köpf vor Erstaunen über unsere Zuverlässigkeit, denn ich war vertragsgemäß vier Wochen nach der Beschwerde auf seinem Rancho erschienen. Nämlich, meine Kollegen daheim wussten, dass ich mit meiner Frau und den zwei Mädelchen in die Tatra gefahren war. Sie hatten keine Bedenken gehabt, mich aus dem eben begonnenen Urlaub herauszutelegrafieren, obwohl sie selbst daran schuld gewesen waren, dass die Maschinen statt unter Dach und Fach unter freiem Himmel lange auf den Transport gewartet hatten.
Mein Direktor hatte mir auch noch ins Gewissen geredet – am Telefon ins Gewissen, denn ich war in der Nähe von Prag, sodass ich das Flugzeug sogleich besteigen konnte – ich sei es unserem Staat schuldig, sofort nach Brasilien zu fliegen, damit die dort wissen, dass unsere Republik streng ihre Verträge einhält.
Das ging aber alles den Jungen, der neben mir stand, nichts an. Er kam mir ziemlich sonderbar vor. Man braucht nicht gleich einem Fremden zu erzählen, was einem durch den Kopf geht.
Er sagte: »All die Leute an Bord, all die Leute an Land, die sich noch irgendwas zurufen müssen! Wie sie sich zuwinken, die nassgeweinten Taschentücher zerknautschen! Und ich, ich bin stolz, dass an dieser Küste kein Mensch mehr für mich existiert zum Abschiednehmen. Alles ist endgültig vorbei, wenn man die Schiffsbrücke hochzieht.« –
»Warum zieht man sie noch nicht hoch?«
»Weil noch etwas angefahren wird. Sehen Sie da drüben den Kran? Jetzt streckt er noch mal seinen Greifer aus. Er setzt auf unserem Schiff noch ein paar Körbe ab. Der Koch, sehen Sie, nimmt alles selbst in Empfang. Wahrscheinlich hat er auf dem nächsten Straßenmarkt in letzter Minute die Reste billig zusammengekauft. Papayas, Guajavas, Orangen, Bananen, Ananas, Avocados. Die Früchte dieses Landes.«
»Ich hoffe, er hat uns auch ein paar Winteräpfel aufbewahrt. Zur Vorbereitung auf daheim, für die letzte Woche.«
»Ich kenne diesen Koch. Er war auf meiner letzten Reise dabei. Die musste ich auch zu Schiff machen. Ich fuhr auf der Joseph Conrads Ich überwachte damals einen empfindlichen Transport. Dieser Koch ist ein überaus sparsamer Mensch. Vielleicht hat er einmal irgendwo an der Ostsee ein Wirtshaus betreut.« –
Inzwischen war das Erwartete geschehen: Die Schiffsbrücke war hochgezogen. Der Lotse brachte uns aus dem Hafen. Zwischen breiten und schmächtigen Schiffen aller Länder der Welt. »Dann wird er uns dem Meer überlassen«, sagte der junge Mensch in dem ihm eigenen Ton, als sei alles wichtig, was er mitteilen musste, »was uns dann widerfährt, daran wird er keinen Anteil mehr haben. Er leitet dann schon ein anderes und wieder ein anderes Schiff aus dem Hafen – « Er brach plötzlich ab. »Verzeihung, ich heiße Ernst Triebel.«
Ich sagte: »Franz Hammer. Ich bin Ingenieur.«
»Ich bin Arzt. Das heißt, ich habe gerade mein Studium beendet.«
Der Schiffsjunge gongte zum Essen.
Weil wir Cargo fuhren, nämlich Kaffee nach Polen und nach der DDR, gab es auf unserem Schiff nur ein paar Kabinen für Passagiere.
Wir setzten uns rasch um unsere zwei Tische herum. An einem dritten Tisch saßen der Kapitän, sein Erster Offizier und sein Erster Ingenieur. Ich entdeckte hinter einem Pfeiler noch ein winziges Tischlein. Es war für eine einzelne Frau bestimmt. Eine kräftige, warm und braun gekleidete Nonne. Sie hatte sich wohl das Recht ausbedungen, allein ihre Mahlzeiten einzunehmen. Zu ihr gehörte offenbar als Begleiterin die ältliche, magere, lang-rockige Frau an meinem eigenen Tisch. Denn die stand oft auf, schlüpfte hinter den Pfeiler und fragte die Nonne nach einem Wunsch. Ich konnte ihr Tun leicht verfolgen, denn sie saß an der Schmalseite des Tisches, und ich war an der Längsseite der letzte. Der Passagier, der neben mir saß, trug den Arm in der Schlinge. Das schien aber seine gute Laune nicht zu verderben. Seine listigen hellblauen Augen gingen unglaublich schnell von einem Passagier zum anderen. Wie sich alsbald herausstellte, sprach er Polnisch und Deutsch, Portugiesisch und Spanisch, Französisch und Englisch und weiß der Teufel was noch. Er drehte auf einmal den Kopf und stellte sich vor: »Sadowski.« Er bat mich ohne viel Federlesens, ihm das Essen auf den Teller zu legen und das Fleisch zu schneiden. Er hätte sich, schon an Bord, den Arm ausgekugelt, als er jemand half, sein Gepäck zu heben. Der Zweite Offizier, der auch als Schiffsarzt fungierte – denn auf kleinen Schiffen wie unserem gab es keinen besonderen Schiffsarzt –, hatte ihm gleich den Arm wieder eingerenkt. »Bei der Ankunft muss er heil sein«, sagte Sadowski. »Ich bin Techniker. Ich habe schon meine Stelle in Gdynia. Ich habe zehn Jahre mit mir gekämpft: Soll ich heimfahren? Ich möchte noch mal meine Mutter lebend Wiedersehen. Und gleich das Pech in den ersten fünf Minuten. –
Drehen Sie sich bitte mal heimlich um«, sagte er kurz darauf – er sprach nicht nur alle möglichen Sprachen, er kannte sich auch unglaublich geschwind in den Schicksalen der Mitreisenden aus –, »gleich hinter Ihnen am anderen Tisch sitzt eine alte verschrumpelte Frau, die war jahrzehntelang in Brasilien. Sie kam mit der polnischen Familie, die sich beim Abschied halbtot geweint hat. Schon die kleinen Kinder dieser Familie hat sie groß gepflegt bis zur Heirat. Und aus Dankbarkeit gab ihr die Familie auf die Heimreise allen Plunder mit, den sie hier nicht mehr braucht, alles Wollzeug, aus drei Generationen. Wahrscheinlich ist die Herrschaft in Brasilien reich geworden. Sie hat ihr aber erklärt, die ausrangierten Sachen seien nötig in unserem bitterkalten Polen.«
Als ich mich nach dem Nachbartisch umdrehte, erblickte ich sofort diese alte Frau. Sie trug eine blaue Wollmütze. Mein Blick fiel auch auf Triebel. Er machte mir ein Zeichen: Nachher.
Sadowski sagte: »Die braune Nonne, die Karmeliterin, war nur ein paar Wochen in Brasilien. Sind Sie nicht schon von Bahia her mit ihr gefahren? Sie hat in dem prächtigen Haus gewohnt, das ihrem Orden gehört – Sie hat wahrscheinlich eine Unmenge unseres Geldes verschoben.« Er sagte schon »unseres«. »Eine Menge hübscher heiliger Mädchen ist um sie herumscharwenzelt mit Abschiedsgeschenken, keine Nonnen, sondern Kinder, noch zu jung, um sich zu vermählen mit einem irdischen oder himmlischen Bräutigam.«
Er brach ab und redete auf polnisch mit dem blondgezopften Mädchen an seiner andren Seite. Die Mutter, auch blond, saß zwischen Tochter und Sohn. Ich dachte: Dieser Sadowski weiß sicher bereits, warum sie unterwegs sind. Und ich war eifersüchtig, weil er Jahr und Jahr auf diesem Erdteil gelebt hatte und nichts verlernt von seiner Muttersprache. Würde ich auch nicht, so dachte ich dann. Seine eigne Sprache verlernt man nie.
Sadowski erzählte mir alsbald, was er von diesen Leuten wusste. Der Vater der Kinder war Konsularbeamter. Sie gingen in Rio in eine portugiesische Schule. Zugleich gab ihnen die Mutter polnischen Unterricht. Ihr Koffer war voll polnischer Schulbücher. Vor dem Ende der Ferien fuhr sie heim mit den Kindern, damit die in Krakau ihre Examen machten. Fuhr der Vater endgültig heim, konnten sie ohne Schwierigkeiten jeden Beruf erlernen.
Ich lobte die Frau. Nur ihre Beharrlichkeit mache den doppelten Unterricht möglich. Sadowski übersetzte mein Lob. Die Frau sah ein wenig hart aus. Ihr Gesicht wurde aber hell vor Freude bei meinem Lob.
Wir bekamen unsren Nachtisch aufgetragen: Ananas, so zubereitet, wie es hierzulande üblich ist. Die Frucht wird zuerst ausgehöhlt, sodass sie wie ein Gefäß auf dem Teller steht. Das Fruchtfleisch wird in kleine Würfel zerhackt und die Schale, das Gefäß auf dem Teller, damit gefüllt.
Ich dachte mir, das ist zuviel Mühe für unseren Koch. Mal sehn, wie lang er es aushält.
Das ältliche bescheidene Fräulein an der Schmalseite des Tisches rührte ihre Ananas gar nicht an. Sie trug sie sofort zu der braunen Nonne. Die bedankte sich fröhlich und fing augenblicklich zu löffeln an. Das Ehepaar, das mir gegenübersaß, flüsterte miteinander. Ich nahm an, ihre Absicht, dieser Nonne Ananas anzubieten, hatte sich als überflüssig herausgestellt. Darum begannen beide begierig, ihre Schalen auszulöffeln und dann noch auszukratzen.
Sadowski beugte sich zu mir und flüsterte, der kleine runde Ehemann sei ein berühmter Sänger in Polen. Jetzt hätte er Gastspiele in Brasilien gegeben, in Rio und in São Paulo. Er sei selbst in Rio dabei gewesen. Die ganze polnische Kolonie hätte geweint. Er hätte nichts vom heutigen Tag gesungen, keine Lieder, welche die Herzen spalten, sondern alte Gesänge, die die Herzen zusammenschmelzen, auch manche frisch vertonte Gedichte, zum Beispiel von Norwid, ob ich den kenne. Ich sagte: »Nein. Nie gehört.« – »Ein Jammer. Den kenne ich sogar, auch wenn ich bloß ein Elektriker bin. Unser Schiff ist nach ihm benannt. Aber Joseph Conrad, den kennen Sie doch?«
Ich wagte nicht, noch mal nein zu sagen, bei uns in der DDR seien diese Schriftsteller nicht sehr bekannt. Ich überlegte schnell, da ich wenig lese, habe ich vielleicht einfach nichts von ihm gehört. Darum sagte ich: »Ja, gewiss.« – »Viele Menschen«, sagte Sadowski, »glauben, Conrad sei Engländer. Er war aber Pole. Er wurde Seemann, und dann ging er nach England.« Ich fragte: »Warum?«, weil ich glaubte in meiner Unwissenheit, der Mann hätte, wie viele andre, sein Land verlassen, um nach dem Westen überzusiedeln. Sadowski fuhr aber fort: »Joseph Conrad war ganz versessen auf Schiffe. Damals stieß Polen noch nicht ans Meer. Als er auf einer Reise mit seinem Hauslehrer das Meer erblickte und zum ersten Mal Umgang hatte mit Seeoffizieren, da war es für ihn ausgemacht, was für einen Beruf er wählen müsse. Er hat an Bord und an Land sein Lebtag Romane geschrieben, die auf der See spielen. Übrigens hat er nie aufgehört, Polen zu lieben, auch als er in England lebte.«
Ich nahm mir fest vor, mir gleich nach der Ankunft ein Buch von Joseph Conrad zu kaufen, falls man ihn wirklich bei uns druckte. Sadowski sagte: »Jetzt wäre Joseph Conrad ganz glücklich, weil ein großes Stück Meer zu uns gehört.«
Ich dachte mir, wie sonderbar stolz dieser Sadowski auf sein Stück Meer ist. Dabei hat er sich jahrelang überlegt, ob er nach Polen zurück soll.
Ich ging nach Tisch in meine Kabine. Der Mensch, mit dem ich sie teilte, hatte am Nachbartisch hinter mir gegessen. Jetzt lag er auf seinem Bett und starrte mich grußlos an. Mein Erscheinen verdross ihn. Freundlich waren die Leute bei Tisch gewesen, in seinem bösen und stummen Gesicht war aber zu lesen: Ob du aus Rostock stammst oder aus Frankfurt am Main, du hast meine Brüder ermordet. Ich konnte kein Polnisch sprechen und außerdem nicht mit der Tür ins Haus fallen und ihm sagen, die Nazis hätten meinen Vater in einem KZ zugrunde gerichtet, und außerdem war ich im Krieg ein Kind und Polen hätte ich nie gesehen. Ihm zu erklären, warum ich auf einem polnischen Schiff fuhr, hätte ein langes, ihm unverständliches Gerede gegeben.
Da er nicht aufhörte, mich böse anzustarren, verließ ich bald die Kabine. Ich ging an Deck. Ein Schimmer Küste war noch sichtbar. An dem Platz, an dem ich ihn morgens getroffen hatte, stand mein junger Reisegefährte Ernst Triebel. Im Gegensatz zu dem, was er über »Abschied« verlauten ließ, starrte er unausgesetzt auf den Küstenstreifen, der vielleicht schon Nebel war. Über uns kreisten die Möwen, oder wie hier die Seevögel hießen. Sie konnten noch immer zurückfliegen.
»Waren Sie auf der Industrieausstellung in São Paulo?«
»Ich hatte dazu keine Zeit, denn ich musste eine dringende Reparatur in Rio Grande do Sul besorgen. Ich flog mit dem Flugzeug hin, weil es furchtbar eilte. Und jetzt fahre ich zurück mit dem polnischen Schiff, das zufällig um diese Zeit abgeht.«
»So war das also mit Ihnen«, sagte Ernst Triebel, »mit mir war es anders.«
»Gewiss. Es ist anders bei jedem.«
»Bei mir war es ganz besonders.«
»Jeder glaubt, bei ihm sei es etwas Besonderes.«
»Es gibt Besonderheiten, die schwer zu ertragen sind. Zum Beispiel meine. Die hab ich fast nicht ertragen. Jetzt, wenn ich denke, wie still es die nächsten Wochen sein wird, dann fühle ich, diese besondre Sache kann vorübergehen. Sie kann vorübergehen, aber das ist noch nicht sicher. Ich weiß nicht einmal, ob sie wirklich vorübergehen soll. Ich meine, im Erinnern.«
»Glauben Sie wirklich, dass all diese Vögel heim fliegen?«
»Alle. Das weiß ich. Das ist schon meine dritte Reise. Das erste Mal fuhr ich, ein kleiner Junge, mit meinen Eltern mit dem Norddeutschen Lloyd nach Brasilien. Vor zwei Jahren fuhr ich von Gdynia nach Santos. Jetzt kam ich zwar mit dem Flugzeug, aber ich muss auf dem Schiff zurück. Wahrscheinlich zum letzten Mal.« –
»Darauf kann man nicht schwören. Ich sicher nicht. Wenn mein Betrieb in diesem Land wieder etwas montiert. Ihnen kann es auch so gehen.« Ich hatte das Gefühl, dass der junge Mensch gerade jetzt das Bedürfnis hatte, sich auszusprechen. –
»Das erste Mal fuhren wir kurz vor der Kristallnacht, wenn Sie wissen, was das ist.«
»Ja, ja. Gewiss. Das hab ich in der Schule gelernt. Etwas Schlimmes mit den Juden.«
Ich war zufrieden, dass ich ihm schneller antworten konnte als dem Sadowski auf seine Frage nach Joseph Conrad.
»Mein Vater war kein Jude«, sagte Triebel. »Er hatte aber Angst, meine Mutter könnte von ihm getrennt werden. Er liebte sie sehr. Ein Glück, dass ihr Bruder schon damals in Rio lebte und uns Visen geschickt hatte und Billetts.«
»War Ihre Mutter schön?« –
»Damals, als mein Vater endgültig den Entschluss fasste abzufahren, sah ich sie wohl zum ersten Mal richtig an. Sie glich den Mädchen und Frauen aus Tausendundeiner Nacht. Ich konnte plötzlich verstehen, warum mein Vater ihrethalben weit wegfuhr. Darin bestand aber nicht allein seine Liebe. Sie steckt tief in einem drin, die Liebe. Und bleibt doch verbunden mit etwas, was sichtbar ist. Das macht an der Liebe das Seltsame aus. Verstehen Sie?« –
»Die Möwen sind immer noch da, obwohl man nichts mehr sieht von Küste.«
»Sie kommen wahrscheinlich von der großen Insel Fernando da Cunha. Nachts fährt unser Schiff da vorbei. Auf dieser Insel sperren die Brasilianer ihre Gefangenen ein.« –
Im selben Moment kam ein junger, fröhlicher Mensch die Treppe heruntergesprungen, auf uns zu. Triebel sagte: »Mein Tischnachbar. Günter Bartsch.«
Der Junge, sein ganzes Wesen war fröhlich und flink, sagte mehr zu Triebel als zu mir: »Kommen Sie gleich rauf. Durch das Radar sieht man schon ein Stück Insel.«
Die Passagiere standen bereits in einer Reihe. Der Opernsänger, Sadowski, der erboste Pole aus meiner Kabine, die Nonne, die blaumützige Kinderfrau, die Konsulin, ihre zwei Kinder. Vielleicht noch ein paar, die ich nicht kannte. Jetzt auch der junge Mann Günter Bartsch, Triebel und ich. Ein Offizier stellte, mit einer Erklärung auf polnisch, das Radar ein. Einer nach dem anderen sah auf blankem Glas einen Fleck mit Zacken.
Ich hatte noch nie durch ein Radar gesehen. Wusste nur, dass jemand ständig durchsehen muss, damit das Schiff nicht auf einen Felsen stößt oder auf eine Insel.
Sadowski sagte: »Das Unglück mit dem italienischen Dampfer passierte, weil der Eisberg bereits zu nah war, um das Schiff zu wenden. Der Kapitän wird nie wieder fahren dürfen. Obwohl natürlich sein Offizier die Hauptschuld hat. Er sah nicht ständig durch das Radar. Er war bei seinem Kollegen, dem Telegrafisten. Niemand ahnte, dass der Eisberg so tief kommt. Das stellte sich alles erst vor dem Seegericht raus.«
Nachdem wir alle den zackigen Fleck auf hellem Grund betrachtet hatten, gingen Triebel und ich hinunter. Im Abenddunst tauchte bald die wirkliche Insel auf. Wir fuhren nach dem Essen an einem felsigen Vorgebirge vorbei. Mir schien, die Insel weiche uns aus und treibe dann wieder auf uns zu. In den Bergspalten glimmten bereits einige Lichter.
Dann fiel die Nacht herunter. – Da mir die Kabine zu stickig war, stand ich nach ein paar Stunden auf und ging an Deck. Triebel stand an seinem alten Platz, als hätte er ihn gar nicht verlassen. Ich sah ihn von der Seite an. Er sah dem letzten, kaum sichtbaren, fast schon verschwundenen Vorsprung der Insel nach, als ob es ihn schmerze.
Er sagte: »Das war das letzte Stück von Amerika.« Er fügte hinzu, weich, wie man zu einem kranken Kind spricht, aber er sprach zu sich selbst: »Wenn wir das Leuchtfeuer von der Bretagne sehen, kommen wir in Europa an. Dazwischen ist Meer. Drei Wochen.« Er schien mir nicht mehr so hell begeistert von diesen drei ganz freien Wochen. –
Ich fragte, nur um ihn abzulenken von irgend etwas, was ihn bedrückte: »Als Sie das erste Mal nach Rio fuhren, fuhren Sie auch an der Insel vorbei?«
Er sagte müde: »Wahrscheinlich. Ich war noch ein Kind und gab darauf nicht acht. Das Schiff war von Auswanderern vollgestopft. Vater und Mutter sprachen meistens heftig allein. Sie haben sich sicher gegenseitig getröstet. Sie konnten beide die Abfahrt einfach nicht fassen. Wir waren vier in der Kabine. Außer uns dreien gab es noch einen großen Jungen. Der lehrte mich Schachspielen.
Mein Onkel, den ich nicht kannte, der Bruder meiner Mutter, war damals stellvertretender Direktor einer Lungenheilanstalt. Die lag nicht weit entfernt von Rio.
Bei der Ankunft starrten wir alle die ungeheure, die rasende Stadt an. Es wäre uns schlecht ergangen, wenn nicht im Augenblick der Landung der Onkel aufgetaucht wäre. Er küsste meine Mutter. Meinen Vater begrüßte er ziemlich kalt. Ihr gemeinsames Studium hatte er längst vergessen. Ich glaube, er klopfte mir auf die Schulter.
Mir war sogleich bange vor dem Onkel, obwohl er sicher ein Arzt war wie alle Ärzte. Ich merkte auch irgendwie, hier herrschten Gesetze, die alles zermürbten. Die Zeit selbst unterstand einem solchen Gesetz. Zum Beispiel, ich habe wahrhaftig bis heute nicht mehr an den Jungen gedacht, der mit uns in der Kabine war und mich Schachspielen lehrte.
Ich hielt mich an meiner Mutter fest. Der Onkel ging mit uns aufs Zollamt. Man nennt es Alfândega. Das ist ein arabisches Wort. Es ist in Rio eine unermessliche Halle, in der es von Ankömmlingen und ihrem Gepäck wimmelt. Am meisten erstaunten mich die vielen Neger und die Gruppen von Mönchen. Die hatten wahrscheinlich soeben ihr italienisches Schiff verlassen. Ihre Sprache, wie eine Glocke, klang zwischen vielen Sprachen.
Da mein Onkel portugiesisch sprach wie ein Portugiese und eine hochfahrende Miene zeigte, bekamen wir schnell unser Gepäck.
Wir aßen dann irgendwo. Mein Onkel, der jetzt die Macht hatte, eröffnete uns, nicht als Vorschlag, sondern als ruhigen Befehl, er fahre mit meinen Eltern nach diesem Sanatorium. Dort sei der künftige Arbeitsplatz meines Vaters. Es gäbe ein Zimmer für Vater und Mutter. Mich aber würde er gleich in das vorzügliche englische Internat bringen, in dem auch seine Jungens lernten. Es sei hier unglaublich schwer, auf einer höheren Schule Platz zu finden. Aber er hätte Glück gehabt. Die Direktorin, Frau Withaker, hätte seine Söhne aufgenommen. ›Und jetzt nimmt sie auch dich auf, Kleiner, denn ihren Sohn untersuche ich dauernd, sodass sie in einem gewissen Sinn von mir abhängt.‹
Als meine Mutter schüchtern fragte: ›Kann er nicht mit uns? In unser Zimmer?‹, sagte mein Onkel: ›Unmöglich.‹
Wir waren alle drei bestürzt. Der Onkel sagte auch: ›Habt ihr keine Zeitung gelesen? Ihr könnt Gott danken, dass ihr hier seid. Sei nicht zimperlich, Hanna.‹
Was hätten wir tun können? Das kleine Haus, in das uns der Onkel fuhr, sah sauber aus. Frau Withaker empfing uns kalt. Als meine Mutter mich küsste, weinte ich bitterlich. Ich weiß noch, dass ich während des Abendessens im leeren Schlafzimmer blieb.
In unserem Zimmer wohnten wohl ein Dutzend Knaben. Auch einer der Vettern. Doch meine Vettern behandelten mich als Außenseiter. Ich konnte weder Englisch noch Portugiesisch, und ich wurde oft ausgelacht. Ich dachte andauernd, wann mich meine Mutter wieder besuchen würde. Sie kam nach ein paar Tagen. Wir waren zusammen glücklich. Kurz darauf ist etwas geschehen, was meine Jugend verändert hat. Stört es Sie, wenn ich es Ihnen noch schnell erzähle?« –
Ich spürte stark, er musste weiter sprechen. Darum sagte ich: »Nein, nein. Erzählen Sie bitte alles.«
Das Abendlicht flutete über die See. Zwei Fluten mischten sich, die eine, die schwärzlichblau war, bereits mit dem Abglanz der Sterne, die andere unruhig und hell, vielleicht noch durchspült vom Schaum der Insel. Da das Schiff schwankte, entstanden beständig vor unseren Augen Himmel und Meer.
Ich hätte viel lieber alles ruhig betrachtet, ohne Worte, ohne Stimme, doch Ernst Triebel fuhr fort: »Ich wartete lange umsonst auf den Besuch meiner Mutter. Sie schrieb mir ein paar Mal, sie sei krank. Eines Tages erschien mein Vater. Ich sah ihm gleich an, was geschehen war. Er führte mich auf die Straße. Wir gingen hin und her und setzten uns dann auf eine freie Bank. Wir schwiegen. Schließlich sagte mein Vater: ›Es war ein schwerer Typhus. Sie hat sich angesteckt!‹
Ich sagte: ›Sie lebt also nicht mehr.‹ –