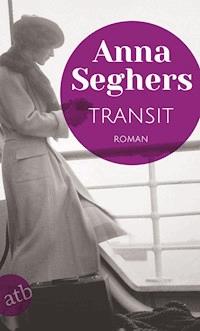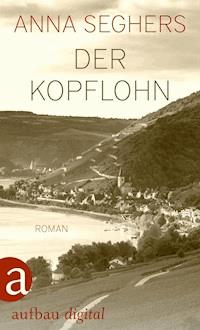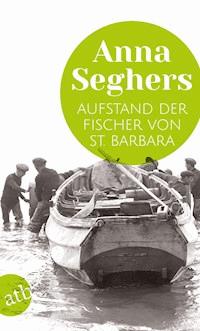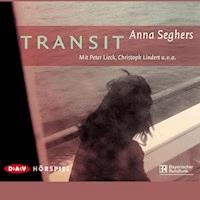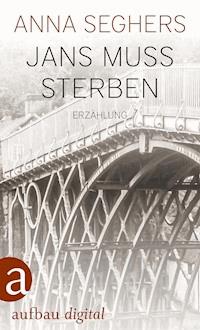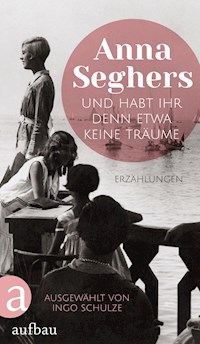
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die großen Erzählungen in einem Band Anna Seghers, die derart viele Tonlagen beherrschte, nutzte die kurze Prosaform so kontinuierlich wie keiner ihrer Zeitgenossen, um literarisch unmittelbar auf sich verändernde Verhältnisse reagieren zu können. Heute lesen sich ihre meisterlichen Erzählungen aktueller denn je und sollten nicht nur dazu anregen, Seghersʼ reizvolles Werk neu zu entdecken, sondern auch ihre Botschaft von der Kraft der vermeintlich Schwachen weiterzutragen. »Anna Seghersʼ Erzählungen gehören zum Besten, was die deutschsprachige Literatur des 20. Jahrhunderts hervorgebracht hat … Es kommt darauf an, sie zu lesen.« Ingo Schulze
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Anna Seghers wurde vor allem berühmt durch ihre großen Romane »Das siebte Kreuz« und »Transit«. Was nicht weniger bemerkenswert ist: Es lässt sich kaum ein Jahr finden, in dem die Schriftstellerin keine Erzählung geschrieben hätte. Die kurze Prosaform ermöglichte ihr, der Schriftstellerin, unmittelbar auf die sich rasant verändernde Welt zu reagieren: von der Weimarer Republik über die Weltwirtschaftskrise und die »Machtergreifung« der Nazis, über Flucht und Exil im Zweiten Weltkrieg, ihre Rückkehr nach Deutschland, die Entstehung zweier deutscher Staaten bis hin zum Mauerbau und weit hinein in die späte DDR. Heute verblüfft, wie aktuell ihre Erzählungen sind und uns noch immer unmittelbar anzusprechen vermögen.
Über Anna Seghers
Anna Seghers wurde 1900 als Netty Reiling in Mainz geboren. Nach der Heirat mit dem Ungarn László Radványi lebte sie ab 1925 in Berlin. 1928 erschien ihre erste Veröffentlichung, die Erzählung »Aufstand der Fischer von St. Barbara«, für die sie den Kleist-Preis erhielt. Als Jüdin und Kommunistin doppelt gefährdet, floh sie 1933 über die Schweiz nach Paris und 1941 mit ihrer Familie von Marseille nach Mexiko. 1947 kehrte sie nach Berlin zurück, im gleichen Jahr wurde ihr der Georg-Büchner-Preis verliehen. Von 1952 bis 1978 war sie Vorsitzende des Schriftstellerverbandes der DDR. Sie starb 1983 in Berlin.
Ingo Schulze, geboren 1962 in Dresden, ist Autor von Romanen, Erzählungen, Essays und Reden. Sein Werk wurde in dreißig Sprachen übersetzt und mit internationalen Preisen ausgezeichnet. 2020 erhielt er den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für sein Engagement als politischer Autor und Künstler. Ingo Schulze lebt in Berlin.
Mehr zum Autor unter www.ingoschulze.com.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Anna Seghers
Und habt ihr denn etwa keine Träume
Erzählungen
Ausgewählt und eingeleitet von Ingo Schulze
Mit einem Auswahl Nachwort von Ingo Schulze
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Von der Kraft der Schwachen — Von Ingo Schulze
Die Ziegler
Auf dem Wege zur amerikanischen Botschaft
Reise ins Elfte Reich
I. Einreise
II. Empfang
III. Die Orden
IV. Berufswechsel
V. Hochzeit
VI. Besuch bei den Behörden
VII. Gesuch
VIII. Einschulung
IX. Wiedersehn
Die schönsten Sagen vom Räuber Woynok
Das Argonautenschiff
Die drei Bäume
Der Baum des Ritters
Der Baum des Jesaias
Der Baum des Odysseus
Der Ausflug der toten Mädchen
Post ins Gelobte Land
Die Unschuldigen
Wiedereinführung der Sklaverei in Guadeloupe
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Der gerechte Richter (Fragment)
Der Führer
Die Heimkehr des verlorenen Volkes
Der Schlüssel
Impressum
Von der Kraft der Schwachen
Von Ingo Schulze
Bevor unsere Deutschlehrerin mit dem Unterricht begann, bat sie darum, die gerahmte Schwarzweißfotografie von Anna Seghers wieder gerade zu rücken. Außer ihr hatte es offenbar niemanden gestört, dass Anna Seghers schief an der Wand hing, womöglich war es von uns gar nicht bemerkt worden.
»Nicht dass sie noch runterfällt!«, sagte unsere Lehrerin und fügte dann hinzu: »An der Anna liegt mir schon viel.«
Dieser Satz hat mich damals – Ende der Siebziger, ich war in der neunten oder zehnten Klasse – derart überrascht und befremdet, dass ich mich heute noch an ihn erinnere. Wie konnte man denn eine Schriftstellerin allein beim Vornamen nennen? Das tat nicht mal meine Mutter. Zudem war Anna Seghers eine offizielle Figur, immerhin die Präsidentin oder mittlerweile Ehrenpräsidentin des Schriftstellerverbandes der DDR. Und ging einen denn das, was sie schrieb, außerhalb der Schule wirklich etwas an? Gerade nach der Schullektüre von »Das siebte Kreuz« – einem Roman, der mich durchaus berührt hatte, der aber eine Welt beschrieb, die in meinen Augen ein für alle Mal vergangen war und nichts mehr mit mir zu tun hatte – erschien mir das familiäre Verhältnis zwischen der Deutschlehrerin und Anna Seghers noch unerklärlicher.
Für mich entdeckt habe ich Anna Seghers erst relativ spät, und das – abgesehen von dem Roman »Transit« – vor allem durch ihre Erzählungen, Geschichten und Legenden. Viele davon gehören für mich zum Besten, was die deutschsprachige Literatur des 20. Jahrhunderts hervorgebracht hat, und damit auch zu jenem Fundus, der uns Heutige unmittelbar anspricht.
Es lässt sich kaum ein Jahr in Anna Seghers’ Schriftstellerleben finden, in dem sie keine Erzählung geschrieben hat. Sie brauchte und nutzte die kürzere Prosaform so kontinuierlich wie keiner ihrer Zeitgenossen. Denn offenbar ermöglichte die Erzählung ihr eine vergleichsweise schnelle Reaktion auf sich verändernde Verhältnisse. Zeitlich spannt sich der Bogen von der Weimarer Republik kurz nach der Inflation über die Weltwirtschaftskrise und die »Machtergreifung« der Nazis, die Flucht von Anna Seghers und ihrer Familie nach Frankreich, den Spanischen Bürgerkrieg, den Zweiten Weltkrieg und die Emigration nach Mexiko, ihre Rückkehr nach Deutschland, die Entstehung zweier deutscher Staaten im Kalten Krieg bis hin zu den Enthüllungen des XX. Parteitags der KPdSU, dem Mauerbau und noch weit hinein in die beginnende Spätphase der DDR in den achtziger Jahren. Zugleich gibt es in deutscher Sprache und über diesen langen Zeitraum kaum jemanden – Alfred Döblin, der einer älteren Generation angehört, einmal ausgenommen –, dessen Kurzgeschichten, Novellen und Erzählungen stilistisch so variationsreich sind, was nicht zuletzt auf sich wandelnde Haltungen hinweist.
Anna Seghers wird als Netty Reiling am 19. November 1900 in Mainz in einer jüdischen Familie geboren. Sie bleibt das einzige Kind. Ihr Vater, der gemeinsam mit seinem Bruder eine erfolgreiche Antiquitäten- und Kunsthandlung betreibt, ist auch Kustos am Mainzer Dom. Mit zwanzig beginnt sie Kunstgeschichte, Sinologie und Geschichte in Heidelberg zu studieren und promoviert dort mit einer Arbeit über »Juden und Judentum im Werke Rembrandts«. Sie stellt sich damit gegen den »Rembrandt-Deutschen« Julius Langbehn, der mit seinem 1890 erschienenen Buch »Rembrandt als Erzieher« den Künstler für nationalistische und antisemitische Haltungen vereinnahmte. Für Netty Reiling malt Rembrandt die jüdischen Gesichter, »wie er einen dunklen Hinterhof oder eine öde und unscheinbare Landschaft gemalt hat, die noch niemand vor ihm in seinem Reichtum von Ausdruck sehen konnte und den man erst im Bilde wiedererkennt«.
Im selben Jahr erscheint ihre Erzählung »Die Toten auf der Insel Djal« in der Frankfurter Zeitung unter dem Pseudonym Antje Seghers. Interessant ist diese früheste Prosa-Etüde durch Seghers Lust an der Fabel, am Schaurigen und der überraschenden Wendung, also an einem Erzählen, für das immer und überall Menschen ihre Köpfe zusammenstecken. Ohne ihrer ersten Wortmeldung zu viel Gewicht beizumessen, zeigt sich hier bereits eines ihrer später ständig wiederkehrenden Themen: das Nachdenken über die Beziehung der Lebenden zu den Toten und die Verlebendigung der Toten durch das Erzählen.
Ihren Namen entlehnt sie Hercules Seghers, einem Zeitgenossen Rembrandts. »Sie kannte das Schicksal dieses Hochbegabten, der, zu seiner Zeit unverstanden, in Armut, ausgestoßen, noch vor seinem fünfzigsten Lebensjahr zugrunde ging …« (Christa Wolf)
1925 heiratet sie den gleichaltrigen László Radványi, der nach der gescheiterten ungarischen Räterepublik als Exilant nach Deutschland gekommen war. 1926 wird der Sohn Peter (Pierre) und 1928 die Tochter Ruth geboren.
Bereits mit »Jans muß sterben« von 1925, ihrer ersten längeren Erzählung, die erst 2000, also 75 Jahre nach ihrer Entstehung, erscheinen wird, verlässt Anna Seghers die Welt ihrer Herkunft. Warum die 25‑Jährige den Text damals nicht publizierte, ist unbekannt. An der gestalterisch-dramaturgischen Kraft, der Präzision der Beschreibungen, der Plastizität der Figuren kann es nicht gelegen haben. Angekommen in einer anderen Welt ist sie mit diesem Gesellenstück aber noch nicht. Jans’ Vater ist Arbeiter – doch bleibt das eher ein äußeres Etikett. Was hier fehlt, erschließt sich wie von selbst bei der Lektüre von »Die Ziegler«, einem zwei Jahre später entstandenen Text, der auf die Erzählung »Grubetsch« folgte, für die Hans Henny Jahnn ihr 1928 den Kleist-Preis zugesprochen hatte.
»Die Ziegler« ist Marie Ziegler, die ihre Eltern, Schwester Anna wie die beiden Brüder, die namenlos bleiben, durch ihre Arbeit als Näherin ernährt. Die Erzählung lebt geradezu von ihrer historischen und sozialökonomischen Genauigkeit, hier gibt es keinen leeren Raum um die Figuren. Die ökonomische Misere der Zwanziger, das »Wolfsgesetz« des Kapitalismus, nimmt dem Leben von Marie und ihrer Familie die Luft. Es bleibt nicht beim Verlust der väterlichen Werkstatt im Hof, selbst in ihrer Wohnung müssen sie noch ein Zimmer vermieten. Der Kreis um Marie wird eng und enger. Der Vater, der zuerst auf seinen erfolglosen Bittgängen, dann auf den Spaziergängen den einstigen Status zu bewahren sucht, die Schwester Anna, deren Verehrer aus einem einst gleichwertigen, nun wesentlich besser gestellten Hause stammt (»Die Falte auf seinem übergeschlagenen Bein lief in einem festen Strich durch das leere, angedunkelte Zimmer«), die verzweifelte Mutter, die eine Fehlgeburt hat, der scheue Jüngste, für den sich keine der Versprechungen erfüllt – alle Figuren sind mit wenigen sicheren Strichen in einer schnörkellosen Sprache gezeichnet. Seghers erhellt die Folgen im Fühlen und Denken derer, denen das Leben durch ihren sozialen Abstieg entrissen wird, obwohl sie sich mit allen Kräften dagegenstemmen. Durch Scham, Selbstzweifel und Krankheit verlieren sie auch ihre Sprache.
Selbst der rebellische ältere Bruder, bei dem es offenbleibt, in welche Richtung ihn seine Empörung führen wird, stößt Marie nur noch tiefer in ihre sprachlose Einsamkeit. Wie in einem kritischen Selbstporträt der Autorin wiederholen sich Begegnungen zwischen Marie und einer ihrer ehemaligen Schulkameradinnen, die als das »Mädchen mit der roten Mütze« vorgestellt wird. »›Nun, Marie.‹ Es ging ein paar Schritte neben ihr her und wartete. Das war zu kurz für Worte, die in einem angenagelt waren und schwer und zugeschüttet. Da hätte das Mädchen Zeit haben müssen, um hundertmal mit Marie durch die ganze Stadt zu gehen […] Sie mußte aber schnell weiter. […] Jetzt war das Wegstück zwischen ihnen, wie ein Stemmeisen, das langsam eins vom anderen abrückte.« Die größtmögliche Auflehnung Maries, der mit aller verbliebenen Kraft hervorgestoßene Schrei, mit dem die Erzählung endet, bleibt folgenlos.
Nachdem Anna Seghers diese Erzählung 1930 in dem Band »Auf dem Wege zur amerikanischen Botschaft« veröffentlicht hatte – es war ihre zweite Buchpublikation, zwei Jahre nach dem Roman »Der Aufstand der Fischer von St. Barbara« –, erschien in der Zeitschrift »Das Tagebuch« Anfang 1931 eine »Selbstanzeige« zu den vier Texten, die nicht erst aus heutiger Sicht grotesk anmutet. Anna Seghers kritisiert darin ihre eigene grandiose Titelerzählung, in der die inneren Monologe von vier Figuren während einer Demonstration gegen die Hinrichtung von Saccho und Vanzetti miteinander verflochten werden. »Die Ziegler« zählt sie wiederum zu den beiden eher gelungenen Arbeiten. Doch auch da plagen sie Vorbehalte: »Wenn man schreibt, muß man so schreiben, daß man hinter der Verzweiflung die Möglichkeit und hinter dem Untergang den Ausweg spürt.« Mit der Hoffnung, dass ihr das in den nächsten Arbeiten gelingen werde, schließt sie ihre »Selbstanzeige«.
Als Leser möchte ich am liebsten mit einer »Gegenanzeige« antworten. Denn je genauer die Verzweiflung und die Umstände beschrieben werden, desto deutlicher werden auch Möglichkeit und Ausweg in den Leserinnen und Lesern lebendig. Andererseits lässt sich die Literatur, so unmittelbar sie auch immer zum Einzelnen sprechen mag, nicht aus dem Boden ihrer Zeit reißen.
Was uns heute als ästhetisch-philosophische Selbstbeschneidung erscheint und ganz und gar nicht im Sinne einer Emanzipation der »Verdammten dieser Erde« sein kann, ist für Anna Seghers ein notwendiger Anspruch, nämlich die Welt als eine veränderbare zu beschreiben. 1928 war sie in die »Kommunistische Partei Deutschlands« eingetreten, im selben Jahr zählt sie, wie auch Johannes R. Becher und Ludwig Renn, zu den Gründungsmitgliedern des »Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller«.
Der Beginn der Naziherrschaft Anfang 1933 ändert im Leben der Familie Seghers/Radvanyi alles. Anna Seghers flieht über die Schweiz nach Frankreich, wo sie wieder mit ihrem Mann und den Kindern zusammenkommt.
An der verhängnisvollen Spaltung der Arbeiterbewegung hatte auch die offizielle Linie der KPD ihren Anteil. Im Exil traf Anna Seghers etliche der früheren »Gegner« wieder. Nun ging es ihr nicht mehr um die Vormacht der KPD, sondern um den Kampf gegen Hitler. Den Faschismus auf einen »Frontalangriff des Finanzkapitals gegen die Arbeiterschaft« zu reduzieren war dafür zu wenig. Und die Welt musste wissen, was in Deutschland vor sich ging.
Anna Seghers hat sich von früh an auf Berichte anderer, auf Briefe und Zeitungsmeldungen gestützt, um Stoffe zu finden, über die sie schreiben wollte. In der Darstellung von Nazideutschland war sie geradezu darauf angewiesen. Erzählerisch sind diese frühen Reaktionen am wenigstens ergiebig. In einigen dieser Kurzgeschichten bildet die Brutalität, mit der die neuen Machthaber vorgehen, den Hintergrund für den heroischen oder stillen Widerstand. Was vermag der Einzelne überhaupt noch gegenüber diesem Folterstaat?
Immer wieder beschäftigt sie die Frage aller Fragen: wie das, was in Deutschland geschieht, passieren konnte und wie aus einem Menschen ein Menschenquäler und Mörder wird.
An der Weimarer Republik rächen sich nun auch diejenigen, die in der Demokratie keine Arbeit, keine soziale Sicherheit und keine Gemeinschaft fanden. Die Nazis verschaffen ihnen ein neues Selbstwertgefühl. Am ehesten könnten die frühen Erzählungen von Anna Seghers, insbesondere »Die Ziegler«, auch als Versuche herangezogen werden, eine Erklärung für die Entmenschung des Menschen zu finden. Doch eine Notwendigkeit, warum sich der eine so und nicht anders entscheidet, gibt es nicht.
Bis zum Überfall von Hitlers Wehrmacht auf Frankreich 1940 lebte die Familie Seghers in Bellevue bei Paris. Als wäre die Bewältigung des Alltags mit zwei Kindern in einem fremden Land nicht genug – stets von Geldsorgen geplagt und dem unsicheren Status einer Emigrantin –, entwickelt Anna Seghers sowohl eine enorme literarische als auch organisatorisch-publizistische Aktivität. Sie gründet zusammen mit Wieland Herzfelde und Oskar Maria Graf die Monatsschrift »Neue Deutsche Blätter« und spricht auf den großen Schriftstellertreffen in Paris und Madrid. In der Emigration erscheinen die Romane »Der Kopflohn« (1933), »Der Weg durch den Februar« (1935), »Die Rettung« (1937) und »Das siebte Kreuz«, im Herbst 1939 beendet und 1942 erstmalig publiziert (der Abdruck als Fortsetzungsroman in der Sowjetunion wird mit der Unterzeichnung des Ribbentrop-Stalin-Paktes Ende August 1939 abgebrochen). 1944 erscheint in Mexiko ihr großer Roman »Transit«.
Wie ein vorgezogenes Satyrspiel dazu nimmt sich die Kurzgeschichte »Reise ins Elfte Reich« von 1939 aus, deren Sarkasmus sich auch in »Transit« wiederfinden wird. Selbst einzelne Details, wie die Beschreibungen des Wappens am Konsulat des »Elften Reichs« und jenes des früheren Konsulats von Mexiko in »Transit«, ähneln einander. Im »Elften Reich« allerdings ist das Geschehen grotesk überhöht. Anna Seghers, die so viele Tonlagen beherrschte, entwirft ein Land, das die Selbstverständlichkeiten bei der Visaerteilung auf den Kopf stellt: Nur diejenigen dürfen einreisen, die keinen Pass, kein Visum, kein Empfehlungsschreiben vorweisen können. Jene aber, die viel Geld besitzen und über die allerbesten Visa, Empfehlungsschreiben und Beziehungen verfügen, haben das Nachsehen. Selbst als sie ihre Papiere zerreißen und die Fetzen hinunterwürgen, werden sie von den Beamten des Elften Reichs gezwungen, alles wieder von sich zu geben. Wie viel Bitternis, Enttäuschung und Schmerz, aber auch wie viel Spott und Verachtung stecken in der Beschreibung der Privilegien und der Hierarchie, die sich selbst unter Leidensgenossen und Antifaschisten angesichts der Flucht und einer »tödlichen Bürokratie« entwickeln. Auf wenigen Seiten holt Seghers zum Rundumschlag aus, um auszusprechen, was ihr an ihresgleichen missfällt, sei es die Geltungssucht derer, die auch als Emigranten hofiert zu werden wünschen, seien es die ordensstolzen Genossen (»Deshalb gibt es in unserem Land auch das Sprichwort, das einem auf die Zunge kommt im Umgang mit einer gewissen Menschensorte: Der Mann hat noch viele Orden abzulegen …«), die Tugendapostel und andere mehr.
»Die Unschuldigen«, eine ähnlich bittere Groteske, entsteht nach dem Zweiten Weltkrieg, kurz vor oder während ihrer Rückkehr nach Deutschland: Die Schuld an den deutschen Verbrechen wird auf immer höhere Chargen abgewälzt, bis selbst Hitler für sich reklamiert, unschuldig zu sein. Eine der großen Stärken von Anna Seghers ist, die Argumente ihrer Gegner und Feinde genau zu erfassen und in ihrer inneren Logik darzustellen, darauf vertrauend, dass die Leser die Differenz zwischen Geschildertem und Wirklichkeit selbst erkennen. Bei den »Unschuldigen« ähneln die abstrusen Argumente und Haltungen zum Verwechseln jenen, die die in Nürnberg versammelten Angeklagten an den Tag legten. Auch sie wiesen jegliche Verantwortung von sich und hatten die Mehrheit der Deutschen – zumindest damals – auf ihrer Seite.
Unter den Erzählungen der Emigrationszeit haben einige der bekanntesten einen legenden- und sagenhaften Charakter. Die Brisanz, die darin liegt, lässt sich am ehesten ermessen, wenn man die »Selbstanzeige« noch im Ohr hat und mit dem Motto vergleicht, das sie ihrem »Woynok« voranstellt: »Und habt ihr denn etwa keine Träume, wilde und zarte, im Schlaf zwischen zwei harten Tagen? Und wisst ihr vielleicht, warum zuweilen ein altes Märchen, ein kleines Lied, ja nur der Takt eines Liedes, gar mühelos in die Herzen eindringt, an denen wir unsere Fäuste blutig klopfen?« Dass Literatur anders wirkt als Fäuste, weiß zumindest jeder Leser. Sie aber muss es offenbar aussprechen, um das Tor zu einer anderen Art Prosa zu öffnen, in der sie sich wie befreit von allen Selbst- und Fremdvorgaben bewegen kann. »Die schönsten Sagen vom Räuber Woynok« von 1936 sind im Grunde eine souveräne Frechheit. Der Titel avisiert eine Abfolge von Abenteuern. Erwartet man nicht, dass hier ein guter Räuber den Reichen nimmt und den Armen gibt? Was wir aber von Woynoks Taten hören wie auch von jenen, die Gruschek und seine Räuberbande verüben, ist kaum mehr als ein Hintergrundrauschen, und das besteht aus Brandschatzung und Plünderung von Klöstern und Dörfern. Jener Gruschek aber hatte »in seinem langen Leben gelernt, die Worte eines Mannes nach seinem reinen Gewicht an Aufrichtigkeit abzuwägen. Wie hätte er sonst so lange eine Bande von vierzig Räubern zusammenhalten können, ohne dass je Verrat oder Zwist ihren Ruhm beschädigte?« Allein solch ein Satz, 1938 in Moskau in der Zeitschrift »Das Wort« veröffentlicht, als die Angst vor den stalinschen Säuberungen allen in den Knochen steckte, muss einem Statement ähnlich gewesen sein.
Die Erzählung erschöpft sich auch bei mehrfacher Lektüre nicht. Sobald Empathie für den rigoros auf seine Unabhängigkeit bedachten Woynok oder für den das Kollektiv preisenden Anführer Gruschek aufkommen will, ist es damit im nächsten Absatz schon wieder vorbei. So wie der eine keine Skrupel hat, die Bande zu verbrennen, hat der andere keine, die Schwächeren durch Stärkere zu ersetzen. Am Ende gerät Woynok in eine Falle und wird von Bauern mit Knüppeln totgeschlagen. Ist das nun gut oder schlecht? Wer aber glaubt, damit wäre es nun mit Woynok zu Ende, sieht sich getäuscht. Figuren wie er führen ein märchenhaftes Eigenleben. Und je nachdem, wie man sie anschaut, verbindet sie mit der Wirklichkeit nichts oder alles.
Ein literarisches Kleinod sind auch die unter einem Titel vereinigten Legenden »Die drei Bäume«. Durch den Mythos wird es möglich, eigene Erfahrung an Menschheitserfahrung zu messen (Franz Fühmann). »Er hatte sich nicht gefürchtet, mit den Seinen in dieser Schlacht zu fallen. Er war aber nicht gefallen. Sein Volk war erschlagen, und mit dem Volk verstummt war die erhabene Stimme, von der er gewohnt war, Weisungen zu empfangen. Da fing er an, sich zu fürchten«, heißt es in »Der Baum des Jesaias«. Weil er sein Volk verloren hat, fehlt ihm auch die Stimme, die ihn seinen Weg geführt hat. Dies wäre eine Möglichkeit, über die Anfechtungen des Exils zu sprechen. In der dritten Legende wenden sich nach der Ankunft des Odysseus die Götter ab, die Geschichte ist zu Ende, und er weiß, dass Penelope nicht weiß, wen sie da eigentlich vor sich hat. Regelrecht prophetisch nimmt Anna Seghers das Misstrauen vorweg, das die Emigranten bei ihrer Rückkehr erwarten wird. Trotz des Beweises ihrer Aufrichtigkeit wird es schwer werden, einander wieder zu vertrauen.
Auch wenn Anna Seghers explizit darauf besteht, dass Märchen Märchen seien, und mögliche Analogien verweigert, ist es in der Erzählung »Das Argonautenschiff« kaum zu übersehen, wie präzise sie ihre Gegenwart mit der Kraft des Märchens und des Mythos durchleuchtet. Dieser zweite große Sagenkreis neben den homerischen Epen hat Jason zum Protagonisten, der das Goldene Vlies von einer Küste am Schwarzen Meer holen soll und dafür eine Vielzahl von Helden auf seinem berühmten Schiff, der Argo, versammelt. Hier ist Jason ein Mann, den alle zu kennen scheinen, der die Menschen anzieht und der sie verwandelt. Er hat das Vlies schließlich erobert, zusammen mit Medea ist er entkommen, er hat den Untergang der Argo überlebt und die Heimat erreicht – um schließlich doch, in einem göttlichen Hain, in dem der Bug der Argo an einem Baum hängt, den Tod zu finden. In einem Sturm fallen die Reste des Wracks auf Jason herab, der sich unter dem Baum ausgestreckt hat, und erfüllen die Weissagung nun auf die unwahrscheinlichste Art und Weise, die sich denken lässt. Für eine Rückkehrerin in die alte Heimat klingt diese 1947 in Berlin entstandene Erzählung – dem Jahr, in dem ihr der Georg-Büchner-Preis in Darmstadt zugesprochen wird –, nicht gerade optimistisch. Doch Jason kündet auch von einer ungewöhnlichen, ja geradezu existentialistischen Selbstbehauptung. Gerade weil er die Prophezeiung seines Scheiterns von Beginn an akzeptiert hat, führte er ein Leben in Freiheit. Er hat sich von den Verhältnissen emanzipiert, soweit das einem Nicht-Gott möglich ist.
1943 wird Anna Seghers in Mexiko-Stadt von einem Auto angefahren, sie erleidet schwere Kopfverletzungen, der Unfallverursacher begeht Fahrerflucht. Nach einigen Tagen Bewusstlosigkeit und einem teilweisen Gedächtnisverlust erholt sie sich relativ schnell. Durch die Veröffentlichung von »Das Siebte Kreuz« in den USA und dessen Verfilmung mit Spencer Tracy im folgenden Jahr beginnt ihr Weltruhm. Die schlimmsten Geldsorgen sind damit überstanden. In dieser Zeit erhält sie aber auch Nachricht von der Deportation ihrer Mutter und anderer Familienangehöriger. Wer es nie erlebt hat, dem bleibt es im Grunde unvorstellbar, wie jemand die ständige Lebensgefahr für sich und die Familie während der Flucht und der mitunter aussichtslos erscheinenden Jagd nach Visa durchsteht. Und wie erträgt Anna Seghers die Vorstellungen davon, was der Mutter und anderen Verwandten womöglich gerade angetan wird, obschon sie selbst und die Familie in Mexiko vorerst in Sicherheit sind. Die Frage, warum Menschen werden, wie sie sind, richtet Anna Seghers in »Der Ausflug der toten Mädchen« nun an jene Welt, aus der sie selbst stammt. Die Erzählerin ist, wie die Autorin, Emigrantin in Mexiko, sie erholt sich in den Bergen. Auf einer Wanderung betritt sie ein verfallenes Anwesen, sieht eine Wippe – und glaubt plötzlich ihren Namen zu hören. »›Netty!‹ Mit diesem Namen hatte mich seit der Schulzeit niemand mehr gerufen.« Was folgt, ist die traumartige Imagination eines lange vergangenen Schulausflugs, bei dem ihre beiden besten Freundinnen, Leni und Marianne, auf einer Wippe sitzen. Die beiden, um deren Zuneigung Netty wirbt, verkörpern geradezu die Gegensätze, die in der Nazizeit über Leben und Tod entscheiden werden. Leni, schon als Mädchen selbstständig, wird stark bleiben und ihren Mann trotz Gestapo-Schlägen nicht verraten, während Marianne, passives Spiegelbild ihres Mannes, stolz auf das Prestige des hohen Nazibeamten, die frühere Freundin denunzieren wird. »Leni samt ihrem Mann seien zu Recht arretiert, weil sie sich gegen Hitler vergangen hätten.« Leni wird im KZ sterben, ihr Kind kommt in ein Nazierziehungsheim, Marianne stirbt in den Trümmern ihres Elternhauses. Durch den unablässigen Wechsel zwischen Gegenwart und Vergangenheit, die hier im selben Maße wirklich und präsent scheint – die Erzählerin zeigt sich immer wieder darüber verwundert –, entsteht eine ständige Abfolge von besonderer Nähe zu den Mädchen auf der einen Seite sowie Erschrecken und Distanz oder Bewunderung zu den später Erwachsenen auf der anderen. Immer bedrängender wird währenddessen die Frage, warum aus den einen Mitläufer und Täter werden konnten, aus den anderen jene, die Bedrängten halfen oder selbst gegen das Unrecht kämpften.
Diese Erzählung zu schreiben erweist sich nach der Logik der Handlung als die Erfüllung einer Aufgabe, die ihr die Lehrerin am Ende des Ausfluges stellt. »Nie hat uns jemand, als noch Zeit dazu war, an diese gemeinsame Fahrt erinnert. […] nie wurde erwähnt, daß vornehmlich unser Schwarm aneinandergereihter Mädchen, stromaufwärts im schrägen Nachmittagslicht, zur Heimat gehörte.« Das Ineinander der verschiedenen Zeitebenen weckt immer wieder die Hoffnung, dass es auch anders hätte kommen können, dass nichts so hätte sein müssen, wie es später werden sollte. Der Schmerz, aus dem diese Erzählung hervorgegangen ist, wird am Ende besonders spürbar. Denn selbst in der Imagination ist die Rückkehr in die Arme der Mutter unmöglich. In keinem anderen Werk stellt Anna Seghers so deutliche Beziehungen zu ihrem eigenen Leben her wie in diesem. Auch in Inhalt und Struktur zeugt es von einer neuen Offenheit und Freiheit, als habe der Schmerz alle Fremd- und Selbstbeschränkungen gesprengt. Es ist ein Erzählen, das seinen Ursprung in der Auflehnung gegen den Tod und das scheinbar Unabänderliche hat, um sich die Möglichkeit einer anderen Gegenwart und eines Neubeginns abzutrotzen.
Im Selbstverständnis von Anna Seghers wie in ihrer öffentlichen ahrnehmung spielte es eine untergeordnete Rolle, dass sie Jüdin war. Mit »Post ins Gelobte Land« erzählt sie die Geschichte einer jüdischen Familie, die als einzige »im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts, als fast die ganze jüdische Einwohnerschaft des polnischen Städtchens L. bei einem Pogrom von den Kosaken erschlagen worden war«, fliehen konnte. Anna Seghers findet hier wieder einen Ton, als erzählte sich das Geschehen selbst. Ein fast schon vergessener Verwandter holt die Familie nach Paris, wo sie, ungeachtet ihrer Herkunft, gleichberechtigt und in Sicherheit leben kann. Der Sohn wird ein berühmter Augenarzt, der seinem Vater, der nach Palästina übersiedelt ist, regelmäßig schreibt, bis er selbst, unheilbar erkrankt, einen Vorrat an Briefen anlegt. Deshalb erreichen den Vater auch nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Paris noch Briefe im gelobten Land. Anna Seghers schreibt nüchtern und ohne Überhöhungen eine geradezu parabelhafte Geschichte der Juden im Europa der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, deren Eindringlichkeit ihresgleichen sucht. Es ist die Schrift, es sind die Briefe, die über den Tod ihres Schreibers hinaus Hoffnung und Lebensmut bewahren.
Etwa zwei Drittel von Anna Seghers umfangreichem Werk an Erzählungen entstand nach ihrer Rückkehr aus Mexiko. Sie lebte schon zehn Jahre in Berlin (anfangs West, längstens Ost), als sie 1957 »Der gerechte Richter« schrieb, also kurz nach dem XX. Parteitag der KPdSU von 1956 und dem Schauprozess gegen Walter Janka, dem Genossen aus dem mexikanischen Exil und Leiter des Aufbau-Verlages, in dem auch ihre Werke erschienen. Anna Seghers hatte mehrmals bei Walter Ulbricht, dem damaligen Parteichef, vorgesprochen und sich für Walter Janka eingesetzt, öffentlich allerdings hatte sie geschwiegen. Es ist eine Zeit der verlorenen Illusionen, auch verlorener Hoffnungen. Sie sucht nach Möglichkeiten, wie der Einzelne sich und seiner Überzeugung treu bleiben kann, gerade dann, wenn es die Eigenen sind, die den Verrat begehen.
Der »gerechte Richter« ist ein junger Untersuchungsrichter in einem nicht näher benannten Land des Ostblocks, der es ablehnt, den ihm vorgeführten Mann für schuldig zu befinden. Aufgrund seiner Weigerung wird er selbst inhaftiert und in ein Arbeitslager gesperrt. Die Erzählung erschien erst im Frühjahr 1990, 33 Jahre nach ihrer Entstehung, sieben Jahre nach dem Tod der Autorin und kurz vor dem Ende der DDR. Bemerkenswert ist, dass diese Erzählung überhaupt existiert. In den Prozessen gegen jüdische West-Emigranten, besonders im Prager Slánský-Prozess von 1952, war in den Verhören auch nach Anna Seghers gefragt worden. Nicht einmal Paul Merker, ein hoher KP‑Funktionär und Mitemigrant in Mexiko, entging der Verhaftung. Auch ihr Mann war mehrfach vorgeladen worden und hatte offenbar gegen Paul Merker ausgesagt. In der Zeit, in der die Erzählung entstand, wäre eine Veröffentlichung in der DDR wohl kaum möglich gewesen. Hinderte sie später die Parteidisziplin? Wollte sie nicht dem »Gegner« in die Hände spielen, den sie vor allem in Bonn verortete und der für sie mit Kanzleramtsminister Hans Globke, dem Mitverantwortlichen für den Holocaust und damit auch für den Mord an ihrer Mutter, ein konkretes Gesicht besaß? »Der gerechte Richter« steht beispielhaft für »die Kraft der Schwachen« in der DDR und scheint wie gemacht dafür, um in den gleichnamigen Erzählungsband von 1965 aufgenommen zu werden. Kann man Anna Seghers die Schuld dafür geben, dass diese Erzählung dem Land fehlte, für das sie geschrieben war? Wie hätte eine »richtige Entscheidung« ausgesehen? Und warum konnte Anna Seghers, die literarisch vorführte, wie Parteidisziplin, Autoritätsgläubigkeit und Angst das eigene Anliegen bis zur Unkenntlichkeit entstellten, selbst nicht die Kraft aufbringen, sich davon zu befreien?
In unmittelbarer zeitlicher Nähe entsteht »Der Führer«, der im Gegensatz zu »Der gerechte Richter« in dem Erzählungsband »Die Kraft der Schwachen« (1965) erscheinen wird. Hier geht Anna Seghers zurück in die Zeit des sogenannten »Abessinienkrieges« (1935–1941), des letzten und größten Kolonialkrieges, den das faschistische Königreich Italien mit enormer Grausamkeit und unter Einsatz von Giftgas gegen Abessinien führte, ein historisches Kapitel, das noch bis vor wenigen Jahren – insbesondere in Italien – verschwiegen oder geleugnet wurde, eine Leerstelle im historischen Bewusstsein Europas.
»Alles war umsonst«, hebt die Erzählung an. »Und auch der letzte Widerstand mit Messern und Zähnen – umsonst.« Die Stimme, die da spricht, gehört den Besiegten. Auch die Hoffnung ist zerstört. »Wenn es keine Zukunft mehr gibt, ist auch das Vergangene umsonst gewesen.« Bald aber löst sich die Erzählung von dieser Stimme und begleitet drei italienische Geologen, die nach »Gold und Silber und Eisen …« suchen. Ein bildschöner, engelsgleicher Junge, der sich sogar der Zudringlichkeit von einem der Geologen erwehren muss, zeigt ihnen Goldsand und bringt sie dazu, ihm zu folgen, statt ihre geplante Route fortzusetzen. Die suggestive Beschreibung ihres nun folgenden Weges immer tiefer hinein in die zerklüftete Berglandschaft steigert beinah von Schritt zu Schritt den Zwiespalt der drei Geologen zwischen Faszination und Furcht. Die Wirkung dieser Erzählung entsteht aus dem Kontrast zwischen der Freundlichkeit und Anmut des Knaben und der erklärungslosen Selbstverständlichkeit, mit der er die drei Okkupanten in den Tod führt und sich dabei selbst opfert. Spätestens wenn die drei Geologen die aus den Felsen gehauenen Gesichter von Paulus und Petrus zu erblicken glauben, sind sie für die Leser als eine Pervertierung der Heiligen Drei Könige zu erkennen. Anstatt Gaben zu bringen, haben sie es darauf abgesehen, die Reichtümer dieses Landes zu rauben. Das bewunderte »Kind« wird, indem es sich selbst opfert, zu ihrem Verderber. Eine Begründung seines Tuns muss weder er noch die Erzählerin geben. Wir wissen ja bereits, warum er so handelt: um sich und sein Volk von dem »umsonst«, mit dem die Erzählung einsetzt, zu erlösen, um wieder eine Zukunft denken zu können und so auch das Vergangene zu retten.
»Der Führer« weist Analogien auf mit anderen Erzählungen, die sich »der Kraft der Schwachen« in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten widmen, vor allem mit den unübertroffenen »Karibischen Erzählungen« (mitunter auch von ihr als »Antillen-Novellen« betitelt). In der Zeit ihrer Rückkehr aus Mexiko nach Deutschland, die eine Phase des Dazwischen ist (ihr Mann bleibt vorerst zurück, beider Kinder Peter und Ruth studieren in Paris, sie nimmt Quartier im amerikanischen Sektor, in Zehlendorf, längere Reisen führen sie nach Paris und in die Sowjetunion), schreibt Anna Seghers die beiden ersten der drei Karibischen Geschichten, »Die Hochzeit auf Haiti« und »Wiedereinführung der Sklaverei in Guadeloupe«, veröffentlicht werden sie 1949. Die dritte Erzählung, »Das Licht auf dem Galgen«, entsteht Mitte der fünfziger Jahre, sie erscheint erst 1961, ein Jahr später werden alle drei Novellen in einem Buch zusammengefasst. Selbst wenn es nur diese drei »Antillen-Novellen« von Anna Seghers gäbe, wären sie genug, um in ihr eine der wichtigsten Stimmen deutscher Sprache im 20. Jahrhundert zu erkennen.
Seghers Interesse an den Antillen und ihrer Geschichte hat seinen Ursprung in der Odyssee ihrer Flucht nach Mexiko, als sie und ihre Familie zuerst in Martinique interniert wurden, von dort aus nach San Domingo gelangten, um schließlich – sie schreibt die ganze Zeit über an »Transit« und ist »viel zu müde, um meine Umgebung zu studieren« – nach einer Internierung in Ellis Island vor New York (in das sie nicht einreisen durften) nach Kuba zu kommen, von wo aus sie endlich an Bord eines Schiffes gehen können, das sie nach Mexiko bringen wird.
Alle drei Erzählungen spielen am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts und kreisen an unterschiedlichen Orten (Haiti, Guadeloupe und Jamaika) um die Achse der Machtübernahme Napoleons. Für den Freiheitskampf der Antilleninseln bedeutet diese Zäsur das Umschlagen von Revolution in Reaktion unter ein und derselben Flagge, von Befreiung zu erneuter Versklavung und Abhängigkeit und de facto die Rückkehr zu vorrevolutionären Zuständen.
Die drei Novellen überlagern einander zeitlich und motivisch. Die »Hochzeit« spielt zwischen der Ankunft des jüdischen Juweliers Michael Nathan auf Haiti zu Beginn der 1790er Jahre und seiner Abreise, nachdem die Flotte Napoleons das Land verwüstet hat, ohne Haitis Unabhängigkeit verhindern zu können. Dazwischen liegt die Selbstbefreiung der schwarzen Sklaven, die sich mit dem aus dem revolutionären Paris angereisten Emissär und seiner kleinen Truppe verbünden und gegen den Widerstand der Plantagenbesitzer und der von ihnen zu Hilfe gerufenen englischen Flotte eine Republik errichten (»Negerrepublik«, heißt es bei Seghers voller Bewunderung). Michael wird kurzzeitig zu einer Art Sekretär des schwarzen Generals und einstigen Sklaven Toussaint.
Im Vergleich zu der ersten wie zu der dritten Erzählung – in der das Scheitern der Erhebung auf Jamaika derart hellsichtig geschildert wird, als hätte Anna Seghers im historischen Gewand das Schicksal von Che Guevara vorweggenommen – widmet sich die »Wiedereinführung« eher der Innensicht des Befreiungsprozesses und seiner Ambivalenz. Es ist nicht nur das Abbiegen der einstigen Ideale von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in ökonomische Kategorien – Guadeloupe liefert keinen oder zu wenig Kaffee und Zucker nach Frankreich –, sondern auch das Verhalten der vormaligen Sklaven, die ihre Befreiung nicht nur als das Ende der Schufterei auf den Plantagen begreifen, sondern als das Ende der Arbeit überhaupt. Schien dieses Problem in der »Hochzeit« dank Toussaint gelöst, bleibt es auf Guadeloupe offen. Hier, so legt es die Erzählung nahe, ist es auch weniger eine Selbstbefreiung als eine Befreiung durch die Pariser Abgesandten. Die Plantagen verwildern.
Anna Seghers wagt sich weit vor. Sie schildert zwei Schwarze, die als Koch und Kräutergärtner für ihre Besitzer gearbeitet haben und von jenen in gewissem Grade als Spezialisten geschätzt und gewürdigt wurden. Jetzt sind beide mit dem neuen Leben unzufrieden: »Sie gestanden sich ein, sobald sie allein waren, in der Sklavenzeit sei ihr Leben schöner gewesen.«
Die Zwischentöne, die Seghers nicht nur in dieser Episode entstehen lässt (auch der Monolog der schwarzen Kinderfrau von Beauvais’ Gattin, die Beauvais damit trösten will, dass sie die Wiedereinführung der Sklaverei für unerheblich hält, gehört dazu), macht die Erzählung auch zu einer Erkundung der condition humaine. Vor diesem Hintergrund leuchten jene Figuren umso heller, die das Erlebnis von Revolution und Freiheit für immer verwandelt hat. Sie sind unfähig, sich den alten Verhältnissen wieder zu unterwerfen. Sie können gar nicht anders, als Widerstand zu leisten, auch wenn der Widerstand aussichtslos ist. Das Tragische und das, was in eine bessere Zukunft weist, werden eins.
Anna Seghers hätte wohl kaum über jene historische Zeit geschrieben, wenn die Fragen, die sie in diesem Stoff fand und verhandelte, sie nicht in ihrer eigenen Zeit beschäftigt hätten. Sie selbst wehrt sich gegen vorschnelle Analogien, wenn sie schreibt: »Als ich die Novelle ›Hochzeit von Haiti‹ schrieb, war unsere Republik noch nicht gegründet, und ich konnte nicht, wie Sie [die Germanistin Renate Francke] glauben, historische Parallelen ziehen. Erst später haben mich manche Probleme bei unserem eigenen Aufbau an manche Probleme beim Aufbau jener Inselrepubliken zur Zeit der Französischen Revolution erinnert.« Andererseits waren ihr die Widersprüche der Sowjetunion vertraut, wenn die Befreiung der Ausgebeuteten aufgrund ökonomischer Argumente zurückgenommen wird und die Gleichheit – ganz zu schweigen von der Brüderlichkeit – eben nicht mehr für alle gilt und damit keine mehr ist. Es waren die Kämpfe, die Seghers selbst zu bestehen hatte, es war ihr soziales Gewissen, es waren ihre Erfahrungen mit dem Januskopf der eigenen revolutionären Bewegung wie auch die Ungewissheiten eines Lebens als Emigrantin mit Familie, die sie hellhörig und aufnahmebereit machten für den großen globalen Zwiespalt, den sie vor allem in ihren Antillen-Novellen erzählerisch zu fassen vermochte.
Anna Seghers war mit diesem Stoff verwachsen. 1980, in ihrer letzten Veröffentlichung zu Lebzeiten, kehrt sie mit dem schmalen Band »Drei Frauen aus Haiti« in die Antillen zurück und knüpft mit »Der Schlüssel«, der mittleren von drei Erzählungen, dort an, wo sie mehr als dreißig Jahre zuvor mit der »Hochzeit von Haiti« geendet hat. Und wieder ist Toussaint das Zentralgestirn, um das die Handlung kreist. Auf ihn, mit dem eine Revolution gelang, aber auch eine Republik mit menschlichem Antlitz, will sie hinweisen, ihm gehört ihre Treue, so wie Amédée und Claudine, beide einst Sklaven auf Haiti, befreit dank Toussaint, ihm die Treue halten, als er in Festungshaft im Jura-Gebirge stirbt. Sein Andenken, sein Vermächtnis tragen sie weiter.
Anna Seghers, die zeitlebens, insbesondere aber nach dem Zweiten Weltkrieg und der Etablierung der »real-sozialistischen« Staaten nach Beispielen suchte, in denen Auflehnung und Veränderung gelungen waren, setzt an das Ende des Bandes »Die Kraft der Schwachen« eine Erzählung, in der ein ganzes Volk seine alte neue Heimat findet. »Die Heimkehr des verlorenen Volkes« beginnt in der Zeit vor der Eroberung des amerikanischen Kontinents durch die Europäer, eine Zeit, die Seghers alles andere als idealisiert. Vierhundert Jahre ist dann das Volk auf der Flucht vor den fremden Göttern, die irgendwann nicht mehr als Götter, sondern als übermächtige Herrscher erkannt werden, denen sich das Volk entzieht. Als nicht weniger wichtig als die Nahrungssuche erweist sich das Wissen, das das Volk in den alten Erzählungen, den Liedern und Bräuchen mit sich trägt, da diese ein Kontinuum ihrer Geschichte sichern, auch wenn der Sinn der Wörter und Rituale schon nicht mehr verstanden wird. Erst als Mexiko unter Präsident Cárdenas dem Volk seine alte Heimat zurückgibt, enthüllt sich auch wieder der Sinn der so lange bewahrten Lieder und Riten.
Diese Erzählung ist auch Anna Seghers’ persönlicher Dank an Lázaro Cárdenas del Río, der während seiner Präsidentschaft von 1934 bis 1940 nicht nur die Eisenbahn, Elektrizitätswerke und Erdölfirmen verstaatlichte und eine Bodenreform durchsetzte, sondern auch großzügig Emigranten aufnahm, deren prominentester Leo Trotzki war, zu denen aber auch Anna Seghers und ihr Mann gehörten und viele andere, die vor Franco oder Hitler fliehen mussten. Die Rettung des eigenen Lebens wie die Rettung eines Volksstammes fallen für sie im Mexiko der Ära Cárdenas zusammen.
Ich weiß nicht, ob eine Fotografie von Anna Seghers heute noch in meiner ehemaligen Schule hängt. Möglich ist es, es könnte aber auch sein, dass man sie abgehängt hat, dass sie nun tatsächlich »heruntergefallen« ist, so wie auch lange Zeit das Wandbild verdeckt wurde, in dem die 11. These über Feuerbach von Karl Marx zu lesen war: »Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt drauf an, sie zu verändern.«
Verändert hat Anna Seghers die Welt, schon weil sie die Literatur auf ganz eigene Weise bereichert hat. Es kommt darauf an, sie zu lesen.
Die Ziegler
An einem Herbstnachmittag, welcher die Lichter der kleinen Stadt eher beschwichtigte als hervorlockte, stand Marie, das Geld für die abgelieferte Strickware in der Hand, vor der zugeschlagenen Tür im Treppenhaus in der Betzelsgasse. Sie presste die Hand zu und stieg eine Treppe tiefer. Es war fast dunkel. Die Messingkugeln auf dem Geländer glänzten, die roten und blauen Scheiben im Treppenfenster hatten geglüht, wie sie heraufgestiegen war; jetzt waren sie trübe. Sie trat in das Fenster, zählte ihr Geld hin und steckte es ein. Sie stieg weiter, ganz langsam, bis zum nächsten Absatz, da blieb sie wieder stehen. Sie sah sich um; die Messingkugeln waren jetzt schmale Halbmonde. Sie zögerte, als erwarte sie etwas. Ihr Herz zog sich zusammen vor Angst oder vor Kummer. Sie beugte den Kopf und wartete. Es kam aber nichts. Langsam und widerwillig zog sich ihr Herz zurecht. Sie verstand gar nichts, sah sich verwirrt um und drückte sich dicht an das Fenster. Sie presste ihr Gesicht an das einzige helle Glas unter den vielen bunten. Zwischen den angrenzenden Häusern war ein Hof, gegen die Mauer gestapelte Säcke, eine Laterne, ein ausgespannter Wagen; ein Arbeiter wartete auf den anderen, dessen Arme in die Jacke fuchtelten. Sie sah herunter, bis er die Arme in den Ärmeln hatte, dann lief sie auf die Straße.
Die Laternen waren schon an. Bebautes Land war so nahe, dass es nach Herbst roch. Auf dem offenen Platz vor den Schaufenstern ratterten die letzten Läden herunter. Sie lief schneller, weil sie fror. Vor ihr her liefen zwei Mädchen, lachten und schlenkerten. Sie erkannte von hinten ihre roten und dunkelblauen Mützen. Sie hatten letztes Jahr in der Schule vor ihr gesessen. Sie erschrak und ging langsam. Aber die Mädchen blieben stehen und sahen sie an. »Ach, Marie!« Die Mädchen standen schön und aufrecht auf hohen, hellen Beinen. »Was machst du denn jetzt?« – »Ich helf zu Hause.« Die Mädchen betrachteten sie, sie presste den Mund zu. Die Mädchen kannten auch noch ihr Kleid, ihr Halskettchen, ihren Scheitel, ihre hellen Brauen. Alles war wie vor Ostern, nur ein bisschen verschwommen. Sie wurden verlegen und gaben sich die Hände.
Im eigenen Hausflur stand ein Geruch von angebranntem Fett. Sie spürte plötzlich nur ihren Hunger, sonst gar nichts. Sie schellte, fuhr wartend mit dem Zeigefinger die Buchstaben auf dem blankgeriebenen Schild nach: Ziegler. Im Wohnzimmer unter dem Spiegel auf dem Sofa saß ihre Schwester Anna und ein junger Mensch, Annas Verlobter. Anna trug eine weiße frische Bluse und einen enggezogenen Gürtel. Sie war ein schönes Mädchen. Ihr Gefährte hielt ihre Hand und strich mit dem Daumen über die Handfläche, da glänzten ihre Augen. Die Falte auf seinem übergeschlagenen Bein lief in einem festen Strich durch das leere, angedunkelte Zimmer. Marie schlupfte in die Küche. Der kleine Bruder lernte hinter dem Tisch. Sein rundes, bleiches Gesicht schwebte über dem Tisch, wie ein kleiner Mond, aus dem genug Helligkeit auf das Heft fiel. Die Mutter zerhäckelte Heringe zu Salat, sie fragte: »Ist was nachbestellt?« – »Friedlers ja und Karstens nein.« Marie sah starr auf die Hände der Mutter, die das Ei in dünne Scheiben zerschnitt und ein Muster auf den Salat drückte. Da, wo der Hunger gewesen war, war jetzt etwas Klebriges, Widerwärtiges.
Sie gingen zusammen hinüber. Die jungen Leute setzten sich vom Sofa an den Tisch, der Mutter gegenüber. Die beiden Kinder drückten sich an die Wand, still und flach, als wollten sie den Raum sparen. Der Vater kam herein. Er hatte im Schlafzimmer gesessen, am hinteren Fenster, und hinuntergesehen auf das weiße, kahle Hofviereck. Er war ein wenig eingeschlafen. Als er aufwachte, war es dunkel und nichts verändert. Nur unter der Tür war ein heller, dünner Streifen. Da bekam er Lust auf Licht und ging hinüber.
Er setzte sich nicht an den Tisch, sondern aufs Sofa, als hielte auch ihn etwas zurück, den Raum in der Mitte zu schmälern. Der junge Gintler hätte ungern die Hand des Mädchens losgelassen, aber es waren auf einmal so viele Gesichter in diesem Zimmer, dicht bei ihm. Als ob sie sein Unbehagen erraten hätten, drückten sich die Kinder tief in die Wand hinein und der Vater ins Sofa; da dachte er: Ich werde wohl bleiben.
Marie ging leise herum und deckte sachte den Tisch. Bevor man ihre Hände sah, waren sie schon weggezogen. Alle fuhren zusammen, als es schellte: der ältere Junge. Jetzt war es voll und eng. Seine langen Glieder flochten sich durch das Zimmer. Auf dem Boden gab es eine Spur von lehmigen Sohlen. Er lehnte sich neben die Geschwister, sah fest dem Bräutigam ins Gesicht und trat an den Tisch. Da, wo er gelehnt hatte, war jetzt auf der Wand ein feuchter Fleck. Alle sahen hin. Der junge Gintler ließ die Hand des Mädchens los. »Ich muss ja wohl jetzt heimgehen.« Als er gegangen war, setzten sich alle zum Essen um den Tisch. Sie zögerten einen Augenblick, das Muster aus Eierscheiben in der Schüssel zu zerstören. Die Mutter langte zu. Unter ihrem ruhigen Blick kam etwas Festes, Ordentliches in alle Sachen, etwas Sattes in die Speisen. Nur der ältere Junge aß für sich allein mit vorgebeugtem Hals. Er schrappte seinen Teller, sah den leeren Teller mit zugekniffenen Augen an, fuhr fort zu scharren, böse, wie ein Hund scharrt. Endlich sagte der Vater, als ob es nichts Besonderes wäre: »Hör doch auf mit dem Schrappen.« Der Junge legte den Löffel hin, nachdem er noch einmal hart über den ganzen Teller gefahren war, und lachte mit bösen, blanken Zähnen.
Morgens schloss Marie die Werkstatt auf, die zu ebener Erde hinter dem Hof lag, sie zog die Läden hoch und struppte den Sack von der Maschine. Sie drehte mit dem Fuß das Rad an. Der Tag zischte los mit Fi, Fi, das fad und dünn wurde, wie das ewige Zirpen einer Grille. Ihre Hände lösten die Hebel ab, verwickelten sich in eine wütende Folge von Griffen. Zwischen den Klammern fing das Stück rostrote Gewebe mit einem Ruck zu leben an. Auf der Walze, auf Mariens Händen lag schon ein feiner, rötlicher Wollstaub. Ihre Hände waren vergessen, wie abgeschnitten.
Sie sah den Briefträger über den Hof kommen und runzelte die Stirn. Der Briefträger legte Post auf den Tisch und sah lächelnd mit zu. Marie drückte ihn in den Hof zurück mit einem bösen Blick. Kleine, helle Hämmerchen klopften ihre Stirn, die Sonne stellte ein wenig Licht in das Hoffenster. In den Gestellen an der Wand blühten die Wollvorräte auf in glühenden nutzlosen Farben. Jemand schlürfte über den Hof, der Vater. Er setzte sich vor das Pult, mitten in die flimmernde Wolke von Sonnenstäubchen, und machte die Post auf. Im vorigen Winter hatten sechs Mädchen in der Werkstatt gestanden. Marie hatte an Ostern die sechste abgelöst. Der Vater warf die Post zurück und kniff die Augen zu. Da gab es noch Marie, und in den Gestellen leuchteten rot und blau die Reste von Wollvorräten. Er sagte: »Warum haben Karstens nichts bestellt?« Marie sagte: »Eins kann doch nicht immerzu als was bestellen.« Der Vater sagte rechthaberisch, als streite er mit den widerspenstigen Karstens: »Solche Einzige müssen doch was bestellen, wir kommen bei den anderen nicht nach.« Er fügte hinzu: »Die Mädchen sind alle zu Matthäus gegangen.« Marie sagte: »Wir kommen vielleicht doch nach.« Der Vater stand auf und fühlte mit der Hand in die Gefächer. Er kreiste rund um Marie herum, blieb irgendwo hinter ihr stehen und betrachtete ihren Rücken, der sich gleich zusammenkrümmte. Er fing von neuem an: »Es ist schon ganz kühl hier und mittags ganz dunkel. Droben in der Wohnung wäre es viel besser für dich, viel wärmer. Es bleibt auch länger hell. Man könnte zum Beispiel die Maschine gegen das Schlafzimmerfenster stellen. Man kann das hier vermieten. Die Gestelle gehen gut herauf, und du, Spätzchen, du nimmst ja gar keinen Platz weg.«
Er berührte ihr Haar, Marie fuhr zusammen, weil sie nicht gemerkt hatte, dass er so nah hinter ihr war. Der Vater zog die Hand zurück und wartete. Marie sagte: »Ja, das kann man.« Der Vater entfernte sich über den Hof, nicht mehr schlürfend, mit leichteren, jüngeren Schritten.
Das helle Wölkchen vom Sonnenstaub rückte von seinem leeren Stuhl weiter, erreichte Marie, umschloss ihren Kopf, ihre Schultern. Da war es ihr warm auf den Augenlidern. Hinter dem Fenster auf dem Hof in einem viel zu harten Sonnenschein standen ein paar Frauen mit Milchkannen. Die lachten wie verrückt, sie schüttelten sich vor Lachen. Dann war es vollkommen still. Auf einmal zog es sich in ihr zusammen, wie gestern Abend, ein Unglück musste doch ganz nah sein oder ein Gram, sie spürte ja schon die scharfe Kante von etwas Schwerem, Hartem. Sie konnte sich aber nicht ganz genau besinnen, weil sie zu müde war. Alle Müdigkeit kam aus einem winzigen Punkt zwischen ihren zwei Augen. Ohne den hätte sie fliegen können. Dann rief die Mutter aus dem Schlafzimmerfenster: »Marie, essen.«
Droben waren alle gut zu ihr. Sie war erleichtert zwischen Bruder und Schwester am ruhigen Mittagstisch in einen festen Ring gefasst. Die Mutter faltete nachher das Tischtuch, legte es aber nicht in die Schublade, sondern nahm auf einmal, als ob sie damit etwas Besonderes vorhätte, das Brot aus dem Korb zurück, den Anna heraustragen wollte. Sie legte aber das Brot auf den Stuhl und setzte sich aufs Sofa. Die Kinder betrachteten aus der Tür die Mutter. Die stemmte die Arme rechts und links auf das Sofa und wiegte den Oberkörper hin und her und bewegte die Backen, als kaue sie Tränen. Der Kleine kam furchtsam zu ihr heran und berührte ihr Knie. Da packte ihn die Mutter mit ihren beiden Händen an den Schultern und schüttelte ihn hin und her. Sie ließ ihn gleich los, aber das Kind bebte in seiner verrutschten Bluse, als würde es immer weitergeschüttelt. Da sah ihn die Mutter an, ihr Blick wurde jetzt fester, zog ihn wieder an sich, streichelte ihn und drückte sein Gesicht an das ihre. Sie erblickte jetzt auch verwundert das Brot auf dem Stuhl und hob es auf. Sie richtete sich ganz hoch mit ihrem alten ruhigen festen Blick, als fordere sie die Dinge auf, die eben durcheinandergefallen waren, wieder an ihre Plätze zurückzukehren.
In der Werkstatt lag der Staub wie heller Flaum auf den Wänden. Marie hatte aber kaum begonnen, als alles tot und grau wurde. Auf der Mauer lagen rote Tapfen von Sonne, Marie hing sich daran, hätte sie an sich ziehen mögen, tief in sich hineinstopfen, wo es ganz hohl und leer war. Sie struppte den Leinwandsack über die Walze. Der ältere Junge lief über den Hof, drückte sein Gesicht gegen das Fenster und riss das Maul auseinander. Marie graulte sich, da riss er erst recht. Auf einmal war er weg. Marie trat hinaus und sah sich furchtsam um in dem leeren stillen Hof. Da war sein Gesicht über der Hofmauer.
Der Junge rannte die Gasse hinunter auf den freien Platz, schnaufte und dachte nach, er sah rund um sich in die Öffnungen der kleinen, krummen Gassen und dann aufwärts gegen den wolkigen, kaum gestirnten Himmel. Er rannte los. Aus irgendeinem entfernten Wald trieb der Wind durch die leere Stadt ein paar Buchenblätter. Auf der Eisenbahnbrücke am Geländer klebten ein paar Buben, sie starrten hinunter in den Bahnsteig, der schon für den Spätzug erleuchtet war. Sie warteten, bis der Zug kam und wieder abfuhr in die windige unerschöpfliche Nacht. Wenn sie sich eilten, konnten sie dann von den Wällen aus noch einmal denselben Zug über die Flussbrücke in die Ebene hineinschießen sehen, mit einem hellen Schweif auf dem Wasser. Sie stiegen die Wallstraße hinauf. Sie liefen weiter gegen die Kaserne. Zwischen der Rückmauer und dem Wall drückten sich schon ein paar herum, weil da die Kantinenfenster waren. Da war auch eine freche, ruppige, strohfarbige Elise und eine kleine Bucklige, über die man schon von weitem die Soldaten lachen hörte. Hinter dem Drahtgitter im Hellen bewegten sich dicke, weiße Hände und klobige, lachende Köpfe. Wie eine durch ein Sieb gepresste Masse quoll durch das Gitter ein dicker Schwaden von Hitze, Schweiß- und Suppengeruch. Durch den Spalt zwischen Gitter und Fensterbrett wurden zuck, zuck Scheiben Kommissbrot geschoben, manchmal mit einem Happen Schmalz. Elise brachte ihren dürren Arm unter dem Gitter durch, die Soldaten zerrten, um mehr von ihr zu kriegen. Auf einmal ging im Innern der Kaserne etwas vor, Geschirr klirrte, alles rannte nach hinten. Das Licht ging aus, und die Fenster flogen zu. Elise brachte mit glänzenden Augen ihre rote, zerschundene Faust voll zerquetschtem Brot an sich.
Zwischen Wall und Mauer war es jetzt kalt und dunkel. Sie liefen vor dem Wind in den Wallgraben. In seinem Innern wuchs ein Gestrüpp, das von oben schwarz und grundlos aussah, wie eine Untiefe. Die kleine Bucklige kroch ein Stück bergab, kam aber wieder. Dann krochen Elise und noch einer und blieben drinnen. Dann kletterte ihnen noch einer nach, und der Erste kroch wieder heraus und hockte sich hin und starrte zurück in das dunkle, verquollene Gestrüpp. Der Junge wäre jetzt auch gern hinuntergestiegen. Er hätte auch gern den Zurückgekehrten gefragt, der war aber so verkniffen und merkwürdig, dass er gar nicht fragte und alles zum nächsten Mal aufschob.
Wie er dann später in die Stadt zurückkehrte, durch die stillen ausgelöschten Gassen, legten sich ihm die vollen Mitternachtsschläge schwer aufs Herz. Er erschrak auch, weil vor der Haustür jemand wartete. Dann waren es aber nur die Schwester und der Verlobte. Sie ließen sich los und starrten in das von Fett und Erde beschmierte Gesicht des Jungen. Anna ließ ihn herein. Sie öffnete die Wohnzimmertür und legte sich aufs Sofa, und er ging durch die Küche, die leise klirrte, und legte sich in die Kammer zu seinem kleinen Bruder.
Marie rückte den Tisch an die Wand, kletterte hinauf und räumte die Wolle aus den oberen Gefächern, sie trug das Zeug durch den Hof, so schnell, dass die Frauen mit den Milchkannen gar nicht verstanden, was sie herumtrug. Der Vater öffnete ihr verwundert die Tür, als hätte er die Abmachung vergessen. Er nahm die Sachen ab und streichelte ihren tiefgesenkten Kopf. Er legte alles auf die Bank, auf der Marie zu schlafen pflegte, am Fußende der beiden schwarzen, großen Betten. Er sah sich unschlüssig um, dann fing er an, zu erklären, wie sich in diesem Zimmer alles verändern sollte. Er streckte den Arm aus und beschrieb mit dem Zeigefinger die künftige Linie der Gestelle. Marie hob den Kopf nur ein wenig, als bereite es ihr Anstrengung, dieser Beschreibung zu folgen. Dann brach der Vater ab und fing schnell an, die Photographien von den Nägeln zu reißen. Als er die erste Photographie herunterriss, fiel das Drückende, Schwere von ihm ab, das das ganze Jahr sein Herz zerquält hatte. Er klapperte mit seinen flink gewordenen Händen in den Bildern herum. Marie trat aus der Tür und räumte das Wandbrett ab. Sie schleppten zusammen den Waschtisch um die Betten herum und steckten die Vorhänge hoch. Marie presste den Mund zu, ihre Stirn glänzte, aber der Vater pfiff und lachte, wenn das Möbel anstieß und ein Stückchen Tapete abfetzte, und er spuckte sich auf die Finger und klebte es wieder an. Dann lief er auf einmal weg, um Nachbarn zu holen, die ihm helfen sollten, die Gestelle und die Maschine heraufzuschleppen. Rund um den Hof klappten die Fenster hoch, um zu sehen, was da drunten gerollt und geschrien wurde. Denn der Vater, der sich sonst abseits hielt und leise auftrat, lärmte jetzt in den hellen Sonnenschein, schrie mit rotem Gesicht seine Anordnungen und klatschte in die Hände. Als dann die Männer gegangen waren, setzte er sich auf ein Bett, obgleich er beim Tragen nicht geholfen hatte. Er deckte sein Gesicht mit den Händen zu. Marie sah auf ihn hinunter, sie hatte vielleicht noch nie seinen Kopf ganz von oben gesehen, weil er ein großer Mann war, die Haut war weiß wie Wachs, die Haarbüschel waren vergilbt und an den Spitzen wie versengt. Er stand seufzend auf mit seinem alt und schwer gewordenen Körper. Er sah sich um, erblickte die Gestelle und die Wolle und die Maschinen, das ganze Zimmer voll, und erschrak. Sein Blick fiel auf den Pack Photographien auf dem Nachttisch, er griff darin herum, da sagte Marie: »Sie kommen schon.« Die Mutter und Anna kamen vom Markt heim. Sie blieben verwundert vor dem Wohnzimmer stehen, das sie geputzt hatten, bevor sie weggegangen waren. Jetzt war es schmutzig und vertreten. Der Vater trat in die Tür und sagte ruhig: »Wir sind schon mit allem fertig.« Die Mutter sah sich mit aufgerissenen Augen um, schwieg und drückte die Türklinke fest in der Hand. Dann sagte sie: »Ihr hättet die Betten zudecken sollen.« Sie sah einen Riss in der Tapete und fuhr mit dem Daumen herüber. Sie sah sich noch einmal, ernster, um, aber nichts richtete sich, alles blieb, wie es war, rot und blau und gelb und kreuz und quer. Da drehte sie sich um und ging ins andere Zimmer. Marie fing an einem Ende an aufzuräumen. Der Vater fragte: »Marie?«, vergaß, wonach er sie fragen wollte, und sah sie nur an. Er sah sie an, wie man jemand ansieht, vor dem man sich gar nicht schämt, er hatte solche Angst in den Augen.
Die Schwestern fegten die Werkstatt. Jetzt, wo sie leer war, war sie ein großer, luftiger Raum. Anna redete immerfort von dem jungen Gintler. Marie wünschte sich, sie möchte zu reden aufhören. Die Tage waren rundherum fest geschlossen, sie hatten vielleicht irgendwo einen Spalt, durch den man durfte, wenn man was vorzeigte. Anna zeigte ihr schönes Gesicht und wurde durchgelassen.
Droben hatte die Mutter auf den gedeckten Tisch das Veilchensträußchen gestellt, das der junge Gintler gebracht hatte. Alle um den Tisch aßen müde und langsam. Nur der Junge tippte an die Veilchen und lachte mit bösen, jungen Zähnen, weil etwas anders war.
Drunten lagen die grauen, toten Fenster der Werkstatt – schon vergessen. Aus dem näher gerückten Himmel kam ein roter Abfall aufs Fensterbrett, auf Mariens Arme. Der Vater war in die Stadt gegangen, um mit Matthäus wegen der Novemberlieferung zu sprechen. Der Kleine lernte am Küchentisch. Der junge Gintler saß schon neben Anna auf dem Sofa, hielt ihre Hand und wünschte sich ihre Brust, ihren jungen Körper. In dem abendlichen Zimmer schwebten die weißen Wolken von Vorhängen. Boden und Tischplatte glänzten noch immer in der Dämmerung, auf den blanken Flächen schienen die Möbelstücke und Vasen zu schwimmen.
Auf einmal, als ob sich alle nur mit Mühe zurückgehalten und in die Winkel versteckt hätten, kamen die Menschen aus allen Türen. Der Vater kam von der Treppe, Marie aus dem Schlafzimmer, die Mutter mit dem Kleinen aus der Küche. Sie baten den Gintler, zum Abendessen zu bleiben, er musste aber heimgehen.
Der Vater grämte sich wach auf dem Bett, dass ihm gerade der alte Matthäus solche Antwort gegeben hatte. Er, Ziegler, hatte zu dem alten Matthäus bitte und danke sagen müssen. Sie waren zu gleicher Zeit in der Schule gewesen, hatten zu gleicher Zeit ein Gewerbe angefangen, geheiratet und Kinder aufgezogen. Dann war dieser Abend gekommen, an dem man sie einander gegenübergestellt hatte, und nicht dem Matthäus, sondern ihm, Ziegler, hatte man etwas Bitteres in die Kehle gegeben. Auf dem Heimweg war er an dem Vater Gintler vorbeigekommen. Sie hatten einander gegrüßt, aber Gintler hatte ihn böse angesehen. Er trug es ihm nach, dass sein Sohn die junge, schöne Tochter aufsuchte. Mit mattem, kränkendem Gruß erinnerte er ihn an seine Pflicht, diesen einzigen Sohn aus seinem angebröckelten Wohnzimmer zum Vater zurückzuschicken. Heute Abend hatten an seinem Weg alle älter gewordenen Männer der Stadt gestanden, sie ließen ihn in der Mitte durchgehen und betrachteten kalt und erstaunt seinen grauen Kopf.
Er hatte nichts Unrechtes getan, manchem gelang es und manchem nicht. Elliser ging es noch schlechter als ihm, von seinem Geschäft war gar nichts übriggeblieben. Elliser ging um zehn Uhr eins trinken. Er hatte ihn mal ohne Weste mit einem verrutschten Vorhemd getroffen. Er selbst hatte einen schwarzen Sonntagsanzug, zwei Werktagsanzüge und einen alten, abgetragenen. Er rechnete in die Morgendämmerung hinein, wann er den alten abgetragenen gekauft und wie lange er gehalten hatte. Morgens erzählte er Marie, was mit Matthäus gewesen war. Marie erwiderte nichts. Da kam es ihm nicht mehr so schlimm vor.
Samstags zog sie sich an, legte die Sachen in den Korb und ging in die Stadt. Neben der Tür stand ein Eimer Wasser, der Teppich war zurückgeschlagen, die Mutter rieb. Das war merkwürdig, die Mutter reiben zu sehen, dicht auf dem Boden, wie ein breites, niedriges Tier mit grauen und schwarzen Haarschwänzen. Sie sah auch von unten nach Marie hin mit dunklen, traurig glänzenden Augen, wie Tiere auf der Straße. Marie wunderte sich, Anna machte sonst immer den Boden. Sie hörte noch hinter der Tür die Mutter reiben und reiben, als gäbe es etwas verborgen unter dem Fußboden.
Draußen war es schon dunkel. Es war kalt, auf dem offenen Platz sogar schneidend kalt. Marie ging zuerst in die Werkstatt von Matthäus. Dort blieb der größte Teil. Vor dem hinteren Ausgang warteten ein paar Burschen und traten von einem Fuß auf den anderen. Marie ging auf die andere Seite, aus der Torfahrt kam ein Geräusch von Geschwatz, Schritten und Lachen. Gesichter und Burschen und Lachen, alles war weit weg, wie Sachen im Traum, unverständlich auf eine dunkle Wand gesetzt.