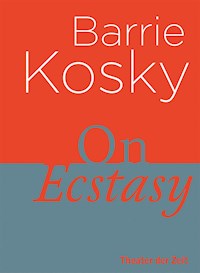21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Australien und Europa, Queerness und Judentum, Popkultur und Opernbühne – Barrie Kosky, gefeierter Opernregisseur und meisterhafter Jongleur scheinbar unvereinbarer Gegensätze, lässt uns in »Und Vorhang auf, hallo!« an seinem außergewöhnlichen Leben teilhaben. Geboren und aufgewachsen in Australien, 15 000 Kilometer Luftlinie entfernt von Europa, der Wiege der Oper, hat er schon früh seine Liebe zu dieser Kunstform entdeckt. Wie kam es dazu? Wie passen diese beiden Welten zusammen? Was verbindet das Musiktheater, die australische Kindheit und Jugend von Barrie Kosky und seine Karriere in den europäischen Kulturmetropolen?
Sieben Figuren aus der Welt des Musiktheaters geben darüber Aufschluss, anhand von ihnen tauchen wir ein in die Biografie des weltberühmten Opernregisseurs, in seine Gedankenwelt, Erfahrungen und Fantasien, in seine Beziehung zu den verschiedenen Opern, ihren Urhebern und Protagonist:innen und lernen diese wiederum aus Koskys besonderer Perspektive ganz neu kennen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
Barrie Kosky
Mit Rainer Simon
»Und Vorhang auf, hallo!«
Ein Leben mit Salome, Mariza, Miss Piggy & Co.
Mit zahlreichen Abbildungen
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Insel Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2023.
© Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2023
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Designbüro Lübbeke, Naumann, Thoben, Köln
Umschlagfoto: Jan Windszus, Berlin
eISBN 978-3-458-77638-3
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Mariza Down Under
Tatjana
Hans Sachs
Miss Piggy
Salome
Tosca
Mackie Messer
Epilog
Fotonachweise
Textnachweis
Informationen zum Buch
Jetzt tanzen alle Puppen,
macht auf der Bühne Licht!
Macht Musik bis der Schuppen
wackelt und zusammenbricht!
Schmeißt euch in Frack und Fummel,
Und Vorhang auf, hallo!
Freut euch auf Spaß und Rummel
Der heutigen Muppet Show.
Aber jetzt geht's los, jetzt kommt die
sensationellste, fabelhaftellste,
blödelhaftellste, muppetionellste
– ja jetzt kommt die super Muppet Show!
Titellied der Muppet Show
Mariza Down Under
Sie war meine erste Liebe. Sie war die erste Diva meines Lebens. Sie blickte mich von einem Schwarz-Weiß-Foto an, das sie signiert hatte und auf dem Schminktisch meiner Großmutter Magda stand. Elegant und raffiniert, mit Armen weiß wie Alabaster und einem seidenen Kleid, wie eine griechische Göttin: Maria Jeritza, eine der größten Sänger:innen des 20. Jahrhunderts. Richard Strauss' erste Ariadne und seine erste Kaiserin, die erste Frau, die Turandot und Jenufa in Nordamerika sang. Als ich sieben Jahre alt war, hatte sie mich komplett verzaubert, diese exotische Sirene von Brno. Maria Jeritza. Das Idol meiner Großmutter und meine erste geheime Liebe. Auch heute noch, wenn ich das Foto, das inzwischen auf meinem Nachttischchen steht, betrachte, werde ich zurückkatapultiert in mein siebtes Lebensjahr und in das damalige Schlafzimmer meiner Großmutter: bewitched, bothered and bewildered.
Signiertes Foto von Maria Jeritza, 1922, aus einem Autogrammalbum meiner Großmutter
Meine ungarische Großmutter, Magda Löwy, wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts geboren und war somit Teil einer Ausnahmegeneration – alt genug, um sich noch an den Ersten Weltkrieg erinnern zu können, und jung genug, um ihm nicht zum Opfer gefallen zu sein; die Jugend in den 1920er Jahren und das frühe Erwachsenenalter in der Nazizeit. Meine Großmutter erlebte so viele Umbrüche im ersten Drittel ihres Lebens wie ich in meinem ganzen Leben nicht. Die Mehrheit meiner Großfamilie überlebte glücklicherweise die Nazizeit, indem sie rechtzeitig geflohen ist – meine belarussische Familie weit vor dem Zweiten Weltkrieg durch Emigration nach Australien und meine polnische Familie durch Auswanderung nach London. Nicht so die Löwys, meine ungarische Familie, der meine Großmutter Magda entstammt. Sie glaubten, sie bildeten als assimilierte, bürgerliche Juden eine Ausnahme und blieben in Budapest. Keiner überlebte die Shoa, bis auf meine Großmutter, die durch die Heirat mit meinem belarussischen Großvater bereits Anfang der 1930er Jahre nach Australien ausgewandert war, sowie ihre Mutter, die bei katholischen Familienfreund:innen Unterschlupf gefunden hatte, ohne dass Magda davon wusste. Die mitteleuropäischen, jüdischen Freund:innen meiner Großmutter, die ich im australischen Exil kennenlernte, teilten mehr oder weniger dieselben brüchigen Erfahrungen, zeichneten sich durch eine Mischung aus Überlebenswille, Hartnäckigkeit, Verschwiegenheit, Nostalgie, Melancholie, Ironie, Freude und Unzufriedenheit aus.
Meine Großmutter wuchs in einer großbürgerlichen Familie auf, die sich zuallererst als europäisches Bürgertum, dann als ungarisch und zuallerletzt als jüdisch begriff – und zwar als assimiliert. Sie waren Hobby-Juden, feierten zwar Schabbat, allerdings mehr als Sozialereignis und aufgrund des feierlichen Rituals als wegen religiöser Motive. Sie besuchten vielleicht drei Mal pro Jahr die Synagoge – zu Rosch ha-Schana, Jom Kippur und Pessach. Meine Großmutter wurde von einem katholischen Kindermädchen großgezogen, mit dem sie regelmäßig in die Kirche ging und dort gebannt christliche Kirchenmusik anhörte. Ihr Vater, mein Urgroßvater, hatte eine Eisenfabrik und gehörte zu den Budapester Großunternehmern. Sein Wohnhaus stand an der besten Adresse Budapests, an der Andrássy út, gewissermaßen der Champs-Élysées oder dem Ku'damm Budapests, dort, wo sich auch das Opernhaus befindet.
Mein Urgroßvater war im Förderkreis der Budapester Staatsoper und hatte eine eigene Familienloge. Von Kindesalter an besuchte meine Großmutter einmal pro Woche gemeinsam mit ihren Eltern eine Opernvorstellung im Budapester Opernhaus, und einmal im Monat fuhr sie sogar mit ihrem Vater nach Wien in die Staatsoper – bis sie schließlich meinen Großvater kennenlernte und mit ihm nach Australien auswanderte. Für meine Großmutter und ihre Familie war der wöchentliche Opernbesuch wie der Wocheneinkauf bei Edeka oder Rewe. Raus aus der Wohnung, einmal die Straße zu Fuß runter, dann die Opernvorstellung und wieder zurück. Sie war eine absolute Opernfanatikerin, kannte das klassische Repertoire in- und auswendig und hatte zahlreiche Opernstars der damaligen Zeit auf der Bühne erlebt. Sie hat Richard Strauss in einem Künstlerclub in Budapest getroffen, Bruno Walter dirigieren sehen und große Sänger:innen wie Fjodor Schaljapin, Lotte Lehmann und Maria Jeritza live gehört. »Ach, die Lotte. Ach, die Jeritza«, seufzte sie gelegentlich. Namen, mit denen ich damals nichts verband. Aber sie sind mir in Erinnerung geblieben. In mehreren Büchlein sammelte sie Autogramme, darunter die Unterschriften von Richard Strauss, Giacomo Puccini, Erich Kleiber und Enrico Caruso sowie ein Brief von Béla Bartók. Ihr Vater, also mein Urgroßvater, hatte damit bereits begonnen. Zu meinem achtzehnten Geburtstag schenkte sie mir die Alben.
Sie hatte zwei Lieblingswerke, die auf eine gewisse Weise ihren Charakter widerspiegeln. Emmerich Kálmáns Operette Gräfin Mariza, deren Uraufführung sie im Jahr 1924 im Theater an der Wien gesehen hatte und Béla Bartóks Oper Herzog Blaubarts Burg. So unterschiedlich diese beiden Werke auch waren – ich kann mir kaum ein größeres Gegensatzpaar vorstellen –, stehen sie gewissermaßen für den Charakter und die Traumvorstellungen meiner Großmutter. Ich glaube, dass meine Großmutter im Innersten aus meinem Großvater einen Operettencharakter machte. Er war sehr gutaussehend, elegant, klug, erfolgreich, ein reicher Pelzhändler aus Australien mit Wurzeln in Belarus, der auf einer Geschäftsreise in Budapest sie sofort in seinen Bann schlug. Er umwarb sie, machte ihr einen Antrag – »Komm mit mir nicht nach Folies Bergère, sondern nach Australien« –, heiratete sie in Paris und fuhr mit ihr auf einem Schiff in ihre neue Zukunft. Genau wie der zweite Akt einer Operette. Sie hatte keinen blassen Schimmer von Australien, hatte sich aber wahrscheinlich eine exotische neue Welt erträumt. Einen Ort wie Buenos Aires, Rio de Janeiro, die Copacabana. Kolonial, exotisch, sonnig. Einen Ort, an dem man stets gute Laune hat, Cocktails trinkt und Samba tanzt. Sie erfand ihre persönliche Operettengeschichte mit meinem Großvater als Prinzen, der sie mit sich in sein fernes Land nahm, ins Land des Lächelns. Emmerich Kálmán, Paul Abraham und Franz Lehár hätten ihre Geschichte kaum besser ersinnen können.
Doch dann holte sie die Realität ein. Australien entsprach mitnichten dem erträumten Paradies. Sie hasste es von Anfang an. Sinnbildlich dafür steht eine kleine Anekdote, die sie nicht müde wurde, uns zu erzählen: Mein Großvater war einer der großen Akteure auf dem australischen Pelzmarkt und also weit entfernt davon, arm zu sein, auch wenn sein Leben in Armut begonnen hatte. Und doch war sein Reichtum nicht vergleichbar mit dem, den meine Großmutter in Budapest erfahren hatte und der nicht nur aus finanziellem, sondern auch aus kulturellem und sozialem Kapital bestand. So musste meine Großmutter, obwohl sie bislang niemals eine Küche betreten hatte, auf einmal selbst kochen und Lebensmittel einkaufen, da sie keine Köchin – wie in Budapest – hatte. So ging sie kurz nach ihrer Ankunft in Melbourne 1934 in ein kleines Lebensmittelgeschäft und verlangte nach Kaffeebohnen. Der Verkäufer lachte sie aus. Kaffeebohnen gab es hier nicht, nur Instantkaffee, der ja auch viel praktischer sei. Sie brach in Tränen aus, stürmte aus dem Laden und rannte nach Hause. Keine Kaffeebohnen. Eine Frechheit. Eine Schande. Ein furchtbares Omen für ihre Zukunft. Ein traumatisches Erlebnis und der holprige Start in ihr neues, verheißungsvolles Leben. Sie versuchte, sich in Australien einzurichten, gebar zwei Kinder, meinen Vater und meine Tante, und musste dann miterleben, wie ihr Mann frühzeitig starb und sie mit den beiden Kindern – mein Vater war gerade mal zwölf Jahre alt – in einem Land zurückließ, das sie verabscheute. Das war nicht der Operettentraum, den sie sich ersehnt hatte. Vielleicht war mein Großvater doch eher eine Art Blaubart, der sie verführte, geheimnisvolle Türen zu öffnen. Und dahinter: das Grauen – Australien.
Neben Gräfin Mariza liebte sie auch Lehárs Lustige Witwe, wobei sie letztlich die Mariza aufgrund von Kálmán, also einem ungarischen Komponisten, bevorzugte. Beide Operetten handeln, nach Ansicht meiner Großmutter, von Frauen, die ihren Mann verloren haben und versuchen, noch einmal die große Liebe zu finden. Man braucht kein Diplom in Psychologie, um hier die Zusammenhänge zu erkennen: Im ersten Akt ihrer Operette verbringt meine Großmutter ihre behütete Jugend im großbürgerlichen Budapester Milieu. Im zweiten Akt lernt sie meinen Großvater, den galanten russischen Ersatzprinzen, kennen, heiratet ihn und folgt ihm in ein fremdes Land. Im dritten Akt durchlebt sie nach dem Tod ihres Mannes eine Version der Mariza bzw. von Hanna Glawari aus Die lustige Witwe – allerdings in Australien während eines Weltkrieges. Die Brüder meines Großvaters übernahmen den Pelzhandel und kümmerten sich sehr um meine Großmutter. Sie fand zwar keine große Liebe mehr, dafür aber in meinem Großonkel Solomon, dessen Frau ebenfalls verstorben war, einen sehr engen Freund und Lebensgefährten. Bei Familienfesten und gesellschaftlichen Ereignissen erschienen sie immer zusammen, auch wenn sie weder eine Liebesbeziehung führten noch zusammenlebten. Sie waren ein halboffizielles Paar. Meine Großmutter blieb also bis zu ihrem Lebensende eine Witwe – allerdings nur mäßig lustig.
Meine Großmutter Magda Löwy, Budapest 1930
Sie war eine der bemerkenswertesten Personen, die ich jemals getroffen habe. Überaus elegant, vornehm, stets bestens gekleidet und geschminkt. Auf Fotos aus ihrer Budapester Jugendzeit lässt sich gut erkennen, wie kultiviert und geschmackssicher sie war.
Sie trug Chanel-Kleider, ging alle drei Tage zum Friseur, hatte ein riesiges Arsenal an Ringen, Ketten, Ohrringen, Seidenschals und Parfums. In meiner Kindheit übernachtete ich ungefähr ein bis zwei Mal im Monat bei ihr. Sie holte mich nachmittags von der Schule ab, wir aßen gemeinsam zu Abend bei ihr, besuchten eine Opernvorstellung oder ein Konzert, ich schlief bei ihr, und sie brachte mich am nächsten Tag wieder zur Schule. Wenn sie mich vor der Schule erwartete, bemerkte ich den riesigen Unterschied zwischen ihr und den Eltern und Großeltern meiner Mitschüler:innen. Sie sah wie niemand anders aus, perfekt und vornehm gekleidet, geschminkt und wunderbar riechend – ein zentraleuropäisches Phantom in dieser angelsächsischen Middle-class-Wüste. Sobald wir bei ihr zuhause ankamen und sie begann, das Dinner vorzubereiten, schlich ich in ihr Schlafzimmer. Eine wunderbare kleine Welt voller exquisiter Schätze. Sie hatte eine große schwarz lackierte Schublade nur für Ringe, von denen ich mir so viele wie möglich an meine Finger steckte. Da sie nur fünfzehn bis zwanzig Minuten fürs Dinner benötigte, war die Zeit zu knapp, um ihre Kleider anzuziehen. Aber an ihrem Spiegel hingen zahlreiche Schals und Tücher, die ich mir schnell überwarf. Zu guter Letzt nahm ich noch ein Flakon von ihrem Schminktisch und besprühte mich mit ihrem Parfum. Dann stolzierte ich als pubertierender Halb-Drag in ihrem Schlafzimmer herum – meine blaue Schuluniform war kaum wahrnehmbar unter den schwarzen Nerzen, dem glitzernden Schmuck und den Chanel-Schals. Wenn meine Großmutter mich dann zum Abendessen rief, musste ich mich schnell der Maskerade entledigen. Der Geruch des Parfums blieb allerdings an mir haften. Sie muss es gerochen haben, ohne es allerdings jemals zu erwähnen. Es gehörte zu den schönsten, geheimnisvollsten und frevelhaftesten Ritualen, heimlich in ihr Schlafzimmer zu schleichen und mich dort zu kostümieren.
Meine Großmutter war eine furchtbare Köchin und hatte im höheren Alter eine Haushaltshilfe, die unter anderem die Zubereitung der Mahlzeiten übernahm. Abends war die Haushaltshilfe jedoch nicht mehr zugegen, daher musste sie das Dinner vormittags vorkochen und in die Wärmebehälter eines Servierwagens füllen. Das Essen war abends indes nur noch lauwarm und völlig ausgetrocknet. Jede Frische, jede Saftigkeit, ja alles Leben war den Speisen entwichen, während sie eine halbe Ewigkeit in dem Wärmebehälter auf ihren Verzehr gewartet hatten. Ich habe seither niemals mehr eine so lausige, staubtrockene Hühnerbrust verzehrt. Meine Großmutter konnte noch nicht einmal ein Frühstücksei zubereiten. Sie nahm die Eier immer zu früh aus dem kochenden Wasser, so dass nicht nur das Eigelb, sondern auch das Eiweiß noch flüssig war. Zum Ei gab es Pumpernickel, völlig ungewöhnlich für ein australisches Frühstück. Auch mein Pausenbrot für die Schule bestand aus Pumpernickel – mit den Fleischresten vom Vortag, Senf und sauren Gurken. Während meine Mitschüler:innen ein klassisches weißes Sandwichbrot mit Erdnussbutter oder Schinken mitbrachten, packte ich ein durch die Gurken völlig durchnässtes dunkles Brot aus, das sofort auseinanderfiel.
Im Esszimmer meiner Großmutter stand ein sehr langer, alter Tisch. Ich nahm am einen und sie am anderen Ende Platz, zwischen uns zwanzig leere Plätze. Im Zentrum des Dinners stand weniger das Essen – wie könnte es auch –, sondern unsere Unterhaltung über das Werk, dessen Aufführung wir bald im Opernhaus erleben würden. In der Regel hatte mir meine Großmutter schon Wochen vorher eine Aufnahme der Oper geschenkt und mich gebeten, sie mir anzuhören sowie das Libretto zu studieren. Das war meine Hausaufgabe, zu der ich dann während des Dinners befragt wurde. Ich musste ihr die Handlung erzählen, von den unterschiedlichen Figuren und meinen Höreindrücken berichten. Schnell ging das Gespräch über in Erzählungen von den Opernerlebnissen ihrer Jugend – welche Produktionen dieser Oper sie gesehen hatte, welche Sänger:innen auf der Bühne und welche Dirigent:innen im Orchestergraben sie bereits in Budapest oder in Wien erlebt hatte, ob sie das Werk mochte oder nicht. Dann blühte meine eigentlich sehr ernste Großmutter auf. Wenn sie über Opern sprach oder das Opernhaus nach einer Vorstellung verließ, war sie auf einmal eine andere Person, versprühte Lebensfreude. Sie liebte Opern, und sie liebte es, mich dabei zu beobachten und zu begleiten, wie ich dieselbe Liebe entwickelte.
Von meinem siebten bis zu meinem achtzehnten Lebensjahr besuchte ich gemeinsam mit ihr Opernvorstellungen. Für mich war das überhaupt kein bildungsbürgerlicher Zwang, sondern der reinste Genuss und die beste Bildung der Welt. Meine Großmutter war meine Lehrerin. Und ich war ihr Schüler. Ihr einziger. Meine Geschwister konnte sie nicht von den aus Europa mitgebrachten Kunstformen überzeugen. Sie versuchte es bei meiner Schwester mit Ballett, bis diese nach zwei Jahren ihr offenbarte, dass sie Ballett nicht ausstehen könne. Mein Bruder zeigte noch nicht einmal einen Anflug von Interesse, weswegen meine Großmutter wiederum kein Interesse an ihm entwickelte. Manchmal begleitete uns mein Vater in die Oper, aber nur manchmal, da er viel auf Handelsreisen war. Im Alter von sieben Jahren wurde ich zu einer Mischung aus Lehrling, Prinzregent und Ersatzehemann, in einem Kinderanzug mit Krawatte. Sie selbst zog für die Opernbesuche lange Abendkleider an, mit einer Pelzstola, aufwendigem Schmuck und hochgestecktem Haar. Das war in den 1970er Jahren in Australien noch Usus. Meine Großmutter besaß aufgrund des Pelzhandels meines Großvaters, seiner Brüder und meines Vaters eine riesige Kollektion an Pelzmänteln und Stolen aus Robben, Füchsen und Nerzen. Ich war gleichermaßen fasziniert und entsetzt, wenn sie die Tiere um ihren Hals schwang, der Schwanz nach unten und der Kopf auf der Schulter, mit einer Diamantenschnalle befestigt, nach hinten blickend. Aus Angst, die Stolen könnten gestohlen werden, gab sie sie nie an der Garderobe ab. Die armen Opernbesucher:innen, die in der Loge hinter ihr saßen, starrte die ganze Vorstellung über ein toter Fuchskopf mit einer Diamantbrosche zwischen den beiden Augen an. Oy.
Wenn wir mit dem Dinner fertig waren, kam ihre Freundin Renata, um uns in ihrem Rolls-Royce abzuholen und zum New Princess Theatre, dem Opernhaus in Melbourne, zu bringen. »The Princess« ist das schönste Theater Australiens, und es hat zudem noch eine großartige Aufführungsgeschichte: Sowohl im 19. als auch im 20. Jahrhundert traten dort viele sehr bekannte Opernsänger:innen auf: Nellie Melba, Luciano Pavarotti, Joan Sutherland. In der Mitte des 19. Jahrhunderts war Melbourne neben Städten wie Buenos Aires oder Kalkutta eine der größten Kolonialstädte weltweit. Und dementsprechend benötigte die Stadt auch ein angemessenes Theater. In den Bau flossen alle möglichen unterschiedlichen europäischen Architekturstile ein. Im Grunde war das Theater als eine Art Erinnerung an Europa erbaut worden, als Ort, der dem Publikum mit seinen vornehmlich britischen Wurzeln ins Gedächtnis rief, woher es ursprünglich stammte.
Allein die Fahrt in Renatas Luxuswagen erscheint mir heute wie eine einzige Operettenfantasie. Renata war eine der vielen jüdischen Witwen aus Europa, mit denen sich meine Großmutter umgab. Keine emigrierten Ghetto- oder Schtetl-Jüdinnen wie meine polnische Großmutter Lea, sondern gebildete, wohlhabende, bürgerliche, ja assimilierte Jüdinnen. Meine Großmutter traf sich mit einigen dieser Witwen zum Bridge. In Sunset Boulevard gibt es die berühmte Szene, in der sich Gloria Swanson in der Rolle der Norma Desmond mit ehemaligen Kolleg:innen aus der Stummfilmära zum Bridge trifft. Dabei spielen sich die Stars – wie Buster Keaton oder H. B. Warner – selbst. Am ganzen Setting, an der Einrichtung, den alten Möbeln, dem aus der Mode gekommenen Spiel lässt sich festmachen, dass ihre Zeit vorbei ist, und doch bemüht sich die kleine Gesellschaft um Haltung, alle haben sich für das gemeinsame Treffen zurechtgemacht. Die Bridgeséancen meiner Großmutter fanden in einer ähnlichen Atmosphäre statt. Und ich fühlte mich wie der junge Drehbuchautor, Joe Gillis, der Norma Desmond besucht und sie ergründen möchte. So wie er war auch ich ein stummer Beobachter, der anstatt den Aschenbecher zu leeren, sich um die Drinks mit Whiskey, Soda und Cocktailbeeren kümmern durfte. Meine Großmutter hielt mit einer Norma-Desmond-Ruhe und -Gefasstheit den Vorsitz über die Bridgerunde. She was always ready for her close-up.
Das Haus meiner Großmutter war das genaue Gegenteil meines Elternhauses, eines Neubaus mit modernen, bunten Möbeln mit einem permanent laufenden Fernseher oder Radio, einem Swimmingpool und einfach allem, was eine Mittelklassefamilie im Australien der 1970er sonst noch so brauchte. Ihr Haus hingegen atmete pure Nostalgie. Die Ruhe, die alten Möbel, die sie in den 1930er Jahren aus Ungarn hatte einschiffen lassen und die jeden Winkel des Hauses besetzten, sowie der Geruch nach altem Parfum erzeugten eine surreale Atmosphäre, eine eigene kleine Welt, halb real, halb Fiktion. Ich liebte es. Blaubarts Burg für Kinder, das nicht besonders lustige Winterhaus der Witwe, ziemlich dunkel, die Jalousien fast immer unten, so dass kaum Tageslicht hereinfiel. Das Haus umfing etwas Geheimnisvolles, Verlockendes, Mysteriöses, strahlte eine rätselhafte Anziehungskraft auf mich und all meine Sinne aus. Die besondere Stimmung entstand nicht nur dadurch, dass meine Großmutter das Haus alleine bewohnte, umgeben von all diesen Antiquitäten, sondern vielmehr dadurch, wie sie mit ihnen umging und die Abläufe dirigierte. Es war ihr persönliches Reich, in dem sie Regie führte und ich die Rollen übernahm, die sie mir zuwies. Stets derselbe Ablauf: Dinner, Oper oder Konzert, dann ein Grimm-Märchen, das sie mir mit ihrem ungarischen Akzent vorlas, und schließlich die Übernachtung in einem Entendaunenbett ihrer Eltern, das sie ebenfalls mit aus Budapest nach Melbourne gebracht hatte. So schlummerte ich zahlreiche Nächte, eingekuschelt im Daunenbett meiner Urgroßeltern.
Meine Großmutter sprach nie vom Schicksal ihrer ungarischen Familie. Ich versuchte immer und immer wieder, etwas aus ihr herauszuquetschen. Aber da kam nichts. Ich glaube, sie fühlte sich schuldig, weil sie als Einzige – neben ihrer Mutter, von deren Überleben sie erst später erfuhr – den Nazis entwischt war. Ihr Bruder, ihre Onkel, Tanten und Cousinen fielen den Nazis zum Opfer. Während viele andere Menschen mit einer ähnlichen Familiengeschichte nicht aufhören können, darüber zu sprechen, schwieg meine Großmutter einfach. Sie sprach nicht über ihre Familie und nahm selten ein Wort Ungarisch in den Mund. Sie verbannte ihre Familiengeschichte ebenso wie ihre Muttersprache aus ihrem Leben. Was eher ungewöhnlich für eine Immigrantin ist. Mein Vater kam nur über seine Großmutter, also meine Urgroßmutter, nachdem sie schließlich in Australien war, in Kontakt mit der ungarischen Sprache. Und ich hörte meine Großmutter lediglich mit ihren ungarischen Exilfreund:innen Ungarisch sprechen, wenn sie ihnen zum Beispiel im Opernfoyer begegnete. Dann wechselte sie allerdings ziemlich schnell in ein Englisch mit starkem ungarischen Akzent oder aber ins Deutsche. Denn für sie war Deutsch die wichtigere Sprache, die Sprache der Kunst und Kultur, und sie drängte mich daher, Deutsch zu lernen.
Da war also ein großes Schweigen über die Familie und die Menschen, die sterben mussten. Dieses brach sie nur, wenn sie über ihre Erlebnisse in der Budapester Oper sprach. Die einzigen Erinnerungen, die sie mit nach Australien genommen zu haben schien, waren diejenigen an Sänger:innen und Dirigent:innen, an Fjodor Schaljapin, Maria Jeritza und Co. Sie hatte ihre Vergangenheit zu einer einzigen Opern- und Operettenfantasie umgewandelt – um den Tag zu überstehen. Später bemerkte ich, wie einsam sie seit dem Tod ihres Mannes gewesen sein muss. Und je länger sie lebte – sie wurde vierundneunzig Jahre alt – und je mehr Freund:innen um sie herum erkrankten und starben, desto häufiger äußerte sie Suizidgedanken und desto mehr wuchsen die Lebensmüdigkeit und die Einsamkeit.
Ein einziges Mal kehrte meine Großmutter zurück nach Budapest. In den späten 1970er Jahren unternahm sie gemeinsam mit einer Freundin eine Europareise. Direkt nach ihrer Ankunft in Budapest ging sie zu ihrem Elternhaus, blieb davor wie angewurzelt stehen, brach in Tränen aus und buchte sofort einen Zug zur Weiterfahrt nach Wien. Sie konnte es nicht ertragen, verbrachte gerade einmal ein paar Stunden in der Stadt ihrer Kindheit und Jugend und verließ sie wieder, ohne etwas anderes als ihr Elternhaus gesehen zu haben. Als ich das erste Mal nach Budapest reiste, löcherte ich sie so lange, bis sie mir endlich die Adresse gab. Unaufgefordert fügte sie dann noch den Rang und die Nummer ihrer Familienloge hinzu. Ich besuchte also sowohl ihr Elternhaus als auch die Opernloge – die einzigen Zeugnisse ihrer Budapester Familiengeschichte, die sie mir hinterließ.
Ich liebte diese Stadt bereits, bevor ich das erste Mal dort war. Durch die Erzählungen meiner Großmutter wurde Budapest für mich zu einer Art Fantasiestadt, einer Märchenstadt, wie die Smaragdstadt aus dem Zauberer von Oz, eine Utopie wie aus einem Roman von Jorge Luis Borges oder Italo Calvino, ein weit entfernter Sehnsuchtsort, der mich magnetisch anzog. Und zugleich wurde Budapest für mich zum Sinnbild für Europa bzw. für eine europäische Stadt – mit einem Opernhaus, einem Schloss, einem Parlament, einem Rathaus und einem großen Fluss, der sich durch die Stadt schlängelt. Meine Großmutter erzählte mir in den schillerndsten Farben von den verschiedenen Restaurants. In das eine geht man wegen des Schnitzels, in das andere wegen der Knödel. »Dort aßen wir den besten Palatschinken, und da tranken wir Tokaji.« Inzwischen habe ich die Stadt gut fünfzehnmal besucht und liebe sie nach wie vor. Die Architektur, das Essen, die Mentalität der Menschen, die Stimmung … Sie ist für mich all das, was Wien nicht ist. Die Stadt meiner Großmutter. Ich wurde mehrmals angefragt, an der Staatsoper Budapest zu inszenieren. Eine großartige Vorstellung, an dem Haus zu inszenieren, an dem meine Familie so viele Opernabende erlebt hatte. Aber solange Viktor Orbán an der Macht ist, möchte ich dort nicht arbeiten. Und doch ist Budapest nach Tel Aviv meine absolute Lieblingsstadt.
Als ich dreizehn Jahre alt war, gab mir meine Großmutter eine LP von Gräfin Mariza, um mich auf einen gemeinsamen Opernabend vorzubereiten. Sie erwähnte gleich, dass Mariza eine Operette sei, eine Spielart von Musiktheater, die ich noch nicht kannte. Mit gesprochenen Dialogen, mit Tanz, mit Witz … Ich hatte bereits viele Opernvorstellungen mit ihr besucht, kannte Mozart, Puccini, Verdi, Wagner, Janáček, Strauss, Donizetti, Bellini und Rossini. Ich kannte Sprechtheater, Musicals, Oper, Ballett. Aber Operette? Emmerich Kálmán? Sie hatte sicherlich ihre Gründe, mir als erstes Werk dieses Genres gerade dieses zu geben. Kálmán stammte wie sie aus Ungarn. Sie hatte die Uraufführung von Gräfin Mariza 1924 am Theater an der Wien gesehen und liebte das Stück über alles. Ich machte meine Hausaufgaben, las mir die Informationen auf der Schallplattenhülle durch und hörte mir die Aufnahme an. Ich war sofort von der Musik begeistert. Diese Mischung aus Dur und Moll, Melancholie und Freude – wie kurz nach Sonnenuntergang oder der letzte Moment bei Tageslicht. Eine komplett neue Welt. Die Platte bestand nur aus Musiknummern, die Dialoge fehlten. Aber zum Glück war die Aufführung auf Englisch, so dass ich alles unmittelbar verstand. Sehr zum Leidwesen meiner Großmutter, die Englisch hasste und die Vorstellung viel lieber in der Originalsprache, in ihrer Muttersprache, erlebt hätte. Und doch gab sie sich voll und ganz der Aufführung hin, floss mit der Musik, die sie so lange nicht mehr live erlebt hatte. Sie kannte jeden einzelnen Ton, summte jede Melodie mit. Ich habe meine Großmutter selten so bewegt erlebt. Sie blühte stets im Opernhaus auf, aber nur bei zwei Stücken habe ich sie wirklich erregt gesehen: Gräfin Mariza und Tristan und Isolde, ihre Lieblings-Wagner-Oper, wie auch meine. Es muss die wunderbare Musik von Kálmán gewesen sein, aber auch die Erinnerungen an ihre Vergangenheit, wie ihr Vater sie mit zur Uraufführung genommen hat, an Ungarn und die ungarische Kultur.
Gemeinsam mit meiner Großmutter besuchte ich einige Operettenaufführungen in Australien und bemerkte dabei, wie viel diese Stücke ihr bedeuteten. Vor allem eine Inszenierung von Die lustige Witwe mit Joan Sutherland ist mir in Erinnerung geblieben bzw. die Reaktionen meiner Großmutter. Sie hasste die Produktion oder vielmehr die Farbe des Kostüms von Hanna Glawari: Pink. Sie sprach stundenlang über nichts anderes als über das schreckliche, rosa Kleid und zeigte mir durch ihre vernichtende Inszenierungskritik, wie sehr sie diese Operette liebte. Noch Jahre danach schimpfte sie über Joan Sutherlands Kostüm. Instantkaffee und pinke Kleider. Was einem Australien alles zumuten kann.
Ich dachte nur: Was um alles in der Welt ist das? Ich war gleichermaßen überrascht wie berauscht. Irgendwie erinnerten mich die Musik und die Aufführungen an die Musicals, die ich mochte. Dann wiederum an die Opernwerke, die ich kannte, mit ihren großen Stimmen, historischen Kostümen und Bühnenbildern. Und dann – während der Dialogszenen – an Sprechtheater. Ich konnte das, was ich sah und hörte, nicht einordnen, hatte keinen richtigen Vergleich. Heute kann ich in Worte fassen, was mich speziell an Kálmán reizte. Es ist diese einzigartige Mischung aus ungarischer Volksmusik, jüdischem Klezmer, Wiener Dreivierteltakt und einer Prise Berliner Jazz. Kálmáns Volksmusikeinflüsse stammen im Grunde aus der gleichen Quelle wie diejenigen von Bartók: ungarische Dörfer, ebendie Dörfer, die dieser aufsuchte, um Aufnahmen zu machen. Bartók experimentierte damit, transformierte sie in seine ganz eigene, unverwechselbare Klangsprache. Sobald man auch nur ein paar Takte Bartók hört, erkennt man, dass die Musik von ihm stammt. Kálmán wiederum kombinierte die ungarische Volksmusik mit zeitgenössischer jüdischer Musik, ja ließ sie zu einer besonderen Form von ungarischem Klezmer werden. Er kannte die Wiener Operetten von Johann Strauss und Franz Lehár, diesen ganz eigenen Kosmos im Dreivierteltakt. Auch hier bediente er sich und fügte seiner Musik eine gute Portion Walzerschwung hinzu. Allerdings ohne die Spießigkeit von Strauss und Lehár, eine Spießigkeit, die die Wiener Operette in eine Sackgasse geführt hatte. Und zu guter Letzt würzte er seine Musik noch mit einem Schuss Jazz – bei Weitem nicht in dem Maße wie Paul Abraham. Aber doch genug, um seiner Musik einen eigenen, sehr zeitgemäßen Rhythmus zu verleihen. Et voilà! Er schuf eine eigenwillige Mixtur, die den kosmopolitischen Geist der Zeit, die Seele der damaligen Metropolen atmete und in den 1920er Jahren zur hippen, angesagten Musik der Stunde wurde. Und er eröffnete ein völlig neues Kapitel der Operettengeschichte, ja bereitete mit seinen Jazz-Experimenten gewissermaßen den Weg für den riesigen Erfolg einer komplett neuen Form in Berlin der 1920er und 1930er Jahre: die Berliner Jazz-Operette. Und schließlich – jenseits dieser enormen Stilbandbreite – war Kálmán ein begnadeter Melodienschreiber. Jede Nummer ein Schlager für sich. Melodien, die direkt in die Seele und ins Herz gehen, die man nicht mehr aus dem Ohr bekommt und die in ihrer Feinsinnigkeit zugleich Sehnsucht und Melancholie atmen. Dazu dann noch seltsame theatrale Konstellationen: Eine Gräfin, die einen neuen Mann sucht, junge Liebespaare, riesige Chöre, ungarische Figuren, die auf Deutsch singen, fahrende Bühnenmusikanten … Aber gerade dieses hybride Gebilde hat meine Großmutter – und auch mich – in seinen Bann gezogen.
Von da an spielte Kálmán eine wichtige Rolle in meinem Leben, obwohl ich interessanterweise bislang noch keine Kálmán-Operette inszeniert habe. Seine Kompositionen führten mich aber auf jeden Fall zu Paul Abraham und der Berliner Jazz-Operette. Beide, Kálmán und Abraham, standen mit ihrer Weltoffenheit – zuhause in Paris, Wien, Berlin und Budapest –, mit ihrer Klugheit, mit ihrem Talent und mit ihrem Gespür für Unterhaltung, für Rhythmus und Erotik für all das, was Hitler hasste. Hitler liebte Kálmáns Musik (wer nicht?!), und doch hasste er all das, was sie repräsentierte. Von einem Tag auf den anderen wurden Kálmán und Abraham, gerade noch die Stars der Stadt, die erfolgreichsten Komponisten ihrer Generation, zu Flüchtenden ohne Hab und Gut. Verlassen mussten sie nicht nur ihre Heimat, sondern auch ihre Wirkungsstätten, ihre Theater, ihre Familien, ihre kreative Mischpoke. Kálmán hatte zwar einen holprigen Start in den USA, feierte aber dann doch noch Erfolge. Im Gegensatz zu Abraham, der in den USA trotz seiner Jazz-Einflüsse nie Fuß fassen konnte und psychisch erkrankte. Irgendwann muss er völlig verwirrt in seinem Schlafanzug auf der Madison Avenue in New York den Verkehr dirigiert haben. Nach Kriegsende starb er in einem Hamburger Sanatorium, betreut von ehemaligen Nazi-Ärzten.
Während meines Studiums verließ ich die Welt der Operette für eine sehr lange Zeit. Weder hörte ich mir Aufnahmen an, noch besuchte ich Vorstellungen. Am Anfang meiner Regiekarriere hatte ich überhaupt kein Interesse an Operetten. Erst als ich 2008 mit den Vorbereitungen meiner Intendanz an der Komischen Oper Berlin begann, wurde mein Interesse wieder geweckt. Ich setzte mich mit der Geschichte der Komischen Oper, mit der Gründung durch Walter Felsenstein sowie seiner künstlerischen Philosophie auseinander. Felsensteins Ansatz war außergewöhnlich, da er gleichermaßen Opern, Operetten und Musicals auf den Spielplan setzte. Er hat in den 1960er und 1970er Jahren sehr erfolgreiche Produktionen, insbesondere von Strauss- und Offenbach-Operetten, auf die Bühne gebracht und dabei auf eine Berliner Offenbach-Tradition aufgebaut. Denn Offenbach dirigierte in Berlin und machte die Hauptstadt bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer Operettenmetropole. Auch bei der Besetzung unterschied Felsenstein nicht zwischen einer Offenbach-Operette und einer Janáček-Oper. Dieselben Ensemblemitglieder traten sowohl in Operetten als auch in Opern auf – im Grunde wie heute.
Der eigentliche Schlüssel zu meiner Wiederentdeckung der Operette war aber schließlich die Geschichte des Metropol-Theaters, also des Theaterbetriebs, der vor der Komischen Oper, von 1892 bis 1944, in dem Theatergebäude an der Behrenstraße wirkte. Ich hatte vom Metropol-Theater gehört, las in die paar wenigen, vorhandenen Texte über dieses Haus hinein und befragte befreundete, deutsche Operettenexpert:innen und -liebhaber:innen: Wie sah die künstlerische Ausrichtung des Metropol-Theaters aus? Welche Stücke wurden aufgeführt? Wer trat dort auf, wer komponierte, dirigierte oder sang dort? Und ich erfuhr, dass das Metropol-Theater in den 1920er und 1930er Jahren das führende deutschsprachige Operettenhaus in Europa war. Ein Leuchtturm der Operettenlandschaft, mit Komponisten wie Lehár und Abraham im Graben und Stars wie Richard Tauber und Fritzi Massary auf der Bühne. Ich fragte mich, wie dieses äußerst erfolgreiche und ruhmvolle Kapitel in der Geschichte des Hauses in Vergessenheit geraten konnte. Ich vermute, dass Walter Felsenstein mit der Gründung der Komischen Oper im Jahr 1947 nicht nur ein neues Kapitel des Hauses, sondern nach dem Zweiten Weltkrieg auch ein komplett neues Buch aufschlagen wollte, dabei alles Bisherige verdrängte und sich selbst als alleinigen Schöpfer und Urheber positionierte: »Die Geschichte des Hauses beginnt mit mir. Ich bin die Stunde null.«
Ich stieß in der Geschichte des Metropol-Theaters auf eine spannende Spur, der ich gemeinsam mit meinem Team folgte. Wir intensivierten die Recherche und fanden eine fantastische Operette nach der anderen, ein Juwel nach dem anderen, alle an ebendiesem Ort aufgeführt. Bekannte Komponisten wie Kálmán, Abraham, Lehár, Mischa Spoliansky und Oscar Straus komponierten und dirigierten die Operettenhits der damaligen Zeit. Ich war von dem Fund begeistert und erinnerte mich zugleich an die Operettenbesuche in meiner Kindheit und Jugend. Die Liebe zur Operette und die Neugierde, die meine Großmutter in mir geweckt hatte, ermöglichten es mir, trotz dreißig Jahre Dornröschenschlaf, den Metropol-Theaterschatz zu finden und ihn zu heben. Ich beschloss, in meiner Intendanz einen Schwerpunkt auf die Berliner Jazz-Operette der 1920er und 1930er Jahre, also auf das Repertoire des Metropol-Theaters, zu legen. Und auf Offenbach. Denn Offenbach war stets eng mit Berlin verbunden – als Dirigent zu seinen Lebzeiten, später dann durch ikonische Inszenierungen unter anderem von Max Reinhardt und Walter Felsenstein. Aber auf keinen Fall wollte ich die Wiener Operette auf den Spielplan setzen.