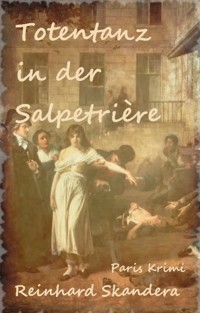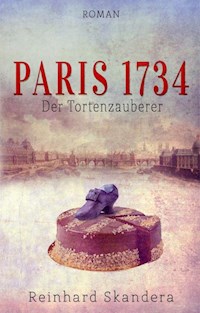3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Kolodzik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die neue Heimat, Verheißung auf eine bessere Zukunft. Die Hoffnung auf ein besseres Leben für die fünf Söhne. Josef und Marie Unfried glauben fest daran. Deshalb lassen sie die geliebte Heimat im schlesischen Sudetengebirge hinter sich und suchen das Glück in der prosperierenden Region an Rhein und Ruhr. Der Werber einer großen Stahlfirma war an der Entscheidung maßgeblich beteiligt. Vieles geht in Erfüllung. Jedoch nicht für den ältesten Sohn Franz, dessen Schicksal im Zentrum der Geschichte steht. Er, gerade 14 Jahre, muss mit dem Vater am Hochofen arbeiten, um die Träume der Familie zu unterstützen. Zwei Brüder besuchen das Gymnasium. Durch unvorhersehbare Ereignisse wird sein Leben mit dem Dreier gleichaltriger junger Menschen untrennbar verknüpft. Er verliebt sich in ein Mädchen, dass einem anderen versprochen ist, der keineswegs bereit ist „ältere Rechte“ aufzugeben. Er lernt auf einem Binnenschiff, auf dem er mit dem Vater anheuert, einen jungen Holländer kennen, der sein erster und bester Freund wird. Durch ihn wird aus dem schüchternen Jungen aus den Bergen ein Mann. Das Leben stellt Franz vor eine Gewissensfrage. Verharren in der Armut oder mit dem Freund in den illegalen Schmuggel von Zigaretten einsteigen. Die Mutter lebte immer nach dem Grundsatz, „die Redlichkeit ist der Reichtum der Armen“. In diesem Sinne hat sie ihre Kinder erzogen. Dramatische Ereignisse zwingen Marie Unfried, mit vier ihrer Söhne in die Heimat zurückzukehren. Franz gerät in Abgründe, denen er zunächst entrinnen will, bevor die Familie zurückkehren kann. Das Mädchen, das er liebt, scheint für immer unerreichbar. Alles muss sich in einem dramatischen Schlussakt entscheiden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Unfried
Die Courage der Ungehorsamen
Reinhard Skandera
Lektorat
Verlag Kolodzik
© Reinhard Skandera
All rights reserved
1. Auflage 12.2021
Covergestaltung
Liane Mai
Impressum
Reinhard Slkandera
Im Oberried 11
61194 Niddatal
1. Kapitel
Franz wälzte sich die ganze Nacht in seinem Heubett. Den 4 jüngeren Brüdern überließ er gerne die Schlafkammer, in der die 5 Söhne der Familie Unfried schliefen. Die Familie lebte auf einer Häuslerei in dem Bergdörfchen Himmlisch-Ribnei, das zum Adlergebirge gehörte. Das wiederum gehörte zum Schlesichen- Sudetengebirge. Sie lebten von dem, was die Häuslerei hergab bzw. von dem Teil, den sie behalten durften. Franz wusste, was es bedeutet, hungrig zu Bett zu gehen. Oft verzichtete er auf ein Stück Brot, um es den jüngsten Geschwistern zu überlassen. Als der Älteste der Söhne wollte er Mitverantwortung in der Familie tragen.
Im Heu genossen er und der Mischlingshund Peggy den unnachahmlichen Duft des getrockneten Grases. In dieser Nacht konnte Franz nicht einschlafen, wie sonst nur, wenn die rolligen Katzen draußen herumstrichen. Er hatte am Tag zuvor unbeabsichtigt ein Gespräch der Eltern mitbekommen, das ihm Rätsel aufgab. Die beiden hatten heftig diskutiert. Das beunruhigte ihn nicht, denn es kam regelmäßig vor. Sie vertraten in der Regel gegensätzliche Standpunkte zu fast allen Themen. Nachdenklich stimmte ihn, dass der Vater, wenn er es richtig verstanden hatte, mit dem Gedanken spielte, Himmlisch-Ribnei zu verlassen.
Franz nahm sich vor, die Eltern in den kommenden Tagen aufmerksam zu beobachten.
Josef Unfried besuchte am Vorabend seine Stammkneipe, die Heinrich Horantzer, sein bester Freund seit den Schultagen betrieb. Der Ehefrau Marie Unfried stanken die Ausflüge des Gatten mächtig. Josef hielt jedoch ihre Übellaunigkeit nach dem Besuch des Gasthauses aus. Auf die Skatabende in der Kneipe zu verzichten, kam für ihn nicht infrage.
An jenem denkwürdigen Abend im Juni des Jahres 1904 durchbrach ein Fremder die Routine in der Gaststätte. Er erregte zunächst das Misstrauen der Männer. Während Wirt und Gäste einfach gekleidet waren und Hose sowie Jacke aus groben Stoff hergestellt waren, trug der Fremde ein weißes Hemd mit goldenen Manschettenknöpfen, Vatermörderkragen und dunkler Krawatte zu einem gedeckten Anzug. Die Gastfreundschaft gebot, dass man ihn nicht allein an einem großen Tisch sitzen ließ. Einige, unter ihnen auch Josef, gesellten sich zu ihm. Josef fragte ihn, woher er komme und ob er auf der Durchreise war, wovon alle ausgingen. Gebeten zu sprechen, folgte der Bitte gerne. Der Reisende kam aus einer Region des deutschen Kaiserreichs, über die man sich in Himmlisch Ribnei Unglaubliches erzählte. Ja, die rasante Entwicklung der Industrieregion an Rhein und Ruhr hatte sich bis Himmlisch Ribnei herumgesprochen. Stumm lauschten sie den schmeichelnden Worten des Mannes. Er fiel nicht mit der Tür ins Haus, sondern interessierte sich für die Belange der Einwohner. So erwarb er ihre Sympathie und achtete genau darauf, wann die Zeit reif war, die Katze aus dem Sack zu lassen. Er war ein Anwerber, geschickt von den Knesebeck Werken, um im schlesischen Bergland Arbeitskräfte zu rekrutieren. Die industrielle Revolution verlangte zigtausende Arbeitskräfte, die in ganz Mitteleuropa gesucht werden mussten. Aus der Bevölkerung an Rhein und Ruhr konnte der Bedarf nicht gedeckt werden. Immer wieder zögerte er die Befriedigung der Neugier der Männer hinaus.
Die gespannten Zuhören glaubten ihren Ohren nicht zu trauen. Die Zugfahrt in die neue Heimat bezahlte der Dienstherr, eine moderne Werkswohnung mit fließend Wasser stand zum Einzug bereit, und, ja meine Herren, sie verhören sich nicht, 1.000 Reichsmark im Jahr Lohn. Die Gesichter röteten sich vor Aufregung. Als Häusler lebten die Besucher des Gasthauses von dem, was sie anbauten oder im Stall mästeten. Einen regelmäßigen Lohn kannten sie nicht. Allenfalls ein paar Reichsmark drückte ihnen ein Großbauer in die Hand, wenn sie ihm zu Diensten standen. Er gab ihnen so viel, wie er für richtig hielt. Bei schlechter Laune des Herren, fielen die Beträge geringer aus.
Die meisten Menschen im Adlergebirge pflegten eine gesunde Skepsis Fremden gegenüber. Nicht so Josef Unfried. Er war einer, den man wohl als einen "Berufsoptimisten“ bezeichnen würde. Im Stillen summierte er das zukünftige Familieneinkommen auf 2.000 Reichsmark pro Jahr hoch. Für ihn gab es keinen Zweifel daran, dass Franz mit seinen 14 Jahren ebenfalls bei den Knesebeck Werken arbeitete. Josef fand, er hatte schon genug Zeit auf der Schulbank vergeudet. Die irrige Annahme, dass die Ehefrau Feuer und Flamme für die Aussiedlung sein würde, kann nur mit dem Hang zu einem übertriebenen Optimismus erklärt werden.
Für Franz stand fest, er würde die Heimat nicht verlassen. Er hätte nichts dagegen, wenn Josef allein ginge, um der Familie ein besseres Leben zu garantieren. Er liebte die Heimat. Im Sommer schwammen sie in einem See und durchstreiften die scheinbar nie enden wollenden Wälder. Im Winter tobten sie den halben Tag im Schnee, veranstalteten Schlittenrennen und jagten mit den langen Brettern durch den Schnee. Nie stellte er sich vor oder träumte davon, von dort wegzugehen.
Er sprach mit fester Stimme zu Peggy:
„Ich bleibe hier, das schwöre ich dir.“
Der Anwerber notierte sich die interessierten Männer und zog weiter. In einigen Wochen würde er wieder vorbeikommen, um mit denen, die Ernst machten, die Papiere zu unterschreiben. Die Entscheidung blieb in der Familie Unfried offen. Josef wollte das Angebot unbedingt annehmen, Marie sagte weder ja noch nein. Im Ergebnis bedeutete das, ohne Maries Zustimmung würden sie in Himmlisch Ribnei bleiben.
Zunächst kehrte wieder Ruhe ein. Franz ging zur Schule und streifte in der Freizeit durch die Wälder der Heimat. Begleitet immer von Peggy, seiner treuen Freundin. Die Düfte und die Geräusche der Tiere, all das bedeutete für ihn zu Hause. Menschen außerhalb der Familie gegenüber verhielt er sich zurückhaltend. Das Leben mit den Brüdern, der Mutter und besonders mit der Peggy erlebte er wie ein Geschenk des Himmels. Da das Schicksal ohne einen Tropfen Wermut nicht schlafen kann, schüttete es den auch in Franzens Becher. Das Verhältnis zum Vater glich dem von Hund und Katze. Jedes Gespräch zwischen ihnen endete in einem Streit, den sie nicht auflösen konnten. Marie sorgte sich um den Sohn, der ihrer Ansicht nach nur um die Anerkennung des Vaters kämpfte. Ihre Appelle an die Vernunft des Ehemannes verpufften. Zu sehr versetzte ihn der Sohn in Rage.
„Marie, er darf mich vor den anderen Söhnen kritisieren, ich bin das Familienoberhaupt. Er schuldet mir unbedingten Gehorsam.“ Diesen Ausdruck benutzte Josef oft und gerne. Der Gehorsam der Kinder rangierte für ihn über allem anderen. Marie bemühte sich um einen Ausgleich und schlug Josef vor, mit Franz durch die Wälder zu ziehen, statt ständig bei Horantzer einzukehren. Josef schwieg und ging weiter in die Kneipe.
„Das Recht, den großen Josef Unfried zu kritisieren, steht ihm nicht zu, aber er hat recht mit dem, was er sagt,“ pflegte Marie dann zu sagen. Auch Josefs nächster Schritt erlebte die tausendste Aufführung. Er spielte den Beleidigten und verabschiedete sich für den Abend, den er im Gasthof Horantzer zu verbringen gedachte. So lief es meistens ab, wenn die Eheleute sich über den ältesten Sohn stritten. Der Familienfrieden litt unter dem Zwist zwischen Vater und Sohn.
Franz rebellierte vor allem gegen ihn, weil ihn dessen Alkoholkonsum fürchterlich störte. Er liebte Josef, sah in ihm einen feinen vernünftigen Mann, den man sich als Vater nur wünschen konnte. Leider veränderte sich sein Verhalten nach dem Genuss von Bier und Schnaps vollständig. Dann verabscheute Franz ihn für sein Prahlen mit Heldentaten, die er nie vollbracht hatte. Wenn der Streit eskalierte, schlug Josef Franz. Sie sprachen wochenlang kein Wort miteinander. Versuchten sie es wieder, ging der Kampf von vorne los. Marie überlegte bereits, den Sohn zu ihren Eltern auf den Hof zu geben.
Franz hatte sich nicht verhört. Josef trommelte die Familie zusammen, um etwas zu verkünden.
„Marie, ich will, dass die Kinder nicht in unserem Kaff groß werden, sie sollen es in ihrem Leben besser haben als wir.“ Er erzählte von dem Fremden, der die einmalige Möglichkeit bot, der Armut und der Abhängigkeit zu entkommen. Marie sagte bis dahin keine Silbe, sie kannte ihren Ehemann, der schnell zu Enthusiasmus für eine neue Sache neigte. Sie wusste, wie rasch er abkühlte.
Die Aussicht auf eine Wohnung mit fließendem Wasser, gekacheltem Bad und einem Garten hinter dem Haus, wich ihre Ablehnung hingegen auf. Josef sah die Chance, sie zu überzeugen.
„Dort im Ruhrrevier liegt unsere Zukunft. Arbeiter verdienen in Fabriken und Zechen genug, um ihre Familien zu ernähren und den Kindern eine anständige Schulbildung zu ermöglichen.“ Auch Marie klagte häufig über das kärgliche Leben in Ribnei, neigte anders als ihr Mann jedoch nicht zu überstürzten Entschlüssen.
„Josef, das Sudetenland ist unsere Heimat. Mein Herz und das der Kinder hängt daran. Ich weiß, ein Luftikus wie du vermeidet jede Bindung, auch die an die Heimat. Deine und meine Vorfahren siedelten vor Hunderten von Jahren hier, die Familien schlugen Wurzeln. Überlege gut, ob wir das aufgeben wollen. In der Fremde fangen wir bei null an. Außerdem glaube ich, Entscheidungen, die in Bierstuben getroffen werden, taugen nichts.“
Josef besaß nicht das erforderliche Maß an Geduld, um vernünftige Gespräche über die wichtigen Dinge des Lebens zu führen. Ein Mann wie er, mit Erkenntnis qua Geschlecht gesegnet, entschied daher aus dem Bauch heraus. Hatte er sich einmal für einen Weg begeistert, dachte er nicht mehr darüber nach. Er lief los. Marie verliebte sich einst in den begehrtesten Junggesellen weit und breit, weil er sie mit seiner Begeisterungsfähigkeit mitriss.
„Den oder keinen“, wie oft schon gesagt, wie oft nicht bereut? Später, in einem Gespräch mit ihrer Mutter, sagte sie:
„Mutter, es stimmt, was die Leute so reden, Liebe macht blind.“ Immer wenn Josef etwas erklären oder begründen sollte, fühlte er sich unwohl. Er fürchtete um seine Autorität, die ihm als Familienoberhaupt durch die ungeschriebenen Gesetze zustand. Ihm ging das Gespräch bereits auf die Nerven.
„Marie, du musst zugeben, Himmlisch Ribnei ist ein verschlafenes Nest mit weniger als 200 Einwohnern, das kein Mensch außer den Bewohnern kennt. Im Ruhrrevier entstehen große Städte, die Tausenden junger Leute die Chance auf eine bessere Zukunft bieten.“ Als er geendet hatte, dachte er, jetzt findet sie das nächste Haar in der Suppe. Sie beurteilte die Möglichkeiten einer Auswanderung realistischer als Josef.
„Jeder dieser jungen Burschen strebt danach, der Beste zu sein. Sie geraten in einen gnadenlosen Konkurrenzkampf, der einigen Wenigen das sogenannte große Glück beschert. Genau genommen heißt das, sie übertreffen die Anderen in puncto Reichtum. Die Verlierer bleiben zurück, ihnen bleibt, aber das brauche ich dir nicht zu erklären, sich das Leben lustig zu trinken.“Marie bereute die gemeine Spitze in dem Moment, in dem sie sie sagte. Ihm verschlug es die Sprache.
Sie verletzte Josef und er spürte einen Stich in seinem Körper. Er konnte nicht schreien.
„Marie, ich frage mich nur, ob sie hier ihr Glück finden, wenn die Welt ihnen bessere Chancen bietet.“
„Josef, ich erkenne deinen Mut an, befürchte aber er beruht auf Leichtsinn. Du denkst nicht daran, dass der Arbeiter jederzeit entlassen werden kann. Der Verdienst fällt ohne Ersatz von einem Tag auf den anderen weg. Willst du stolzer Mann zur Fürsorge gehen? Die Rückkehr zum früheren Leben ist verbaut. Die Häuslerstelle ist längst vergeben. Bitte bedenke deine Entscheidung gründlich, bevor du sie endgültig triffst.“ Josef ging im Zimmer auf und ab, antwortete nicht sofort, sondern überlegte einige Sekunden.
„Marie, dir fehlt der Mut. Warum schicken die Industriekonzerne Werber bis in die entlegensten Ecken? Weil sie nicht wissen, woher sie die Arbeiter holen sollen. Wer dort fleißig ist, verdient sein Geld.“ Marie wollte auf keinen Fall ins Ruhrrevier. Deshalb musste sie dem Ehemann noch einmal wehtun.
„Nicht fehlende Traute ist der Grund für mein Zögern, sondern dein Charakter. Du findest auch dort eine Kneipe, in die du regelmäßig zum Skatspiel einkehrst. Ein Teil unseres Einkommens wandert in die Tasche des Wirts.“ Franz spürte ein Unbehagen. Er mochte es nicht, wenn die Eltern aneinander Schmerz zufügten.
„Dir fehlen die Argumente, deshalb greifst du meinen Charakter an. Ein arbeitender Mann darf hin und wieder eine Runde Skat spielen, um sich von der Anstrengung zu erholen oder nicht?“ Gespannt warteten alle auf Maries Antwort. Diesmal beendet sie die Diskussion. Für sie stand fest, dass sie die Heimat nicht verlassen wollte. Zu dem Zeitpunkt ahnte sie nicht, dass kommende Ereignisse ihre Festigkeit erschüttern würden.
„Ich muss mich jetzt um den Kessel mit dem Eingemachten kümmern. Du stimmst mir hoffentlich zu, dass unsere Winterversorgung wichtiger ist als deine Hirngespinste.“ Das Gespräch endete an der Stelle. Fritz, der Zweitälteste, sah wenig später seinen Vater auf dem Weg in die Schenke. Aufgrund der Dramatik der Ereignisse, vergaß Franz die Arbeit, die ihm Josef für den Tag aufgetragen hatte. Schnurstracks marschierte er in die kleine Schulbibliothek, um herauszufinden, wo das verdammte Ruhrrevier lag. Sein allerbester Freund, der Lehrer Himmelmann, verschloss gerade das Schulgebäude, in dem sich die Bücherei befand.
„Franz, was ist in dich gefahren? Ich hoffe, du leidest nicht unter Lernfieber.“ Himmelmann mochte Franz nicht, weil der zum Widerspruch neigte. Eine Eigenschaft, die in deutschen Schulen nicht geschätzt wurde. Das Motto hieß:
„Der Kaiser erteilte uns Lehrern den Auftrag, euch zu unterrichten, dass ihr später gute Soldaten werdet, die das Vaterland zu jeder Zeit gegen Feinde verteidigen.“ Das Alibi rechtfertigte die unnachgiebige Strenge, mit der die Schüler behandelt wurden. An dem Tag begegnete Franz dem Himmelmann mit ausgewählter Freundlichkeit, um an die Information zu kommen, die seine brennende Neugierde stillen sollte.
„Herr Himmelmann, ich weiß, es ist spät und ihre von mir verehrte Frau Mutter wartet mit dem Essen. Ich bitte Sie um eine Auskunft, die ich unter allen Umständen sofort benötige.“
„Franz, hat das nicht Zeit? Weil ich sie heute darum bat, serviert Mutter ihr böhmisches Gulasch mit Knödeln; wüsstest du, wie es schmeckt, ließest du mich gehen.“ Himmelmanns Gesichtsausdruck verriet die Vorfreude, mit der er dem Essen entgegen schmachtete. Franz gab alles, um eine Miene der Verzweiflung aufzusetzen, der Himmelmann erlag.
„Ich muss heute wissen, wo das Ruhrrevier liegt, Herr Lehrer.“
„Warum willst du das wissen? Wir haben in Heimatkunde die Provinz Rheinland bisher nicht durchgenommen.“
„Bitte Herr Himmelmann, es ist wichtig.“ Wenig später beugten sie sich über einen Atlas.
„Sieh Franz, wir leben im Sudetenland, genauer im Adlergebirge. Das ist Teil des Riesengebirges.“ Er verharrte mit dem Bleistift auf einem Punkt in der Karte.
„Hier liegt Himmlisch Ribnei, es ist zu klein, wir sehen es auf dem Plan nicht.“ Franz interessierte mehr der Ort, an dem er zukünftig wohnen würde.
„Wo ist endlich das Ruhrrevier?“
„Franz, das Ruhrrevier ist eine Region, die aus verschiedenen Städten besteht. Oberhausen, Duisburg, Essen und andere Orte gehören zu dem Gebiet.“ Franz dachte, hätte ich bloß nicht den Himmelmann gefragt, der erweist sich wieder einmal als vollkommen ahnungslos. Mein Vater arbeitet in Zukunft an dem Ort.
„Wie weit liegt das von hier entfernt?“
„1000 km, Junge.“ Auf der nächsten Seite im Atlas zeigten Fotos die Lage im Ruhrrevier. Riesige Fabriken, rauchende Schornsteine und Stahltürme die Seile antrieben, starrten Franz von den Bildern an. Menschen wohnten in Wohnblöcken, die Bienenstöcken ähnelten, glaubte Franz Himmelmann nicht.
„Wo finde ich die Wälder, Bäche, die Felder auf denen sie das Korn anbauen, Herr Himmelmann?“
„Die suchst du vergeblich, sie brauchen den Platz für Fabriken, Zechen und Wohnungen.“ Die Zeit lief davon, das böhmische Gulasch drohte die Frische einzubüßen. Der Lehrer ließ sich auf keine Verlängerung mehr ein. Er komplimentierte Franz hinaus und eilte zu Mutters Rockschoß. Vorbeigehende, die ihn in ein Gespräch ziehen wollten, passierte er stumm.
Auf dem Weg durch den Wald fiel Franz siedendheiß ein, welchen Auftrag der Vater ihm am Morgen erteilt hatte. Die Tomaten pflanzen. Er rannte so schnell er konnte, nach Hause. Peggy an seiner Seite animierte ihn zu noch mehr Tempo. Alles umsonst, Josef Unfried weilte schon seit einer halben Stunde in dem Häuslerhäuschen und erwartete ihn zornig wie ein Löwe, wenn die Frauen das Essen verspätet servieren.
Laut schimpfend stürzte er mit dem Siebenstränger in der Hand aus dem Haus. Franz täuschte ihn, indem er anzeigte, nach rechts zu laufen, um sofort in die andere Richtung zu drehen. Der Bewegung vermochte Josef nicht zu folgen, sodass der Delinquent entkam. Der treue Peggy eilte tapfer bellend zur Hilfe. Er fing sich sogleich einen harten Hieb mit den sieben Riemen, der ihn zum Rückzug motivierte. Franz nutzte die Ablenkung, rannte ins Haus. Er verkroch sich unter dem Küchentisch. Der Platz bot keinen idealen Schutz vor dem Wütenden.
Der erwischte die Beine mit den Schlägen, bis Marie in die Küche kam, die ihn anschrie:
„Josef, Schluss damit!“ Sie standen direkt nebeneinander, Josef holte zum nächsten Streich aus. Er sah Marie nicht. Der Hieb verfehlte Franz, traf jedoch Marie, indem er das Folterinstrument in ihre Richtung schwang. Augenblicklich trat eine Stille ein, in der man eine Stecknadel beim Aufprallen auf den Boden hätte hören können. Maries Blicke durchdrangen den erschrockenen Vater vernichtend, der schimpfend den Siebenstränger vor ihre Füße warf.
„Das ist allein die Schuld von Franz.“
Nach dem Missgeschick mit dem Siebenstränger floh Josef schnurstracks in die Arme des Freundes Heinz Horantzer. Allerdings beabsichtigte er nicht, eine der üblichen Sauftouren mit dem Kumpanen zu unternehmen. Aufgrund der Lage der Dinge wollte er Maries Wut auf keinen Fall weiter anstacheln. Die beiden Freunde vergnügten sich von Zeit zu Zeit durch Exkursionen in die Kreisstadt Rokitnitz. Zahlreiche Eskapaden verliehen ihnen dort einen Bekanntheitsgrad, der die Aufmerksamkeit der Ordnungshüter weckte und Aktionen der lokalen Platzhirsche provozierte. Josef, im Grunde genommen ein friedlicher Mensch, der keinen Streit mochte, unterschied sich in diesem Punkt von Heinz, der bei erhöhtem Alkoholspiegel zu Stänkereien neigte. Die beiden bevölkerten die Gaststätte allein, was Heinz auf eine Idee brachte.
„Du Unfried, ich schließe den Laden und wir machen Rokitnitz unsicher. Los ist ewig her.“ Josef gab sich keiner Illusion hin, Maries Toleranz für Ausflüge der Art hatte den Nullpunkt erreicht. Dieses Mal würde er dem Drängen des Freundes nicht nachgeben.
„Ein anderes Mal Heinz, heute passt es leider überhaupt nicht.“ Heinz, mit den Empfindlichkeiten des Kameraden bestens vertraut, lächelte, denn Josef umzustimmen, bedeutete für ihn keine Herausforderung. Er wusste, dass das Dorf munkelte, er stünde bei Marie unter dem Pantoffel.
„Du fürchtest dich vor Marie?“ Treffer. Josef rang kurz mit sich, bevor er antwortete:
„Unsinn Horantzer, auf gehts nach Rokitnitz.“
Am kommenden Morgen traute Marie ihren Augen nicht. Ihr Ehemann und Heinz Horantzer lagen nebeneinander bewusstlos auf einem Leiterwagen, den zwei Polizisten aus Rokitnitz auf die Häuslerei steuerten. Die Gesichter verrieten ihre Verwicklung in Handgreiflichkeiten. Einer der Ordnungshüter erklärt Marie den Auftritt:
„Liebe Frau, jemand nannte sie als Anlaufstelle für die Herren. Sie gerieten heute Nacht stark betrunken in der Kreisstadt Rokitnitz in eine Rauferei mit einer Gruppe, die deutlich in der Überzahl antrat. Es besteht kein Grund für große Sorge, sie sind nur leicht verletzt, müssen allerdings mit einer Anzeige wegen Majestätsbeleidigung rechnen. Ehrbare Bürger beobachteten sie beim Urinieren gegen eine Statue des Kaisers. Beleidigungen ihrer Majestät kommen erschwerend hinzu. Eine saftige Geldstrafe ist zu erwarten.“ Nachdem Marie Josef identifizierte, trugen ihn die Ordnungskräfte in die Schlafkammer. Die drei ältesten Söhne Franz, Fritz und Heiner beobachteten gespannt das Geschehen. Sie wagten nicht, sich ihrer Mutter zu nähern. Die verlieh ihrer Wut durch nicht druckreife Flüche Ausdruck. Das erste Mal in ihrem Leben nahm Marie Unfried derartige Worte in den Mund. Der hilflose Gatte bekam von der Erweiterung des Wortschatzes der Gattin nichts mit. Sein Zustand glich einer Ohnmacht. Während des Frühstücks sprach die Mutter keine Silbe, sondern servierte das Essen mit versteinertem Gesicht. Einen Satz sagte sie dann doch:
„Heute Abend erwarte ich von euch allen absolute Pünktlichkeit zum Abendessen.“
Josef Unfried erwachte, nachdem die Sonne ihren höchsten Stand überschritten hatte. Beim Blick in den Spiegel erschrak er vor dem Gegenüber. Langsam tauchten die Erinnerungen an die letzte Nacht aus dem Nebel auf. Sie sahen sich gezwungen, ihren Rokitnitzer Lieblingsfeinden eine Lektion zu erteilen. Da die in der Überzahl antraten, blieben eigene Verletzungen nicht aus. Er überlegte fieberhaft, wer sie nach Hause gebracht hatte. Vorsichtige Versuche, das von Marie zu erfahren, scheiterten kläglich. Sie ignorierte ihn wie einen Pestkranken. Josef fühlte sich miserabel. Der Werber aus dem Ruhrrevier kam schon am darauf folgenden Tag in die Gaststätte und erwartete eine endgültige Antwort. Josef hatte ihm seine Zustimmung zu dem Angebot bereits signalisiert. Wieder einmal bereute er die Voreiligkeit, der er bei wichtigen Entscheidungen oft unterliegt. Unter den gegebenen Umständen glaubte er nicht an das Einverständnis der Angetrauten.
2. Kapitel
Fünf Jahre vergingen seit der Ankunft der Unfrieds im Ruhrrevier. Fünf Jahre, in denen Franz Unfried seine Träume begraben musste, weil Josef es so wollte. Sechs von sieben Tagen einer Woche schuftete er an der Seite des Erzeugers an einem Hochofen der Knesebeck Fabriken. Vor der Abreise verschwieg das Familienoberhaupt, dass er für Franz ebenfalls einen Arbeitsvertrag abgeschlossen hatte, um das Recht auf eine Werkswohnung zu erwerben. Nur Familien, aus denen zwei Mitglieder bei den Werken arbeiteten, stand das Recht auf eine Betriebswohnung zu. Der angenehme Nebeneffekt eines zweiten Einkommens spielte Josef in die Karten, denn das ermöglichte ihm, regelmäßig Pfennigskat in der neuen Stammkneipe zu spielen. Das angeschlagene Vertrauensverhältnis zwischen den Eheleuten hatte durch Josefs Eigenmächtigkeit einen Riss bekommen, der nicht ohne Weiteres verheilen würde. Marie verliebte sich einst in Josefs Lust am Leben, in den Einfallsreichtum, mit dem er sie immer wieder überraschte und nicht zuletzt in seine unbändige Freude an der Liebe. In der gemeinsamen Bewältigung der harten Alltagsrealität ließ er sie oft im Stich. Oft stritten sie unerbittlich über die Kleinigkeiten des täglichen Lebens. Josefs Versuche, sie nach Fehltritten aufzuheitern, scheiterten immer häufiger.
Das Pausensignal ertönte, Franz setzte sich mit Josef abseits der anderen Arbeiter. Er wollte dringend über seine Situation sprechen. Josef vermied jegliches Gespräch darüber. Er wollte nichts hören von einer Kündigung oder den Besuch einer Schule. 19 Jahre alt, gezeichnet durch die harte Arbeit am Ofen, fürchtete Franz, sein Leben an einem siedend heißen Hochofen zu verschwenden. Er hatte sich mit diesem Schicksal noch nicht abgefunden, wollte raus aus dem Höllenschlund.
Er verlangte von Josef, den Arbeitsvertrag zu kündigen. Der lehnte ab. Alles hatte sich in seinem Sinne entwickelt. Heiner und Fritz hielt er für die Begabtesten in der Familie. Sie besuchten die höhere Schule. Das erfüllte ihn mit Stolz. Er konnte sich die geliebten Besuche in der Kneipe leisten, spendierte den Skatbrüdern hin und wieder eine Runde. Franz musste im Sinne der Familie weiter bei den Knesebeck Werken schaffen.
„Franz, du weißt ganz genau, dass wir das Geld für die Schulbücher brauchen. Die Familie ist stolz auf deine beiden Brüder. Sie stehen den Söhnen der Adligen und der betuchten Bürger in nichts nach. Wenn sie das Abitur geschafft haben, darfst du den eigenen Weg gehen. Bis dahin verlange ich von dir, alles zu belassen, wie es ist.“ Franz fühlte sich wie ein Verräter, als er antwortete:
„Auch ich freue mich über den Erfolg meiner jüngeren Brüder. Aber was ist mit mir, darf ich keine eigenen Ziele haben? Du sprichst nie von mir. Ich arbeite seit dem 14. Lebensjahr am Hochofen. Wann zähle ich?“
In dem Augenblick öffnete jemand die Tür zum Pausenraum. Eine junge Frau mit 2 Männern im Schlepptau betrat den Raum. 30 schmutzige, mampfende Arbeiter starrten das Mädchen an. Eine seltsame Stimmung füllte den Ort. Jeder fragte sich, warum kommt ein weibliches Wesen in einem geblümten Kleid in der Pause zu den Hochofenarbeitern. Einer der Kollegen kannte sie. Er flüsterte Franz ins Ohr.
„Ariane Knesebeck, die einzige Tochter des Patrons.“ Franz dachte in diesem Augenblick nicht mehr an Kündigung.
Von einer Sekunde auf die andere galt sein gesamtes Interesse der jungen Frau, die den Mut aufbrachte, in solch einer Kulisse aufzutreten. Bis zu dem Tag hielten alle die Knesebecks für strikte Gegner von sozialen Zuwendungen an die Mitarbeiter der Werke. Der Eigentümer Wolfgang Knesebeck mied jeglichen direkten Kontakt zu den Werktätigen. Thomas Knesebeck, der Betriebsleiter, pflegte hingegen regelmäßig einen Austausch mit den Arbeitern am Hochofen. Ariane hörte dem Onkel aufmerksam zu, wenn er die Geschichten der Arbeiterfamilien erzählte. Sie fesselten sie mehr als die langweilige Lektüre der Deutschlehrerin auf dem Gymnasium. Im Pausenraum herrschte ein Gemurmel und Getuschel unter den Kollegen, bis Fräulein Knesebeck das Wort ergriff:
„Liebe Mitarbeiter, ich heiße Ariane Knesebeck und bin die Tochter von Wolfgang Knesebeck, der euch herzlich grüßen lässt. Die Knesebeck Werke haben sich entschlossen, in den großen Pausen ab sofort kostenlos Bier auszugeben. Die beiden Herren an meiner Seite werden jetzt die Gläser und die vollen Krüge auf die Tische stellen. Sie bedienen sich bitte.“ Sie überraschte die Männer mit der Ankündigung dermaßen, dass keiner einen Mucks herausbrachte; das Bier vor ihnen rührten sie nicht an. Erst nach Arianes freundlicher Aufforderung wagte es Einer, voranzugehen. Die Anderen folgten seinem Beispiel begeistert.
Franz hatte das Fräulein Knesebeck schon gesehen. Wo und bei welcher Gelegenheit fiel ihm nicht sofort ein, bis die Erinnerung zurückkehrte. Sie begegneten sich bereits zweimal. Das erste Mal in dem chaotischen Gedränge, das bei der Ankunft vor 5 Jahren am Bahnhof Osterfeld geherrscht hatte. Drängende Passagiere trennten die Unfrieds in zwei Gruppen. Franz sah die Mutter zum ersten Mal in Panik verfallen.
Ein etwa gleichaltriger Junge, der zu Franzens Verwunderung eine prachtvolle Uniform trug, baute sich plötzlich vor ihm auf.
Der Ton, in dem er Franz anschnauzte, klang militärisch.
„Aus dem Weg, Platz für den Polizeipräsidenten von Malotki!“ Franz und Josef sahen sich verdutzt an; dieser Knirps kann doch unmöglich Polizeipräsident sein. Wie ein Hochstapler wirkte er auf die Unfrieds auch nicht. Franz hielt das Ganze für einen Scherz und die Uniform des Kleinen für ein Kostüm. Er folgte der Anordnung des Jungen nicht, sondern baute sich vor dem Schreihals auf, blieb stehen und grinste. Der vermeintliche oberste Polizist geriet in Rage. Um einen Scherz handelt es sich doch nicht, dachte Franz. Der Kleine wurde ungehalten.
„Aus dem Weg Proletenlümmel, ich hole den Herrn Vater.“ Den Ausdruck Proletenlümmel kannte Franz nicht. Wieso sagt er Herr Vater? Widerstand rührte sich in ihm. Maries Versuche, ihn wegzuziehen, scheiterten. Er verharrte wie eingepflanzt. Eine weitere Bemerkung des Kontrahenten verfestigte seine Haltung.
„Ich bin der Sohn des Polizeipräsidenten,“ brüllte er sichtlich aufgeregt. Franz blieb ruhig, verschränkte die Arme vor der Brust.
„Vor mir sehe ich einen aufgeblasenen Lackaffen.“ Das saß, der uniformierte Junge verstummte.
In der Zwischenzeit hatte ein Mädchen, das den Zornigen offensichtlich kannte, den Streit beobachtet und schaltete sich in den Konflikt ein. Ariane Knesebeck, so hieß die Schlichterin, war das einzige Kind des Stahlbarons Wolfgang Knesebeck.
„Gute Herren, wir wollen uns zivilisiert benehmen in aller Öffentlichkeit.“ In der kurzen Unterbrechung, die entstand, geriet Franz in Josefs Griff. Streng ermahnte er den Sohn, friedlich zu bleiben.
„Ärger gleich am ersten Tag dulde ich nicht,“ wies er Franz zurecht. Die Aufregung unter den Passagieren legte sich und wie von einem unsichtbaren Ordnungsdienst arrangiert, öffneten alle eine Gasse für die Familien Knesebeck und von Malotki. Sie passierten ungehindert, Männer zogen den Hut, Frauen deuteten einen Knicks an. In Franz erwachte der Zorn, er sah dem Vater in die Augen.
„Findest du immer noch, dass wir hier richtig sind?“ Josef, dem das Schauspiel auch missfiel, versuchte, Franz zu beruhigen.
„Sohn, wir sind hier in Preußen, da ist das eben so, militärisch zackig.“
„Vater, wenn das so ist, ist in Preußen grundsätzlich etwas faul.“ Josef hatte keine Lust, weiter zu diskutieren, er führte die Familie wieder zusammen und dirigierte sie zum Ausgang.
Die unterschiedlichsten Typen entstiegen dem Zug, strömten in Richtung Bahnhofsgebäude. Mehrheitlich angezogen wie die Unfrieds, dunkle Jacke zu dunkler Hose. Einige Damen fielen hingegen durch extravagante modische Aufmachung ins Auge. Selbstbewusst präsentierten sie farbige Mäntel, in der Taille betont eng geschnitten, manche verziert mit einem bunten Gallenkitzler. Sie trugen witzige Hüte, geschmückt mit Rosetten, getrockneten Blumen und ausgestopften kleinen Singvögeln. Franzens Laune besserte sich beim Anblick der Kuriositäten auf dem Kopf der Frauen. Er lachte in sich hinein, nein, beim besten Willen, das würde Mutter nicht anziehen.
Als er schon nicht mehr an die vorherige Begegnung dachte, stand das Mädchen, das schlichtend eingriff, auf einmal vor mir und lächelte ihn an.
„Ich heiße Ariane Knesebeck und wohne schräg gegenüber von Schloss Oberhausen in einer der Villen. Komm mich besuchen, ich zeige dir den Schlosswald. Deine blonden Locken finde ich hübsch.“ Franz stand da, wie vom Donner gerührt. Niemals zuvor hatte ein Mädchen so zu ihm gesprochen. Es schien, dass sie hier in der Stadt einen anderen Stil pflegten als in der Heimat.
Abends vor dem Einschlafen, als Ulrich, der jüngster Bruder, an seiner Seite schon selig schlummerte, erinnerte Franz sich an die zweite Begegnung mit Ariane Knesebeck. Den Wald um das Schloss Oberhausen empfand Franz als ein Geschenk Gottes. Anders als befürchtet musste er auf die ausgiebigen Touren durch den geliebten Wald nicht verzichten. Er liebte es, allein durch den Schlosswald zu streifen. Die Gerüche und das unterschiedliche Licht des Forstes erzeugten in ihm eine friedliche Ruhe. Er vergaß in der Zeit die anstrengende Arbeit am Hochofen. Stunden verbrachte er in der Natur, ohne einem Menschen zu begegnen. Der Heimweg führte am Schloss, das die Familie des Polizeipräsidenten der Provinz Rheinland von Malotki bewohnte, vorbei. In dem großen Garten erkannte er die beiden vom Bahnhof wieder. Mit den Malotki Mädchen Bertha und Frieda spielten sie ein seltsames Spiel. Mit einem Sportgerät, ein komischer Stock mit einem dicken Klotz an einem Ende, versuchten sie, Kugeln durch kleine gebogene Tore zu bugsieren. Franz dachte eine Freizeitbeschäftigung für Weicheier, nichts für einen echten Jungen. Er blieb hinter dem Zaun stehen und belächelte heimlich die erfolglosen Versuche der Spielerinnen. Ariane Knesebeck misslang ein Schlag vollkommen. Die Spielkugel segelte über die Einfriedung, rollte Franz direkt vor die Füße. Rochus von Malotki spurtete heran.
„Dort die Kugel, hol sie und wirf sie zurück, sofort!“ Der Kerl nahm inzwischen die Spitzenposition auf Franzens Liste unsympathischer Personen ein. Er teilte ihm mit, dass er auf derart unhöflich vorgetragene Aufforderungen grundsätzlich nicht reagiert. Innerlich dachte er, vor so einem Hampelmann wie dir, kusche ich nicht. Die Begegnung entwickelte sich wie die Erste. Der Knabe bekam vor Wut eine Gesichtsfarbe, die an eine Tomate erinnerte.
„Dich kenne ich. Wir begegneten uns auf dem Bahnhof. Deine Eltern haben versäumten, dir Manieren beizubringen. Nervtötend, stets das Gleiche mit euch Bauerntrampeln. Wirf die Kugel rüber, ich vergesse das schlechte Benehmen.“ Eher versänke Franz im Erdboden, bevor er gehorchte. Rochus wütete gegen die Umgrenzung des Gartens, Franz übel beschimpfend; Proletenlümmel, Schweinepfotenfresser, Plumpsklosetttaucher, Worte, die man aus dem Mund eines adligen Ehrenmannes nicht erwartet hätte. Ariane Knesebeck unterbrach das unwürdige Schauspiel.
„Rochus, wenn du nicht aufhörst, den Jungen mit Schimpfwörtern zu beleidigen, gehe ich nach Hause.“ Er schien überrascht durch ihre entschlossene Haltung. Jedenfalls beendete er die Schimpftiraden. Franz wurde die Situation unangenehm. Nachdem er die Kugel über den Zaun geworfen hatte, verschwand er. An Rochus dachte er bald nicht mehr. An Ariane dagegen schon.
In den Pausen sprachen die Kollegen viel von den Streiks in Kohleminen. Auf Anordnung der Regierenden wurden sie von den Ordnungskräften gewaltsam aufgelöst. Es brodelte zwischen den Zechenarbeitern und den Baronen, die die Bergwerke betrieben. Die Eigentümer der Werke verlangten immer mehr Leistung von den Männern, ohne die Löhne anzuheben.
Der Kaiser persönlich mischte sich in die Kämpfe ein, stellte sich überraschend auf die Seite der Werktätigen.
„Die Unternehmer und Aktionäre müßten nachgeben, die Arbeiter seien ihre Untertanen, für die er zu sorgen habe; wollten die industriellen Millionäre ihm nicht zu Willen sein, so würde er seine Truppen zurückziehen; wenn dann die Villen der reichen Besitzer und Direktoren in Brand gesteckt, ihre Gärten zertreten würden, so würden sie schon klein werden.“
- Wilhelm II. laut Otto von Bismarck, als er sich weigerte, Soldaten zur Niederschlagung eines Streiks im Ruhrevier zu schicken.
Der Kaiser schmeichelte dem Volk, berühmt wurde der Spruch: „Je veux etre un roi des gueux.“ Er forderte ein Verbot der Sonntagsarbeit und der Nachtarbeit für Frauen und Kinder. Er drang darauf, dass werdende Mütter in den letzten Schwangerschaftsmonaten bei vollem Lohn zu Hause bleiben durften. Kinderarbeit unter 14 Jahren, in der Zeit absolut üblich, lehnte er ab.
Josef Unfried, ein begeisterter Anhänger des Kaisers, ordnete einen Familienausflug zum Oberhausener Rathaus an. Dort fand zu Ehren des Geburtstages ihrer Majestät eine öffentliche Feier statt. Niemand von der Familie hatte Lust, dorthin zu gehen. Er kannte keine Nachsicht. Marie, die die Begeisterung des Gatten für den Herrscher nicht teilte, fügte sich widerwillig. Durch einen alleinstehenden Nachbarn, einen gewissen Olaf Kampermann, hatte sie die Gewerkschaftsbewegung kennengelernt. Sie besuchte die Schulungen der neu gegründeten Christlichen Gewerkschaft. Ihre politische Sympathie galt der Sozialdemokratischen Partei Deutschland. Verärgert über die ihrer Meinung nach sinnlose Huldigung des Regenten sagte sie:
„Die SPD wird deinen Kaiser absetzen. Kaiser oder König braucht kein Mensch.“ Josef Unfrieds typische Reaktion für die Männer der Zeit lautete:
„Kümmere du dich um die Kinder, besorge den Haushalt. Die Politik überlass den Männern, die verstehen davon mehr als du.“
Zur damaligen Zeit fanden politische Querelen in den Familien überall im Land statt. Aus dem Grund mobilisierte der Veranstalter der Feier eine große Anzahl von Polizisten, die sich in den Nebenstraßen postierten, um im Falle von Unruhen, sofort eingreifen zu können.
Josef Unfried verkürzte der Familie die Wartezeit bis zum Beginn der offiziellen Feierlichkeiten, indem er den Clown für die Umstehenden mimte. Er imitierte einen feinen Pinkel mit Zylinder und Stock, der sich mit dem eigenen Stecken ein Bein stellte. Mit der Darbietung gewann er den Beifall des Publikums, nicht den der Gattin. Die verkniff sich das Lachen, schaute während der Aufführung bewusst in eine andere Richtung. Sie wusste, dass sie ihn damit ärgerte.
„Marie, du Trauerkloß, hier gibt es keinen Keller, in den du zum Lachen gehen kannst.“ Der Bumerang traf ihn frontal. An dem Tag schien Marie einfach nicht für Komik aufgelegt.
„Du vergnügst dich auf Kosten anderer, genau wie du zulasten deines Sohnes die Mittel für die geliebten Kneipengänge aufbringst.“ Sie bedrängte ihn in den letzten Jahren ständig, an Privatausgaben zu sparen, um Franz den Schulbesuch zu ermöglichen. Zum ersten Mal sprach sie über das Thema in der Öffentlichkeit, womit sie dem Gemahl gründlich die Stimmung verdarb. Nachbarn hielten sich in der Nähe auf.
Die Geburtstagsfeier für den verehrten Monarchen nahm einen komplett anderen Verlauf, als ihn die Organisatoren minutiös geplant hatten. Außer den zahllosen Pferdegespannen, die in der Umgebung um das Rathaus parkten, wartete eines der neuen Vehikel, Automobil genannt, auf den nächsten Einsatz. Die Vierbeiner bestaunten den kommenden Konkurrenten neugierig, bis der mit einem lauten Knall den Motor anließ. Zahlreiche Gäule verloren die Nerven, ergriffen ihrer Bestimmung folgend die Flucht. Sie verursachten ein riesiges Durcheinander, dass bald die im Halbrund um das Rathaus stehenden Zuschauer erfasste. Das edle Volk der Adligen und die betuchten Bürger kamen mit der großen Gruppe der Arbeiter in Berührung, die sich die Gelegenheit nicht entgehen ließen. Schubsereien, leichte Raufereien, provoziert durch die weniger Reichen, verursachten ein wildes Durcheinander. Achim von Malotki, ebenfalls mit kompletter Sippe angereist, dirigierte die wartenden Polizisten mit gezücktem Säbel zu den Schlachtfeldern. Dort hielt sich die Familie Unfried auf, deren weibliches Oberhaupt vergeblich den Rückzug anordnete. Außer ihr und den beiden jüngsten Söhne, die an ihrem Rockzipfel hingen, beteiligten sich die Familienmitglieder aktiv am Geschehen. Beim Weg zu ihrer Kutsche verloren Wolfgang und Elisabeth Knesebeck ihre Tochter Ariane aus den Augen. Die geriet in einen Hinterhalt von 2 Halunken, die mehr Lücken im Mund hatten als Zähne und das vornehme Mädchen mit größtem Vergnügen begrapschten. Das gnädige Fräulein, das ein derartiges Verhalten zuvor nicht erlebt hatte, ergriff Panik, die sich durch hysterisches Schreien entlud.
Marie Unfrieds Verbot, in das Zentrum der Keilerei zu gehen, ignorierte ihr Ältester. Der Vater strebte dorthin, den er nicht allein lassen wollte. Aufgrund der schrillen Schreie einer Frau vergaß Franz Josef zu folgen. Er eilte in die Richtung, aus der sie kamen. Zwei zerlumpte Kerle belästigten das schreiende Mädchen. Franz beleidigte sie, indem er auf die fehlenden Zähne hinwies. Sie ließen von ihr ab und nahmen Franz ins Visier. Es gelang ihm, einen durch einen harten Kinnhaken zu beeindrucken. Daraufhin entschlossen sie sich, neue Opfer zu suchen. Erst jetzt bemerkte Franz, wen er gerettet hatte. Ariane Knesebeck. Sekunden später drängte ein Bursche bekleidet mit einer Paradeuniform sich zwischen Retter und Geretteter. Nicht schon wieder der, dachte Franz. Rochus spielte sich als Beschützer des Mädchens auf, obwohl er zur Befreiung aus der misslichen Lage nichts beigetragen hatte.
„Ariane, geht es dir gut. Belästigte dich der Proletenlümmel,“ fragte er.
Wütend näherte er sich Franz Unfried, schlug ohne Vorwarnung zu. Franz stolperte aufgrund des Treffers und landet auf dem Boden. Er sprang auf, um zurückzuschlagen; Josef, der die Attacke bemerkt hatte, stellte sich zwischen die Kampfhähne. Er beendete die Rauferei, bevor sie richtig begonnen hatte.
Ariane rätselte, warum Rochus sich aggressiv gegen den jungen Mann verhielt, der sie ritterlich verteidigte. In der Kutsche machte sie Rochus auf seinen Irrtum aufmerksam.
„Der nette Junge, den du ohne Grund geschlagen hast, rettete meine Ehre vor zwei üblen Typen, die über keinen Anstand verfügten. Du hättest dich besser bei ihm bedankt.“
„Ich mich bedanken bei einem Proleten? Bist du von allen guten Geistern verlassen?“
Am 18. Geburtstag stand Franz am Hochofen. Er öffnete die Klappe am Ofen, die den flüssigen Stahl freigab, um durch ein Rinnensystem in die Gießpfanne zu fließen. Einmal hatte er geträumt, er steckte den Zeigefinger in das geschmolzene Eisen, der sich darauf hin in einen glänzenden Stahlfinger verwandelte. Jeder kennt die Erleichterung, die das Aufwachen nach solcher Art von Träumen bedeutet. In der Realität erschrak er. Ein Kollege teilte ihm mit, Thomas Knesebeck wünsche ihn in seinem Büro zu sehen. Was hatte das zu bedeuten? Das Herz in der Hose und mit einem flauen Gefühl in der Magengegend schlich er zum Büro des Chefs. Die Angst erwies sich als vollkommen unbegründet. Es ging um einen Verbesserungsvorschlag. Seine Idee, die die häufigen Unterbrechungen beim Ablauf des flüssigen Goldes reduzierte, sparte dem Betrieb Ärger und Kosten. Thomas Knesebeck belohnte den Vorschlag mit einem Prämienschein über 10 Deutsche Mark. Die Nachricht brachte Franz ganz aus dem Häuschen. Zum ersten Mal im Leben erkannte jemand seine Leistung ausdrücklich an. Ein Schauer der Freude erfasste den gesamten Körper. Von dem regulären Lohn sah er keinen Pfennig, denn den nahm Josef in Empfang. Die Prämie floss in seine Hände. Thomas Knesebeck, den er verehrte, sagte:
„Gut gemacht Franz. Die Belohnung kannst du dir im Lohnbüro bei Ariane Knesebeck abholen.“ Franz schwebte auf Wolke sieben aus dem Büro. Später erzählte er den Kollegen von der Prämie. Sie freuten sich ehrlich mit ihm. Josef fand die Freude, die er mit den anderen teilte, übertrieben.
„Verbreite nicht so viel Wind, nur weil du einmal im Leben eine Prämie bekommst.“ Habe ich zu dick aufgetragen, den Neid der Kameraden geweckt, fragte Franz sich. Ein schlechtes Gewissen befiel ihn. Zu prahlen verabscheute er.
Olaf Kampermann gehörte auch zu der Gruppe, in der Vater und Franz arbeiteten. Er ging zu Josef, um ihm die Leviten zu lesen.
„Ich verstehe dich nicht, Unfried. Gönnst du deinem eigenen Jungen die Auszeichnung nicht? Eine Schande. Du hast bisher keinen einzigen Verbesserungsvorschlag vorgelegt, du erträgst nicht, dass er besser ist als du.“
„Kampermann, merke dir ein für alle Male, halte dich aus meiner Familie heraus, anderenfalls wirst du es bereuen.“
Freitag, Zahltag. Ein großer Tag. Franz würde am Abend über 10 Mark verfügen. Der bei Weitem höchste Betrag, über dessen Verwendung allein er entscheiden konnte. Schon beim Aufstehen spürte er eine Aufgeregtheit. Warum bin ich nervös, dachte er. Es besteht nicht der geringste Anlass. Dennoch schwitzten die Hände und er aß nichts zum Frühstück an diesem Morgen. Er zog den einzigen Anzug an, das beste Hemd mit Krawatte und die besten Schuhe. Marie unterstellte Franz eine Verliebtheit; sie hoffte es, denn seine Zurückhaltung gegenüber dem weiblichen Geschlecht besorgte sie.
„Ich muss heute ins Lohnbüro die Prämie von 10 Mark für einen Verbesserungsvorschlag abholen.“ Marie freute sich für ihn. Die Brüder gratulierten, sie gönnten Franz den Erfolg. Fritz und Heiner quälte ständig ein schlechtes Gewissen. Josef schwieg, zwischen ihm und Marie herrschte seit Tagen dicke Luft. Sie erzählte bei Tisch von Gerüchten, die sie beim Christlichen Gewerkschaftsbund gehört hatte. Angeblich drohten bei Knesebeck Entlassungen. Es rumorte in den Werken. Wolfgang Knesebeck hatte riesige Investitionen getätigt. Der Kaiser kam mit der Finanzierung des geplanten Ausbaus der Kriegsflotte jedoch nicht nach. Die erweiterten Kapazitäten waren viel zu schwach ausgelastet. Zinszahlungen und Tilgungsraten drückten. Josef wollte darüber nicht sprechen. Er sprach Marie jede Kompetenz zu dem Thema Arbeit ab. Stets stritten sie so lange, bis er die Lust am Streit verlor.
Hat Mutter recht, fragte sich Franz,trage ich meinen einzigen Anzug, um Ariane Knesebeck zu imponieren? Nein, sprach er zu sich, es gehört sich, wenn man in offizieller Angelegenheit vorspricht. Egal ob Ariane Knesebeck oder einer anderen Frau die Prämie auszahlt. Das spielte keine Rolle. Nass bis auf die Haut kam er im Lohnbüro an. Ein heftiger Regenguss ließ von seiner Aufmachung nicht viel übrig. Der Anzug völlig durchnässt und zerknittert, das blonde Haar zerzaust.
„Bitte vor Eintritt anklopfen“, forderte ein Hinweisschild die Besucher auf; Franz folgte der Anweisung.
Drinnen nahm keiner Notiz von den Geräuschen. Man muss dazu sagen, dass Franz schüchtern anklopfte, bevor auf Samtpfoten eintrat. Ariane Knesebeck beschäftigte sich mit irgendwelchen Akten. Ein Mann arbeitete entweder hoch konzentriert oder schlief im Sitzen.
Genau erkannte Franz es nicht. Nach einer Ewigkeit bemerkte sie ihn.
„Guten Tag? Womit kann ich helfen?“ Sie stand vor ihm, in einem taillierten bunten Kleid, die blonden Locken umrahmten das schöne Gesicht, ihr Lächeln paralysierte Franz.
„Prämie 10 Mark“, presste er kaum hörbar heraus. Franz hatte bemerkt, dass der Prämienbeleg durch den Regen keine Auskunft über die Höhe der Vergütung mehr gab. Die mit dem Federhalter geschriebenen Buchstaben und Zahlen liefen auf dem Papier ineinander. Stumm überreichte er ihr das aufgeweichte Stück Papier. Das kann nicht zu meinen Lasten gehen, dachte er. Ging es dann aber doch, zumindest vorübergehend. Mit einem Lächeln im Gesicht vertröstete sie ihn:
„Leider ist der Schein durch den Regen unleserlich. Bitte sagen Sie mir Ihren Namen und Ihre Adresse, ich werde heute Abend mit meinem Onkel sprechen. Die Prämie bringe ich am Sonntagmorgen vorbei.“ Franz hatte sich beruhigt. Pech, dass aus dem Prämienschein ein abstraktes Gemälde geworden war. Er gab ihr die gewünschten Informationen und sagte Auf Wiedersehen. Die Sonne gewann die Oberhand. Auf dem Heimweg nutzte er einige Umwege. Ariane ging ihm nicht aus dem Kopf. Immer wieder musste er an ihr hübsches Gesicht und die blonden Haare denken.
Ihr freundliches Lächeln, das gleichzeitig eine beruhigende wie erregende Wirkung auf ihn ausübte.
Erschöpft vom Kampf mit den Eltern, die verhinderten wollten, dass Ariane zu den Unfrieds fuhr, saß sie in der Kutsche. Der Kutscher Johan steuerte sie in Richtung Skagerrakstraße. Ariane fand es wichtig, dass Franz das Geld so schnell wie möglich bekam. Wolfgang Knesebeck verstand das nicht. Die Zahlung von Prämien für Verbesserungsvorschläge schmeckte ihm generell nicht.
„Er kann froh sein, wenn er die 10 Mark am Montag erhält. Warum diese Eile?“ Arianes Argument, dass der Mitarbeiter nicht die Schuld an der Verzögerung trug, sondern Onkel Thomas, wischte er einfach vom Tisch. In der Gedankenwelt des Wolfgang Knesebeck besuchte ein Angehöriger der Inhaberfamilie einen Werktätigen nicht in dessen privatem Wohnbereich. Er glaubte, durch Nähe zu den Arbeitern, an Autorität zu verlieren. Elisabeth fürchtete andere Gefahren wie ansteckende Krankheiten, die aufgrund der mangelhaften Hygiene in Arbeiterhaushalten häufig grassierten. Nicht in den Knesebeck Wohnungen, denn dort gab es fliessendes Wasser. Sie verboten Ariane das Versprechen, das sie dem blonden Jungen mit den hübschen Locken gegeben hatte, einzuhalten. Für sie kam das überhaupt nicht infrage, trotz des Neins der Eltern fuhr sie zu den Unfrieds. Wolfgang und Elisabeth stürzten die Tochter in einen Gewissenskonflikt. Sie brachten keine Gründe vor, sondern erniedrigten ausgerechnet die Menschen, die ihnen durch ihre Arbeit zu dem unendlichen Reichtum verhalfen.
Marie öffnete Ariane die Tür. Sie kannte sie. Sonst die Ruhe in Person verlor Marie etwas an Contenance. Sie fing sich schnell und führte den Gast in das Wohnzimmer. Franzens Geschwister platzten vor Neugierde. Arianes Wunsch, allein mit Franz in die gute Stube zu gehen, fand keine Fürsprecher. Die Familienmitglieder versammelten sich vollständig. Sie erzählte die Geschichte vom aufgeweichten Prämienschein, über die die Burschen schreiend lachten. Als sie Franz die Prämie überreichte, schlug das Lachen in Beifall um. Ariane wunderte sich, dass Franzens Vater sich verabschiedete. Es sei Zeit für den Frühschoppen, ein Wort, das sie nicht kannte, weniger noch seine Bedeutung. Die Mutter servierte Tee mit selbst gebackenen Kokosmakronen, die Ariane die Sinne raubten, so unvergleichlich gut schmeckten sie. Sie spürte etwas bei den Unfrieds, das sie als fremd empfand, doch es fühlte sich gut an. Die herzliche, ruhige Atmosphäre entspannte ihre Nerven. Allerdings fiel ihr auf, dass sie sich erst voll entfaltete, nachdem Josef gegangen war. Familiäre Treffen bei Knesebecks verliefen in der Regel steif, es wurde ausschließlich über betriebliche Themen gesprochen.
Für Franz hatte sie eine besondere Überraschung vorbereitet, von der sie vorher nicht genau wusste, ob sie ihm damit eine Freude machte. In der schönen Atmosphäre wagte sie es.
„Herr Unfried, vielen Dank, dass Sie mich bei der Geburtstagsfeier für unseren Kaiser aus den Klauen der beiden üblen Typen befreit haben. Bis Sie kamen, fühlte ich mich ausgeliefert und spürte große Angst. Ein Geschenk drückt meinen Respekt nur unvollkommen aus. Mutter betreibt eine private Bücherei, aus der sie mir ein Buch für dich gab. Es heißt "Die Abenteuer des Huckleberry Finn“ von Mark Twain, einem amerikanischen Schriftsteller.“ Franz erhob sich und stand wie eine Salzsäule. Er zeigte keine äußerliche Regung. Die Brüder stimmten ein großes Hallo an und erinnerten ihn daran, dass ein gewisser Lehrer Himmelmann aus ihrer Heimat das Buch einmal erwähnt hatte. Franz rührte sich immer noch nicht, ließ sich das Buch von den Brüdern aus der Hand reißen. Endlich rang er sich einen Satz ab.
„Keine Ursache, ich habe gerne geholfen. Danke für das Buch.“ Ein flaues Gefühl eroberte seine Magengegend im Sturm. Am liebsten wäre Ariane ihm um den Hals gefallen, aber das verbot sich selbstverständlich. Der Anstand gebot es, sich nun zu verabschieden. Alles in ihr wollte noch bleiben. Marie kam ihr zur Hilfe.
„Fräulein Knesebeck wir alle würden uns freuen, wenn sie noch ein wenig bleiben könnten.“ In den nächsten zwei Stunden genoss sie jede Minute mit dieser wunderbaren Frau und den offenherzigen Kindern. Marie lud sie ein, die Unfrieds jederzeit zu besuchen.
Heiner sagte:
„Wenn du Muttis Kuchen in deinem Leben nicht gegessen hast, hast du echt etwas versäumt.“
Nachdem sie sich verabschiedet hatte, überfiel Ariane ein seltsames Gefühl. Ihre Gedanken kreisten nur um Franz, wann kann ich ihn wiedersehen. Ich könnte morgen vorgeben, etwas im Bereich des Hochofens zu tun zu haben, um ihn aus der Ferne zu beobachten. In der Kutsche überfiel sie eine seltsame Niedergeschlagenheit, denn es war völlig sinnlos, an ihn zu denken; er der Sohn eines ungelernten Arbeiters und sie die Tochter von Wolfgang Knesebeck, einem der reichsten Männer im gesamten Kaiserreich. Das war, als wachte ein Schimmel eines Morgens als Rappe auf. Nicht sie durfte einen Ehemann aussuchen, sondern die Eltern würden eine angemessene Partie für sie finden, die allen Ansprüchen, besonders den Finanziellen genügte.
3. Kapitel
Obwohl Josef es ihr verbot, besuchte Marie mit dem Nachbarn Kampermann eine Gewerkschaftsversammlung. Auch wenn er es nie zugegeben hätte, Josef quälte die Eifersucht. Ohne jeden Grund allerdings, denn Marie Unfried war eine Frau mit eisernen Grundsätzen, zu denen auch die eheliche Treue zählte. Die Erklärungen untreuer Frauen, sie hätten sich unsterblich in den Mann verliebt, bezeichnete sie als Alibi für Charakterschwache. Sie kehrte aufgewühlt nach Hause zurück. Beim Abendessen versetzte sie die Familie in helle Aufregung. Angst ging um unter den fünf Söhnen.
„Josef, ich befürchte, dass ihr den Arbeitsplatz verliert. Die Gewerkschafter kennen die Plänen der Knesebeck Leitung, Mitarbeiter zu entlassen. Wenn das passiert, gehen wir nach Himmlisch Ribnei zurück. Klipp und klar, ich stelle mich nicht bei der Fürsorge an.“ Josef hasste es, in existenziellen Fragen, unter Druck gesetzt zu werden. Er explodierte, ging sofort hoch, fühlte sich persönlich angegriffen.
„Die von der Gewerkschaft wissen nicht, wie es im Betrieb aussieht. Wir schaffen die Arbeit nur, weil wir Überstunden kloppen. Warum sollte die Geschäftsleitung Leute rausschmeißen?“ Josef forderte von Franz, dass er die Aussagen bestätigte. Franz verspürte keinerlei Lust, ihm zur Seite zu springen. Die Familie legte jedoch Wert auf seine Meinung zu der Sache.
„Es stimmt, spezielle Bereiche kloppen Mehrarbeit.“ Maries besorgtes Gesicht ließ erkennen, dass die Feststellung sie nicht beruhigte. Josef stellte unmissverständlich klar:
„Marie, niemals, niemals werde ich nach Himmlisch Ribnei zurückgehen. Ich bin nicht von dort weggegangen, um als geschlagener Mann heimzukehren.“
Es herrschte dicke Luft in der Führungsriege der Knesebeck Werke, zu der neben den Brüdern Knesebeck inzwischen auch Ariane gehörte. Ihr Enthusiasmus galt dem Betrieb. Das kleine Mädchen spazierte bereits an Vaters Hand voller Neugierde durch die Werkshallen. Die einmalige Atmosphäre der Bereiche, in denen Stahl gewonnen, verarbeitet und veredelt wurde, fesselte sie. Wolfgang blieb ein männlicher Nachkomme versagt. Das lebhafte Interesse der Tochter half über den Makel hinweg. Er ließ sich von ihr breit schlagen, dass sie nach dem Abitur eine kaufmännische Ausbildung im Betrieb antrat. Elisabeth zürnte ihm deshalb, denn nach ihrem Willen sollte die Tochter den Weg aller höheren Mädchen gehen. Das hieß ein großes Haus führen und ansonsten sich der Wohltat und den schönen Künsten zuneigen. Zwar war sie kein offizielles Mitglied der Geschäftsleitung, durfte aber an wichtigen Besprechungen teilnehmen. Im Kaiserreich existierte kein weiteres Industrieunternehmen, in dessen Vorstand ein weibliches Mitglied saß. Ganz hinten in seinem Kopf legte Wolfgang die Ernennung der Tochter als Plan B ab, falls das mit dem Schwiegersohn nicht funktionierte. Ariane liebte den Lärm, die Geschäftigkeit, die Gerüche der Hochöfen, Stahlwerke und Kokereien; sie dankte es ihrem Vater durch großes Engagement, dass er sie in den Werken arbeiten ließ.
Arianes Herz platzte vor Stolz. Zum ersten Male durfte sie an einer wichtigen Besprechung teilnehmen. Das Gefühl, das sie selbst als hochmütig empfand, schlug schnell in Nervosität um, nachdem sie das Thema der Sitzung erfuhr: Anpassung der Personalkapazität.
Kaiser Wilhelm II. hatte Wolfgang Knesebeck über Mittelsmänner ausrichten lassen, dass er ihn in den Adelsstand erheben würde, wenn der ihn bei der Aufrüstung der Kriegsflotte unterstützte. Die Knesebeck Werke nahmen daraufhin hohe Bankdarlehen auf, um die Kapazitäten beträchtlich auszubauen. Die Finanzierung der Pläne des Kaisers verzögerte sich. Die Banken forderten dennoch unnachgiebig die vereinbarten Zinsen und Tilgungen. Die Knesebeck Werke gerieten in raue See.
„Wir müssen drosseln, vor allem an den Öfen, unsere Fertigprodukte liegen zu lange auf Lager.“ Wolfgang Knesebeck kam schnell zur Sache, er wollte 50 Arbeiter entlassen. Später, nachdem die Nachfrage sich gebessert hatte, plante er, sie wieder einstellen. Thomas Knesebeck gab sich keinen Illusionen hin, er würde einen Teil der gut eingearbeiteten Belegschaft verlieren. Er hatte Wolfgang gewarnt, vergeblich. Wenn der Kaiser in Berlin ihm den Hering an die Decke hing, rannte der zur Bank. Gegen den Älteren richtete Thomas schon zu gemeinsamen Kindertagen nichts aus. Obwohl ein begnadeter Ingenieur, der großen Anteil an dem immensen Erfolg der Firma Knesebeck hatte, unterlag er im Konflikt stets dem entschlossenen brutalen Bruder.
„Thomas, ich kenne dein Gequake, die Kreditverträge werden bedient, unser Ruf bei den Instituten darf nicht leiden. Lange Rede, kurzer Sinn entlasse 50 Mann am Ofen.“ Arianes Stolz wandelte sich in Erschrecken über die Selbstverständlichkeit, mit der ihr Vater den Rausschmiss von Mitarbeitern anordnete. Thomas stemmte sich gegen ihn, argumentierte mit der Mühe, die die Einarbeitung der Arbeiter gekostet hatte. Ariane sah ihrem Vater an, egal was ihr Onkel sagte, es änderte an der Entscheidung nichts. Sie musste an die Unfrieds denken, an Franz und seine 4 Brüder, die ihr aufgrund ihrer Offenheit und Ehrlichkeit ans Herz gewachsen waren. Sie streckte sich, nahm allen Mut zusammen und legte ihre Meinung zu dem Thema auf den Tisch.
„Papa und Onkel. Sagen wir, die vorhandenen Mitarbeiter am Ofen arbeiten kürzer. Die Personalkosten würden sinken, ohne dass wir einen der gut eingearbeiteten Männer entlassen müssen. Das ist es, was du willst Papa, oder?“ Der Betriebsleiter Knesebeck fand die Idee auf Anhieb gut, unterstützte sie leidenschaftlich.
„Mensch Wolfgang, das ist ein neuer guter Ansatz, ich finde die Idee von Ariane großartig.“ Wolfgangs wütendes Gesicht verriet jedoch schon, was er dachte.
„Das kommt nicht infrage“, schrie er.
„Wir passen um 50 Mitarbeiter an, Thomas, zeig ihr, wie das funktioniert, wir übernehmen hier keine neuen Methoden. Das Fräulein muss noch eine Menge lernen.“ Die Körpersprache verdeutlichte seinen Unwillen, weitere Diskussionen zu dem Thema zu führen. Auf ein Zeichen von Thomas verließen sie den Raum, zurück blieb der Patron, der einsame Mann, der die Verantwortung trug. Niemand durfte sie ihm abnehmen.
4. Kapitel
Der Ehrgeiz des Wolfgang Knesebeck kannte keine Grenzen. Er wollte die Knesebeck Werke zur Nr. 1 der Stahlindustrie machen. Die wichtigsten Konkurrenten saßen in England und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Verheiratung der Tochter Ariane mit dem Spross einer im Kaiserreich einflussreichen Familie zählte zu den Bausteinen seiner Strategie. Wolfgang hatte viele Möglichkeiten gründlich geprüft. Die Wahl fiel schließlich auf Rochus von Malotki, dem Sohn des Polizeipräsidenten der Provinz Rheinland, Achim von Malotki. Ein hoch ambitionierter Mann, über den man in höheren Kreisen sagte, er werde in naher Zukunft ein Ministeramt in Berlin antreten. Durch die Eheschließung erfolgte Arianes Erhebung in den Adelsstand. Die Familien kannten sich lange. Die Freundschaft beruhte mehr auf Interessen als auf einer emotionalen Bindung. Bei einem geheimen Treffen trafen die Oberhäupter der Familien eine Vereinbarung unter Ehrenmännern. Sie besiegelten die Hochzeit von Ariane und Rochus. Die obligatorische Verlobung, die nach gesellschaftlichem Brauch mindestens 6 Monate andauerte, sollte schon in Kürze im Schloss Oberhausen gefeiert werden. Wolfgang hatte bis dahin weder Elisabeth noch Ariane in die Absprachen eingeweiht.
Jetzt eilte es, da es Achim von Malotki mit dem offiziellen Eheversprechen pressierte.
An einem Abend im März 1910 bat Wolfgang die Familie um eine Unterredung im Wohnzimmer der Villa Knesebeck. Die Einrichtung des Raumes zeigte den Reichtum des Hausherrn. Er bevorzugte Mobiliar im Jugendstil, gekennzeichnet durch aufwendige florale Ornamente und Intarsien, die dem Zimmer eine Anmutung von hohem Wert verliehen. Wolfgangs wies Besucher mit Stolz auf die beiden Originalgemälde des französischen Malers Henry Toulouse-Lautrec hin, die Kenner der Malerei selbst die wunderschönen orientalischen Teppiche übersehen ließen.
Wolfgang wirkte feierlich ernst, beinahe etwas unruhig. Ein Mann, den man dem Kaiser vorgestellt hatte, nervös bei einem Familientreffen? Es muss wichtig sein, dachte Ariane. Sie überkam eine Ahnung. Wolfgang bat um Aufmerksamkeit.
„Wir alle wissen, in welcher guten freundschaftlichen Beziehung wir zu der Familie von Malotki stehen. Der regelmäßige Kontakt ist uns Freude und Pflicht zugleich. Die Mädchen Frieda und Bertha besuchten mit Ariane dieselbe Schule. Bei der Ernennungsfeier des Freiherrn Achim von Malotki zum Polizeipräsidenten saßen wir Knesebecks an seinem Tisch.
Rochus, der einzige Sohn der Malotkis, tritt in die Fußstapfen des Vaters.“
Ab hier verlor Ariane jeden Zweifel, um was es ging.
„Kürzlich startete er eine erfolgversprechende Karriere bei der Kriminalpolizei. Eine bessere Partie finden wir im ganzen Kaiserreich nicht. Unter Ehrenmännern beschlossen wir wie üblich per Handschlag, die Verlobung der Kinder. Ariane, ich freue mich für dich.“ Er ging auf die Tochter zu, um sie zu umarmen. Alles in der sträubte sich gegen die einsame Entscheidung des Vaters. An der Erwartung des Familienoberhauptes bestand kein Zweifel. Gehorsam, den sie ihm wider Erwarten in dem Fall verweigerte.
„Nein, Papa Rochus wird ein Spielkamerad aus der Kindheit bleiben, ein Freund. Heiraten kann ich ihn beim besten Willen nicht.“ Wolfgang Knesebeck, sichtlich überrascht von dem Widerstand der Tochter, setzte ein beleidigtes Gesicht auf. Er fand schnell die Schuldige für das unerhörte Verhalten der Tochter.
„Elisabeth, Arianes Ungehorsam finde ich unerträglich. Die Aufgabe, sie zu einer jungen Dame zu erziehen, die die gesellschaftlichen Gepflogenheiten kennt, liegt in deinen Händen. Als Oberhaupt der Familie besitze ich das Recht, den geeigneten Ehemann für das Fräulein Tochter auszusuchen.“ Elisabeth reagierte wie sie es mit den Jahren als die Frau eines Stahlbarons gelernt hatte.
„Bitte Ariane gehorche dem Vater, es ist das Recht des Patrons, den Gatten für die Tochter auszusuchen. Idealerweise bindet er die Gattin in die Entscheidung ein, verpflichtet ist er dazu nicht.“ Elisabeth sprach die Worte ohne Nachdruck, woran Ariane erkannte, dass ihr Wolfgangs Alleingang mehr oder weniger egal war. Sie brach in Tränen aus und stürzte aus dem Zimmer. Wolfgang beschwor Elisabeth:
„Liesel, du weißt es, eine Vereinbarung mit Achim von Malotki ist verbindlicher als das geschriebene Gesetz.“
„Eben deshalb verstehe ich nicht, warum du seinem Sohn unsere einzige Tochter versprichst. Rochus kennt man, die cholerische Ader ist angeboren.“
Achim von Malotki war ein hervorragender Polizist, der die Polizeiarbeit des Rheinlands revolutionierte. Er gründete die erste Polizeischule im Reich, in Düsseldorf. Sein Ruf erreichte Berlin, wo niemand wusste, dass sich hinter dem hochbegabten Beamten eine äußerst vielschichtige Persönlichkeit verbarg. Er hatte Rochus in das Präsidium nach Düsseldorf bestellt. Alle Besucher des Polizeipräsidenten wurden 1 Stunde dem Adlerblick des Zerberus ausgesetzt, auch Rochus, wodurch das Selbstvertrauen der Meisten auf einen Tiefpunkt sank. Die Begrüßung durch Achim tat das Übrige.
„Ach der Herr Sohn, halte er sich ein bisschen gerade.“ Rochus, dessen Haupt ein wenig mehr nach vorne knickte, hatte vor Kurzem die Polizeiakademie beendet, an die sich gemäß Achims Willen eine Karriere bei der Kriminalpolizei anschloss.
„Setz dich Rochus, ich muss dir Wichtiges mitteilen.“
„Danke, Herr Vater,“ flüsterte Rochus. Achim hielt sich nicht gerne mit langen Vorreden auf. Seine unverhohlene Direktheit entmutigte Rochus von vornherein, wobei es in diesem Fall keine Rolle spielte, denn die Nachricht des Tyrannen löste große Freude bei ihm aus.
„Der Leiter der Dienststelle Essen erhielt von mir den Befehl, dir die Leitung der neu gegründeten Sondereinheit Zigarettenschmuggel zu übertragen.“
„Zigarettenschmuggel. Das hört sich interessant an, Herr Vater.“
„Hör weiter zu. Der preußische Finanzminister Georg Kreuzwendedich Freiherr von Rheinbaben beauftragte mich persönlich, den Betrug schnellstmöglich zu beenden, da unserem Staat viel Geld durch die Verbrecher verloren geht.“
„Herr Vater, ich werde die Hunde jagen.“
„Zuhören. Ein Gastwirt aus Oberhausen steht in Verdacht, der Kopf eines Zigarettenkartells zu sein, das mithilfe von Komplizen billige asiatische Kippen ins Ruhrrevier schmuggelt. Du wirst der Bande das Handwerk legen, ich dulde keinen Misserfolg, damit das klar ist.“
„Herr Vater, ich werde die Diebe zur Strecke bringen, die unseren guten Staat bestehlen.“ Achim traute dem unerfahrenen Rochus die Aufgabe im Grunde genommen nicht zu. Deshalb stellte er ihm Anton Griesbeck, einen erfahrenen Kriminologen mit einer legendären Aufklärungsquote, zur Seite. Eine Maßnahme, die Achim später bereuen sollte.
„Du wirst unter Aufsicht des ollen Griesbeck arbeiten. Er zittert zwar mehr als ein Tattergreis, du kannst von ihm jedoch viel lernen.“ Rochus, mit unbändigem Ehrgeiz ausgestattet, duldete keinen Vorgesetzten.
„Ich schätzte es, Herr Vater, wenn ihr erlaubtet, dass ich die Sondereinheit allein leitete.“
„Deine Ambitionen in Ehren. Beim Schmuggel musst du die Gangster in flagranti schnappen, der Griesbeck kennt die Mittel, die dafür nötig sind.“
„Danke, Herr Vater.“
Als Achim am Abend nach Hause kam, vertiefte sich Rochus in das Klavierspiel, in das er viel mehr Begeisterung investierte als in die Kriminalarbeit. Er verehrte Frederic Chopin, dessen Stücke ihn die Knute des Vaters vergessen ließen. Eingetaucht in die Musik, verpasste er Achims in das Zimmer. Rochus maß im Gegensatz zu dem 1,90 m großen Vater, gerade 1,70 m, er repräsentierte eher den schlanken drahtigen Typus, während der Erzeuger eine stattliche Korpulenz aufwies. Das blasse kantige Gesicht des Sohnes bildete einen Kontrast zu dem pechschwarzen Haar. Er wirkte auf die Umgebung verschlagen, schwierig zu durchschauen, weil er häufig den Blick senkte.
Das Wohnzimmer ähnelte dem der Knesebecks, ohne dass Achim die Mittel besaß, Wolfgangs Kunstgeschmack Gleichwertiges entgegenzusetzen. Das Prunkstück des Raumes bildete ein mannshoher Zentaur aus edlem Meissner Porzellan. Rochus spielte das Klavierkonzert Nr. 2 in f-Moll, das Chopin für die Gräfin Delfina Potocka komponiert hatte. Achim unterbrach das Spiel rüde, die Stimmung in dem Wohnzimmer kippte von einer Sekunde zur anderen.
„Statt deine Zeit mit dem weinerlichen Geklimper zu verschwenden, solltest du besser an einer Reserveübung teilnehmen.“ Empört vergaß Rochus die Zucht, die Achim von Malotki ihm eingebläut hatte.