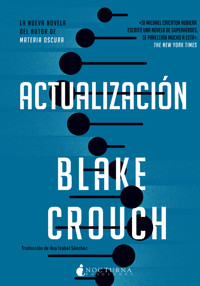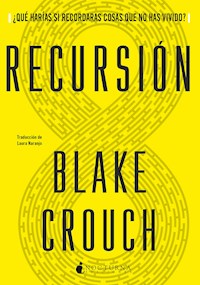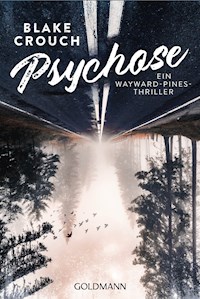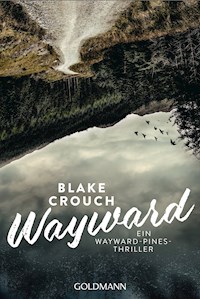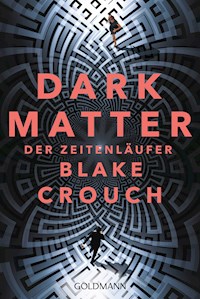13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Amerika in der nahen Zukunft: Special Agent Logan Ramsay kommt bei einem Einsatz mit einer unbekannten Substanz in Berührung. Zunächst ohne Folgen, wie Logan erleichtert feststellt. Doch dann beginnt er Veränderungen an sich zu bemerken: Seine Sinne sind geschärfter, sein Erinnerungsvermögen unschlagbar, er ist körperlich fitter. Dass ausgerechnet er dieses »Upgrade« erfährt, hat einen Grund, der weit in die Vergangenheit zurückreicht. Zu einem schrecklichen Familiengeheimnis, das Logan am liebsten vergessen würde. Doch damit nicht genug: Was mit Logan passiert, ist nur der erste Schritt eines perfiden Plans, um die Menschheit zu einer besseren zu machen – auch wenn das bedeutet, dass neunzig Prozent der Weltbevölkerung dabei sterben werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
DASBUCH
Amerika in der nahen Zukunft: Seit einerdurch genmanipulierte Heuschrecken ausgelösten, globalen Hungersnot steht jede Form der DNS-Manipulation unter schwererStrafe. Die Gene Protection Agency ist dafür zuständig, abtrünnige Wissenschaftler aufzuspüren, und Logan Ramsay ist einer ihrer besten Agenten.
Doch dann kommt Logan eines Tages bei einem Routineeinsatz mit einer mysteriösen Substanz in Berührung und mit einem Mal ist alles anders: Er entwickelt schier übermenschliche Kräfte, sein IQ schießt in schwindelerregende Höhen und seine Sinne sind so geschärft wie nie zuvor. Schnell gerät er in Verdacht, die Veränderungen an seinem Genom selbst vorgenommen zu haben, und muss fliehen. Auf der Flucht quer durch die USA findet er heraus, dass sein »Upgrade« Teil eines weltumspannenden Plans ist, der die Menschheit für immer verändern wird. Ein Plan, der seinen Ursprung in Logans eigener Vergangenheit hat …
»UPGRADE ist Blake Crouchs bester Roman!«
PUBLISHERSWEEKLY
»Actiongeladen, moralisch komplex und überraschend emotional!«
KIRKUSREVIEWS
DERAUTOR
BLAKECROUCH hat sich bereits als erfolgreicher Autor von Kurzgeschichten und Spannungsromanen einen Namen gemacht. Seine WAYWARDPINES-Trilogie wurde zudem mit verschiedenen Hollywoodstars als TV-Serie verfilmt. Der große internationale Durchbruch gelang ihm mit dem Roman DARKMATTER – DERZEITENLÄUFER, der auf Anhieb zum Bestseller und in zahlreiche Länder verkauft wurde. Blake Crouch feierte seither mit jedem seiner Romane internationale Erfolge. Sein jüngstes Werk UPGRADE stand auf der Bestsellerliste der New York Times. Blake Crouch lebt mit seiner Familie in Colorado.
BLAKE CROUCH
UPGRADE
Roman
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Urban Hofstetter
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
Titel der Originalausgabe UPGRADE
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 05/2023
Redaktion: Sven-Eric Wehmeyer
Copyright © 2022 by Blake Crouch
Copyright © 2023 der deutschsprachigen Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Das Illustrat GbR, München
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-30090-6V001
www.diezukunft.de
Für Michael McLachlan – Marine, Anwalt, teurer Freund (1946 – 2021)
ERSTER TEIL
»Man kann die Kernspaltung beenden. Man kann aufhören, zum Mond zu fliegen. Man kann auf den Einsatz von Aerosolen verzichten. Man kann sogar davon absehen, ganze Bevölkerungen mit Bomben zu töten. Man kann jedoch keine neu geschaffene Lebensform zurücknehmen.«
Erwin Chargaff
1
Wir fanden Henrik Soren dreißig Minuten vor seinem Hyperjet-Flug nach Tokio in einer Weinbar im internationalen Terminal.
Vor dieser Nacht hatte ich ihn nur auf Fotografien von Interpol und CCTV-Aufnahmen gesehen. In natura wirkte er nicht sehr beeindruckend. In seinen künstlich zerschlissenen Turnschuhen von Saint Laurent war er knapp einen Meter siebzig groß. Er trug einen Designerhoodie, der den Großteil seines Gesichts verdeckte, und saß mit einem Buch und einer Flasche Krug am Ende der Theke.
Ich nahm den Barhocker neben ihm und legte meine Dienstmarke zwischen uns. Sie zeigte einen Weißkopfseeadler, dessen Schwingen von einer DNS-Doppelhelix umwickelt waren. Eine ganze Weile geschah nichts. Ich war nicht sicher, ob er die Marke unter den kugelförmigen Hängelampen hatte funkeln sehen. Schließlich wandte er doch noch den Kopf und sah mich an.
Ich schenkte ihm ein Lächeln.
Er schlug das Buch zu. Falls er nervös war, zeigte er es nicht. Stattdessen blickte er mich unverwandt mit seinen skandinavischen blauen Augen an.
»Hallo, Henrik«, sagte ich. »Ich bin Agent Ramsay. Ich arbeite für die GPA.«
»Was wirft man mir vor?«
Er war vor dreiunddreißig Jahren in Oslo zur Welt gekommen, aber – wie man seinem Englisch noch immer anhörte – in London, wo seine Mutter als Diplomatin gearbeitet hatte, zur Schule gegangen.
»Wieso unterhalten wir uns nicht irgendwo anders weiter?«
Der Barkeeper, der meine Marke bemerkt hatte, beobachtete uns. Wahrscheinlich machte er sich Sorgen wegen der Getränkerechnung.
»Ich muss in Kürze zum Boarding«, sagte Soren.
»Heute Nacht fliegen Sie nicht mehr nach Tokio.«
Seine Kiefermuskeln verspannten sich. Er strich sich die kinnlangen blonden Haare hinter die Ohren und sah sich in der Bar um. Dann blickte er durch das Fenster zu den Fluggästen, die das Terminal durchquerten.
»Sehen Sie die Frau auf dem Hocker hinter uns?«, fragte ich. »Die mit den langen blonden Haaren und der marineblauen Windjacke. Das ist meine Partnerin, Agent Nettmann. Die Ausgänge werden von der Flughafenpolizei bewacht. Ich kann Sie hier rausschleifen, oder Sie kommen freiwillig mit. Es liegt ganz an Ihnen, aber Sie müssen sich jetzt entscheiden.«
Ich glaubte nicht, dass er davonlaufen würde. Soren wusste mit Sicherheit, wie schwer es war, sich auf einem Flughafen voller Sicherheitsleute und Überwachungskameras der Verhaftung zu entziehen. Doch verzweifelte Leute neigen zu Kurzschlusshandlungen.
Er sah sich noch einmal um und dann wieder zu mir. Seufzend trank er seinen Champagner aus und hob seine Tasche vom Boden auf.
Wir fuhren auf der I-70, die um diese Uhrzeit so gut wie leer war, in die Stadt zurück. Nadine Nettmann saß am Steuer des umgebauten Dienst-Edison.
Soren hatten wir die Hände mit Kabelbindern hinter dem Rücken gefesselt und ihn nach rechts hinten gesetzt. Ich hatte sein Handgepäck – eine Umhängetasche von Gucci – inspiziert, doch das einzig Interessante darin war ein Laptop, den wir nur mit einem Durchsuchungsbefehl hätten filzen dürfen.
»Sie sind Logan Ramsay, stimmt’s?«, fragte Soren. Es waren seine ersten Worte, seit wir ihn aus dem Flughafen abgeführt hatten.
»Richtig.«
»Der Sohn von Miriam Ramsay?«
»Ja«, antwortete ich so sachlich wie möglich. Soren war nicht der erste Verdächtige, der diese Verbindung herstellte. Ich sah aus dem Fenster und spürte, dass Nadine mich von der Seite ansah.
Wir erreichten mit hundertneunzig Kilometern pro Stunde den Rand des Stadtzentrums. Die beiden Elektromotoren liefen fast vollkommen lautlos. Durch die NightShade-Fensterscheiben sah ich eine Plakatwand der GPA vorbeizischen. Sie war Teil der jüngsten öffentlichen Aufklärungskampagne.
In großen schwarzen Lettern stand auf weißem Hintergrund:
Genom-Editierung ist ein Kapitalverbrechen
#GPA
Die Innenstadt von Denver kam in Sicht.
Der gigantische Half-Mile Tower ragte wie eine Lichtsäule in den Himmel.
Hier war es ein Uhr morgens und damit drei Uhr in D. C.
Ich dachte an meine Frau Beth und unsere Tochter Ava, die friedlich in unserem Haus in Arlington schliefen.
Wenn in dieser Nacht alles glattging, würde ich am nächsten Abend zum Essen zu Hause sein. Wir hatten vor, am Wochenende ins Shenandoah Valley zu fahren und vom Skyline Drive aus das bunte Herbstlaub zu bewundern.
Wir kamen an einer weiteren Plakattafel vorbei:
Ein einziger Fehler führte zur Großen Hungersnot
#GPA#Niemalsvergessen
Ich hatte es schon einmal gesehen, dennoch zuckte ich bei seinem Anblick zusammen.
Ich versuchte nicht, meine Schuldgefühle zu verdrängen, sondern wartete ab, bis sie von selbst wieder vergingen.
Die hiesige Außenstelle der Gene Protection Agency war in einem unscheinbaren Gewerbegebiet in Lakewood untergebracht. Man konnte sie kaum als echte Dienststelle bezeichnen.
Sie befand sich auf einem einzelnen Stockwerk in einem Gebäude mit nur geringem Admin-Support und verfügte über eine Arrestzelle, einen Verhörraum, ein molekularbiologisches Labor und eine Waffenkammer. Die GPA unterhielt nur in wenigen Großstädten Dienststellen. Da Denver das Hyperloop-Drehkreuz des Westens war, ergab es jedoch Sinn, dort eine Operationsbasis zu betreiben.
Wir waren eine junge Agency und hatten keine vierzigtausend Angestellten wie das FBI, sondern lediglich fünfhundert. Doch wir wuchsen rasch. Es gab nur fünfzig Special Agents wie Nadine und mich. Wir waren in der Gegend um D. C. stationiert und wurden überall dort eingesetzt, wo unsere Aufklärungsabteilung ein illegales Genlabor vermutete.
Nadine fuhr zur Rückseite des niedrigen Gebäudes und durch den Lieferanteneingang zu den Aufzügen. Sie parkte hinter einem Panzerfahrzeug, dort hatten vier Bio-SWAT-Officer ihre Ausrüstung auf dem Betonboden ausgebreitet und checkten ein letztes Mal ihre Waffen. Mit den Informationen, die wir hoffentlich von Soren bekommen würden, wollten wir noch vor dem Morgengrauen zu einer Razzia aufbrechen.
Ich half unserem Verdächtigen aus dem Fahrzeug, und wir fuhren zu dritt mit dem Aufzug in den zweiten Stock hinauf.
Im Verhörraum schnitt ich die Kabelbinder durch und setzte Soren an einen Metalltisch, auf dem für widerspenstige Verdächtige ein Haltebolzen festgeschweißt war.
Nadine ging Kaffee holen.
Ich setzte mich Soren gegenüber.
»Sollten Sie mir nicht meine Rechte vorlesen?«, fragte er.
»Das Genschutz-Gesetz erlaubt es uns, Sie ohne Angabe von Gründen zweiundsiebzig Stunden lang festzuhalten.«
»Faschisten.«
Ich zuckte die Achseln. Er hatte nicht unrecht.
Ich legte sein Buch auf den Tisch und beobachtete, wie er darauf reagierte. »Sind Sie ein großer Camus-Fan?«
»Ja, ich sammle seltene Ausgaben seiner Werke.«
Es handelte sich um ein altes Hardcover von Der Fremde. Ich blätterte es vorsichtig durch.
»Es ist sauber«, sagte Soren.
Ich suchte nach steifen Seiten, die womöglich mal nass geworden waren, sowie winzig kleinen kreisrunden Flecken. In einem normalen Buch konnte man riesige Mengen DNS oder Plasmide verstecken. Dazu musste man sie nur in einem Mikroliter Flüssigkeit auf das Papier aufbringen und eintrocknen lassen. Wenn man sie später verwenden wollte, rehydrierte man sie einfach wieder. Selbst ein dünner Roman wie Der Fremde konnte eine schier endlose Menge an genetischen Informationen enthalten. Gut möglich, dass sich auf jeder Seite die Genomsequenzen von Säugetieren, schrecklichen Krankheiten oder künstlichen Spezies befanden, die nur darauf warteten, in einem gut ausgestatteten illegalen Genlabor aktiviert zu werden.
»Wir werden jede einzelne Seite mit Schwarzlicht beleuchten«, sagte ich.
»Nur zu.«
»Wir lassen auch Ihr Gepäck herbringen. Ihnen ist natürlich klar, dass wir es auseinandernehmen werden.«
»Tun Sie, was Sie nicht lassen können.«
»Ist es Ihnen egal, weil Sie Ihre Ware bereits abgeliefert haben?«
Soren schwieg.
»Was war es?«, fragte ich. »Modifizierte Embryonen?«
Er sah mich mit unverhohlenem Abscheu an. »Ist Ihnen eigentlich klar, wie viele Flüge ich wegen Aktionen wie dieser bereits verpasst habe? Weil irgendein FBI-Mann am Gate aufgetaucht ist und mich zum Verhör geschleppt hat? Das europäische Amt für Gensicherheit hat mich bereits durch die Mangel gedreht. Die Brasilianer ebenfalls. Und jetzt durchkreuzt ihr Arschlöcher meine Reisepläne. Dabei hat man mich nie eines Verbrechens angeklagt.«
»Das stimmt nicht ganz«, sagte ich. »Soweit ich weiß, würden sich die chinesischen Behörden sehr gern mit Ihnen unterhalten.«
Soren verfiel in tiefes Schweigen.
Hinter mir ging die Tür auf, und der säuerlich-verbrannte Geruch von altem Kaffee stieg mir in die Nase. Nadine trat mit dem Absatz die Tür hinter sich zu. Sie nahm neben mir Platz und stellte zwei Becher auf den Tisch. Soren griff nach einem, doch sie stieß seine Hand beiseite.
»Nur die Guten bekommen Kaffee.«
Die schwarze Flüssigkeit schmeckte ungefähr so appetitlich wie Satans Pisse, aber es war spät und ich würde in naher Zukunft keinen Schlaf finden. Also nippte ich mit verkniffenem Gesicht am Becher.
»Ich will nicht lange drumherum reden«, sagte ich. »Wir wissen, dass Sie gestern mit einem gemieteten Lexus-Z-SUV in die Stadt gefahren sind.«
Soren neigte unwillkürlich den Kopf, hielt aber weiterhin den Mund.
Ich beugte mich zu ihm vor. »Die GPA hat uneingeschränkten Zugriff auf die Gesichtserkennungs-KI des Justizministeriums. Sie durchforstet sämtliche CCTV-Aufnahmen und sonstige Überwachungsdaten. An der Abfahrt der I-25 an der Alameda Avenue hat gestern um 9:17 Uhr vormittags eine Kamera Ihr Gesicht durch die Windschutzscheibe erfasst. Wir sind deswegen heute von D. C. hergeflogen. Wo kamen Sie her?«
»Sie wissen sicher bereits, dass ich dieses Auto in Albuquerque gemietet habe.«
Er hatte recht, das wussten wir.
»Was haben Sie dort gemacht?«, fragte Nadine.
»Ich wollte mir die Stadt ansehen.«
Nadine verdrehte die Augen. »Niemand will sich Albuquerque ansehen.«
Ich zog einen Stift und einen Notizblock aus der Tasche und legte beides auf den Tisch. »Schreiben Sie Name und Adresse von jedem auf, den Sie dort getroffen haben. Sowie jeden Ort, an dem Sie waren.«
Soren lächelte bloß.
»Was machen Sie in Denver, Henrik?«, fragte Nadine.
»Ich fliege von hier nach Tokio. Oder besser gesagt: Ich versuche, von hier nach Tokio zu fliegen.«
»Wir haben Gerüchte über ein Genlabor in Denver gehört«, sagte ich. »Ein technisch exzellent ausgestatteter Laden, in dem Erpresser-Bioware hergestellt werden soll. Ich glaube nicht, dass Sie sich rein zufällig ausgerechnet jetzt in der Stadt aufhalten.«
»Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen.«
»Jeder weiß, dass Sie mit hochwertigem Genmaterial handeln. Gen-Netzwerke und -Sequenzen. Scythe.«
Scythe war das revolutionäre und mittlerweile illegale biologische DNS-Bearbeitungssystem, auf das meine Mutter, Miriam Ramsay, das Patent gehalten hatte. Es war ein technologischer Quantensprung gewesen und hatte die früheren Methoden – ZFNs, TALENs und CRISPR-Cas9 – weit in den Schatten gestellt. Scythe hatte eine neue und letzten Endes katastrophale Ära der Gen-Manipulation und -Verteilung eingeleitet. Heutzutage wanderte man automatisch für dreißig Jahre ins Gefängnis, wenn man es verkaufte oder selbst damit eine Keimbahn veränderte, um einen neuen Organismus zu erschaffen.
»Ich glaube, ich würde jetzt gern meinen Anwalt anrufen«, sagte Soren. »Dieses Recht habe ich in Amerika doch noch, oder?«
Damit hatten wir gerechnet. Ehrlich gesagt überraschte es mich, dass er mit dieser Forderung so lange gewartet hatte.
»Selbstverständlich können Sie Ihren Anwalt anrufen«, sagte ich. »Aber davor sollten Sie sich klarmachen, wie es dann weitergeht.«
»Wir werden Sie an die chinesische Genbehörde ausliefern«, erläuterte Nadine.
»Amerika hat kein Auslieferungsabkommen mit China«, sagte Soren.
Nadine beugte sich auf die Ellbogen gestützt vor. Der Dampf aus ihrem Kaffeebecher stieg ihr ins Gesicht. »Für Sie machen wir eine Ausnahme. Während wir hier sprechen, werden bereits die nötigen Dokumente ausgestellt.«
»Die haben nichts gegen mich in der Hand.«
»Ich glaube, dort drüben versteht man unter einem fairen Verfahren nicht das Gleiche wie hier«, erwiderte sie.
»Sie wissen doch, dass ich nicht nur die norwegische, sondern auch die amerikanische Staatsbürgerschaft besitze.«
»Das ist mir egal«, sagte ich und sah Nadine an. »Juckt dich das?«
Sie tat, als dächte sie darüber nach. »Nein.«
Tatsächlich war es mir nicht egal. Einen amerikanischen Staatsbürger hätten wir niemals an China ausgeliefert, doch Bluffen gehörte beim Umgang mit Kriminellen nun mal zum Handwerk.
Soren ließ sich an die Stuhllehne zurücksinken. »Können wir ein hypothetisches Gespräch führen?«
»Wir lieben hypothetische Gespräche«, sagte ich.
»Was wäre, wenn ich auf diesen Notizblock eine Adresse schreiben würde?«
»Was für eine Adresse?«
»Von einem Haus, an das heute Morgen eventuell eine hypothetische Lieferung gegangen ist.«
»Was wurde geliefert? Hypothetisch gesprochen?«
»Biomining-Bakterien.«
Nadine und ich wechselten einen Blick.
»Haben Sie die beim Labor abgeliefert?«, fragte ich. »Oder irgendwo anders?«
»Ich habe sie nirgends abgeliefert«, entgegnete er. »Das ist alles rein hypothetisch.«
»Natürlich.«
»Aber wenn ich es getan hätte und Ihnen die Adresse verriete … Was würde dann passieren?«
»Kommt darauf an, was wir rein hypothetisch an diesem Ort vorfinden würden.«
»Wenn Sie dort hypothetisch dieses Genlabor fänden, von dem Sie gehört haben, was würde dann aus mir?«
»In dem Fall säßen Sie im nächsten Flugzeug nach Tokio«, sagte Nadine.
»Und was ist mit der chinesischen Genbehörde?«
»Wir haben, wie Sie schon sagten, kein Auslieferungsabkommen mit China.«
Soren zog den Stift und den Block zu sich heran.
Wir folgten dem unbeleuchteten SWAT-Einsatzfahrzeug durch die verlassenen Straßen. Die Adresse, die Soren uns gegeben hatte, befand sich am Rand von Five Points, einem gentrifizierten Viertel, in dem zu dieser späten Stunde nur noch ein paar Marihuana-Bars geöffnet hatten.
Ich machte das Seitenfenster auf.
Die Oktoberbrise, die mir ins Gesicht blies, war erfrischender als der Kaffee, den wir in der Dienststelle getrunken hatten.
In den Rockies war es Spätherbst.
Die Luft roch nach totem Laub und überreifen Früchten.
Über der gezackten Skyline des Vorgebirges hing ein riesiger gelber Vollmond.
Die höchsten Gipfel hätten mittlerweile schneebedeckt sein müssen, doch über der Baumgrenze war nur nacktes Felsgestein zu sehen.
Wieder einmal wurde mir bewusst, in was für einer eigenartigen Zeit wir lebten. Das Gefühl, dass alles den Bach runterging, war fast mit Händen zu greifen.
Allein in Afrika lebten vier Milliarden Menschen, von denen die meisten kaum etwas zu essen hatten. Selbst hier in Amerika kämpften wir noch immer mit Lebensmittelknappheit, Lieferkettenengpässen und einem angespannten Arbeitsmarkt. Nachdem der Preis für Fleisch durch die Decke gegangen war, hatten die meisten Restaurants nach der Großen Hungersnot gar nicht erst wiedereröffnet.
Wir lebten in einem rigiden Überwachungsstaat und beschäftigten uns mehr mit Displays und Bildschirmen als mit unseren Liebsten. Die Algorithmen kannten uns besser als wir uns selbst.
Jahr für Jahr gingen aufgrund von Automatisierungsprozessen und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz immer mehr Jobs verloren.
Teile von New York City und fast ganz Miami waren von Wasser überflutet. Und im Indischen Ozean schwamm ein Plastikteppich von der Größe Islands.
Doch nicht nur die Menschen waren von den Umwälzungen betroffen. Die nördlichen Breitmaulnashörner und die südchinesischen Tiger waren ebenso ausgestorben wie Rotwölfe und zahllose weitere Tierarten.
Im Glacier National Park gab es keine Gletscher mehr.
Wir hatten vieles richtig gemacht.
Und zu vieles falsch.
Mittlerweile war die Zukunft, von der alle gesprochen hatten, angebrochen, und jetzt hatten wir den Salat.
»Ist mit dir alles in Ordnung?«, fragte Nadine.
»Mir geht’s gut.«
»Ich kann seitlich ranfahren, wenn du …«
»Noch nicht.«
Nadine und ich waren seit fast drei Jahren ein Team. Vor der GPA hatte sie als Umweltwissenschaftlerin für die UNESCO gearbeitet.
Ich zog mein Handy hervor und öffnete meinen Nachrichtenverlauf mit Beth. Hallo, Beth. Bin zu einer Razzia unterwegs. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dich liebe. Umarme Ava fest von mir. Ich melde mich morgen früh.
Als ich den Text abschickte, knackte unser Funkgerät.
»In drei Minuten sind wir da«, sagte Officer Hart, der Leiter des SWAT-Teams.
Ich bekam ein flaues Gefühl im Magen, ausgelöst vom Adrenalinschub, der mich auf das Kommende vorbereitete.
Manche Menschen waren für solche Situationen geschaffen. Sie hatten Spaß daran, mitten in der Nacht in einem Schutzanzug in ein Lagerhaus zu stürmen und nicht zu wissen, was für ein Unheil sie dort erwartete.
Ich gehörte nicht zu dieser Sorte. Ich war Wissenschaftler – oder hatte zumindest mal davon geträumt, einer zu werden.
»Halt an«, sagte ich.
Nadine fuhr den Edison sofort an den Randstein. Die automatische Steuerung protestierte und piepte.
Ich warf die Tür auf, beugte mich hinaus und kotzte auf die Straße.
Erneut knackte das Funkgerät. »Alles okay bei Ihnen da hinten?«, fragte Hart. »Wir haben Sie verloren.«
Ich wischte mir über den Mund, spuckte noch ein paarmal aus und zog die Tür wieder herunter.
Nadine schwieg. Es gab nichts zu sagen. Dass sie seitlich ranfuhr und ich mir die Seele aus dem Leib reiherte, war so etwas wie unser gemeinsames Ritual vor jeder Razzia.
Nachdem das erledigt war, konnten wir uns jetzt an die Arbeit machen.
Nadine trat das Fahrpedal durch, und wir rasten hinter dem SWAT-Fahrzeug her.
Ich hasste diese Razzien und musste mich jedes Mal daran erinnern, dass meine Angst ein notwendiger Teil meiner Buße war.
Die meisten illegal tätigen Wissenschaftler, die wir aufs Korn nahmen, waren schlichte Verbrecher. Der Schwarzmarkt für Synbio-Produkte boomte seit Jahren. Man konnte sich dumm und dämlich verdienen mit maßgeschneiderten Haustieren, Kleidung aus Spinnenfäden, exotischen Gen-Nahrungsmitteln und einer vollkommen neuen, in einem Labor in Vancouver erfundenen Lebensform, die wie ein winziger pinker Gorilla aussah und unter russischen Oligarchen als Statussymbol galt.
Auch herkömmliche Schwarzmarktdienstleistungen und -produkte waren verbessert worden, zum Bespiel genetisch gehackte Drogen wie Cannabis und Heroin oder in synthetische menschliche Haut gehüllte Sexpuppen.
Ein illegales, von den Federales ausgehobenes Genlabor in Mexico City hatte für die Kartelle »Rachewespen« konstruiert. Diese schwarzgelb gestreiften Tierchen konnten jede beliebige Person an ihrem genetischen Fingerabdruck erkennen und gezielt attackieren. Außerdem trugen sie ein primitives Scythe-System in sich, das ganze Gen-Netzwerke modifizieren konnte, was bei den Opfern zu Gehirnschäden, Wahnsinn und einem qualvollen Tod führte.
Andere pfuschten bloß mit Genen herum, um zu beweisen, dass sie dazu in der Lage waren. Wie die vier Biologiestudenten von der Brown, die versucht hatten, einen urzeitlichen Wolf wiederaufleben zu lassen.
Für wieder andere war es eine sehr ernste Angelegenheit – wie zum Beispiel für die sozial ausgegrenzte, aber brillante Sechzehnjährige, die ein gegen Antibiotika resistentes fleischfressendes Bakterium züchten wollte, um damit einen brutalen Schlägertypen an ihrer Schule zu infizieren.
Oder der skrupellose Genetiker, den wir erwischten, als er mit entkernten Schwarzmarkt-Zygoten eine verbesserte Version seiner toten Frau herzustellen versuchte.
Und natürlich die verzweifelten Eltern, die keine Krankenversicherung hatten und die Anlagen für Muskelatrophie aus der DNS ihres Sohnes herausschneiden wollten. Sie hatten es tatsächlich geschafft, ihn zu heilen, doch die unbeabsichtigten Mutationen, die mit dieser Therapie einhergingen, veränderten das mediale Frontallappennetzwerk des Jungen. Er wurde psychotisch, brachte sie um und beging anschließend Selbstmord.
Außerdem gab es da noch die absoluten Albtraumlabore, in denen Terrororganisationen Krankheitserreger und andere zur Massenvernichtung geeignete Lebensformen züchteten. So wie die Gruppierung in Paris, die kurz davor gewesen war, einen synthetisch verstärkten Pockenerreger auf die Welt loszulassen, als das europäische Amt für Gensicherheit eine Aerosolbombe auf ihr Lagerhaus abwarf.
Dass ich solche Vorhaben auffliegen ließ, bereitete mir kein schlechtes Gewissen.
Was mich dagegen schmerzte, waren die Razzien bei echten Wissenschaftlern – Leuten, die bahnbrechende Arbeit für die gesamte Menschheit geleistet hatten, als die Regierungen in aller Welt plötzlich in Panik gerieten und weitere Forschungen verhinderten.
Leute wie Anthony Romero.
Manchmal dachte ich noch an ihn. Er hatte sein Labor in Wyoming auf einer Ranch im Bighorn National Forest unweit von Sheridan betrieben.
Bevor das Genschutz-Gesetz sämtliche privaten und universitären genetischen Forschungen faktisch unterband, war Dr. Romero einer der führenden Köpfe auf dem Gebiet der genetischen Krebstherapie gewesen. Gerüchteweise hatte er den Nobelpreis für Medizin oder Physiologie schon so gut wie in der Tasche gehabt. Doch dann hatte die New York Times seinen Gastbeitrag veröffentlicht, in dem er sich über das seiner Ansicht nach viel zu weit gefasste Genschutz-Gesetz beschwert hatte. Danach war er kurzerhand von der Liste staatlich anerkannter Genetiker gestrichen worden.
Wir hatten Dr. Romero um halb drei in der Nacht festgenommen. Ich wusste noch, dass der Schnee sanft auf die Gelb-Kiefern vor seiner Hütte gefallen war. Ich hatte mich schlecht gefühlt, als wir ihn in Handschellen auf die Rückbank unseres Wagens verfrachteten. Nicht nur, weil ich einen meiner Helden verhaftete, dessen Leben und Karriere ich schon immer bewundert hatte, sondern auch, weil ich wusste, dass unser Justizministerium mit der vollen Härte des Gesetzes gegen ihn vorgehen würde und ihm eine lebenslange Haftstrafe drohte.
Andererseits hatte er ein Verbrechen begangen, oder etwa nicht?
Als wir Dr. Romero am Sheridan County Airport den U. S. Marshals übergaben, hatte er etwas zu mir gesagt, das ich mein Lebtag nicht vergessen werde: »Ich weiß, dass Sie das Richtige zu tun versuchen, aber Sie können dieses Wissen nicht mehr aus der Welt schaffen.«
Ich sah zu, wie die Marshals ihn im Schneetreiben zum Flugzeug führten, und fühlte mich hundeelend.
Wie ein Verräter an der Zukunft.
Das SWAT-Fahrzeug bog in eine Gasse und hielt an. Nadine blieb dahinter stehen.
Ich betrachtete durch das graugrüne NightShade-Glas unsere Umgebung. Anstelle der Fabrikgebäude, mit denen ich eigentlich gerechnet hatte, sah ich windschiefe Zäune und Garagen, die sich an die Rückseiten viktorianischer Häuser schmiegten. Ihre steilen Dächer zeichneten sich deutlich vor dem Sternenhimmel ab.
»Das ist eine Wohngegend«, sagte ich.
»Ja, komisch, oder?«
Wir hatten bereits einige Labore durchsucht, die in Kellern oder Garagen von Wohnhäusern untergebracht gewesen waren. Die relativ simple Technologie machte es möglich. Doch bei unserer heutigen Razzia war ich von einem großen und komplexen Unternehmen ausgegangen, das sich in einer Lagerhalle und nicht in einem viktorianischen Haus in einem historischen Viertel befand. Schließlich hatte Henrik Soren es beliefert.
Ich übertrug unseren Funkverkehr von der Kommunikationseinheit in der Mittelkonsole in unsere Ohrhörer. »Logan hier. Sind wir ganz sicher an der richtigen Adresse?«
»Es ist auf jeden Fall die, die Ihr Informant aufgeschrieben hat.«
»Welches Haus ist es?«
»Das mit der Kuppel. Wir starten jetzt die Drohne. Halten Sie sich in Bereitschaft.«
Durch die Windschutzscheibe sah ich die vier SWAT-Officer aussteigen. Einer von ihnen bereitete die Wärmebild-Drohne vor. Sie würde das Areal um den Zielort abfliegen und nach Wärmesignaturen suchen, damit wir eine Vorstellung davon bekamen, wie viele Personen sich im Gebäude aufhielten.
Die SWAT-Leute würden zuerst hineingehen, Nadine und ich die Nachhut bilden. Sobald das Labor einigermaßen gesichert war, würden sie weiterhin die Umgebung überwachen, während Nadine und ich die Ausrüstung begutachteten und herauszufinden versuchten, was genau diese kriminellen Wissenschaftler geplant hatten.
Ich befestigte die Magnetstreifen auf meiner induktiven Schutzweste und nahm meine Waffe aus der Transporttasche. Es war eine mit 45er-Kaliber-Munition geladene G47. Nach mehreren Razzien in Lagerhäusern ohne ordentliche Stromversorgung hatte ich an der Glock eine Klemme für Taschenlampen angebracht.
Nadine befestigte unterdessen ein Trommelmagazin an ihrer Lieblingswaffe. Hin und wieder machte ich mich darüber lustig, dass sie trotz der üblichen SWAT-Unterstützung stets ein Atchisson-Sturmgewehr zu unseren Einsätzen mitbrachte, doch ihre Motivation dafür war nachvollziehbar. Bevor wir zusammenarbeiteten, war sie einmal in Spokane im Staat Washington in eine üble Klemme geraten. Sie hatte ein komplettes Magazin 40er-Kaliber-Patronen auf einen Wissenschaftler abgefeuert. Er hatte eine Vielzahl seiner eigenen Gene in den SKI-, PGC-1-α – und IGF-1-Pfaden manipuliert, was zu einer massiven Hypertrophie seiner Skelettmuskulatur geführt hatte. Der Mann, der ihrer Schilderung nach wie der Kingpin aus den Spider-Man-Comics aussah, hatte sie fast totgeprügelt, ehe er endlich verblutete.
Nadine hatte recht: Auf der ganzen Welt existierte kein Tier, das nicht mit zwanzig 12er-Kaliber-Geschossen aus einem Vollautomatikgewehr zu Fall gebracht werden könnte.
In meinem Ohrhörer erklang Officer Harts Stimme: »Wir finden auf diesem Anwesen keine Wärmesignaturen.«
»Verstanden.«
Es war also niemand zu Hause. So war es uns am liebsten. Damit konnten wir das leere Labor ungestört auf den Kopf stellen und anschließend auf die Ankunft der Wissenschaftler warten. Es war viel einfacher, sie auf der Straße unschädlich zu machen, statt in einem Raum voller explosiver Chemikalien und gefährlicher Biosubstanzen.
Ich checkte die Zeit: 2:35 Uhr morgens.
Bis zum Sonnenaufgang blieben uns noch gute drei Stunden.
Ich sah zu Nadine hinüber. »Wollen wir?« Die Luft war so kalt, dass mein Atem Wölkchen bildete.
Wir nahmen unsere Nachttarnschutzanzüge aus dem Kofferraum und halfen uns gegenseitig, sie anzulegen. Sie verfügten über ein in sich geschlossenes Atemgerät und ein speziell angefertigtes Visier mit vergrößertem Blickfeld für Gefechtssituationen.
Schließlich öffneten wir die Lufttanks und schlossen uns der SWAT-Kolonne an.
»Nachtsicht oder Taschenlampen?«, fragte Hart.
»Taschenlampen«, erwiderte ich. Wegen des aufsteigenden Vollmonds war das Umgebungslicht zu stark für Nachtsicht. Schon bald würde er durch die Fenster ins Haus scheinen.
Der Zaun war zu hoch, um dahinter etwas erkennen zu können. Das Gartentor war unversperrt.
Der Rasen war schon seit Ewigkeiten nicht mehr gegossen oder anderweitig gepflegt worden.
Die Grashalme standen hüfthoch.
Ich sah zu den Fenstern des Hauses hinauf. Sie waren allesamt dunkel. In einigen fehlten die Scheiben.
Wir betraten die Veranda. Die durchhängenden Dielen knarzten unter unseren Stiefeln.
Officer Hart kniete sich vor die Hintertür und knackte innerhalb von zehn Sekunden das Schloss.
Wir folgten ihm und seinem Trupp in die Dunkelheit.
Die Scheinwerfer an ihren Sturmgewehren glitten durch eine nicht fertig aufgebaute Küche.
Wir gingen ins Esszimmer. Die Wände bestanden lediglich aus Stützstreben, überall lagen Stromkabel und Werkzeuge herum.
»Das sieht nach Renovierungsarbeiten aus«, flüsterte ich über den offenen Kanal.
»Warten Sie hier«, sagte Officer Hart.
Nadine und ich standen auf dem Estrich eines Raums, bei dem es sich vermutlich um das Wohnzimmer handelte.
Trotz meines Anzugs konnte ich Sägespäne und Bauschaum riechen.
Durch die vorderen Fenster fiel Mondlicht.
Allmählich gewöhnten sich meine Augen an die Lichtverhältnisse.
Ich hörte die Stiefelschritte des SWAT-Teams, das sich über mir systematisch von Raum zu Raum bewegte.
»Irgendwas gefunden?«, fragte ich.
»Negativ«, antwortete Hart. »Hier oben sieht es genauso aus wie unten. Das Haus ist komplett auseinandergebaut worden.«
Nadine sah mich an. »Glaubst du, Soren hat uns reingelegt?«
»Wieso sollte er das tun? Er sitzt noch immer in Haft und weiß, dass er erst freigelassen wird, wenn wir es sagen.«
Ich bemerkte eine Tür unter der Treppe. Sie war mit einem Zahlenschloss gesichert. Ich zog daran, doch es gab nicht nach.
»Mach mal Platz«, sagte Nadine.
Ich drehte mich um und sah, dass sie einen Ziegelstein in der Hand hielt.
Als ich zur Seite trat, drosch sie ihn auf das Schloss.
Der Metallbügel zerbrach, und das Schloss knallte auf den Boden.
»Das waren wir«, teilte ich dem Team mit. »Wir haben gerade ein Türschloss zerschmettert.«
»Wir kommen zu Ihnen zurück«, sagte Hart. »Hier oben ist komplett tote Hose.«
Ich stieß die Tür auf.
Die rostigen Scharniere gaben ein schrilles Quietschen von sich.
Ich zielte mit der Glock in die Finsternis. Der Scheinwerfer beleuchtete eine alte Treppe, die in einen Keller hinabführte.
Mein Herz raste. »Wollen wir auf die SWAT-Leute warten?«
»Da unten ist niemand«, antwortete Nadine. »Ich sehe keine Wärmesignaturen.«
Die erste Stufe ächzte unter meinem Gewicht.
Mit jedem Schritt in die Tiefe wurde es kälter.
Der Geruch von Moder und nassen Steinen drang durch die Luftfilter meines Anzugs.
»Im Erdgeschoss ist nichts«, meldete sich ein anderer SWAT-Officer über den allgemeinen Kanal.
Als ich den unteren Treppenabsatz erreichte und auf den schmutzigen Boden trat, beschlich mich das ungute Gefühl, dass Nadine recht haben könnte: Vielleicht hatte Soren uns wirklich reingelegt. Auch wenn ich mir keinen Grund dafür vorstellen konnte.
»Soren hat uns erzählt, dass er das Paket einem Mann an der Vordertür ausgehändigt hat«, sagte Nadine. »Er hat das Haus nicht betreten.«
»Was willst du damit sagen?«
»Vielleicht verwenden sie diesen Ort nur als Lieferadresse.«
»Das würde mehr Sinn ergeben, als in einer ruhigen Wohngegend ein voll ausgestattetes Labor zu betreiben«, erwiderte ich und fragte mich, ob wir mit diesem Einsatz nur unsere Zeit verschwendet hatten.
Wir konnten Soren zwar zweiundsiebzig Stunden lang festhalten und ihm noch ein bisschen Angst einjagen. Aber wir hatten nichts gegen ihn in der Hand. Sein Gepäck war sauber.
Ich drehte mich mit vorgehaltener Pistole langsam im Kreis.
Die Ränder meines Visiers beschlugen von meinem Atem.
Die Wände waren die ursprünglichen Steinfundamente des Hauses.
Ich sah einen rostigen Boiler.
Staubige Möbel.
Und einen alten Waschtisch, auf dem ein eigenartiger schwarzer Würfel mit einer Kantenlänge von ungefähr dreißig Zentimetern stand.
»Logan«, sagte Nadine in eindringlichem Ton.
Ich drehte mich zu ihr um.
»Da drüben.«
Ich folgte mit dem Lichtstrahl ihrem Finger und sah eine Kamera auf einem Dreibeinstativ.
Sie war auf uns gerichtet.
Ein rotes Licht blinkte.
»Sie hat gerade mit der Aufnahme begonnen«, sagte ich.
In diesem Moment kam das SWAT-Team die Treppe runter.
Ich ließ den Lichtstrahl ein weiteres Mal langsam durch den Keller gleiten.
Nun machte ich mir keine Sorgen mehr, wir könnten umsonst hergekommen sein.
In der Mitte des Raums streifte mein Licht den Würfel, den ich eben entdeckt hatte.
Er war dabei, sich zu öffnen.
»Nadine«, sagte ich.
»Ich sehe es.«
Als die Seiten des Würfels abfielen, durchdrang mein Licht eine Kugel, die aus Eis zu bestehen schien. Sie war ungefähr so groß wie eine Bowlingkugel. Dem vielen Dampf nach zu urteilen, der von ihr aufstieg, war sie entweder extrem kalt oder das Eis bestand aus etwas anderem als H2O.
»Da drüben ist noch so eine«, sagte Nadine.
Ich drehte mich um und sah, dass sie mit ihrer Lampe eine identische Eissphäre unter der Kellertreppe beleuchtete.
»Was zum Teufel ist das?«, fragte sie.
Ich sah sie an. »Die Vibes hier unten gefallen mir ganz und …«
Ein Summen unterbrach mich. Es kam aus dem Spülbecken.
Ich ging darauf zu, sah, was in dem Becken vibrierte, und geriet in Panik.
Neben der Eiskugel lag ein Handy, auf dessen Display ein Anruf angezeigt wurde. Aus dem Handy ragten zwei Drähte, einer verschwand in einem Loch im Tisch, der andere unter dem Eis.
In beiden Kugeln leuchteten blaue Lichter auf.
»Alle sofort raus hier!«, schrie ich.
Die SWAT-Officer waren bereits halb die Treppe hinauf.
Nadine lief hastig hinter ihnen her.
Ich sah, wie alle im Erdgeschoss verschwanden. Ich selbst war noch mehrere Sekunden vom unteren Treppenabsatz entfernt, als es im Keller plötzlich komplett weiß wurde.
Ich spürte einen immensen Druck auf der Brust.
Im nächsten Augenblick lag ich auf dem Rücken und starrte zur freigelegten Isolierung unter der Decke hinauf.
Das Visier meiner Haube war an mehreren Stellen gesplittert und zerkratzt. Zahlreiche durchsichtige Fragmente steckten darin. Ich begriff nicht, worum es sich dabei handelte, bis von einem der Granatsplitter ein eiskalter Wassertropfen in mein linkes Auge fiel.
Ich schaffte es, meine Pistole zu heben und das Licht auf meinen Anzug zu richten. Er war zerrissen und mit Löchern übersät.
Meine Panik kehrte zurück.
Und mit ihr kamen die Schmerzen.
Meine Arme und Beine – sämtliche ungeschützten Hautpartien – begannen mit einem Mal zu brennen, als hätten mich tausend Insekten gestochen.
2
Als ich Atem holte, durchzuckte ein quälender Schmerz meine Brust.
Ich hörte mich selbst stöhnen und öffnete die Augen.
Ich lag in einem Krankenhausbett.
Auf einem Tisch neben mir piepte in regelmäßigen Abständen ein Überwachungsmonitor. An meinem dick bandagierten linken Arm war eine Infusionsnadel befestigt, durch die eine Flüssigkeit aus einem durchsichtigen Beutel in meinen Körper rann. Mein anderer Arm und die Beine waren mit Mull verbunden. Noch verstörender war die dunkle Plastiktrennwand, die mich und das Bett komplett umschloss. Dahinter konnte ich nur Umrisse und vage Schemen ausmachen. Die Stimmen, die ich hörte, klangen entfernt und gedämpft.
Ich wusste nicht, ob es an den Schmerzmitteln oder meinen Verletzungen lag, aber es kostete mich große Mühe, mich an meinen letzten wachen Moment zu erinnern.
Ich hatte auf dem schmutzigen Kellerboden des viktorianischen Hauses in Denver gelegen. Es hatte eine Explosion gegeben. Ich hatte aufstehen wollen, war aber von den Schmerzen in meiner Brust wie gelähmt gewesen.
Also war ich in der Dunkelheit liegen geblieben und hatte mich gewundert, wohin mein Team verschwunden war.
Ich hatte mich gefragt, ob ich sterben würde.
Da mein Zeitgefühl getrübt gewesen war, wusste ich nicht, wie viel Zeit vergangen war, als endlich schwere Schritte die Kellertreppe herabdonnerten. Ein Trupp Mediziner in Schutzanzügen hatte mich umstellt. Als sie bemerkt hatten, wie sehr ich litt, hatte einer von ihnen mir gnädigerweise irgendeine wunderschöne Droge verabreicht.
Ich war selig auf einem finsteren Meer davongesegelt.
Bis ich an diesem Ort wieder zu mir gekommen war.
»Hallo, Logan. Wie fühlen Sie sich?«
Die auffällig tiefe Frauenstimme kam aus einem kleinen Lautsprecher auf dem Nachtkästchen.
»Atmen tut weh«, entgegnete ich. »Extrem.«
»Wo würden Sie Ihre Schmerzen auf einer Skala von eins bis zehn verorten?«
»Sieben. Vielleicht acht.«
»Zu Ihrer Rechten befindet sich ein Stab mit einem dunkelroten Knopf am oberen Ende. Wenn Sie ein paarmal darauf drücken, wird Ihnen Morphium injiziert.«
Ich streckte die Hand danach aus, hielt dann aber inne. Ich hatte schon einmal Morphium bekommen. Das war nach einer fehlgeschlagenen Razzia im Inland Empire gewesen, bei der mein erster Partner umgekommen war und ich einen Bauchschuss abbekommen hatte. Ich liebte Morphium. Aber es entspannte mich so sehr, dass ich selbst den einfachsten Gesprächen kaum folgen konnte. Und in diesem Moment benötigte ich ein paar Antworten.
»Wo bin ich?«, fragte ich.
»Im Denver Health Medical Center. Mein Name ist Dr. Singh, ich bin Intensivmedizinerin.«
Ich machte einen weiteren schmerzhaften Atemzug.
»Bin ich auf der Intensivstation?«
»Ja.«
Wow. Angesichts der neuen Viren und der Mutationen bekannter Krankheiten, die ständig den Erdball umkreisten, waren Intensivbetten ein äußerst rares Gut. Entweder hatte die GPA Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um mir eins zu besorgen, oder es ging mir richtig schlecht.
»Sterbe ich?«
»Nein, Ihre Vitalwerte sehen mittlerweile wieder gut aus.«
»Wozu die Plastikwand?«
»Wissen Sie noch, was gestern Nacht passiert ist?«
»Ich habe an einer Razzia teilgenommen. Etwas ist explodiert.«
»In dem Keller ist ein kontaminierter Sprengkörper detoniert. Es kann sein, dass Sie etwas abbekommen haben.«
Eine lähmende Angst befiel mich. »Was zum Beispiel?«, fragte ich.
»Ein Pathogen oder ein Toxin.«
»Und, ist es so?«
»Das wissen wir noch nicht. Wir führen verschiedene Tests durch. Allem Anschein nach sind Sie aber nicht vergiftet worden. Ihre Organe funktionieren ausnahmslos gut.«
»Was ist mit den anderen, die mich begleitet haben? Meine Partnerin, Nadine. Das SWAT-Team.«
»Sie befinden sich zur Sicherheit auch hier in Quarantäne. Sie waren allerdings nicht im Keller, als das Gerät explodiert ist. Ihre Anzüge wurden nicht beschädigt.«
Ich rutschte unbehaglich auf dem Bett herum.
Die Schmerzen nahmen zu, und der Lockruf des roten Knopfs wurde immer lauter.
»Was für Verletzungen habe ich?«, fragte ich.
»Zwei gebrochene Rippen, drei weitere sind angeknackst. Ihr linker Lungenflügel ist kollabiert, aber das haben wir wieder hinbekommen. Und Ihre Arme und Beine sind mit Schnittwunden von den Eissplittern übersät.«
»War die Explosion so schlimm?«
»Da Sie sich in einem geschlossenen Raum befunden haben, hat der Druckunterschied zwischen Ihren mit Luft gefüllten Organen und der Detonationswelle ein paar Schäden angerichtet. Zum Glück aber keine lebensbedrohlichen. Davon werden Sie sich wieder komplett erholen.«
Mittlerweile lenkten mich die Schmerzen mindestens genauso sehr ab, wie das Morphium es tun würde.
Ich drückte mehrfach den roten Knopf und fühlte mich sofort erleichtert.
Schwerelos und warm.
»Ich sehe, dass Sie die Morphium-Pumpe aktiviert haben. Versuchen Sie, ein wenig zu schlafen, Logan. Ich sehe in ein paar Stunden wieder nach Ihnen.«
Ich wachte erneut auf.
Diesmal fühlte ich mich anders.
Etwas stimmte nicht.
Von meiner Brust gingen noch immer Schmerzwellen aus, doch nun tat mir auch der restliche Körper weh, und mir war unsagbar heiß. Das Laken und die Bettdecke waren voller Schweiß. Er rann mir in die Augen. Außerdem keuchte ich.
Mein Überwachungsmonitor piepte zu schnell.
Jemand stand neben dem Bett und injizierte den Inhalt einer Spritze in meinen Infusionsschlauch.
»Was ist los?«, fragte ich.
Meine Stimme klang schlaftrunken, die Worte waren verwaschen.
Die Ärztin oder Krankenschwester blickte durch das Visier eines Schutzanzugs auf mich herab. Ich versuchte, an ihrem Blick abzulesen, wie ernst die Lage war, doch es gelang mir nicht.
Ihre Stimme drang aus einem Lautsprecher im Visier. Sie klang nach der Ärztin, mit der ich zuvor gesprochen hatte. Ich konnte mich nicht mehr an ihren Namen erinnern.
»Sie haben sehr hohes Fieber, Logan. Wir versuchen, Ihre Temperatur zu senken.«
»Wie hoch?«
»Zu hoch.«
Ich murmelte etwas, das ich nicht einmal selbst verstand.
Die Reißverschlusstür in der Plastiktrennwand wurde geöffnet, und eine weitere Medizinerin im Schutzanzug betrat meine Blase. »Ich habe die Kühlbeutel, Dr. Singh.«
»Danke, Jessica.« Dr. Singh legte die Spritze weg und schlug meine Bettdecke zurück. Meine Verbände und das Krankenhaushemd waren komplett durchgeschwitzt.
Singh hob vorsichtig meinen Kopf vom Kissen, damit Jessica mir eine kalte Kompresse um den Hals wickeln konnte.
Ich versuchte zu fragen, ob ich sterben würde, doch anstelle von Worten brachte ich nur schillernde Farben heraus. Ich sah tatsächlich bunte Feuerwerksexplosionen aus meinem Mund dringen.
Schwitzend und stöhnend durchlitt ich in einer Dauerschleife bizarre und verstörende Fieberträume, wie ich sie noch nie erlebt hatte.
Als ich das nächste Mal erwachte, war mein Fieber abgeklungen.
Meine Brust tat noch immer weh, aber nicht mehr so schlimm wie zuvor.
Ich befand mich allein in meiner Blase. »Hallo, Logan. Wie fühlen Sie sich?«, drang Dr. Singhs Stimme aus dem Lautsprecher.
»Besser.«
»Sie haben uns Sorgen gemacht. Ihre Temperatur hat zeitweise die 41-Grad-Marke geknackt.«
»Ich hatte nicht die Absicht, irgendwelche Rekorde zu brechen.«
»Derart hohes Fieber sehen wir nicht gern. Bei solchen Temperaturen kann es zu Organschäden und tödlichen Krampfanfällen kommen.«
»Was hat es ausgelöst?«, fragte ich.
»Das untersuchen wir noch, aber nichts deutet auf eine bakterielle Ursache oder eine Infektion hin. Im Moment gehen wir von einem Virus aus.«
Verdammt. Irgendwelche Spinner, die sich an der GPA rächen wollten, hatten uns eine Falle gestellt. Sie hatten das Ganze sogar auf Video aufgenommen.
Noch schlimmer als die Vorstellung, dass sich ein synthetischer Erreger einen Weg durch meine Organe brannte, war der andere Grund, aus dem man solche Viren konstruierte: Sie waren das perfekte Instrument, um fremde genetische Informationen in einen Körper einzubringen und seine DNS umzuschreiben.
Die Vorstellung, ein DNS-Modifikator wie Scythe könnte meinen Gen-Code revidieren und mich in meinem Wesenskern verändern, erschreckte mich mehr als alles andere.
»Hier ist jemand, der Ihnen Hallo sagen möchte.«
Eine neue Stimme kam aus dem Lautsprecher: »Logan?«
Ich lächelte so breit, dass meine trockenen Mundwinkel aufplatzten. »Beth?«
»Ich bin hier im Nebenraum.«
Es klang, als würde sie weinen.
Mir kamen ebenfalls die Tränen.
»Wann bist du nach Denver gekommen?«, fragte ich.
»Gestern. Als Ava und ich hörten, was passiert ist, sind wir sofort hergefahren.«
»Ava ist auch hier?«
»Hallo, Dad.«
»Oh mein Gott. Hallo, Süße. Wie schön, deine Stimme zu hören.«
»Geht mir genauso.«
»Was haben sie euch erzählt?«, fragte ich.
»Nicht viel. Edwin sagte, ein Labor, in das du eingedrungen bist, sei explodiert. Und die Ärzte haben uns gesagt, dass du dabei mit etwas kontaminiert worden sein könntest und deswegen in Quarantäne bist.«
»Das mit unserem Wochenende tut mir leid. Eigentlich wären wir jetzt alle in Shenandoah.«
»Das holen wir nach, sobald du hier raus bist«, antwortete Ava.
»Du lässt aber nicht die Schule schleifen, oder, Schatz?«
»Nein.«
»Ich will nicht, dass du ins Hintertreffen gerätst. Dass ich fast in die Luft gesprengt worden bin, zählt nicht als Ausrede.«
»Ich finde, dass das eine großartige Ausrede ist. Aber ich habe meinen Laptop mitgenommen und im Wartezimmer gearbeitet.«
»Okay«, sagte Beth. »Sie geben uns gerade zu verstehen, dass du dich ausruhen musst.«
»Werdet ihr in der Nähe bleiben?«
»Wir gehen nirgendwohin.«
In dieser Nacht flammte mein Fieber ein weiteres Mal auf.
Ich versuchte zu schlafen, wurde aber erneut von wilden Träumen heimgesucht. Ich befand mich in meinem Körper und sah zu, wie das Virus in meine Zellen eindrang. Dann wurde ich selbst zum Virus, löste mich und meine genetischen Befehle auf und übernahm meine DNS, um mehr von meiner Sorte herzustellen. Weitere Viruspartikel.
Wieder und wieder und …
Als ich erwachte, war ich völlig verwirrt.
Schwestern in Schutzanzügen wickelten mir Kühlkompressen um den Hals und schütteten Eis auf meine Brust.
Ich stöhnte und murmelte Unsinn.
»Ich bin das Virus«, stammelte ich. »Ich bin das Virus.«
»Sechshundert Milligramm Interferon«, verlangte Dr. Singh.
Ich blickte zu ihrem Visier hoch. »Ich kann es in meinen Zellen fühlen.« Dr. Singh ignorierte mich und sah eine der Schwestern an. »Mehr Eis. Schnell.«
In meinem Plastikkönigreich begann es zu regnen. Doch so ein Unwetter hatte ich noch nie erlebt.
Die einzelnen Regentropfen waren Leuchtbuchstaben.
A
G A
C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G
T C
T
Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin: die vier chemischen Basen, aus denen die Desoxyribonukleinsäure besteht.
DNS.
Die Luft war mit Nukleinbasen gefüllt.
Sie wurden zur Seite geweht.
Bildeten Wirbel.
Rannen an den Plastiktrennwänden herab.
Endlose, mysteriöse Permutationen der Blaupause, auf denen jedes irdische Leben basierte.
Ich spürte, wie die Buchstaben auf mein Gesicht prasselten.
Ich atmete sie ein.
Einen Strom aus Bio-Code, der sich ständig veränderte und mutierte.
Mein Kopf brannte.
Ach, könnte ich den Code doch nur entschlüsseln, dachte ich. Dann würde ich vielleicht verstehen, was das Virus mit mir anstellte.
Als ich das nächste Mal zu mir kam, saß jemand in einem Schutzanzug neben mir. Meine Rippen fühlten sich besser an und das Fieber war abgeflaut, aber ich war schrecklich müde.
Die Person im Schutzanzug wandte sich mir zu.
Ich blickte in das Gesicht meines Chefs – Edwin Rogers, der Leiter der Gene Protection Agency. Ich war froh, ihn zu sehen. Ich hatte mich gleich nach meiner Entlassung aus dem Gefängnis bei der GPA beworben und nicht geglaubt, dass sie mich ernst nehmen würden. Doch Edwin Rogers hatte persönlich das Vorstellungsgespräch mit mir geführt und mich trotz meiner zahlreichen Verurteilungen und meiner fehlenden Erfahrung im Polizeidienst vom Fleck weg engagiert. Allein deswegen konnte er sich meiner ewigen Loyalität gewiss sein.
»Na, sieh mal an, wer da aus seiner Ohnmacht erwacht«, sagte Edwin.
»Hallo«, erwiderte ich matt. »Wo ist Nadine?«
»Sie ist noch immer in Quarantäne, hat aber keinerlei Symptome und wird voraussichtlich in ein oder zwei Tagen entlassen werden. Sie waren der Einzige, den es erwischt hat.«
»Und wissen wir schon, was ›es‹ gewesen sein könnte?«
Edwin räusperte sich. »Ihnen ist sicher bereits bewusst, dass Sie in eine Falle getappt sind. Wir halten Henrik Soren nach wie vor fest und werden ihn wegen versuchten Mordes anklagen.«
»Was sagt er zu der ganzen Sache?«, fragte ich.
»Er tut, als wüsste er von nichts, und schwört, er habe lediglich am Donnerstagvormittag an der Haustür einem Mann eine Lieferung übergeben.«
»Hat er einen Namen genannt?«
»Er hat uns nur eine grobe Beschreibung und einen Darknet-Link gegeben, der …«
»… nirgendwohin führt«, sagte ich und versuchte, trotz meiner kaum zu ertragenden Rippenschmerzen, mich aufzusetzen. Edwin schob mir die Kissen in den Rücken. »Haben Sie sich den Keller angeschaut?«
»Ja. Wir haben die Rückstände von zwei Eisbomben gefunden. Das war der mit Abstand merkwürdigste Sprengsatz, den ich je zu Gesicht bekommen habe.«
»Bestanden die Kugeln aus H2O oder …?«
»Aus zu unglaublich hartem Eis gepresstem H2O. Die Explosion hat sie in Schrapnells verwandelt. Sie haben Ihren Anzug durchdrungen. Und Sie.«
»Konnten Sie etwas von dem Schmelzwasser oder Eisfragmente bergen?«
»Ja. Und wir sind gerade mit der Sequenzierung einer Probe fertig geworden. Diese Kugeln enthielten ein tiefgefrorenes Virus.«
Plötzlich war ich hellwach.
»Ziemlich genial gemacht«, fuhr er fort. »Die Splitter sind durch oberflächliche Schnitte in Ihren Körper eingedrungen und geschmolzen, ohne bleibende Schäden zu verursachen.«
»Oh Gott.«
Er legte mir eine behandschuhte Hand auf die Schulter. »Bevor Sie ausflippen: Es ist kein Virus aus der Filoviridae-Familie. Um Ebola oder Marburg handelt es sich auch nicht. Genauso wenig um die Pocken. Vieles weist darauf hin, dass es aus der Orthomyxoviridae-Familie stammt.«
»Grippe?«
»Ja.«
»Wurde es künstlich erzeugt?«
»Davon gehen wir aus.«
Und dann stellte ich die Frage, vor deren Antwort ich mich am meisten fürchtete: »Enthielt es einen Scythe-Code?«
Er nickte.
Verdammt. Ich war nicht nur mit einem Virus unbekannter Herkunft, sondern auch noch mit einer Ladung des mächtigsten genverändernden Systems aller Zeiten infiziert worden. Höchstwahrscheinlich war es nicht dazu gedacht, mich krank zu machen, sondern sollte die Zellen meines Körpers befallen und Teile meiner DNS umschreiben.
»Wissen Sie, auf welche Gene es abzielt?«
»Noch nicht, aber wir analysieren eine Probe Ihrer weißen Blutkörperchen.«
Ich versuchte, mich zu beruhigen, schaffte es aber nicht. Das waren die schlimmstmöglichen Neuigkeiten.
Edwin langte durch den Rausfallschutz meines Bettes und klopfte mir auf die Schulter. »Ich wollte es Ihnen persönlich mitteilen. Wir werden denjenigen finden, der dafür verantwortlich ist, und ihm die Hölle heißmachen. Sie müssen sich jetzt nur darauf konzentrieren, wieder gesund zu werden.«
»Ich werde es versuchen, Sir.«
Er wollte mich trösten, doch den Schuldigen zu fassen würde nicht helfen, wenn sich diese Genveränderungen als tödlich erwiesen. Ein Scythe-System konnte alle möglichen Verwüstungen in meinem Genom anrichten.
Würde man den genetischen Code einer Person in ein Buch schreiben, wäre dieses Werk zwanzig Stockwerke hoch und würde drei Milliarden Permutationen der Buchstaben A, C, G und T enthalten – die für die vier Nukleinbasen Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin standen. Die spezifische Anordnung dieser vier Basen erzeugt den Code für sämtliche biologische Lebensformen auf dem Planeten. Dieser Code heißt Genotyp. Seine jeweilige körperliche Ausprägung (zum Beispiel die Augenfarbe) bezeichnet man als Phänotyp. Wir wissen noch immer nicht viel darüber, welcher Genotyp welchen Phänotyp hervorbringt.
Edwin erhob sich von seinem Stuhl, öffnete die Reißverschlusstür und trat hinaus.
Während ich zusah, wie er mich wieder in meinem Universum aus Plastik einschloss, fühlte ich mich vollkommen allein.
Es erinnerte mich an meine Zeit im Gefängnis.
Die anderen kamen und gingen, wie es ihnen beliebte, doch ich blieb in meiner Zelle eingeschlossen.
Zusammen mit meinem mutierenden Genom.
Sie behandelten mich mit Interferon Gamma und mehreren neuen virenhemmenden Medikamenten.
In der folgenden Nacht bekam ich noch einmal hohes Fieber. Danach besserte sich mein Zustand rasch. Ich war wieder voller Energie, mein Appetit kehrte zurück, und ich konnte bis zum Morgen durchschlafen.
Nach drei Tagen wurden mir die Verbände abgenommen. Die Schnittwunden waren verkrustet.
Die Rippen taten mir noch immer weh, aber ich wollte unbedingt aus dem Bett aufstehen und auf dem Korridor der Intensivstation auf und ab gehen.
Ich sehnte mich nach einer echten Toilette anstelle der demütigenden Bettpfanne.
Doch sie ließen mich nicht aus meiner Blase.
Da sie so gut wie nichts über den veränderten Grippevirenstamm wussten, mit dem ich infiziert war, wollte Dr. Singh kein Risiko eingehen. Ich zeigte zwar keine Symptome, schied das Virus aber noch immer aus und war somit potenziell ansteckend.
Also verbrachte ich die Tage damit, Filme auf meinem Tablet zu streamen und – wenn es meine Konzentration erlaubte – etwas zu lesen. Meist grübelte ich jedoch fieberhaft darüber nach, was Scythe gerade in mir anrichten mochte.
Die Krankenhausleitung hatte sich geweigert, meine Frau und meine Tochter mit Schutzanzügen zu mir zu lassen, nach einer Woche im Bett bestand ich jedoch darauf, sie sehen zu dürfen.
Meine vierzehn Jahre alte Tochter durchquerte in kompletter Schutzkleidung, in der sie fast zu verschwinden schien, die Plastiktrennwand. Sie trug einen Stoffbeutel über der Schulter.
Ich lachte, als ich sie sah – zum ersten Mal, seit ich fünf Tage zuvor in der Intensivstation erwacht war. Wegen meiner gebrochenen Rippen verwandelte sich meine Freude jedoch sofort in Schmerz.
»Hallo, Dad«, drang Avas Stimme aus dem Anzuglautsprecher. Sie beugte sich über das Bett und umarmte mich ungeschickt. Ich presste das Gesicht an ihr Visier. Trotz der Latexhandschuhe und des Tyvek-Anzugs brachte mich die Berührung eines Menschen, den ich liebte und der mich liebte, zum Weinen.
»Ist alles in Ordnung mit dir, Dad?«
»Es geht mir gut.« Ich wischte mir über die Augen.
Sie zog einen Stuhl heran und holte ein Schachbrett aus dem Stoffbeutel.
»Willst du eine Partie spielen?«
»Unbedingt! Ich habe es satt, immer nur Displays anzustarren.«
Ich setzte mich stöhnend auf und versuchte, die Kissen in meinem Rücken zurechtzurücken. Ava klappte derweil das Schachbrett auf, legte es auf das Bett und stellte die Figuren auf.
Es rührte mich, dass Ava in den Anzug gestiegen war, um Zeit mit mir in meiner Isolation zu verbringen. Für Neulinge konnten sich die Schutzanzüge klaustrophobisch anfühlen. Sie waren heiß und sperrig, und sobald man die Haube aufsetzte, juckte es einen unweigerlich im Gesicht. Das weitaus Schlimmste war aber natürlich die Angst vor einem Leck in der Versiegelung.
Sie streckte mir beide Fäuste hin, und ich tippte auf die rechte. Als sie die Finger öffnete, kam ein weißer Bauer zum Vorschein.
Ich würde den ersten Zug machen.
Ava war fünf gewesen, als ich ihr das Schachspielen beibrachte. Sie hatte von Anfang an gemocht, wie sich die Figuren auf dem Brett bewegten, und schnell begriffen, dass man eine Strategie brauchte, um zu gewinnen.
Seither versuchten wir, jeden Tag eine Partie zu spielen. Am liebsten auf dem schmiedeeisernen Gartentisch und bei schlechtem Wetter vor dem Kaminfeuer.
Mit zehn war sie eine hervorragende Spielerin gewesen.
Mit zwölf mir ebenbürtig.
Mit dreizehn hatte sie mich mit ihrem großen Repertoire an Eröffnungszügen und ihrem starken Endspiel bereits überflügelt. Mittlerweile konnte ich sie nur noch schlagen, wenn ich mir keinen einzigen Fehler erlaubte und Ava mindestens einmal die Konzentration verlor. Doch beides zusammen kam selten vor.
Manchmal fragte ich mich, ob sie die Intelligenz meiner Mutter geerbt hatte.
Ich machte meinen Eröffnungszug.
»Ähem, Dad«, sagte sie, während sie im Gegenzug ihren Damenspringer auf f6 schob. »Nur zur Erinnerung: Wir stehen bei fünfhunderteinundsechzig.«
Ich verdrehte die Augen.
Sie grinste mich durch ihr Visier an.
Damit wollte sie mich daran erinnern, wie viele Tage es her war, seit ich sie zum letzten Mal schachmatt gesetzt hatte.
Während der nächsten Woche spielten wir jeden Tag.
Sie gewann jedes Mal deutlich.
Beth schlüpfte ebenfalls in den Anzug und setzte sich zu mir. Ohne die Ablenkungen unseres Alltags in Virginia sprachen wir so viel miteinander wie schon seit Jahren nicht mehr.
Eines Nachmittags blickte sie durch ihre Sichtscheibe auf mich herab und nahm meine Hand in ihre, wobei eine Latexschicht unsere Haut voneinander trennte.
»Wann wird es reichen?«, fragte sie.
Sie meinte meinen Job. Darüber stritten wir oft.
»Ich weiß es nicht.«
»Du bist schon mal angeschossen worden. Und jetzt kannst du dich auch noch damit brüsten, dass du fast in die Luft gesprengt wurdest.«
»Darauf bilde ich mir nichts ein.«
»Natürlich tust du das«, erwiderte sie. »Sieh mich bitte an. Wenn ich das Gefühl hätte, dass du diesen Job magst, würde ich trotz der schrecklichen Gefahren, in die du dich ständig begibst, nichts sagen. Aber ich weiß, dass du ihn hasst. Er entspricht dir nicht. Du machst ihn nur aus Pflichtbewusstsein und Schuldgefühlen, und anfangs hat das vielleicht auch einen gewissen Sinn ergeben, aber inzwischen ist deine Begnadigung fünfzehn Jahre her. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du dir selbst vergibst und dir eine Beschäftigung suchst, die dir tatsächlich liegt.«
Was mir wirklich lag, was ich schon immer gewollt hatte, war, als Genetiker zu arbeiten. Den Quellcode des Lebens zu verstehen und zu meistern, um die Welt zu verbessern. Diesen übertriebenen Ehrgeiz hatte ich vermutlich von meiner Mutter geerbt, die eine wahre Naturgewalt gewesen war.
Doch in der Welt, in der wir inzwischen lebten, würde ich diesen Traum niemals verwirklichen können.
Und selbst wenn es erlaubt gewesen wäre, hätte ich es niemals geschafft. Denn ich besaß, auch wenn ich es mir nur äußerst ungern eingestand, nicht einmal einen Bruchteil der überragenden Intelligenz eines Anthony Romero oder einer Miriam Ramsay.
Ich war zwar überdurchschnittlich ambitioniert, aber nur mittelmäßig begabt.
Exakt zwei Wochen nach meiner Einlieferung auf die Intensivstation des Denver Health ging die Reißverschlusstür zu meiner Blase auf, und Dr. Singh trat breit lächelnd ein. Eine Kaskade aus langen dunklen Locken fiel ihr über die Schultern.
»Sie haben ja Haare«, sagte ich.
»Das stimmt. Eine ganze Menge.«
»Wo ist Ihr Anzug?«
»Den brauche ich nicht mehr.«
Sie kam zu mir und setzte sich auf den Stuhl neben meinem Bett. Sie war ein wenig jünger, als ich angesichts ihrer rauchigen Stimme angenommen hatte.
»Wir sind sicher, dass das Virus – worum auch immer es sich dabei gehandelt hat – nicht mehr aktiv ist. Sie werden noch ungefähr einen Monat lang nicht ganz auf der Höhe sein, aber wir werfen Sie jetzt raus. Ach ja, ich habe jemanden am Telefon, der Ihnen etwas mitteilen möchte.« Sie nahm ihr Handy aus der Tasche und aktivierte den Lautsprecher. »Direktor Rogers? Sie sind jetzt mit Logan verbunden.«
»Können Sie mich hören, Logan?«
»Ja, Sir.«
»Ihre Ärztin hat mich bereits über die guten Neuigkeiten informiert, und ich habe auch welche für Sie. Die Ergebnisse Ihrer DNS-Analyse sind da. Sie sind sauber.«
»Gibt es keine Veränderungen an meinem Genom?«, fragte ich.
»Wir konnten keine finden.«
Ich kämpfte mit den Tränen.
»Danke, Sir. Vielen, vielen Dank.«
»Wir sehen uns in Washington.«
Als Dr. Singh das Telefonat beendete, drängten sich Beth und Ava durch die Öffnung in der Plastiktrennwand und eilten an mein Bett. Sie kletterten auf die schmale Matratze und schmiegten sich von beiden Seiten an mich.
Ich stöhnte. »Passt auf meine Rippen auf.«
Wir alle lachten und weinten, und ich merkte, wie sehr ich diese alltäglichen Sinneseindrücke vermisst hatte. Ihren Geruch. Den ungedämpften Klang ihrer Stimmen. Das Gefühl von Haut auf Haut.
Nach der vierzehntägigen Quarantäne war das alles wie eine Einladung, wieder ins Leben zurückzukehren.
Nach Hause.
3
EINMONATSPÄTER
Die Tür zum Badezimmer ging knarzend auf, und Beth spähte herein.
»Was machst du da?«, fragte sie mit verschlafenem Blick.