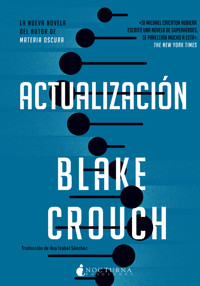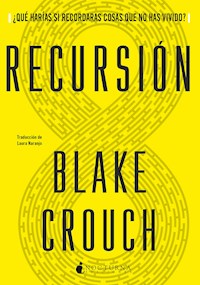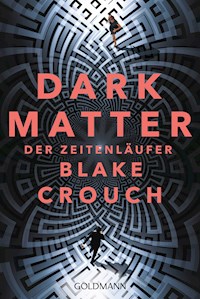
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Bist du glücklich?“ Das sind die letzten Worte, die Jason Dessen hört, bevor ihn ein maskierter Mann niederschlägt. Als er wieder zu sich kommt, begrüßt ihn ein Fremder mit den Worten: „Willkommen zurück, alter Freund.“ Denn Jason ist in der Tat zurückgekehrt – doch nicht in sein eigenes Leben, sondern in eines, das es hätte sein können. Und in diesem Leben hat er seine Frau nie geheiratet, sein Sohn wurde nie geboren. Und Jason ist kein einfacher College-Professor, sondern ein gefeierter Wissenschaftler. Doch ist diese Welt real? Oder ist es die vergangene Welt? Wer ist sein geheimnisvoller Entführer? Und vor die Wahl gestellt – was will er wirklich vom Leben: Familie oder Karriere? Auf der Suche nach einer Antwort begibt Jason sich auf eine ebenso gefährliche wie atemberaubende Reise durch Zeit und Raum. Eine Reise, die ihn am Ende auch mit den dunklen Abgründen seiner eigenen Seele konfrontieren wird …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Jason Dessen wollte die Welt verändern. Der hochbegabte Physiker arbeitete an einem bahnbrechenden Projekt, das ihm die Hochachtung und den Neid vieler seiner Kollegen einbrachte, war kurz vor einem entscheidenden Durchbruch. Dann kam Daniela, und Jason verliebte sich Hals über Kopf in die junge Künstlerin. Entschied sich für sie und für eine Familie. Die Forschung musste ohne ihn auskommen, er wurde Physikdozent. Und auch wenn er eigentlich glücklich ist, wenn er seine Frau und seinen Sohn wirklich liebt – es bleibt ein letzter Zweifel. Was hätte aus ihm werden können? Hätte er wirklich die Welt verändert? Was wäre, wenn?
Als ein ehemaliger Kollege einen wichtigen Preis verliehen bekommt, beginnt Jason unwillkürlich erneut zu grübeln. Und wird jäh dabei unterbrochen: Ein maskierter Mann hält ihm eine Pistole an den Kopf, entführt ihn und injiziert ihm eine geheimnisvolle Flüssigkeit. Als Jason wieder zu sich kommt, findet er sich in einem Labor wieder, umringt von fremden Menschen in Schutzanzügen, die ihn begrüßen, als sei er ein lang verlorener Freund. Nach und nach erfährt er eine Wahrheit, die er doch nicht zu akzeptieren vermag: Er ist in einer Realität zu sich gekommen, die seiner eigenen gleicht, aber doch anders ist: Seine wichtigste Lebensentscheidung gilt hier nicht, stattdessen ist er tatsächlich ein brillanter Wissenschaftler geworden – Ruhm, Ehre und Preise wurden ihm ebenso zuteil wie die entscheidende bahnbrechende Erfindung. Doch wer hat ihn hierhergebracht? Wo ist seine geliebte Familie? Sein eigentliches Leben? Und wie soll er es jemals wiederfinden?
BLAKE CROUCH
Dark Matter
Der
Zeitenläufer
Roman
Deutsch
von Klaus Berr
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Dark Matter«
bei Crown, an imprint of the Crown Publishing Group,
a division of Penguin Random House LLC, New York.
Zitatnachweise:
„Was gewesen wäre und was gewesen ist“: aus: »Burnt Norton« (Auszug), aus: T. S. Eliot, Vier Quartette. Übertragung und Nachwort von Norbert Hummelt. © Suhrkamp Verlag Berlin 2015.
„Nichts ist da.“: aus: Mark Twain, Der Geheimnisvolle Fremde, Eine Phantasie, übertragen von Wilhelm Nobbe, Leizpig 1921.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2016 by Blake Crouch
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Regina Carstensen
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotive: Frau: Zero Creatives / Getty Images Mann: George Doyle / Getty Images Hintergrund: Shutterstock
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-17142-1V006
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für alle, die sich fragen,
wie ihr Leben am Ende
des nicht eingeschlagenen Wegs
aussehen könnte.
Was gewesen wäre und was gewesen ist
Verweisen aufs gleiche, nämlich das, was da ist.
Fußtritte klingen nach, hier im Gedächtnis
Hier diesen Weg entlang, den wir nie gingen
Zu dieser Tür, die uns verschlossen blieb
T. S. Eliot, »Burnt Norton«
EINS
Ich liebe Donnerstagabende.
Sie fühlen sich an wie aus der Zeit gefallen.
Das ist unsere Tradition, nur wir drei – Familienabend.
Mein Sohn Charlie sitzt am Tisch und zeichnet in einen Skizzenblock. Er ist knapp fünfzehn. Über den Sommer ist er fünf Zentimeter gewachsen und jetzt so groß wie ich.
Ich wende mich von den Zwiebeln ab, die ich gerade schneide, und frage: »Darf ich mal sehen?«
Er hält den Block in die Höhe, zeigt mir einen Gebirgszug, der aussieht, als gehöre er auf einen anderen Planeten.
Ich sage: »Gefällt mir. Nur zum Spaß?«
»Klassenprojekt. Muss ich morgen abgeben.«
»Dann halt dich ran, Mister ›Alles-auf-den-letzten-Drücker‹.«
Ich stehe glücklich und leicht angetrunken in der Küche. Keineswegs bin ich mir bewusst, dass dieser Abend das Ende von all dem hier ist. Das Ende von allem, was ich kenne, von allem, was ich liebe.
Niemand sagt einem, dass sich alles ändern, einem alles genommen wird. Es gibt keine Warnung, keinen Hinweis darauf, dass man bereits am Abgrund steht. Und vielleicht ist es das, was eine Tragödie so tragisch macht. Es geht dabei nicht nur um das, was passiert, sondern wie es passiert: Es ist dieser Schlag in die Magengrube, wenn man es am wenigsten erwartet. Keine Zeit, um auszuweichen oder sich wegzuducken.
Die Strahler an der Küchendecke spiegeln sich auf der Oberfläche meines Weins, und die Zwiebeln treiben mir die Tränen in die Augen. Thelonious Monk dreht sich auf dem alten Plattenspieler im Arbeitszimmer. Die analoge Aufnahme hat einen Sound, von dem ich nie genug kriege, speziell das Rauschen zwischen den Stücken. In dem Zimmer stapelt sich altes Vinyl, das ich, wie oft hatte ich es mir schon geschworen, längst einmal sortieren und in Ordnung bringen wollte.
Meine Frau Daniela sitzt an der Kücheninsel, schwenkt ihr fast leeres Weinglas in der einen Hand und hält in der anderen ihr Smartphone. Sie spürt meinen Blick und grinst, ohne vom Display hochzuschauen.
»Ich weiß«, sagt sie. »Ich verletzte die kardinale Grundregel des Familienabends.«
»Was ist denn so wichtig?«, frage ich.
Sie schaut mich mit ihren dunklen, spanischen Augen an. »Nichts.«
Ich gehe zu ihr hinüber, nehme ihr das Handy sanft aus der Hand und lege es auf die Arbeitsfläche.
»Du könntest mit der Pasta anfangen«, sage ich.
»Ich schau dir lieber beim Kochen zu.«
»Wow!« Leiser: »Macht dich das etwa an?«
»Nein, es macht mehr Spaß, einfach nur zu trinken und nichts zu tun.«
Ihr Atem ist süß vom Wein, und sie lächelt, wie nur sie es kann. Es haut mich noch immer um.
Ich leere mein Glas. »Wir sollten noch eine Flasche aufmachen, oder?«
»Es wäre dumm, es nicht zu tun.«
Während ich eine neue Flasche entkorke, nimmt sie ihr Handy und hält mir das Display entgegen. »Ich habe gerade die Besprechung von Marsha Altmans Ausstellung im Chicago Magazine gelesen.«
»War man gnädig mit ihr?«
»Ja, es ist fast eine Liebeserklärung.«
»Schön für sie.«
»Ich denke mir oft …« Sie beendet den Satz nicht, aber ich weiß, worauf sie hinauswill. Als wir uns vor fünfzehn Jahren kennenlernten, war sie ein aufgehender Stern in der Kunstszene Chicagos. Ihr Studio war in Bucktown, sie hatte schon in einem halben Dutzend Galerien ausgestellt und bereitete ihre erste Einzelausstellung in New York vor. Doch dann kam ihr das Leben dazwischen. Ich. Charlie. Eine lähmende Wochenbettdepression.
Entgleisung.
Jetzt gibt sie Schülern der Unterstufe Kunstunterricht.
»Es ist ja nicht so, dass ich mich nicht für sie freue. Ich meine, sie ist brillant, sie hat es wirklich verdient.«
Ich sage: »Falls es dich tröstet, Ryan Holder hat gerade den Pavia-Preis gewonnen.«
»Was ist das?«
»Eine fachübergreifende Auszeichnung für herausragende Leistungen in den Naturwissenschaften. Ryan hat ihn für eine seiner neurowissenschaftlichen Arbeiten bekommen.«
»Ist das eine große Sache?«
»Da geht es um Millionen Dollar. Um die Ehre. Und um die Fördergelder, denen ein solcher Preis Tür und Tor öffnet.«
»Und um die riesige Schar von attraktiven Anhängern.«
»Klar, das ist die Hauptsache. Er hat mich heute Abend zu einer kleinen, zwanglosen Feier eingeladen, aber ich habe abgesagt.«
»Warum?«
»Weil es unser Abend ist.«
»Du solltest hingehen.«
»Lieber nicht.«
Daniela hebt ihr leeres Glas. »Du willst damit also sagen, dass wir beide gute Gründe haben, heute Abend sehr viel Wein zu trinken.«
Ich küsse sie und schenke ihr großzügig aus der frisch geöffneten Flasche ein.
»Du hättest diesen Preis bekommen können.«
»Du hättest die Kunstszene dieser Stadt beherrschen können.«
»Aber wir haben das hier hervorgebracht.« Sie zeigt zur hohen Decke unseres Stadthauses. Ich hatte es von einer Erbschaft gekauft, lange bevor ich Daniela traf. »Und das hier auch«, sagt sie und deutet auf Charlie, der völlig versunken vor sich hin zeichnet. Er erinnert an Daniela, wenn sie beim Malen nichts mehr von dem wahrnimmt, was um sie herum passiert.
Es ist seltsam, Vater eines Teenagers zu sein. Einen kleinen Jungen aufzuziehen ist eine Sache – etwas ganz anderes ist es, wenn dieser sich dann an der Schwelle zum Erwachsenwerden ratsuchend an einen wendet. Manchmal beschleicht mich das Gefühl, dass ich wenig zu geben habe. Es gibt Väter, die eine ganz bestimmte Sicht auf die Welt haben, die genau wissen, was sie ihren Söhnen und Töchtern mitgeben wollen. Ich gehöre nicht dazu. Je älter ich werde, desto weniger verstehe ich diese Welt. Ich liebe meinen Sohn. Er bedeutet mir alles. Und doch werde ich das Gefühl nicht los, dass ich ihn im Stich lasse. Dass ich ihn den Wölfen zum Fraß vorwerfe mit nichts als den mickrigen Krümeln meiner unsicheren Weltsicht.
Ich gehe zum Schrank neben dem Spülbecken und suche nach der Fettuccine-Packung.
Daniela wendet sich Charlie zu: »Dein Vater hätte den Nobelpreis bekommen können.«
Ich lache. »Das ist möglicherweise etwas übertrieben.«
»Charlie, lass dich nicht täuschen. Er ist ein Genie.«
»Du bist süß«, sage ich. »Und ein bisschen betrunken.«
»Es stimmt, und das weißt du genau. Die Wissenschaft ist nicht so weit, wie sie sein könnte, weil du deine Familie liebst.«
Ich muss lächeln. Wenn Daniela trinkt, passieren drei Dinge: Ihr Akzent wird stärker, sie wird unnachgiebig wohlwollend, und sie neigt zur Übertreibung.
»Dein Vater hat mir einmal gesagt – ich werde es nie vergessen –, dass wahre Forschung das ganze Leben fordert …« Sie wirkt gerührt, was mich überrascht. Ihre Augen werden feucht, und sie schüttelt den Kopf, wie sie es immer tut, wenn sie den Tränen nahe ist. Doch dann fängt sie sich wieder und redet weiter. »Er hat gesagt: ›Daniela, auf meinem Totenbett würde ich mich lieber an dich erinnern als an ein kaltes, steriles Labor.‹«
Ich schaue zu Charlie und ertappe ihn dabei, wie er beim Zeichnen die Augen verdreht. Wahrscheinlich ist ihm diese Zurschaustellung mütterlicher Melodramatik peinlich.
Ich starre in den Küchenschrank und warte, bis ich keinen Kloß mehr in meinem Hals habe.
Als es soweit ist, nehme ich die Nudelpackung heraus und schließe die Küchenschranktür.
Daniela trinkt einen Schluck Wein.
Charlie zeichnet.
Der Augenblick vergeht.
»Wo ist Ryans Party?«
»Im Village Tap.«
»Das ist doch deine Kneipe, Jason.«
»Na und?«
Sie kommt zu mir und nimmt mir die Packung aus der Hand.
»Gönn dir einen Drink mit deinem alten College-Kumpel. Sag ihm, dass du stolz auf ihn bist. Erhobenen Hauptes. Und richte ihm meine Glückwünsche aus.«
»Deine Glückwünsche richte ich ihm nicht aus.«
»Warum nicht?«
»Er steht auf dich.«
»Hör auf.«
»Es stimmt aber. Seit Ewigkeiten. Seit wir uns ein Zimmer geteilt haben. Kannst du dich noch an die letzte Weihnachtsfeier erinnern? Er wollte dich die ganze Zeit dazu bringen, dass du dich mit ihm unter den Mistelzweig stellst.«
Sie lacht nur: »Wenn du zurückkommst, steht das Essen auf dem Tisch.«
»Das heißt, ich sollte wieder hier sein in …«
»Fünfundvierzig Minuten.«
»Was wäre ich nur ohne dich?«
Sie küsst mich.
»Darüber denken wir am besten gar nicht erst nach.«
Ich nehme Schlüssel und Brieftasche aus der Keramikschüssel neben der Mikrowelle und gehe ins Wohnzimmer, wo mein Blick auf den Tesseraktlüster über dem Esstisch fällt. Daniela hat ihn mir zum zehnten Hochzeitstag geschenkt. Das beste Geschenk, das ich je bekommen habe.
Als ich schon an der Haustür bin, ruft Daniela mir zu: »Und komm bloß nicht ohne Eiscreme zurück!«
»Minze mit Schokochips«, sagt Charlie.
Ich hebe den Arm und strecke den Daumen in die Höhe.
Ich drehe mich nicht mehr um.
Ich verabschiede mich nicht.
Auch dieser Augenblick vergeht unbemerkt.
Das Ende von allem, was ich kenne, allem, was ich liebe.
Seit zwanzig Jahren lebe ich in Logan Square, dem Viertel um den gleichnamigen Platz, und schöner als in der ersten Oktoberwoche wird’s hier nicht. Ich muss dann immer an diesen Satz von F. Scott Fitzgerald denken: »Das Leben beginnt von Neuem, wenn es im Herbst kühler wird.«
Der Abend ist frisch und der Himmel so klar, dass ich eine Handvoll Sterne sehen kann. In den Bars geht es heftiger zu als sonst, überall drängen sich enttäuschte Cubs-Fans.
Ein Schild blinkt, »Village Tap« ist auf ihm zu lesen. Im Schein des blauen Neonlichts bleibe ich stehen und schaue durch die offene Tür in eine typische Eckkneipe, wie man sie in jedem anständigen Viertel Chicagos findet. Es ist meine Stammkneipe. Ich muss nicht weit gehen – es sind nur ein paar Blocks bis nach Hause.
Ich lasse mich vom Neonlicht leiten und betrete das Lokal.
Matt, der Barmann und Besitzer, nickt mir zu, während ich mich am Tresen entlang zu der Gruppe schiebe, die Ryan Holder umringt.
Ich sage zu Ryan: »Gerade habe ich Daniela von dir erzählt.«
Er lächelt, sieht dabei aus wie aus dem Ei gepellt, perfekt für den Vorlesungszirkus – fit und gebräunt, in einem schwarzen Rollkragenpullover, die Gesichtsbehaarung fein säuberlich gestutzt.
»Verdammt, tut das gut, dich zu sehen. Ich bin ganz gerührt, dass du gekommen bist. Darling?« Er berührt die nackte Schulter einer jungen Frau auf dem Barhocker neben ihm. »Würdest du meinem lieben alten Freund für ein paar Minuten deinen Platz überlassen?«
Die Frau räumt ohne zu murren den Hocker, und ich setze mich neben Ryan.
Er ruft den Barmann. »Könntest du uns vielleicht den teuersten Whisky, den du vorrätig hast, kredenzen?«
»Ryan, das ist doch nicht nötig.«
Er packt mich am Arm. »Heute Abend trinken wir nur das Beste.«
Matt sagt: »Ich habe einen fünfundzwanzig Jahre alten Macallan.«
»Doppelte, bitte. Auf meine Rechnung.«
Als der Barmann verschwindet, boxt Ryan mich auf den Arm. Kräftig. Auf den ersten Blick würde man ihn nicht für einen Wissenschaftler halten. Er hat während des Studiums Lacrosse gespielt und verfügt noch immer über die breitschultrige Statur und geschmeidigen Bewegungen eines geborenen Sportlers.
»Wie geht’s Charlie und der wunderbaren Daniela?«
»Hervorragend.«
»Du hättest sie mitbringen sollen. Ich habe sie seit letztem Weihnachten nicht mehr gesehen.«
»Ich soll dir ihre Glückwünsche ausrichten.«
»Du hast eine tolle Frau, aber das ist ja nichts Neues.«
»Wie stehen die Chancen auf eine feste Beziehung bei dir?«
»Schlecht. Das Singleleben mit seinen beträchtlichen Vorteilen passt einfach zu gut zu mir. Bist du noch immer am Lakemont College?«
»Ja.«
»Anständige Schule. Physik fürs Hauptstudium, nicht wahr?«
»Genau.«
»Du unterrichtest also …«
»Quantenmechanik. Hauptsächlich Grundlagen. Nichts, was sonderlich sexy wäre.«
Matt kommt mit unseren Getränken, Ryan nimmt sie ihm ab und stellt mir ein Glas hin.
»Und dieses Fest …«, sage ich.
»Ist was ganz Spontanes. Ein paar meiner Doktoranden haben es auf die Beine gestellt. Lieben nichts mehr, als mich betrunken zu machen. Sie wollen sehen, wie ich dann Hof halte.«
»Ein großes Jahr für dich, Ryan. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie du fast in Differenzialrechnung durchgerasselt wärst.«
»Du hast mir den Arsch gerettet. Und zwar mehr als einmal.«
Nur eine Sekunde lang erblicke ich hinter dem gelackten Selbstbewusstsein den lebenslustigen Doktoranden, mit dem ich mir eineinhalb Jahre lang eine ziemlich schreckliche Wohnung geteilt habe.
»War der Pavia-Preis für deine Arbeit zur …«
»Identifikation des präfrontalen Cortex als Bewusstseinsgenerator.«
»Richtig. Natürlich. Ich habe deinen Aufsatz dazu gelesen.«
»Wie fandst du ihn?«
»Brillant.«
Er scheint sich aufrichtig über das Kompliment zu freuen.
»Wenn ich ehrlich bin, Jason, und das soll jetzt keine falsche Bescheidenheit sein, dachte ich immer, dass du derjenige sein würdest, der die bahnbrechenden Arbeiten veröffentlicht.«
»Wirklich?«
Er schaut mich über sein schwarzes Brillengestell hinweg an. »Selbstverständlich. Du bist viel schlauer als ich. Das weiß doch jeder.«
Ich trinke meinen Whisky und versuche mir nicht anmerken zu lassen, wie gut er ist.
Ryan sagt: »Darf ich dich mal was fragen? Betrachtest du dich heute eher als Forscher oder als Lehrer?«
»Ich …«
»Also, ich sehe mich in erster Linie als Mann, der die Antworten auf fundamentale Fragen sucht. Na ja, wenn die Leute um mich herum …« Er deutet auf die Studenten, die sich enger um ihn drängen. »… so schlau sind, dass sie mein Wissen durch die schiere Nähe zu mir absorbieren können, dann ist das klasse. Aber die traditionelle Weitergabe von Wissen interessiert mich nicht. Das einzig Wichtige ist die Wissenschaft. Die Forschung.«
Mir fällt eine gewisse Verärgerung oder sogar Wut in seiner Stimme auf, die immer stärker wird, als würde er sich in etwas hineinsteigern.
Mit einem Lächeln steure ich dagegen. »Bist du sauer auf mich, Ryan? Es klingt ja fast, als würdest du glauben, dass ich dich im Stich gelassen hätte.«
»Pass auf, ich habe am MIT, in Harvard und an der Johns Hopkins gelehrt, den besten Schulen des Planeten. Ich habe die klügsten Wichser kennengelernt, und Jason, ich sag dir, du hättest die Welt verändert, wenn du dich für diesen Weg entschieden hättest. Wenn du dabeigeblieben wärst. Stattdessen bringst du zukünftigen Ärzten und Patentanwälten physikalisches Grundwissen bei.«
»Wir können nicht alle solche Superstars sein wie du, Ryan.«
»Nicht, wenn man aufgibt.«
Ich trinke meinen Whisky aus.
»Na, da bin ich aber froh, dass ich vorbeigekommen bin.«
»Sei doch nicht so, Jason. Das sollte ein Kompliment sein.«
»Ich bin stolz auf dich, Mann. Und das meine ich ernst.«
»Jason.«
»Danke für den Whisky.«
Wieder draußen, stapfe ich den Bürgersteig entlang. Je weiter ich mich von Jason entferne, desto wütender werde ich.
Und ich bin mir nicht mal sicher, auf wen.
Mein Gesicht ist heiß. Schweiß läuft mir hinunter.
Ohne nachzudenken, trete ich blindlings bei Rot auf die Straße. Augenblicklich höre ich das Geräusch blockierender Reifen, höre Gummi, der über den Asphalt quietscht.
Ich drehe mich um und starre ungläubig ein gelbes Taxi an, das auf mich zurast.
Durch die näher kommende Windschutzscheibe kann ich den Taxifahrer deutlich erkennen – ein Mann mit Schnurrbart und vor Panik weit aufgerissenen Augen in Erwartung eines unglückseligen Zusammenstoßes.
Doch dann liegen meine Hände flach auf dem warmen Metall der Motorhaube. Der Taxifahrer lehnt sich aus dem Fenster und schreit mich an: »Du Trottel, du könntest jetzt tot sein! Mach doch die Augen auf!«
Hinter dem Taxi ertönt Hupen.
Ich begebe mich zurück auf den Bürgersteig und lasse den Verkehr an mir vorbeiziehen.
Die Insassen von drei Autos sind so freundlich, kurz abzubremsen, um mir den Stinkefinger zu zeigen.
Whole Foods riecht wie das Hippiemädchen, mit dem ich vor Daniela zusammen war – eine Mischung aus frischem Obst, gemahlenem Kaffee und ätherischen Ölen.
Der Schock mit dem Taxi hat mich schlagartig nüchtern gemacht. Wie im Nebel durchstöbere ich die Kühltruhe. Ich bin müde, träge.
Als ich vor dem Biosupermarkt stehe, fühlt sich die Luft sehr kalt an, ein steifer Wind bläst vom See her und kündigt den grässlichen Winter an, der kurz bevorsteht.
Mein Leinenbeutel ist voller Eiscreme. Ich nehme einen anderen Weg nach Hause. Er ist sechs Blocks länger als die übliche Strecke, aber was ich an Kürze verliere, gewinne ich an Einsamkeit. Und nach Ryan und dem Taxi-Vorfall brauche ich jetzt ein bisschen Zeit, um mich zu fassen.
Ich komme an einer Baustelle vorbei, die jetzt am Abend verlassen daliegt, und etwas später am Spielplatz der Grundschule, die mein Sohn früher besuchte. Die metallene Rutsche glänzt im Licht einer Straßenlaterne, die Schaukeln bewegen sich im Wind.
Diese Herbstabende berühren etwas, das tief in mir verborgen ist. Etwas aus weiter Vergangenheit. Aus meiner Kindheit im westlichen Iowa. Ich denke an Footballspiele in der Highschool, daran, wie die Flutlichtstrahler die Spieler aufleuchten ließen. Ich rieche reife Äpfel und die Säure des Biers, das wir auf Kornfeldern direkt aus dem Fass zapften. Ich spüre den Wind im Gesicht bei einer nächtlichen Fahrt über eine Landstraße auf der Ladefläche eines alten Pick-ups, im Schein der Rücklichter wirbelt rot der Staub hoch, und mein gesamtes Leben liegt noch vor mir.
Das ist das Schöne an der Jugend.
Es herrscht eine Schwerelosigkeit, die alles durchdringt, weil noch keine belastenden Entscheidungen getroffen wurden und die Straße, die sich vor einem gabelt, unbegrenzte Möglichkeiten verspricht.
Ich liebe mein Leben, aber diese Leichtigkeit des Seins habe ich schon ewig nicht mehr gespürt. Besser als an Herbstabenden wie diesem wird es nicht.
Die Kälte führt dazu, dass ich allmählich wieder einen klaren Kopf bekomme.
Ich freue mich darauf, gleich zu Hause zu sein. Soll ich vielleicht den Gaskaminofen anzünden? Vor Halloween haben wir noch nie ein Feuer gemacht, aber heute Abend ist es so ungewöhnlich kalt, dass ich nach diesem Spaziergang nichts mehr möchte, als mit Daniela und Charlie und einem Glas Wein vor dem Kamin zu sitzen.
Die Straße verläuft unter der El hindurch, der Hochbahn von Chicago. Über mir sehe ich die stark rostende Eisenkonstruktion der Brücke.
Diesen Teil der Strecke mag ich am liebsten, es ist der dunkelste und stillste.
Vor allem im Augenblick …
Keine ankommenden Züge.
In beiden Richtungen keine Scheinwerfer.
Kein hörbarer Kneipenlärm.
Nichts als das entfernte Dröhnen eines Jets am Himmel beim Landeanflug auf O’Hare.
Moment …
Da ist etwas … Schritte auf dem Bürgersteig.
Ich schaue mich um.
Ein Schatten stürzt auf mich zu, so schnell, dass ich nicht begreife, was passiert.
Das Erste, was ich sehe, ist ein Gesicht.
Bleich wie ein Geist.
Hohe, gewölbte Brauen, wie gezeichnet.
Rote, gespitzte Lippen … zu dünn, zu perfekt.
Und angsteinflößende Augen … groß und pechschwarz, ohne Pupillen oder Iris.
Das Zweite, was ich sehe, ist der Lauf einer Waffe, nur zehn Zentimeter von meiner Nase entfernt.
Die tiefe, heisere Stimme hinter der Geisha-Maske sagt: »Umdrehen.«
Ich zögere, zu benommen, um zu reagieren.
Er stößt mir die Waffe ins Gesicht.
Ich drehe mich um.
Bevor ich dem Maskierten sagen kann, dass sich meine Brieftasche in der vorderen linken Tasche befindet, blafft er los: »Ich bin nicht wegen deinem Geld hier. Geh!«
Ich gehe los.
»Schneller.«
Ich gehe schneller.
»Was willst du?«, frage ich.
»Halt den Mund.«
Über mir donnert ein Zug, und als wir aus der Dunkelheit der Brücke treten, schlägt mir das Herz bis zum Hals. Auf einmal nehme ich meine Umgebung viel deutlicher wahr. Auf der anderen Straßenseite liegt eine bewachte Wohnanlage, der Block auf meiner Seite besteht aus einer Reihe von Läden und Dienstleistungsbetrieben, die um fünf zumachen.
Ein Nagelstudio.
Eine Anwaltskanzlei.
Eine Reparaturwerkstatt für Haushaltsgeräte.
Ein Reifengeschäft.
Dieses Viertel ist eine Geisterstadt, auf der Straße nirgendwo ein Mensch.
»Siehst du diesen SUV?«, fragt der Maskierte. Am Bordstein direkt vor mir parkt ein schwarzer Lincoln Navigator. Die Alarmanlage jault. »Setz dich hinters Steuer.«
»Was immer du auch vorhast …«
»Oder willst du hier auf dem Bürgersteig verbluten?«
Ich öffne die Fahrertür und setze mich wie befohlen hinters Steuer.
»Meine Tasche mit den Einkäufen«, sage ich.
»Die nimmst du mit.« Der Mann steigt hinter mir ein. »Starte den Motor.«
Ich ziehe die Fahrertür zu und stelle den Leinenbeutel auf den Boden des Beifahrersitzes. Im Auto ist es so still, dass ich meinen Puls hören kann – ein schnelles Pochen im Ohr.
»Worauf wartest du?«, fragt er.
Ich drücke auf den Startknopf.
»Schalte das Navi ein.«
Ich habe noch nie einen Wagen mit eingebautem GPS besessen, und ich brauche einen Augenblick, um auf dem Touchscreen das richtige Symbol zu finden.
Drei Standorte werden angezeigt.
Einer davon ist mein Zuhause. Ein zweiter die Universität, in der ich arbeite.
»Hast du mich verfolgt?«, frage ich.
»Gib Pulaski Drive ein.«
Ich tippe auf 1400 Pulaski Drive, Chicago, Illinois 60616, habe allerdings keine Ahnung, wo sich die Straße überhaupt befindet. Die Frauenstimme des Navi gibt mir Anweisungen: Bitte wenden, wenn möglich, dann null Komma acht Meilen geradeaus.
Ich lege einen Gang ein und schere auf die dunkle Straße aus.
Der Mann hinter mir sagt: »Anschnallen.«
Ich lege den Gurt an, er tut dasselbe.
»Jason, nur damit das klar ist, wenn du etwas anderes tust, als genau diesen Anweisungen zu folgen, erschieße ich dich durch den Sitz. Verstehst du, was ich dir sage?«
»Ja.«
Während ich uns durch mein Viertel fahre, frage ich mich, ob ich das alles hier zum letzten Mal sehe.
An einer roten Ampel halte ich direkt vor dem Village Tap. Durch das dunkel getönte Beifahrerfenster kann ich erkennen, dass die Tür noch immer offen steht. Ich sehe Matt und in der Menge Ryan, der sich auf seinem Barhocker umgedreht hat, den Rücken an der Theke, die Ellbogen auf dem abgenutzten Holz. Im Kreise seiner Doktoranden hält er Hof. Wahrscheinlich amüsiert er alle mit einer Anekdote über das Versagen seines früheren Zimmergenossen.
Ich möchte ihm etwas zurufen. Ihm zu verstehen geben, dass ich in Schwierigkeiten stecke. Dass ich ihn brauche.
»Es ist grün, Jason.«
Ich beschleunige, während wir über die Kreuzung fahren.
Das GPS lotst uns nach Osten durch Logan Square zum Kennedy Expressway, wo mich die gleichgültige Frauenstimme anweist: In dreißig Metern rechts abbiegen, dann neunzehn Komma acht Meilen geradeaus.
Der Verkehr in südlicher Richtung ist so schwach, dass ich die Tachonadel auf siebzig Meilen hochtreibe. Meine Hände kleben am Leder des Lenkrads, und mir will die Frage nicht aus dem Kopf gehen: Werde ich heute Abend sterben?
Mir kommt der Gedanke, dass ich, sollte ich überleben, den Rest meiner Tage mit einer ganz neuen Erkenntnis verbringen werde: Wir verlassen unser Dasein auf dieselbe Art, wie wir es betreten: völlig allein, aller Dinge beraubt. Ich habe Angst, und weder Daniela noch Charlie noch sonst jemand kann etwas tun, um mir in diesem Augenblick zu helfen, in dem ich sie am nötigsten brauche. Sie wissen nicht einmal, was ich gerade durchmache.
Die Interstate führt am westlichen Rand der Innenstadt entlang. Der Willis Tower und seine Horde kleinerer Wolkenkratzer erleuchten mit beruhigender Wärme die Nacht.
Trotz Angst, ja Panik, arbeitet mein Hirn auf Hochtouren, will herausfinden, was hier eigentlich passiert.
Meine Adresse ist im Navi. Es war also keine zufällige Begegnung. Dieser Mann hat mich verfolgt. Kennt mich wahrscheinlich. Also hat womöglich etwas, das ich getan habe, hierzu geführt.
Aber was?
Ich bin nicht reich.
Mein Leben ist nichts wert – außer was es für mich bedeutet und für meine Liebsten.
Ich wurde noch nie verhaftet, habe nie ein Verbrechen begangen.
Habe nie mit der Frau eines anderen geschlafen.
Natürlich flippe ich im Straßenverkehr schon mal aus, aber so ist das eben in Chicago.
Meine erste und einzige körperliche Auseinandersetzung fand in der sechsten Klasse statt, als ich einem Klassenkameraden auf die Nase schlug, weil er mir Milch über den Rücken geschüttet hatte.
Ich habe noch nie jemandem ernsthaft Unrecht getan. Zumindest nicht so, dass ich hinter dem Steuer eines Lincoln Navigator dafür mit einer Waffe am Hinterkopf bedroht werden müsste.
Ich bin Atomphysiker und Professor an einem kleinen College.
Allen meinen Studenten, auch den schlechtesten, begegne ich ausschließlich mit Respekt. Wer in meinen Kursen durchfällt, hat versagt, weil ihm von vornherein jegliches Interesse fehlte. Von denen kann mir keiner vorwerfen, dass ich ihm das Leben ruiniert hätte. Ich tue wirklich alles, um ihnen das Weiterkommen zu ermöglichen.
Die Skyline im Seitenspiegel wird kleiner, weiter und weiter entfernt sie sich wie ein heimischer, tröstlicher Küstenstrich.
»Habe ich dir in der Vergangenheit etwas angetan?«, frage ich. »Oder jemandem, für den du arbeitest? Ich verstehe einfach nicht, was du von mir willst.«
»Je mehr du redest, desto schlimmer wird es.«
Zum ersten Mal erkenne ich etwas Vertrautes in seiner Stimme. Ich kann ums Verrecken nicht sagen, wann und wo, aber wir sind uns schon einmal begegnet. Da bin ich mir ganz sicher.
Ich spüre mein Handy vibrieren – eine SMS.
Dann noch einmal.
Und noch einmal.
Er hat vergessen, mir das Handy abzunehmen.
Ich schaue auf die Zeitanzeige: 21:05 Uhr.
Vor einer guten Stunde habe ich das Haus verlassen. Es ist mit Sicherheit Daniela, die sich fragt, wo ich bleibe. Ich bin schon fünfzehn Minuten zu spät dran, und ich verspäte mich sonst nie.
Ich schaue in den Rückspiegel, aber es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen, außer einem Bruchstück der gespenstisch weißen Maske. Ich riskiere ein Experiment. Ich nehme die linke Hand vom Steuer, lege sie in den Schoß und zähle bis zehn.
Er sagt nichts.
Ich lege die Hand erneut ans Lenkrad.
Die weibliche Computerstimme durchbricht die Stille: Nach vier Komma drei Meilen rechts in die Eighty-Seventh Street abbiegen.
Abermals entferne ich die linke Hand vom Steuer.
Diesmal stecke ich sie in die Tasche meiner Khaki-Hose. Mein Handy ist tief in ihr vergraben, und ich kann es kaum mit Daumen und Zeigefinger berühren, doch irgendwie schaffe ich es.
Millimeter um Millimeter ziehe ich es heraus, doch die Handyhülle aus Kunststoff verfängt sich in jeder Falte, und in diesem Augenblick spüre ich zwischen den Fingerspitzen eine längere Vibration – ein Anruf.
Als ich das Telefon schließlich aus der Tasche befreit habe, lege ich es mit dem Display nach oben auf meine Oberschenkel und umfasse mit der Hand das Lenkrad.
Während die Stimme aus dem Navi die Entfernung zur nächsten Abbiegung verkündet, werfe ich einen verstohlenen Blick aufs Handy.
Ich sehe einen verpassten Anruf von »Dani« und drei Textnachrichten:
DANI vor zwei Min
Das Essen steht auf dem Tisch.
DANI vor zwei Min
Beeil dich, wir sind am VERHUNGERN!
DANI vor einer Min
Hast du dich verlaufen?:)
Ich konzentriere mich auf die Straße und frage mich, ob das Licht meines Handys vom Rücksitz aus zu sehen ist.
Der Touchscreen wird dunkel.
Ein weiteres Mal greife ich nach meinem Telefon, drücke die An/Aus-Taste und wische über das Display. Ich tippe meinen vierstelligen Code ein und klicke auf das grüne »Nachrichten«-Symbol. Danielas Nachrichten stehen ganz oben, aber in dem Moment, in dem ich antworten will, bewegt sich mein Entführer auf dem Rücksitz.
Ich packe das Steuer wieder mit beiden Händen.
In eins Komma acht Meilen rechts in die Ausfahrt Eighty-Seventh Street abbiegen.
Der Bildschirmschoner wird deaktiviert, die automatische Sperre aktiviert. Das Display ist schwarz.
Scheiße.
Ich nehme die eine Hand vom Steuer, gebe den Code nochmals ein und beginne, die wichtigste Nachricht meines Lebens zu schreiben. Mein Zeigefinger bewegt sich schwerfällig, für jedes Wort brauche ich zwei oder drei Versuche, weil das Rechtschreibprogramm durchdreht.
Der Lauf der Waffe drückt in meinen Hinterkopf.
Ich schlittere auf die Überholspur.
»Was soll das, Jason?«
Einhändig bringe ich uns wieder auf die rechte Spur, während der Zeigefinger meiner anderen Hand sich in Richtung »Senden« bewegt.
Der Maskierte schnellt zwischen den Vordersitzen vor, eine behandschuhte Hand greift um mich herum und schnappt mir das Handy weg.
Nach einhundertfünfzig Metern rechts in die Ausfahrt Eighty-Seventh Street abbiegen.
»Wie lautet dein Code, Jason?« Als ich nicht antworte, sagt er: »Warte. Ich wette, ich weiß es. Monat und Jahr deines Geburtstags rückwärts? Mal sehen … Drei-Sieben-Null-Eins. Na also.«
Im Rückspiegel sehe ich, wie sich die Maske im Licht des Handys erhellt.
Laut liest er den Text, den er mich nicht hat abschicken lassen.
»›1400 Pulaski ruf 91…‹ Böser Junge.«
Ich schere aus, um die Interstate-Ausfahrt nicht zu verpassen.
Das Navi sagt: Auf der Eighty-Seventh Street drei Komma acht Meilen in östlicher Richtung.
Wir sind jetzt in South Chicago, fahren durch eine Gegend, in der wir nichts zu suchen haben.
Vorbei an Fabrikgebäuden.
Wohnblocks.
Leere Parks mit verrosteten Schaukeln und Basketballkörben ohne Netz.
Für die Nacht vergitterte Ladenfassaden.
Überall haben Gangs ihre Graffiti hinterlassen.
Er fragt: »Nennst du sie eigentlich Dani oder Daniela?«
Es schnürt mir die Kehle zu.
Wut und Angst und Hilflosigkeit breiten sich in mir aus.
»Jason, ich habe dich was gefragt.«
»Geh zum Teufel.«
Er beugt sich dicht zu mir, ich fühle seinen heißen Atmen an meinem Ohr. »So solltest du mich lieber nicht behandeln. Ich werde dir mehr wehtun, als dir je wehgetan wurde. Du wirst Schmerzen haben, von denen du gar nicht wusstest, dass es sie gibt. Wie nennst du sie?«
Ich knirsche mit den Zähnen. »Daniela.«
»Nie Dani? Obwohl das so in deinem Handy steht.«
Ich bin versucht, das Lenkrad bei hoher Geschwindigkeit herumzureißen, um uns beide zu töten.
Ich sage: »Selten. Sie mag es nicht.«
»Was ist in dem Beutel?«
»Warum willst du wissen, wie ich sie nenne?«
»Was ist in dem Beutel?«
»Eiscreme.«
»Heute ist Familienabend, nicht wahr?«
»Ja.«
Im Rückspiegel sehe ich ihn auf meinem Handy tippen.
»Was schreibst du?«, frage ich.
Er reagiert nicht.
Wir haben das Ghetto hinter uns gelassen und fahren durch Niemandsland, das sich gar nicht mehr wie Chicago anfühlt, da die Skyline nur noch eine Lichtschliere am weit entfernten Horizont ist. Die Häuser, an denen wir vorbeikommen, sind zerfallen, lichtlos und leblos. Die ganze Gegend ist längst verlassen.
Wir überqueren einen Fluss, und direkt vor uns liegt der Lake Michigan. Seine schwarze Weite passt zu dieser städtischen Wildnis.
Als wäre die Welt hier zu Ende.
Und meine ist es vielleicht wirklich.
Rechts abbiegen und vier Komma fünf Meilen auf dem Pulaski Drive in südlicher Richtung bis zum Zielort.
Er kichert in sich hinein. »Wow, jetzt bist du aber bei deiner besseren Hälfte echt in Schwierigkeiten.« Ich kralle mich am Lenkrad fest. »Wer war dieser Mann, mit dem du vorhin Whisky getrunken hast? Ich konnte ihn von außen nicht erkennen.«
Es ist so dunkel hier draußen, in diesem Grenzland zwischen Chicago und Indiana.
Wir fahren an den Ruinen von Bahnhöfen und Fabriken vorbei.
»Jason.«
»Sein Name ist Ryan Holder. Er war früher …«
»Dein alter Zimmergenosse.«
»Woher weißt du das?«
»Steht ihr euch nahe? Ich finde ihn nicht in deinen Kontakten.«
»Nicht wirklich. Woher weißt du …«
»Ich weiß fast alles über dich, Jason. Man könnte sagen, ich habe dein Leben zu meinem Spezialgebiet gemacht.«
»Wer bist du?«
Sie erreichen den Zielort nach einhundertfünfzig Metern.
»Wer bist du?«
Er antwortet nicht, doch meine Aufmerksamkeit ist jetzt auch weniger auf ihn, sondern mehr auf die zunehmend abgeschiedene Umgebung gerichtet.
Der Asphalt fließt unter den Scheinwerfern des SUV dahin.
Leere hinter uns.
Leere vor uns.
Links ist der See, rechts sind verlassene Lagerhäuser.
Sie haben das Ziel erreicht.
Mitten auf der Straße schalte ich das Navi ab.
Er sagt: »Die Einfahrt ist links vor uns.«
Die Scheinwerfer streifen einen vier Meter hohen Maschendrahtzaun, der mit einer Tiara aus verrostetem Stacheldraht versehen ist. Das Tor steht einen Spalt offen, und die Kette, die es einmal verschloss, wurde durchtrennt und liegt spiralförmig im Unkraut neben der Straße.
»Stoß das Tor einfach mit der Stoßstange an.«
Auch im beinahe schalldichten Inneren des SUV klingt das Quietschen des aufschwingenden Tors laut. Die Lichtkegel beleuchten die Überreste einer Straße, der Asphalt ist durch die vielen strengen Winter, die Chicago hat, aufgerissen und aufgeworfen.
Ich schalte das Fernlicht ein.
Die Scheinwerfer erleuchten einen Parkplatz, auf dem überall umgekippte Straßenlaternen wie zu Boden gefallene Streichhölzer liegen, die aus einer Schachtel gefallen sind.
Dahinter ragt ein großes Gebäude in den Nachthimmel.
Die Backsteinfassade des von der Zeit verwüsteten Baus wird flankiert von riesigen, zylindrischen Tanks und zwei Kaminen, die über dreißig Meter in die Höhe streben.
»Was ist das hier?«
»Schalte auf ›Parken‹ und mach den Wagen aus.«
Ich bringe das Auto zum Stehen und stelle den Motor ab.
Es wird totenstill.
»Was ist das hier?«, frage ich noch einmal.
»Wie sehen deine Pläne für Freitag aus?«
»Wie bitte?«
Ein heftiger Schlag seitlich auf den Kopf schleudert mich gegen das Lenkrad. Er hat mich völlig unvorbereitet getroffen, und eine halbe Sekunde lang frage ich mich, ob es sich so anfühlt, wenn man in den Kopf geschossen wird.
Nein, er hat mich mit seiner Waffe nur geschlagen.
Ich hebe die Hand zu der schmerzenden Stelle. Als ich sie wieder senke, sind die Finger klebrig von Blut.
»Morgen«, sagt er. »Was hast du morgen vor?«
Morgen. Eine fast unmögliche Vorstellung.
»Mein Kurs PHYS 3316 schreibt einen Test.«
»Was sonst noch?«
»Das ist alles.«
»Zieh deine Klamotten aus.«
Ich schaue in den Rückspiegel.
Warum um alles in der Welt will er, dass ich nackt bin?
Er sagt: »Wenn du etwas hättest probieren wollen, hättest du es tun müssen, solange du noch die Kontrolle über das Fahrzeug hattest. Von diesem Augenblick an gehörst du ganz mir. Jetzt zieh dich aus, und wenn ich es noch einmal sagen muss, lass ich dich bluten. Und zwar reichlich.«
Ich löse den Sicherheitsgurt.
Während ich den Reißverschluss meines grauen Kapuzenpullovers aufziehe und die Ärmel abstreife, klammere ich mich an einen letzten Hoffnungsschimmer – er trägt noch immer die Maske, was heißt, dass er mich sein Gesicht nicht sehen lassen will. Wenn er vorhätte, mich zu töten, wäre es ihm egal, ob ich ihn identifizieren kann.
Oder?
Ich knöpfe mein Hemd auf.
»Auch die Schuhe?«, frage ich.
»Alles.«
Ich ziehe meine Laufschuhe aus, meine Socken.
Ich schiebe die Hose und die Boxershorts über die Beine.
Dann liegen meine Sachen – bis zum letzten Faden – in einem Haufen auf dem Beifahrersitz.
Ich fühle mich wehrlos.
Ausgeliefert.
Und komischerweise schäme ich mich.
Was, wenn er mich vergewaltigen will? Geht’s ihm vielleicht darum?
Er legt eine Taschenlampe auf die Konsole zwischen den Sitzen.
»Aussteigen, Jason.«
Mir wird bewusst, dass ich den Lincoln als eine Art Rettungsboot betrachte. Solange ich im SUV bleibe, wird er mir nichts tun. Er wird im Auto keine Sauerei veranstalten.
»Jason.«
Meine Brust bebt, ich fange an zu hyperventilieren, sehe schwarze Punkte vor den Augen.
»Ich weiß, was du denkst«, sagt er, »aber ich kann dir genauso leicht in diesem Fahrzeug Schmerzen zufügen.«
Ich kriege zu wenig Sauerstoff, fange an durchzudrehen. Trotzdem stoße ich, wenn auch atemlos, einige Worte heraus: »Blödsinn. Du willst mein Blut nicht hier drin haben.«
Als ich wieder zu mir komme, zerrt er mich an den Armen vom Fahrersitz. Er wirft mich in den Kies, wo ich benebelt dasitze und warte, dass mein Kopf wieder klar wird.
Am See ist es immer kühler als in Chicago, und der heutige Abend ist keine Ausnahme. Der Wind ist beißend kalt, auf meiner nackten Haut ist das besonders zu spüren. Sie ist von einer Gänsehaut überzogen.
Hier draußen ist es so viel dunkler, dass ich mindestens fünfmal so viele Sterne sehen kann wie in der Stadt.
Mein Kopf dröhnt, und neues Blut läuft an meinem Gesicht hinunter. Aber bei der geballten Ladung Adrenalin, die durch meinen Körper schießt, spüre ich den Schmerz nur gedämpft.
Er wirft eine Taschenlampe neben mir auf die Erde, und bei einer zweiten richtet er den Strahl auf das baufällige Gebäude, das ich bei unserer Ankunft sah.
»Nach dir.«
Ich packe die Taschenlampe und richte mich mühsam auf. Als ich auf das Gebäude zustolpere, treten meine nackten Füße auf durchnässtes Zeitungspapier. Ich weiche den zerdrückten Bierdosen und den Glassplittern aus, die im Schein der Lampe funkeln.
Während ich mich dem Haupteingang nähere, stelle ich mir diesen verlassenen Parkplatz an einem anderen Abend vor. An einem Abend in der Zukunft. Der Winter hat gerade Einzug gehalten, und hinter einem Vorhang aus Schnee zucken blaue und rote Lichter durch die Dunkelheit. Polizisten und Spürhunde schwärmen in den Ruinen aus, und während der Pathologe meine Leiche untersucht, die unbekleidet und verwest und entstellt irgendwo da drinnen liegt, hält vor meinem Haus in Logan Square ein Streifenwagen. Es ist zwei Uhr morgens, und Daniela öffnet im Morgenmantel die Tür. Seit Wochen werde ich vermisst, und tief in ihrem Herzen weiß sie, dass ich nicht zurückkomme. Sie ist der Meinung, dass sie sich mit dieser Tatsache bereits abgefunden hat, doch als sie die jungen Polizeibeamten mit diesem harten, nüchternen Blick, dem Rest von Schnee auf den Schultern und den Mützen sieht, die sie sich respektvoll unter den Arm geklemmt haben, zerbricht etwas in ihr, von dem sie gar nicht wusste, dass es noch heil war. Sie spürt, wie ihr die Knie weich werden, alle Kraft sie verlässt, und als sie auf den Fußabstreifer sinkt, steigt Charlie hinter ihr die knarzende Holztreppe herunter und fragt mit verquollenen Augen und strubbeligem Haar: »Geht’s um Dad?«
Als wir das Gebäude fast erreicht haben, erkenne ich auf der verwitterten Backsteinfassade über dem Eingang zwei Wörter: CAGOPOWER.
Er zwingt mich durch eine Öffnung in der Mauer.
Die Lichtkegel unserer Taschenlampen erhellen einen Empfangsbereich.
Mobiliar, das bis auf die Metallrahmen verrottet ist.
Ein alter Wasserkühler.
Die Überreste eines Lagerfeuers. Ein zerfetzter Schlafsack.
Benutzte Kondome auf verschimmeltem Teppichboden.
Wir betreten einen langen Korridor.
Ohne die Taschenlampen wäre es hier so dunkel, dass man die Hand nicht vor den Augen sähe.
Ich bleibe stehen, um nach vorne zu leuchten, aber der Lichtstrahl wird von der Schwärze verschluckt. Auf dem welligen Linoleumboden unter meinen Füßen liegt jetzt weniger Müll, und bis auf das Stöhnen des Windes außerhalb der Mauern ist rein gar nichts zu hören.
Mir wird von Sekunde zu Sekunde kälter.
Er rammt mir den Lauf seiner Waffe in die Niere und zwingt mich weiter.
Bin ich irgendwann ins Visier eines Psychopathen geraten, der sich vornahm, alles über mich herauszufinden, bevor er mich ermordete? Ich habe oft mit Fremden zu tun. Vielleicht haben wir uns kurz in dem Café in der Nähe des Campus unterhalten. Oder in der El. Oder bei einem Bier in meiner Stammkneipe.
Was hat er mit Charlie und Daniela vor?
»Willst du mich betteln hören?«, frage ich, obwohl mir fast die Stimme versagt. »Denn das werde ich tun. Ich werde alles tun, was du willst.«
Und das Schreckliche ist: Es stimmt. Ich würde mich erniedrigen. Einem anderen etwas antun, nahezu alles machen, was mich wieder in mein Viertel zurückbringt und diesen Abend so ablaufen lässt, wie er geplant war. Ich will nichts weiter, als zu meiner Familie zurückkehren und ihnen die Eiscreme bringen, die ich versprochen habe.
»Damit was passiert?«, fragt er. »Damit ich dich gehen lasse?«
»Ja.«
Sein Gelächter hallt den Gang entlang. »Ich hätte Angst davor zu sehen, was du alles zu tun bereit bist, nur um aus dem hier rauszukommen.«
»Aus was genau?«
Aber er antwortet nicht.
Ich sinke auf die Knie.
Meine Taschenlampe rutscht über den Boden.
»Bitte«, flehe ich. »Du musst das nicht machen.« Ich erkenne meine eigene Stimme kaum wieder. »Du kannst einfach verschwinden. Ich weiß nicht, warum du mir etwas antun willst, aber denk nur einen Augenblick darüber nach. Ich …«
»Jason.«
»… liebe meine Familie. Ich liebe meine Frau. Ich liebe …«
»Jason.«
»… meinen Sohn.«
»Jason!«
»Ich werde alles tun.«
Ich zittere unkontrolliert, vor Kälte und vor Angst.
Er tritt mir in den Bauch, und während mir die Luft aus der Lunge weicht, falle ich auf den Rücken. Er stürzte sich auf mich, schiebt mir den Lauf der Waffe zwischen die Lippen, in den Mund, tief hinunter in die Kehle, bis der Geschmack von altem Öl und Kohlenstoffresten stärker ist, als ich ertragen kann.
Zwei Sekunden bevor ich den Wein und den Scotch dieses Abends über den Boden erbreche, zieht er die Waffe wieder heraus.
Schreit: »Steh auf!«
Er packt mich am Arm, zerrt mich auf die Füße.
Mit der Waffe zielt er auf mein Gesicht, zugleich drückt er mir die Taschenlampe wieder in die Hand.
Ich starre die Maske an, und das Licht meiner Lampe gleitet über die Waffe.
Es ist mein erster richtiger Blick auf die Pistole. Ich weiß so gut wie nichts über Feuerwaffen, kann nur erkennen, dass es eine Handwaffe ist, mit einem Hahn und einem Zylinder. Am Ende des Laufs starre ich in ein riesiges Loch, das durchaus in der Lage zu sein scheint, mir den Tod zu bringen. Im starken Schein der Taschenlampe leuchtet die Spitze der Kugel, die auf mein Gesicht zielt, kupferfarben auf. Aus irgendeinem Grund stelle ich mir diesen Mann in einem Einzimmerapartment vor, wie er Patronen in den Zylinder lädt und sich auf das vorbereitet, was er jetzt mit mir vorhat.
Ich werde sterben, vielleicht sogar im nächsten Augenblick.
Jede Sekunde fühlt sich an, als wäre sie die letzte.
»Beweg dich«, knurrt er.
Ich setzte mich wieder in Bewegung.
Wir biegen in einen Gang ein, der breiter und höher als der erste ist, dazu überwölbt. Die Luft ist feucht, fast drückend. Ich höre ein entferntes Tropf … Tropf … Tropf von fallendem Wasser. Die Wände bestehen aus Beton, und anstelle des Linoleums ist der Boden hier mit feuchtem Moos übersät, das mit jedem Schritt dicker und nasser wird.
Das Metallene der Waffe in meinem Mund verbindet sich jetzt mit dem bitteren, beißenden Geschmack hochkommender Galle.
Mein Gesicht wird an einigen Stellen taub vor Kälte.
Eine Stimme in meinem Kopf schreit, ich solle etwas tun, etwas versuchen, irgendwas. Lass dich nicht wie ein Lamm zur Schlachtbank führen, setz nicht einen Fuß vor den anderen. Warum es ihm so leicht machen?
Ganz einfach.
Weil ich Angst habe.
So viel Angst, dass ich kaum aufrecht gehen kann.
Meine Gedanken schwirren ungeordnet durcheinander.
Jetzt verstehe ich, warum Opfer sich nicht wehren. Ich kann mir nicht vorstellen, diesen Mann zu überwältigen. Nicht einmal davonlaufen könnte ich.
Und das ist die beschämende Wahrheit: Ein Teil von mir will, dass alles schon vorbei ist, weil die Toten weder Angst noch Schmerz spüren. Heißt das, dass ich ein Feigling bin? Ist das die letzte Wahrheit, der ich mich stellen muss, bevor ich sterbe?
Nein.
Ich muss etwas tun.
Wir verlassen den Tunnel und treten auf eine Metalloberfläche hinaus, auf der mir schier die Fußsohlen festfrieren. Ich stütze mich auf einem verrosteten Eisengeländer ab, das ein Podest umgibt. Hier ist es noch kälter, wir befinden uns gefühlt in einem großen, offenen Raum.
Wie aufs Stichwort taucht ein gelber Mond über dem Lake Michigan auf und steigt langsam höher.
Sein Licht strömt durch die oberen Fenster einer riesigen Halle, und es ist so hell, dass ich auch ohne Taschenlampe alles erkennen kann.
Der Magen dreht sich mir um.
Wir stehen am höchsten Punkt einer freischwingenden Treppe, die über fünfzehn Meter in die Tiefe führt.
Alles sieht aus wie auf einem Ölgemälde, altehrwürdiges Mondlicht fällt auf eine Reihe außer Dienst gestellter Generatoren und lässt ein Geflecht aus Doppel-T-Trägern über meinem Kopf aufleuchten.
Es ist so still wie in einer Kathedrale.
»Wir gehen nach unten«, sagt er. »Pass auf, wo du hintrittst.«
Wir steigen hinab.
Zwei Stufen vom mittleren Absatz entfernt, drehe ich mich um, ziele mit der Taschenlampe auf seinen Kopf …
… und treffe in Leere, sodass mein Schwung mich den Kreis vollenden lässt.
Verliere das Gleichgewicht, falle.
Mit voller Wucht knalle ich auf den Treppenabsatz, die Taschenlampe verschwindet scheppernd über den Rand.
Eine Sekunde später höre ich sie sieben Meter weiter unten zerbersten.
Den Kopf schief gelegt, die Waffe auf mein Gesicht gerichtet, starrt mein Entführer hinter seiner ausdruckslosen Maske auf mich herunter.
Er spannt den Abzug und kommt auf mich zu.
Ich stöhne auf, als er mir das Knie ins Brustbein rammt und mich auf dem Absatz fixiert.
Die Waffe berührt meinen Kopf.
Er sagt: »Ich muss zugeben, ich bin stolz, dass du es versucht hast. Es war armselig, aber wenigstens bist du kämpfend zu Boden gegangen.«
Ich zucke zusammen, als ich einen scharfen Stich seitlich am Hals spüre.
»Kämpfe nicht dagegen an«, sagt er.
»Was hast du mir gegeben?«
Bevor er antworten kann, schießt etwas durch meine Blutbahnen wie ein Dreiachser. Ich fühle mich unglaublich schwer, doch zugleich auch vollkommen schwerelos; die Welt dreht sich und stülpt sich von innen nach außen.
So schnell, wie es mich traf, ist es auch wieder vorbei.
Eine weitere Nadel bohrt sich in mein Bein.
Während ich aufschreie, wirft er beide Spritzen weg. »Gehen wir.«
»Was hast du mir gegeben?«
»Steh auf.«
Ich ziehe mich am Geländer hoch. Mein Knie blutet von dem Sturz. Auch die Wunde an meinem Kopf ist wieder aufgeplatzt.
Ich friere, bin schmutzig und nass, und meine Zähne klappern so sehr, dass es sich anfühlt, als würden sie gleich herausbrechen.
Wir gehen nach unten, und das schwache Stahlgerüst schwankt unter unserem Gewicht. Nach der letzten Stufe gehen wir an einer Reihe alter Generatoren entlang.
Von unten wirkt die Halle noch riesiger.
In der Mitte bleibt er stehen, der Strahl seiner Taschenlampe trifft auf eine Sporttasche, die an einem der Generatoren lehnt.
»Neue Klamotten. Beeil dich.«
»Neue Sachen? Ich verstehe nicht.«
»Du musst nichts verstehen. Du musst dich einfach nur anziehen.«
Trotz meiner großen Angst spüre ich ein leichtes Aufkeimen von Hoffnung. Wird er mich verschonen? Warum sonst sollte ich mich anziehen? Habe ich eine Chance, das alles zu überleben?
»Wer bist du?«, frage ich.
»Beeil dich. Du hast nicht mehr viel Zeit.«
Ich kauere mich neben die Sporttasche.
»Mach dich erst mal sauber.«
Ganz oben in der Tasche liegt ein Handtuch, damit wische ich mir den Dreck von den Füßen, das Blut vom Knie und vom Gesicht. Ich ziehe Boxerhorts an und eine Jeans, die tadellos sitzt. Was er mir auch gespritzt hat, ich spüre das Zeug in meinen Fingern, einen Verlust von Geschicklichkeit, als ich mit den Knöpfen eines Karohemds kämpfe. Meine Füße gleiten mühelos in teure Lederslipper. Sie passen so gut wie die Jeans.
Mir ist nicht mehr kalt. Als hätte ich mitten in meiner Brust einen Kern aus Hitze, der in Arme und Beine ausstrahlt.
»Auch die Jacke.«
Ich hole eine schwarze Lederjacke aus der Tasche, schlüpfe in sie hinein.
»Perfekt«, sagt er. »Jetzt setz dich.«
Ich rutsche am Eisensockel des Generators entlang auf den Boden. Es ist ein massiges Teil, groß wie eine Lokomotive.
Mein Entführer nimmt mir gegenüber Platz, die Waffe hält er eher lässig in meine Richtung.
Jetzt erobert der Mondschein vollends die Halle, bricht sich an den kaputten Fenstern und fällt auf …
Kabelgewirr.
Getriebe.
Röhren.
Hebel und Flaschenzüge.
Instrumententafeln mit gesprungenen Anzeigen und Bedienelementen.
Technologie aus einer anderen Zeit.
Ich frage: »Was passiert jetzt?«
»Wir warten.«
»Worauf?«
Er wischt die Frage mit einer Handbewegung beiseite.
Eine merkwürdige Ruhe legt sich über mich. Ein falsches Gefühl von Frieden.
»Hast du mich hierher gebracht, um mich zu töten?«, will ich wissen.
»Habe ich nicht.«
Es fühlt sich gut an, sich an dem ausgedienten Generator anzulehnen.
»Aber du hast mich das glauben lassen.«
»Es gab keine andere Möglichkeit.«
»Keine andere Möglichkeit wozu?«
»Um dich hierher zu bringen.«
»Und warum sind wir hier?«
Statt zu antworten, schüttelt er nur den Kopf, während er die linke Hand unter die Geisha-Maske schiebt und sich kratzt.
Ich komme mir merkwürdig vor.
Als würde ich einen Film ansehen und gleichzeitig darin agieren.
Eine unwiderstehliche Schläfrigkeit befällt mich.
Mein Kopf sinkt auf die Brust.
»Lass es einfach zu.«
Aber ich will das nicht. Ich kämpfe dagegen an, denke, wie beunruhigend schnell sich sein Ton verändert hat. Es ist, als wäre er ein anderer Mann, und die Unvereinbarkeit zwischen dem, der er im Augenblick ist, und der Gewalttätigkeit, die er noch vor Minuten an den Tag gelegt hat, sollte mir eigentlich Angst machen. Ich sollte nicht so ruhig sein, aber mein Körper schnurrt einfach zu friedlich vor sich hin.
Ich fühle mich gelassen und ruhig, als wäre ich weit weg.
Dann sagt er zu mir, und es ist fast ein Geständnis: »Es war ein langer Weg. Ich kann kaum glauben, dass ich tatsächlich hier sitze und dich anschaue. Mit dir rede. Ich weiß, du verstehst nicht, aber es gibt so vieles, was ich dich fragen will.«
»Worüber?«
»Wie es ist, du zu sein.«
»Was meinst du damit?«
Er zögert, sagt dann: »Was denkst du über deinen Platz in der Welt, Jason?«
Ich antworte langsam: »Das ist eine interessante Frage nach allem, was du mich heute Abend hast durchmachen lassen.«
»Bist du glücklich in deinem Leben?«
In diesem finsteren Augenblick ist mein Leben schmerzhaft schön.
»Ich habe eine unglaubliche Familie. Eine Arbeit, die mich ausfüllt. Es geht uns gut. Niemand ist krank.« Meine Zunge fühlt sich schwer an. Meine Stimme klingt verwaschen.
»Aber?«
Ich sage: »Mein Leben ist großartig. Es ist nur nicht außergewöhnlich. Und es gab einmal eine Zeit, da hätte es so sein können.«
»Du hast deinen Ehrgeiz verloren, oder?«
»Wie das manchmal so ist. Ich hab ihn ignoriert.«
»Und weißt du, wie das passiert ist? Gab es einen Augenblick, als …«
»Mein Sohn. Ich war siebenundzwanzig, und Daniela und ich waren seit ein paar Monaten zusammen. Sie sagte mir, dass sie schwanger sei. Wir hatten Spaß miteinander, aber es war keine Liebe. Oder vielleicht war es das. Ich weiß es nicht. Wir hatten auf jeden Fall nicht vor, eine Familie zu gründen.«
»Aber du hast es getan.«
»Wenn man Wissenschaftler ist, sind die Jahre mit Ende zwanzig entscheidend. Wenn man bis dreißig noch nichts veröffentlicht hat, gelangt man schnell aufs Abstellgleis.«
Vielleicht ist es die Droge, aber das Reden fühlt sich gut an. Eine kleine Oase, eine Form von Normalität nach zwei der verrücktesten Stunden, die ich je erlebt habe. Ich weiß, es stimmt nicht, aber es fühlt sich an, als könne, solange wir uns unterhalten, nichts Schlimmes passieren. Als würden die Worte mich beschützen.
»Hattest du was Großes in Arbeit?«
Ich muss mich darauf konzentrieren, meine Augen offen zu halten.
»Ja.«
»Und was war das?«
Seine Stimme klingt weit entfernt.
»Ich versuchte, die Quantensuperposition eines Objekts zu erzeugen, die für das menschliche Auge sichtbar ist.«
»Warum hast du deine Forschung aufgegeben?«
»Charlie hatte gleich nach seiner Geburt große medizinische Probleme, die das ganze erste Jahr andauerten. Eigentlich hätte ich tausend Stunden in einem Reinraum experimentieren müssen, aber ich schaffte dieses Zeitfenster nicht. Daniela brauchte mich. Mein Sohn brauchte mich. Ich verlor meine Finanzierung. Verlor meinen Schwung. Einen Augenblick lang war ich das junge Genie, aber als ich ins Stocken kam, nahm ein anderer meinen Platz ein.«
»Hast du je deine Entscheidung bedauert, bei Daniela zu bleiben und mit ihr ein Leben aufzubauen?«
»Nein.«
»Nie?«
Meine Gedanken gehen zu Daniela, und all meine Gefühle gewinnen wieder Oberhand über mich, begleitet vom Grauen der Situation. Die Angst kehrt massiv zurück und mit ihr ein Heimweh, das mich bis ins Mark erschüttert. In diesem Augenblick brauche ich sie mehr, als ich in meinem Leben etwas gebraucht habe.
»Nie.«
Auf einmal liege ich auf dem Boden, das Gesicht am kalten Beton. Die Droge trägt mich davon.
Er kniet neben mir, dreht mich auf den Rücken, und ich beobachte das Mondlicht, das durch die hohen Fenster dieses vergessenen Ortes strömt und die Dunkelheit mit farbigen Blitzen aufhellt, während sich neben den Generatoren dunkle Schwaden bilden, die ins Leere verschwinden.
»Werde ich sie wiedersehen?«, frage ich.
»Ich weiß es nicht.«
Ich will ihn zum millionsten Mal fragen, was er mit mir vorhat, aber ich finde nicht die richtigen Worte.
Immer wieder fallen mir die Augen zu. Ich bemühe mich, sie offen zu halten, aber es ist ein aussichtsloser Kampf.
Er zieht einen Handschuh aus und berührt mein Gesicht mit der bloßen Hand.
Sonderbar.
Behutsam.
Er sagt: »Hör zu. Du wirst Angst haben, aber du kannst es zulassen. Du kannst alles haben, was du nie hattest. Tut mir leid, dass ich dir vorher Furcht einjagen musste, aber ich musste dich hierher schaffen. Es tut mir so leid, Jason. Ich tue das für uns beide.«
Ich forme mit den Lippen die Worte: Wer bist du?
Anstatt zu antworten, greift er in seine Jackentasche und holt noch eine weitere Spritze und eine winzige Glasampulle mit einer klaren Flüssigkeit heraus, die im Mondlicht schimmert wie Quecksilber.
Er entfernt die Schutzhülle und zieht den Inhalt der Ampulle auf die Spritze.
Während meine Lider sich langsam senken, sehe ich noch, wie er seinen linken Arm freimacht und sich selbst spritzt.
Dann lässt er die Spritze und die Ampulle zwischen uns auf den Beton fallen, und das Letzte, was ich sehe, bevor meine Augen sich schließen, ist die Ampulle, die auf mein Gesicht zurollt.
Ich flüstere: »Und jetzt?«
Er antwortet: »Du würdest mir nicht glauben, wenn ich es dir sagen würde.«
ZWEI
Ich spüre, dass mich jemand an den Füßen packt.
Während Hände sich unter meine Achseln schieben, sagt eine Frau: »Wie hat er es aus dem Würfel geschafft?«
Ein Mann antwortet: »Keine Ahnung. Schau, er kommt zu sich.«
Ich öffne die Augen, nehme aber nichts als verschwommene Bewegungen wahr. Und Licht.