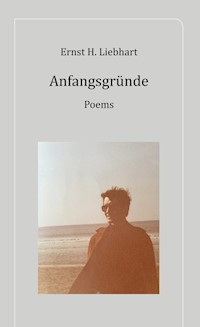Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
"Du hast dein Alleinsein, das ein heller, lebendiger Schmerz war und vor allem eine Kraft, eingetauscht gegen eine sprachlose, dumpfe, erstickende Selbstvergessenheit ohne Hoffnung", erkennt einer der Protagonisten in 'Utopie und andere Liebesversuche' am Ende seiner Ehe. Ernst H. Liebhart sucht in seinen Erzählungen nach der Utopie einer Liebe, die nicht Risse in einer Wunschwelt schließt, kein Heilmittel gegen Einsamkeit ist, kein Spiel; er sucht die Liebe, die nichts verlangt, in der das Ich zu sich selbst kommt, eine Liebe, die reich macht allein durch den Versuch, lieben zu lernen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 104
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Anrede oder Sankt Georg, Bogenhausen
Die Schranke
Utopie
Verfangen
Gregor
Der Vagant
Ginevra und Lancelot
Die Ringelblume
Raum
Wer bist du?
Bis gleich
Anrede oder Sankt Georg, Bogenhausen
Jetzt bist du wieder hier. Du stehst auf diesen rötlichen quadratischen Platten, Buntsandstein, ganz hinten in dem kleinen Kirchenschiff, wie früher, schwer, ohne viel zu denken, etwas fremd unter dem feierlich-dunklen Barock. Aber, das weißt du, dieser Ort hier am Rand der Isar-Terrasse reicht viel weiter zurück als in die Barockzeit; nicht nur bis in deine Anfänge, sondern bis in die Anfänge überhaupt.
Wie früher bist du zuerst über den kleinen Friedhof gegangen, der die Kirche umgibt, bist ehrerbietig, aber auch wie ein Heimkehrender stehen geblieben vor den Gräbern von Annette Kolb, Gustl Waldau, Wilhelm Hausenstein und, weiter hinten, Hans Knappertsbusch, unter dem deine Mutter noch gesungen hatte – das erzählte sie schon dem kleinen Jungen – und dessen Name dich an frühe Übertragungen aus Bayreuth erinnert, an dein Schaudern über diese germanische Finsternis. Dann, in der Außenmauer der Kirche, die Gedenktafeln für die vier ermordeten Jesuiten, nur Tafeln, kein Grab, denn die Mörder haben die Asche der Opfer in die Winde verstreut, wie es heißt. Das ist eine Beschönigung, du weißt es, aber wieder spürst du, dass die vier, Pater Delp und seine Gefährten, lebendiger sind als alle anderen.
Und du bist jetzt einfach wieder hier. Was willst du? Du schweigst. Seinerzeit, als du die ersten Male kamst – du wohntest ja nicht weit von hier, damals – wusstest du, was du wolltest, oder du meintest, es zu wissen: deine Freundin, die allererste, wolltest du wiederhaben. Schifo – sprich skifo, zu Deutsch: Ekel – war der Name, den sie dir gegeben hatte, zärtlich auf einer langen italienischen Reise. Ihr habt nie miteinander geschlafen; manchmal war es fast schon zu viel, ihre Stimme zu hören oder ihre Hand zu halten. Du batest darum, dass sie zurückkommen möchte. Aber sein Wille geschehe, sagtest du dazu; der kleine Satz hatte etwas Befreiendes, der Raum wurde weiter durch ihn, die Welt und deine Wünsche, deine Wunschwelt, traten ein wenig zurück. Ein kleiner Schnitt in einen Vorhang, vielleicht der erste, den du selber ausgeführt hast.
Deine Bitte ist nicht gewährt worden. Damals war deine Freundin, was du nicht wusstest, schon schwanger von einem anderen. Schnell war das gegangen. Hättest du sie wiederhaben wollen, auch wenn du das gewusst hättest? Ja, klar, du bist sicher. Eines der wenigen Dinge, deren du sicher bist. Dass die ermordeten Jesuiten lebendig sind, ist genauso sicher. Damals wurden die Schnitte im Vorhang, die Risse in der Wunschwelt zahlreicher; Pausen, Schmerzpausen sozusagen. Dann batest du um nichts, machtest meistens auch keine Worte. Hinter den Rissen war – nichts. So schien es dir. Das befremdete dich, damit wusstest du nichts anzufangen. Sei genau: du fürchtetest die Anstrengung, die es dich gekostet hätte, anzufangen, ohne zu wissen. So bist du zurückgekehrt zu deinen Wünschen, diesem fest verschnürten Paket. Schmerz als Zeitvertreib. Es ist viel Zeit, die du dir vertrieben hast.
Drei Jahre später, so lang hat es immerhin gedauert, wolltest du bloß nicht mehr allein sein, wolltest einfach eine neue Freundin. Nicht allein sein: das war der erste und auch der letzte Wunsch, der Wunsch der Wünsche, die schlichte Grundformel der Wunschwelt. Allein, du hast das wirklich gedacht, sogar gesagt, seist du, sei der Mensch nichtexistent. Hast du dich selbst alleingelassen, damals? Und um nicht allein zu sein: dazu brauchtest du eine Frau, eine Freundin. So einfach war das. Dachtest du. Dann würden sich die Risse schließen: Geborgenheit, Glück, äußerste Rückkehr – das, was du erstlich, letztlich wolltest. Dachtest du. Also batest du um eine Freundin, eine neue. Jemanden lieben, von dem du geliebt würdest, sagtest du einmal; das war gut gesagt. Aber wusstest du, was du da sagtest? Weißt du es jetzt? Alleinsein dürfte ja nicht vorkommen bei diesem Lieben, diesem Geliebtwerden. Darf, dürfte das jetzt vorkommen? Jedenfalls batest du. Ist diese Bitte gewährt worden? Oder konntest du nur nicht warten: nicht allein sein?
Sicher ist, dass du bald darauf geheiratet hast. Nicht lange nachdem du sie kennengelernt hattest, zeigtest du deiner späteren Frau diese Kirche, den Friedhof, den Park und berichtetest ihr, wahrheitsgemäß und genau, dass du hier um eine Freundin gebeten hattest – um sie, meintest du damals. Ein paar Tage darauf erwähnte die Freundin, sie habe dies ihrer Psychoanalytikerin erzählt und die habe gemeint, das sei ja rührend; ein Mann, der um eine Freundin bitte. Rührend. Was war dir peinlich daran? Es wurden dir immer mehr Dinge peinlich, im Lauf der Zeit. Ein hochsensibler Verräter, denkst du. Warum urteilst du?
Übrigens, beinahe hättest du es vergessen, ist deine erste Bitte doch gewährt worden: Deine erste Freundin ist zurückgekehrt zu dir, sechs Jahre nach der Trennung, einfach so, verändert, ganz unaufdringlich, fragend und ganz offen, mit ihrem vierjährigen, rebellischen Töchterchen. Unvermutet war sie da; du wolltest es nicht wahrhaben. Es ist aber wahr. Es war zu spät für dich: so lange hattest du nicht allein bleiben können. So lange hattest du nicht bei dir bleiben können. Lebenschaos. Die Risse hatten sich geschlossen. Dachtest du.
An deine Hochzeit denkst du nicht so gerne, aber es hilft nichts, die Trauung fand hier statt, auf dein Betreiben, hier, wo du jetzt stehst, schwarzer Anzug, weißes Brautkleid, deine Mutter sang das Ave Verum von Mozart, ausgerechnet das Ave Verum; sie sang es makellos und noch heute gibt es unter deinen Sachen ein Tonband, dein Bruder hat alles aufgezeichnet, für alle Ewigkeit, für das Jüngste Gericht. Was ist dir peinlich daran? Vielleicht solltest du das Band noch einmal hören.
Wo hat der Verrat begonnen? Du hast zugelassen, dass jener wassersüchtige, immerzu qualmende alte Benediktiner mit dem biederen irischen Namen euch traute, derselbe, der deine Eltern getraut hatte. Klar, dass deine Mutter das arrangiert hatte. Du wusstest ganz genau, dass dieser Mönch ein korrekter Verwalter der Amtskirche und ihrer Gnadenmittel, so nannte man das, war, aber Menschen, die Regungen des menschlichen Herzens ohne Zutrauen oder gar Liebe beobachtete. Was hast du von den Regungen deines Herzens gehalten, damals? Was regt sich da überhaupt noch? Unglaublich, meinst du jetzt. Es war aber so.
Wo hat der Verrat begonnen? Sicher nur, dass er in dir begonnen hat, denkst du. Deine Frau war viel zu unwissend, als dass sie zum Verrat fähig gewesen wäre. Noch genauer: sie hatte nichts zu verraten. Aber du hattest etwas zu verraten. Ziemlich am Anfang – jetzt gibt das Gedächtnis die Erinnerung frei – habt ihr, einander umarmend, gebetet, nein, bleib bei der Wahrheit: du hast gebetet, mit einfachen, neuen Worten, stellvertretend für beide, und sie hat zugehört, regungslos, stumm, vielleicht verwundert, ratlos. Da warst du allein, zum letzten Mal auf lange Zeit, und du warst bei dir, zum letzten Mal auf lange Zeit. Warum weinst du? Du warst in dem, was du noch jetzt dir kaum oder nur zögernd zutraust: deinem – ja, überwinde wenigstens hier, jetzt dieses Zögern: deinem! – transzendenten Mannsein, deiner wirklichen Geistigkeit, deiner von niemandem verliehenen priesterlichen Würde, dem Grund aller Potenz und Zeugungsfähigkeit. Wofür hast du dies verkauft?
Du merkst: nichts daran ist peinlich, auch nicht dein Erschrecken, wenn du die wahren Worte gebrauchst: das hat schon seinen Grund. Was war dir peinlich, damals? Ihre Stummheit machte dein Alleinsein hörbar, greifbar. Später bist du Feminist geworden, um nicht mehr Mann: nicht mehr allein sein zu müssen. Brauchtest du Publikum? Mitspieler? Jedenfalls hast du das Beten mit ihr bald gelassen und wenig später auch das Beten allein.
Du hast dich selbst verlassen, um nicht mehr allein zu sein. Die Krankheit zum Tode: verzweifelt nicht man selbst sein zu wollen. Das ist nicht zu verstehen. Es blieben die Umarmungen und es fehlte der Inhalt. Blieben die Umarmungen wirklich? Du hast dich zum Weib gemacht, bei erhaltener Potenz und Zeugungsfähigkeit. Sei genau: was heißt da erhalten? Später – aber da wäre es noch Zeit gewesen – hast du gelesen, es war wohl in Das Brot der frühen Jahre: Miteinander zu beten ist mehr als miteinander zu schlafen. Du wirst das noch einmal nachlesen müssen. Du hast dein Alleinsein, das ein heller, lebendiger Schmerz war und vor allem eine Kraft, eingetauscht gegen eine sprachlose, dumpfe, erstickende Selbstvergessenheit ohne Hoffnung.
Das ist lang her, findest du, viel länger als die Anfänge. Du bist dann nicht mehr hierher gekommen, viele Jahre lang. Aber jetzt bist du wieder hier. Was willst du? Du bittest um nichts mehr, seit langem. Das hat bald aufgehört nach deiner Heirat; zuerst hattest du noch manchmal das Gefühl, zu ersticken, aber auch das hörte auf. Es sei doch unmöglich, jemanden anzureden, an dessen Existenz man nicht mehr glaube. Das war sehr trotzig gedacht und sehr konsequent. Hie und da, wenn du ganz am Ende warst, hast du dich nicht daran gehalten, hast ganz wenige Worte gemacht oder eine fast unsichtbare Gebärde. Auch dass sein Wille geschehen solle, sagtest du nicht mehr, aber ein paar Augenblicke warst du einig mit diesem Willen. Mit dir selber, wie kommst du darauf? Vielleicht, dachtest du später, ist es ja umgekehrt: man kann jemandes Existenz nicht lange glauben, wenn man ihn nicht anredet. Du hast ja auch an deine eigene Existenz nicht mehr geglaubt, weil du dich nicht mehr angeredet hast. Noch später dämmerte dir, dass all dies – Glauben und Nichtglauben, Anreden und Nichtanreden – Hirngespinste sind, Wortblasen, Luftblasen, die vom Grund eines Sees aufsteigen. Du glaubst nicht mehr an ihn, der dir deine Wünsche erfüllen würde, gut. Da ist wieder der Riss. Glaubst an deine eigene Existenz? Ist das etwas anderes? Zugleich hast du gelernt, dass es ganz unerheblich ist und keine besondere Aufmerksamkeit verdient, was du glaubst oder nicht glaubst, und dass es ein Selbstbetrug ist, an den Unglauben zu glauben, als ob wenigstens der ein sicherer Boden wäre. Ach, du weißt, als Festung hast du ihn verwendet, als Bollwerk gegen dich selbst. Die einzige Wirklichkeit ist dieser Raum, jetzt, und dass du wieder hier bist.
Was willst du, jetzt? Willst du noch mal eine Freundin? Wie viele Freundinnen willst du noch? Eine jede immer wieder als letzte, nein: als einzige, mit völliger Reinheit und Leidenschaft? Niemand verspricht dir etwas, aber es ist ja durchaus möglich, dass du noch mal eine Freundin findest. Aber ist es wirklich das, was du willst? Der Verdacht kommt dir, dass du immer noch kein Mann bist, sondern ein Schürzenjäger. Und deine leise Angst schon beim Aufwachen: vielleicht ist das gar nicht Angst vorm Alleinbleiben, sondern davor, dich noch einmal zu verkaufen. Oder willst du deine alte Freundin wiederhaben wie damals? Nicht die erste, sondern die letzte? Aber, das weißt du, mit deiner letzten Freundin hast du es nicht ausgehalten. Diese Liebe war ja ein Trick, sehr intelligent eigentlich, denkst du jetzt, die einzige Rettung: Ausgerechnet diese Frau hast du dir gewünscht, um nicht allein zu sein, um den Riss zu flicken: sie, die dich völlig allein ließ, immer wieder, schockartig, die den Riss mitleidlos – unnötig grausam, meintest du damals – öffnete, so dass er sich seither nicht mehr schließt, nicht einmal scheinbar. Damals hast du ihr die Schuld gegeben, der Einfachheit halber. Du habest nicht bekommen, was du wolltest, was du brauchtest. Du meintest, nicht zu bekommen, was du meintest, zu wollen, zu brauchen. Geplänkel auf der Flucht.
Du hast es mit ihr nicht ausgehalten, so viel ist gewiss. Du hast es mit dir selbst nicht ausgehalten.
Das weißt du auch. Aber ein Kind wolltest du mit ihr, unbedingt. Statt dich selber zur Welt zu bringen, denkst du jetzt, aus der Wunschwelt auf die Welt, wie sie ist. Vater der Konfusion nannte sie dich, mit einem Hauch von Zärtlichkeit. Das war es. Und jetzt? Willst du lernen, dich selber auszuhalten, immerhin einen Mann, wenn du ihn ernst nimmst, indem du zu einer Frau zurückkehrst, mit der du es auch nicht ausgehalten hast? Willst du lebenslänglich das Pferd vom Schwanz her aufzäumen, weil merkwürdigerweise der Kopf unsichtbar