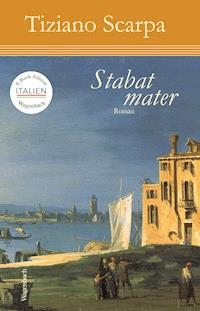Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dass Venedig die Form eines Fisches hat, sieht jeder, der auf eine Landkarte schaut. Tiziano Scarpa lädt dazu ein, diesen Wunderfisch mit allen Sinnen zu erkunden – deshalb schreibt er nicht über Venedig, sondern darüber, was in Venedig mit uns passiert. Die Kapitel heißen: Füße, Beine, Herz, Gesicht, Ohren, Mund, Nase, Augen und Haut. Wir erfahren, warum man sich in Venedig unbedingt verirren sollte, weshalb die Stadt als Kulisse für Liebeserklärungen ungeeignet ist und wieso Venedigs Schönheit hochgradig gesundheitsgefährdend ist. Scarpa wirft viel vom Bildungsballast, der auf Venedig lastet, ins Meer und sorgt dafür, dass man über diesen wunderlichen Venedig-Fisch auf unerwartete Weise ins Staunen gerät. Für diese Ausgabe hat Tiziano Scarpa seine »passeggiata« gründlich überarbeitet und ergänzt: unter anderem mit vielen neuen Möglichkeiten, sich im Herzen der Lagune zu verlieren – und mit ein paar Seitenblicken auf das nur in der Pandemie glasklare Wasser, das Venedig immer häufiger zu Leibe rückt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tiziano Scarpa führt durch seine Heimatstadt und lässt uns Venedigs Stadt- und unsere Körperteile auf ungeahnte Art entdecken – ein ungewöhnlicher Reisebegleiter in erweiterter Neuausgabe.
Tiziano Scarpa
Venedig ist ein Fisch
Erweiterte Neuausgabe
Aus dem Italienischen von Olaf Matthias Roth
Verlag Klaus WagenbachBerlin
Venedig ist ein Fisch. Schau es dir auf einer Landkarte an. Es ähnelt einer riesigen Seezunge, die platt auf dem Grund liegt, oder einer Dorade, die auf einer Welle dahinschießt. Wieso ist dieses Wundertier die Adria hinaufgeschwommen und hat sich ausgerechnet hier verkrochen? Es hätte ja noch ein wenig umherstreifen können, um mal hierhin, mal dahin einen Abstecher zu machen, ganz nach Lust und Laune. Reisen, durch die Gegend ziehen, sich die Zeit vertreiben, so wie es das immer gern getan hat: dieses Wochenende in Dalmatien, übermorgen in Istanbul, nächsten Sommer in Zypern. Wenn es nun hier vor Anker gegangen ist, so muss es dafür einen Grund geben. Die Lachse reiben sich die Bäuche auf, wenn sie gegen den Strom schwimmen, erklimmen Wasserfälle für ihr Liebesspiel in den Bergen. Wale, Sirenen und Galionsfiguren, alle sterben sie in der Sargassosee.
Die anderen Bücher würden lächeln über das, was ich dir da erzähle. Sie berichten von der Entstehung der Stadt aus dem Nichts, dem glänzenden Aufstieg zur Handels- und Militärmacht, dem Niedergang: Märchen. So ist es nicht, glaub mir. Venedig hat es schon immer in der Form gegeben, die du siehst. Seit Anbeginn der Zeiten schwimmt es herum; in allen Häfen hat es Station gemacht, kennt alle Flüsse, alle Quais und Molen. An seinen Schuppen blieben orientalische Perlen haften, durchsichtiger phönizischer Sand, griechische Mollusken, byzantinische Algen. Eines Tages spürte es jedoch die Last jener Splitter und Körnchen, die es so nach und nach auf der Haut angesammelt hatte; es bemerkte, welche Kruste es mit sich herumschleppte. Seine Flossen wurden zu schwer, um sich durch die Strömung zu schlängeln. Daher beschloss es, ein für alle Mal in eine der Buchten weiter oben am Mittelmeer hinaufzuschwimmen, in die ruhigste, die entlegenste, und sich dort auszuruhen.
Auf der Landkarte gleicht die vier Kilometer lange Brücke, die es mit dem Festland verbindet, einer Angelschnur: Es sieht aus, als hätte Venedig angebissen und wolle sich nun wieder losmachen. Es hängt an einer doppelten Schnur: an einem Stahlgleis und einem Asphaltband; doch das kam später: Mitte des neunzehnten Jahrhunderts wurden die Gleise verlegt, und in den 1930er Jahren folgte die Fahrbahn für die Autos. Wir bekamen nämlich Angst, Venedig könne es sich eines Tages anders überlegen und weiterziehen; und so haben wir es in der Lagune festgebunden, damit es nicht plötzlich den Anker lichtet und abhaut, und diesmal für immer. Den anderen sagen wir, es sei zum Schutze Venedigs geschehen, denn nach all den Jahren vor Anker hat es das Schwimmen verlernt: Es würde sofort gefangen werden, auf irgendeinem japanischen Walfangboot landen und in einem Aquarium in Disneyland gezeigt werden. In Wahrheit aber kommen wir nicht mehr ohne Venedig aus. Wir sind eifersüchtig. Auch despotisch und grausam, wie alle, die das Liebste bei sich behalten wollen. Wir haben noch Schlimmeres getan, als es ans Festland anzubinden: Wir haben es auf dem Grund festgenagelt.
In einem Roman von Bohumil Hrabal gibt es ein Kind, das von Nägeln besessen ist. Es schlägt sie nur in Fußböden ein: zu Hause, im Hotel, bei Gästen. Alle Parkettböden, die ihm unter die Finger geraten, werden von morgens bis abends behämmert. Als wolle das Kind die Häuser am Boden befestigen, um sich sicherer zu fühlen. Mit Venedig ist es genauso, nur sind die Nägel nicht aus Eisen, sondern aus Holz, und sie sind riesig, zwei bis zehn Meter lang und haben einen Durchmesser von zwanzig, dreißig Zentimetern. Sie wurden in den Schlamm auf dem Meeresboden gerammt.
Die Paläste, die du siehst, die reichverzierten Bauten aus Marmor und Kalkstein, die Backsteinhäuser, sie alle konnte man nicht auf Wasser errichten, sie wären im Schlick versunken. Wie Franco Mancuso dargelegt hat, sind in Venedig nicht die Außenmauern die tragenden Elemente, eben damit die Gebäude nicht an der weichen Uferböschung absinken; die legendären Fassaden der Palazzi am Canal Grande sind von Fenstern durchlöchert, um ihr Gewicht zu verringern: ihr anmutiges Aussehen ist die Folge einer architektonischen Notwendigkeit; die Ästhetik wird von der Bautechnik diktiert. Wie aber erbaut man ein solides Fundament auf Schlamm? Die Venezianer rammten eine riesige Menge Pfähle in den Boden. Unter der Basilica della Salute sind es Tausende; auch zu Füßen der Rialtobrücke, denn sie müssen dem Druck des steinernen Bogens standhalten. Die Basilica von San Marco ruht auf einem Gitter aus Eichenholz, das von einem Pfahlwerk aus Ulmen- und Erlenholz getragen wird. Die Stämme besorgte man sich in den Wäldern von Cadore, in den venetischen Alpen. Man brachte sie bis zur Lagune und ließ sie dazu auf den Flüssen treiben, auf dem Piave. Unter der Wasseroberfläche, im Schlick begraben, sind da Lärchen, Ulmen, Erlen, Eichen, Kiefern, Stieleichen. Die Serenissima war sehr umsichtig; immer hatte sie ein Auge auf den Baumbestand; äußerst strenge Gesetze schützten die Wälder.
Die Bäume wurden mit einer Art Holzblock, der nur mit Muskelkraft an Haltegriffen emporgezogen wurde, kopfüber in den Boden gerammt. Als Kind habe ich noch gesehen, wie diese altertümliche Vorrichtung funktionierte, habe die Lieder der Pfahlbauer gehört, die langsamen und gewichtigen Taktschläge jener in der Luft hängenden, zylinderförmigen Hämmer, die entweder von Hand angehoben oder auf einer vertikalen Schiene auf und ab glitten; sie fuhren langsam hinauf und sausten dann wie der Blitz herab. Dass die Stämme zu Mineralien wurden, bewirkte der Schlamm, der sie mit seiner Schutzschicht umgab und so verhinderte, dass sie beim Kontakt mit Sauerstoff verfaulten. Nach Jahrhunderten im luftleeren Raum hat sich das Holz beinahe in Stein verwandelt.
Du gehst also über einen unendlichen, umgedrehten Wald, spazierst über einen geradezu unglaublichen auf dem Kopf stehenden fossilen Forst. Es kommt einem vor wie die Erfindung eines mittelmäßigen Science-Fiction-Schriftstellers, aber es ist wahr.
Venedig ist ein urbaner Parcours der Sinneswahrnehmungen, ein Sensodrom. Dieses Buch dient als Ergänzung der Reiseführer. Normalerweise steht das kulturelle Erlebnis im Mittelpunkt eines Besuchs der Kunststädte: Wir besuchen sie, um ihre Bauwerke und Museen, ihre Architektur kennenzulernen, und begnügen uns damit, historisch-künstlerische Erkenntnisse zu shoppen. Das Gehirn speichert Nachrichten, vernachlässigt aber das, was mit dem Körper und damit auch der Seele geschieht. Geist und Körper wandeln auf zwei sehnsüchtelnd voneinander getrennten Bahnen. In diesem Buch führe ich sie zusammen. Ich beschreibe dir nun, was mit deinem Körper in Venedig passiert, und fange bei den Füßen an.
Füße
Venedig ist eine Schildkröte: Ihr steinerner Panzer besteht aus grauen Trachytblöcken (maségni, wie die Venezianer sagen), mit denen die Straßen gepflastert sind. Es ist ein poröses vulkanisches Gestein, das aus den Euganeischen Hügeln in der Nähe von Padua stammt. Die Kanten der Kanalufer und die Zierleisten der Treppenstufen sind aus weißem Stein aus den Steinbrüchen Istriens. Fast alles, was man in Venedig sieht, so hat Paolo Barbaro geschrieben, kommt von anderswo, wurde importiert oder erschwindelt, wenn nicht gar geraubt. Die Oberfläche, über die du gehst, ist glatt, auch wenn viele Steine mit einem kleinen Hammer gerädelt wurden, damit du bei Regen nicht ausrutschst.
Wohin gehst du denn? Wirf doch den Stadtplan weg. Warum willst du unbedingt wissen, wo du dich im Augenblick befindest? In allen Städten, in Einkaufszentren, an Autobus- oder U-Bahn-Haltestellen finden sich noch Hinweisschilder, die uns heute wie ein Relikt aus alten Zeiten vorkommen, wo doch alle das Telefon benutzen, um eine Adresse zu finden; dennoch gibt es hier noch Schilder mit einem farbigen Punkt darauf, einem Pfeil, die dich lautstark darauf aufmerksam machen: »Sie sind hier.« Du möchtest gern erwidern: »Weiß ich doch!«, und deinen Handybildschirm mit dem eingeschalteten Navigationssystem schwenken. In der Smartphone-Ära scheinen diese Schilder inzwischen eher den Orten selbst in Erinnerung zu rufen, wo sie sind: als ob die Häuser, Straßen und Plätze nicht mehr wüssten, wo sie sich befinden; sie sind inmitten ihrer Bewohner verschwunden, die wiederum in eine Parallelwelt umgezogen sind. Die Passanten laufen nur dem Anschein nach durch die Straßen; sie bewegen sich aber in ihren Köpfen fort, in dem weitverzweigten Netz, die Augen auf ihre leuchtenden Rechtecke gerichtet. Die Menschheit hat beschlossen, die Orte hinter sich zu lassen, und lebt jetzt in ihren eigenen Gedanken.
Auch in Venedig brauchst du die Augen nur ein wenig nach oben zu richten und wirst viele Schilder sehen, gemalt oder an einer Hauswand angebracht, mit Pfeilen, die dir sagen: Du musst hier lang gehen, lass dich nicht durcheinanderbringen, Zum Bahnhof, Nach San Marco, Zur Accademia. Lass sie links liegen, achte nicht darauf. Warum willst du gegen ein Labyrinth ankämpfen? Folge ihm doch einfach. Keine Sorge, die Gassen bestimmen deinen Weg, und nicht umgekehrt. Lerne, dich treiben zu lassen, umherzuschweifen. Lass dich in die Irre führen. Schlendere dahin.
Mach auch du »den Venezianer«. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielte diese Redensart auf unsere Fußballmannschaft an, »den Venezianer machen«, »es wie Venedig machen«. Die Art, wie die Venezianer Fußball spielten, war nervtötend: egoistisch, immer den Fuß am Ball, viel Dribbling und wenige Pässe, kaum Spielübersicht. Kein Wunder: Die Fußballer waren ja in einem Gewirr aus schmalen Gassen, Sträßchen, Biegungen und Engstellen aufgewachsen. Um zur Schule zu gelangen, war der kürzeste Weg immer der durchs Wollknäuel. Und so sahen sie auch weiterhin Gassen und kleine Plätze vor sich, wenn sie in Trikots und kurzen Hosen den Rasen betraten, selbst auf einem völlig leeren Spielfeld, und versuchten, sich aus ihrer persönlichen Labyrinth-Halluzination zwischen Mittelfeld und Strafraum herauszuwinden.
Stell dir vor, du wärst ein rotes Blutkörperchen, das in den Venen dahintreibt: Folge dem Herzschlag, lass dich von diesem unsichtbaren Herzen voranpumpen, bis in die Haargefäße der Sträßchen hinein. Vielleicht bist du ja auch ein Bissen, der in den Eingeweiden transportiert wird: Die Speiseröhre einer engen Gasse drückt dir Backsteinwände entgegen, bis du beinahe zermalmt wirst, speit dich aus, lässt dich durch das Ventil einer Brücke entschlüpfen, die sich über das Wasser spannt, woraufhin du in einem geräumigen Magen landest, einem Platz, wo du nicht weitergehen kannst, ohne ein wenig ausgeruht zu haben; du musst stehenbleiben, weil die Fassade einer Kirche dich zwingt, sie anzuschauen, dich tief im Innern chemisch verwandelt und verdaut.
Die einzige Route, die ich dir empfehlen möchte, hat einen Namen. Sie heißt: Zufall. Untertitel: Ohne Ziel. Venedig ist klein, du darfst dich also ruhig verlaufen, denn weit kommst du sowieso nicht. Du gelangst immer an einen Rand, an ein Ufer, hast die Lagune vor dir. In diesem Labyrinth gab es bis vor wenigen Jahren keinen Minotaurus, kein Monster, das seinen Opfern auflauert, um sie zu verspeisen. Heute hingegen musst du aufpassen. Sieh dich vor, es gibt Taschendiebe, vor allem in der Umgebung der Piazza San Marco, an den überfüllten Bootsanlegestellen, auf den Vaporetti. Inzwischen gibt es Angriffe sowohl auf Touristen als auch auf Einwohner: als hätte sich Venedig, diese Mini-Metropole, vorgenommen, mit anderen Weltstädten gleichziehen zu müssen. Als ich aufs Gymnasium ging, kam eine amerikanische Freundin von mir zum ersten Mal in einer Winternacht nach Venedig. Sie fand ihr Hotel nicht und wanderte immer ängstlicher durch die verlassene Stadt, die Adresse ganz unnötig auf einem Zettel notiert. Je mehr Minuten vergingen, umso überzeugter war sie, gleich vergewaltigt zu werden. Sie konnte es nicht fassen, dass sie seit drei Stunden in einer fremden Stadt unterwegs war und noch niemand sie überfallen und ihr die Koffer zu klauen versucht hatte. Sie kam aus Los Angeles.
Heute terrorisieren jugendliche Banden die Passanten und schlagen mit Fäusten oder Flaschen auf sie ein, einfach so, zum Spaß. Es gibt auch den einen oder anderen Dieb, der in den versteckten Gassen Leute überfällt. Vor ein paar Monaten, als ich vor der Notaufnahme Schlange stand, lernte ich einen jungen Israeli mit gebrochenem Unterarm kennen. Er hatte gerade das Hotel verlassen, um zum Flughafen zu gelangen, als er von einem Mann zu Boden gestoßen wurde, der ihm den Koffer aus der Hand riss und ihm dabei den Arm brach.
Am touristischen Fähr-Terminal am Tronchetto existiert ein widerrechtliches Transportsystem, das sich allmählich breitgemacht hat und nun einfach hingenommen wird. Ins Leben gerufen hat es eine Bande von Kriminellen, die in den Neunzigerjahren zerschlagen wurde; einige der Verurteilten haben ihre Strafe abgesessen und sind inzwischen wieder frei; sie haben das Geld aus den Raubzügen, das sie zur Seite schaffen konnten, für den Kauf von Booten verwendet, um Touristen nach San Marco zu bringen. Ihre Tarife liegen unter denen des öffentlichen Nahverkehrs, weil sie keine Steuern zahlen. Sie benutzen abgefeimte, auch illegale und gewalttätige Methoden, um die Leute abzufangen, die gerade ankommen. Eine spanische Touristenführerin haben sie zusammengeschlagen, weil sie sich weigerte, ihre Schützlinge in diese ungenehmigten Boote einsteigen zu lassen.
Auch in Murano gibt es sie; dort geben sie sich als von der Kommune autorisierte Angestellte aus. Sie tragen gefälschte Schildchen auf der Brust und Mützen mit der Aufschrift »Venezia«, überreden dich, die Glaswarengeschäfte ihrer Wahl zu besuchen, zulasten der anständigen Produzenten und Händler.
Das Geld fördert die übelsten Seiten des Menschen zutage. Vielleicht wurde es zu diesem Zweck erfunden. Eigentlich sollte es einen gegenteiligen Zweck erfüllen, nämlich alle zu besänftigen. Das italienische Wort »pagare«, bezahlen, stammt vom Lateinischen pax, pacis, »Friede«. »Pagare« bedeutet »pacare« – befrieden, den Frieden wiederherstellen. Jemandem Geld zu geben ist eine Art, Konflikte zu beschwichtigen und die Schieflage zwischen dem, der gibt, und dem, der empfängt, wieder auszugleichen. Der Umgang der Menschen miteinander ruft Schuld, Unrecht und Revanchegelüste hervor. Immer schwebt die mögliche Fehde über den zwischenmenschlichen Beziehungen. Das Geld ist erdacht worden, um Racheakte und Vergeltungssucht auszuschalten, um Frieden zu schaffen und es anderen zu entgelten – stattdessen verursacht es noch blutigere Auseinandersetzungen.
Venedig will Geld von dir. Es versetzt dich in die Position des Schuldners, noch ehe du es darum gebeten hast, dir etwas zu verkaufen. Es erpresst dich mit seiner Schönheit, lässt sie sich von dir bezahlen, damit zwischen euch wieder Frieden herrscht, als schuldetest du ihm etwas, nur weil es eben da ist.
Die Eingänge zu den Geschäften, den Läden und Restaurants sind wie Poren, die dich einsaugen wollen. Du schlenderst so dahin, doch deine Füße werden zu einem Schaufenster umgeleitet: offensichtlich, um dir etwas zu verkaufen, in Wirklichkeit jedoch, um Venedig zu besänftigen, um dich zu versöhnen und dich für den Anblick, den es dir bietet, bezahlen zu lassen. Schönheit ist habgierig, sie erheischt Entschädigungen und Bußgelder. Zumindest ist das die Deutung der Venezianer ihres Gründungsmottos, das in Versalien in dem offenen Buch zwischen den Klauen des geflügelten Löwen steht: Pax tibi Marce evangelista meus. Die Legende fußt auf einer zwölf Jahrhunderte zurückliegenden Begebenheit. Zwei Kaufleute aus der Lagune, Bon da Malamocco und Rustego da Torcello, raubten die Leiche des heiligen Markus in Alexandria und brachten sie nach Venedig. Wie hatten sie das bewerkstelligt? Indem sie sie inmitten des Schweinefleischs versteckten, das für Muslime tabu ist. Bon und Rustego überquerten das Mittelmeer und fuhren dann die Adria hinauf: das Schiff mit der kostbaren Leiche beladen; die Seele von schweren Gewissensbissen belastet. Natürlich war es ein genialer Einfall gewesen, um die arabischen Zollkontrollen zu umgehen. Aber sie hatten den Leib eines Heiligen unterm Schweinefleisch vergraben. Und was für einen Heiligen: einen Evangelisten! »Haben wir ihm genügend Respekt erwiesen?«, fragten sie sich. »Ist er jetzt böse mit uns?« Als sie in der Lagune ankamen, sorgte ein Engel dafür, dass die Sache wieder ins Reine kam. Er erschien dem Heiligen und sagte: Pax tibi, Marce. Für gewöhnlich lautet die Übersetzung: »Friede sei mit dir, Markus.« Aber in den Ohren der Kaufleute klang es sicherlich wie »Keine Sorge, Markus: Ich vergelte es dir.«
Als ich noch Raucher war, bekam ich beim Anblick einer wunderschönen Landschaft immer Lust, mir eine Zigarette anzuzünden, während ich die Landschaft in Ruhe betrachtete. Ich wollte die Angst lindern, die mir die Schönheit einflößt, wollte das, was ich sah, physisch erfassen, auch mit dem Atem schauen, als würde ich beim Inhalieren meinem Körper eine kondensierte Version des Panoramas einverleiben, seinen Gegenwert in Gasform. Mir wurde bewusst, dass sich, seit ich nicht mehr rauche, diese Art, die Unruhe zu besänftigen, auf das Geld übertragen hat: Ich baue meine ästhetische Erregung ab, indem ich einen kleinen Einkauf tätige. Ich kaufe einen Bleistift, eine Zeitung. Ich erkaufe mir Erleichterung. Ich bezahle, befriede, besänftige.
Setze deinen Spaziergang fort, biege in verlassene Gassen ein, in denen es weder Geschäfte noch Espressobars gibt und in denen dir niemand etwas verkaufen will. Sie wurden für dich entworfen, damit du dich wie ein Teilchen fühlst, das von der Trägheit des Seins angetrieben wird. Streune in diesen zwischen die Häuser gezwängten Sträßchen herum. Du findest dich in architektonischen Schluchten wieder, Canyons aus ausgewaschenen Mauerziegeln, verkrustetem Putz, dunklen Fenstern. Das Licht dringt hier nur mit Mühe herein. Dort oben glitzern die Dächer, Balustraden und Fenster im hellen Sonnenlicht, doch nach unten zu werden die Schatten dichter und drängen sich zusammen. Wer wohnt in diesen düsteren Unterwelten? Wer hat sich entschieden hier zu leben, in diesen schlecht beleuchteten Erdgeschossen? Jede vermoderte kleine Tür ist der Zugang zu einer anderen Welt; ein widerwärtiger Schlund zieht dich hinab ins Vergessen, in den Verfall. Die Venezianer sind janusköpfige Wesen: halb Eremiten, halb Entertainer. Venedig ist ein abgezirkeltes Kloster mit den weltlichen Dingen zugetanen Mönchen, ein Bienenstock voll urbaner Einsiedler. Auf den Plätzen, den Campi und Campielli, treffen sie Gott und die Welt, auch unfreiwillig; die Stadt zwingt sie zur Geselligkeit, fordert Fröhlichkeit von ihnen. Der Kontakt mit anderen führt zu Verbrennungen; um diese zu heilen, ziehen sie sich zurück in ihre dunklen Höhlen, ihre feuchten Grabstätten.
Setze deinen Spaziergang fort. Versuch zu vergessen, so gut das geht. Venedig ist ein Niemandsdrom, ein Parcours, der erfunden wurde, damit jeder sich seiner Identität entledigen kann. Lass dich treiben. Wenn du dich nicht mehr auskennst, triffst du bestimmt einen Venezianer, der dir freundlich zeigen wird, wie du wieder zurückfindest. Wenn du überhaupt wieder zurückfinden willst.
Sichverirren ist der einzige Ort, den anzusteuern sich lohnt. Im Grunde kannst du, mit einer gewissen Vorsicht, überall hingehen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Es gibt keine verrufenen Viertel, oder zumindest nicht mehr.
Als Kinder hatten wir Angst, nach Santa Marta zu gehen, einer sehr belebten Gegend im sestiere Dorsoduro. In der Mittelschule lebten wir in ständiger Furcht vor einer legendenumwobenen Gestalt. Er wurde Jekyll genannt, war ein paar Jahre älter als wir und prügelte angeblich auf jeden ein, der ihm in einer verlassenen Gasse über den Weg lief. Ein Junge war sogar am Fuß des Ponte dell’Accademia ins Wasser gesprungen, um seinen Fausthieben zu entgehen. Auf dem Weg von der Schule mieden wir daher die versteckten Gässchen, auch wenn es bequeme Abkürzungen waren. Eines Tages hatten zwei meiner Klassenkameraden und ich allerdings zu großen Hunger und wollten unbedingt so rasch wie möglich an den heimischen Esstisch. Nach dem Rio San Trovaso blieben wir daher nicht auf den belebten Fondamente am Rio della Toletta, sondern schlugen uns durch die schmalen Seitengassen. Rate mal, wer uns da begegnete. Sobald er uns sah, blieb Jekyll stehen. Stell dir ein Duell in der Sonne vor, mit Revolvern, wie in einem Western; nur dass dieses Duell nicht auf einem Platz stattfand, sondern in einem schmalen Gang, zwischen den zwei Mauern, die ein schmales Sträßchen flankierten und keine Fluchtmöglichkeit boten. Es war unmöglich, ihn zu ignorieren und in der kaum einen Meter breiten Gasse einfach vorbeizugehen. Unter einem Vorwand sprach uns Jekyll auf Venezianisch an. Idiotischerweise antwortete ich darauf. Indessen zwängten sich meine beiden Kameraden rasch an ihm vorbei. Ich stand buchstäblich mit dem Rücken zur Wand vor ihm, in der irrsinnig schmalen Calle del Pistor. Er funkelte mich mit seinem Junge-aus-armem-Viertel-Grinsen an. In seinen Augen war ich ein typischer Vertreter der Oberschicht, der auf die Mittelschule ging, weil er eine Familie hatte, die sich um ihn kümmerte. Allein deshalb, so seine Logik, hatte ich eine Strafe verdient. »Schau, ich bin genau wie du«, versuchte ich es, »ich wohne in einer winzigen Wohnung, meine Eltern sind nur in die Grundschule gegangen …« Es war keine gute Idee, ihn mit einer soziologischen Analyse besänftigen zu wollen. Er holte aus, um mir einen Fausthieb ins Gesicht zu verpassen. Ich wich blitzartig aus. Er konnte sich nicht mehr bremsen: Anstatt mir das Nasenbein zu brechen, trafen seine Knöchel mit voller Wucht die Backsteinwand neben meinem Kopf. Ich flitzte davon, während Jekyll sich vor Schmerzen krümmte und dabei fluchte. Er hielt sich die Hand, das Grinsen hatte sich in eine schmerzverzerrte Grimasse verwandelt.
So wurde Venedigs Labyrinth mit seinen nur einen Meter breiten Gassen zur Ursache und zur Lösung, als ich einem der ersten Minotauren meines Lebens begegnete. Als zweigesichtige, scheinheilige, diplomatische Stadt hat Venedig für keinen von uns beiden Partei ergriffen. Erst hat es Jekyll ermöglicht, mich anzugreifen, und sich auf meine Kosten zu seinem Komplizen gemacht, dann hat es mich gerettet, indem es ihm Einhalt gebot und ihm die Faust durch die Gleichgültigkeit seiner Mauern zerschmetterte.
Während du weitergehst, solltest du dich mit den Bezeichnungen in Venedig vertraut machen; nenne sie nicht Viertel, sondern sestiere, Sechstel, denn es gibt sechs Viertel in der Altstadt: Sie bilden je ein Sechstel Venedigs, nicht ein Viertel; das Wort Viertel, quartiere, hat seinen Ursprung in den vier Häusergruppen jener Städte, die an der Kreuzung zweier wichtiger Handelsstraßen entstanden, in den vier von einem Straßenkreuz durchschnittenen Erdschollen. Venedigs sestieri heißen Santa Croce, Cannaregio, Dorsoduro, San Polo, San Marco, Castello. Die Hausnummern an den Türstöcken fangen nicht in jeder Gasse bei eins an, sondern werden im ganzen sestiere durchgezählt. Das sestier de Castello erreicht die Rekordziffer 6828, bei der Fondamenta Dandolo, zu Füßen des Ponte Rosso. Auf der anderen Brückenseite, am Ende der Calle delle Erbe, endet das sestier de Canaregio bei Nummer 6426. In Häusern mit so hohen Hausnummern zu wohnen hat sein Gutes; man fühlt sich dann nicht so schnell als etwas Besonderes.
Die Pflastersteine sind einer nach dem anderen in den Boden eingelassen, in langen, säuberlich getrennten Reihen. Sie geben die Richtung der Gassen vor, unterstreichen ihren Fluchtpunkt. Sie sind so lang wie der Schritt eines Kindes und müssen speziell für sie entworfen worden sein. Doch die Kinder machen sich einen Spaß daraus, darauf zu laufen, ohne je auf die Fugen zu treten. »Nicht von der Linie abweichen!«, sagte Salvador Dalí, als er das Kompositionsprinzip seiner Malerei erläuterte, die so reaktionär in der Form und so verrückt im Gehalt ihrer Vision ist. Kinder in Venedig gewöhnen sich daran, die Linie nicht zu überschreiten, die Umrisse der Formen zu respektieren: Zugleich lernen sie, deren Inhalt auf den Kopf zu stellen. Die Schrittlänge ihrer kleinen Beine passt sich der Länge des maségno an. Der Rhythmus des Körpers folgt dem des Pflasters. Das Innere rechnet mit dem Äußeren, lebt das Ungleichgewicht zwischen Spontaneität und Gesetz; es erlegt sich Selbstdisziplin auf und plant bereits die heimliche Revolte. Huldigen venezianische Füße dem Status quo, um ihn dann auf visionäre Weise zu entstellen? Sieh nur, was für ein surreales Delirium, was für ein absurdes Traumgebilde wir da errichtet haben, indem wir eine Milliarde gleichförmiger, absolut rechtwinkliger Quader aneinandersetzten. Jeder maségno ist ein blindes Emblem, ein leeres Wappen: Keine heraldische Figur ziert es, nur eine graue Grundierung; es ist eine Schiefertafel ohne Schriftzeichen. Die einzige Zeichnung ist seine Umrandung. Es besteht aus Hintergrund, weil seine Gestalt mit seinem Hintergrund in eins fällt, mit seinen Außengrenzen. Weit mehr als der geflügelte Löwe ist der maségno das perfekte Wappen Venedigs, jene in ihr Profil eingelassene, in ihren Umriss gepresste, vom Wasser abgesonderte Stadt, ohne Möglichkeit, sich auszubreiten, sich selbst zu überwinden, verrückt geworden vor lauter Grübelei und Introspektion.
Carlo Goldoni ist der Meister dieses unerbittlichen Syndroms. Er schrieb Komödien, die bei genauerem Hinsehen Essenzen verschiedener Orte sind: Man nehme, schön nacheinander, einen Campiello oder eine Locanda mit einer Wirtin oder ein Kaffeehaus oder einen Spielsalon. Man presse diese Orte aus wie bei einer Spremuta, bis alle denkbaren sozialen Beziehungen durchgespielt sind, um den Saft all dessen, was da drin geschehen kann, zu gewinnen. Shakespeare unternimmt Streifzüge in die ganze Welt; in jeder seiner Komödien oder Tragödien stürzt er sich auf eine Geschichte und deren Verwicklungen: Die Schauplätze wechseln von Akt zu Akt, von Szene zu Szene; er ist der englische Eroberer, der den Globus für sich einnimmt. Goldoni ist der Venezianer, der sich auf seine Lagune beschränkt und einen einzigen Schauplatz genau betrachtet: Seine Komödien sind Versuche, die venezianischen Schauplätze erschöpfend zu beschreiben, sie begnügen sich mit dem, was vorhanden ist, und ziehen den größtmöglichen Gewinn daraus; die feine Ironie, die über seinen Stücken liegt, hilft dabei, einen von der Melancholie zu heilen.
Geschickt wurden die maségni einer neben den anderen gesetzt, ohne Bindemittel. Immer wieder werden Stimmen laut, die heutigen Gebräuche missachteten die althergebrachte Technik: Die Arbeiter kleben hastig mit Zement einen maségno an den anderen, außerdem imitieren sie, quasi zum Spaß, die Trennlinie zwischen den Steinen – die sogenannte fuga –, indem sie den noch frischen Zement einritzen. Du kommst an Baustellen vorbei, da wird das Pflaster aufgeschlitzt, damit eine Leitung ausgetauscht, ein Rohr der Wasserversorgung geschweißt oder eine Abwassergrube gereinigt werden kann; du siehst die auf einer Seite aufgehäuften maségni neben dem Erdloch: Sie sind massiv, schwer, zwanzig Zentimeter dick; die Arbeiter setzen sie wieder an ihren Platz, aber in einer anderen Reihenfolge als zuvor. Venedig ist immer gleich und doch immer anders, wie ein Stoß mit tausend Spielkarten, ein Domino mit tausend Steinen, die unablässig neu gemischt werden. Es ist ein Buch aus tausend Wörtern, die unendlich oft wieder neu kombiniert werden.
Tritt du ruhig auf die Fugen der maségni: Du wirst millimeterdünne Unebenheiten unter deinen Sohlen spüren, gesprungene Fugen, abgetretene Stellen, Löcher. Ein französischer Herr namens Marcel ist als kleiner Junge im Baptisterium von San Marco draufgetreten und hat sie für immer im Gedächtnis behalten.
Am einundzwanzigsten November, dem Fest der Madonna della Salute, musst du dich genau in die Mitte der achteckigen Kirche stellen, unter den bleiernen Leuchter, der viele Meter von der Kuppel herabhängt; du streifst, wie es Tradition ist, mit der Schuhsohle über die bronzene Tafel, die in den Boden eingelassen ist; berühre mit der Schuhspitze die Inschrift unde origo inde salus in der Metallplatte: Das Heil kommt vom Ursprung; der Ursprung ist die Erde, über sie zu wandeln bringt Glück, tut gut; Gesundheit pflanzt sich von den Füßen aufwärts fort.
Im Frühjahr, auf den Zattere, musste ich als kleiner Junge aufpassen, wo ich hintrat: Nachts ging dort so mancher Venezianer zum Fischen hin, lockte mit Lampen und Leuchten die verliebten Tintenfische an, fing sie mit einer Art großem Schmetterlingsnetz. Aus der Tiefe des Eimers spritzten die gefangenen Tiere mächtige Tintenstrahlen auf die Ufersteine, befleckten hinterrücks Schuhe und Hosen.
Ab und an begegnet dir ein Tourist, häufiger eine Touristin, die ihre Absätze satt hat; sie zieht sich die Schuhe aus und läuft barfuß: Ihre Fersen stechen noch deutlicher hervor auf den jahrhundertealten maségni