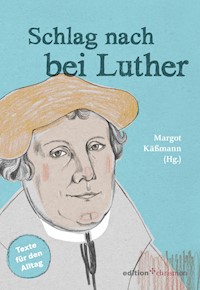17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: bene! eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Die bekannte Theologin Margot Käßmann weiß, wie schwer es ist, zu vergeben, wenn einem Unrecht getan wurde. Und doch ist es der einzige Weg, Frieden zu finden. Denn die Wut und der Schmerz schaden vor allem uns selbst – und nicht dem Täter oder der Täterin. In diesem Buch zeigt die Bestseller-Autorin Wege auf, wie Vergebung gelingen kann. Gerade als Christinnen und Christen dürfen wir wissen: Am Ende leben wir alle von Vergebung! Vergeben zu können ist eine der schwierigsten Herausforderungen, vor der wir stehen. Jeder Mensch erfährt im Laufe seines Lebens Leid, das ihm andere Menschen zufügen. Manchmal ist der Groll so stark, dass er uns zu überwältigen droht: die Verletzungen beim Scheitern einer Ehe, der Ärger über den Bruder, der uns tiefes Unrecht zugefügt hat. Oft bemerken wir das überwältigend negative Gefühl erst, wenn es schon zu spät ist: ein Elternteil ist verstorben, und wir spüren ungeklärte Konflikte, die uns auf der Seele lasten. Der innere Friede geht verloren, und stattdessen bestimmen uns Wut und Ärger. Einfühlsam vermittelt Margot Käßmann, wie es gelingen kann, zu verzeihen und sagt: »Auch wenn es uns sehr schwer fällt zu verzeihen: Immer wieder habe ich erfahren, wie gut es tut, wenn es gelingt. Nur so können wir wieder frei werden!«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Margot Käßmann
Vergebung – Die befreiende Kraft des Neuanfangs
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Vergeben zu können ist eine der schwierigsten Herausforderungen, vor der wir stehen. Jeder Mensch erfährt im Laufe seines Lebens Leid, das ihm andere Menschen zufügen. Manchmal ist der Groll so stark, dass er uns zu überwältigen droht: die Verletzungen beim Scheitern einer Ehe, der Ärger über ein Geschwisterteil, das uns tiefes Unrecht zugefügt hat. Oft bemerken wir das extrem negative Gefühl erst, wenn es schon zu spät ist: Ein Elternteil ist verstorben und wir spüren ungeklärte Konflikte, die uns belasten. Einfühlsam vermittelt Margot Käßmann, wie es gelingen kann, zu verzeihen. Sie berichtet von konkreten Fällen rund um Paare, Eltern und Kinder, Täter sowie Opfer und beleuchtet dabei auch theologische Aspekte und historische Zusammenhänge.
»Immer wieder habe ich erfahren, wie gut es tut, zu verzeihen. Nur so können wir wieder frei werden!«
Margot Käßmann
Inhaltsübersicht
Vergeben kann befreien, aber [...]
Vorwort
1. Einander vergeben – Familienlasten und andere persönliche Verletzungen
Den eigenen Eltern vergeben
Schwiegerkinder
Kontaktabbruch
Erben
Freundschaften
Schule
Am Arbeitsplatz
2. Ehe und Partnerschaft
3. Ich kann nicht vergeben – anderen oder auch mir selbst
Sich selbst vergeben
4. Vergebung als Prozess
5. Vom Umgang mit Schuld
6. Biblische Aspekte
7. »Vergebung ist eine Waffe« – und Voraussetzung für Versöhnung
8. Wenn Institutionen um Vergebung bitten
9. Aus der Geschichte lernen
10. Vergebung im Strafrecht
Zuletzt: Vergebung macht frei
Vergeben kann befreien, aber niemand kann dazu gedrängt werden. Doch was kostet es mich, nicht zu ergeben?
Vorwort
Das Thema Vergebung treibt mich schon lange um. Immer wieder war es präsent in Seelsorgegesprächen und auch im persönlichen Kontext. Aber auch in öffentlichen Debatten frage ich mich oft: Kann es in einer bestimmten Situation Vergebung geben? Und wenn ja, was kann sie bewirken?
Wenn jemand getroffen wurde durch ein böses Wort, durch Betrug, durch Vertrauensbruch, gar durch ein Verbrechen, kann das zutiefst verletzen, ja das ganze Leben aus der Bahn werfen. Da entsteht eine Wunde, die schmerzt. Wie kann ich damit weiterleben? Wie dem Menschen noch begegnen, der mir das angetan hat?
In der Vaterunser-Bitte sprechen Menschen in aller Welt: »Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.« Gott wird gebeten, Schuld zu vergeben, und im Gegenzug erklärt der Mensch, auch er werde denen vergeben, die an ihm schuldig geworden sind. Das sagt sich leicht. Vergeben kann aber ungeheuer schwer sein. Weil der Schmerz in mir nagt. Weil das, was mir angetan wurde, so ungeheuerlich ist, dass es dafür keine Vergebung geben kann. Dabei ist die Erfahrung: Wer vergibt, löst sich aus der Macht des Täters oder der Täterin, verharrt nicht in der Opferrolle. Doch niemand kann zu Vergebung gedrängt werden. Für manche Menschen ist es schlicht nicht möglich, seinen Peinigern zu vergeben, etwa wenn sie als Kind brutal sexuell missbraucht wurden.
Und wie verhält es sich mit der Vergebung gegenüber Institutionen, etwa wenn sie Missbrauch vertuscht haben? Kann Vergebung für das Unrecht, das Nationen verursacht haben, möglich werden? Wir wissen gerade als Deutsche, wie schwer Aussöhnung nach einem Krieg gelingt. Aktuell stellt sich die Frage beispielsweise im Konflikt und den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine. Aber sie stellt sich auch hinsichtlich der Kolonialgeschichte, in der sich viele Länder an anderen schuldig gemacht haben.
Vergebung ist auch eine Machtfrage: Ich kann sie gewähren oder nicht. Wer an uns schuldig geworden ist, kann um Vergebung bitten. Sich selbst entschuldigen geht nicht. Vergeben heißt dabei nicht, kleinzureden, was war. Aber es kann eine befreiende Haltung sein, mit den Verletzungen umzugehen. Die Frage ist auch, ob ich vergeben kann, selbst wenn der Mensch, der an mir schuldig geworden ist, das gar nicht erbittet. Gibt es auch einseitige Vergebung?
Im Folgenden wird es um Paare gehen, um Eltern und Kinder, Täter und Opfer. Auch um weltweite Aspekte, um unser Land, unsere Kirchen – und um unser Justizsystem, das darauf beruht, dass Menschen neu anfangen dürfen. Konkrete Fälle kommen ebenso zur Sprache wie theologische Aspekte und historische Zusammenhänge.
Ich danke allen, die mitgedacht haben. Insbesondere meinem Lebenspartner Andreas Helm, der so manchen Spaziergang mit mir und dem Thema verbracht hat, sowie Stefan Wiesner vom bene!-Verlag, der wieder ein sehr konstruktiver Lektor war.
Hannover im Mai 2022,
Margot Käßmann
1. Einander vergeben – Familienlasten und andere persönliche Verletzungen
Die größten Verletzungen finden im ganz persönlichen Umfeld statt. Unsere Beziehungen in der Familie zu Eltern und Geschwistern, zu eigenen Kindern, Schwiegerkindern und Enkeln und natürlich auch zum Partner, zur Partnerin sind ja tragend in unserem Leben. Und weil es um sehr persönliche Gefühle geht, sind auch immense Emotionen im Spiel. Wird Vertrauen gebrochen, macht sich Enttäuschung breit, dann werden tiefe Gefühle in uns angerührt, die sich nicht einfach rational erklären oder bewältigen lassen. Es tut weh, von den Eltern missachtet zu werden. Der »Seitensprung« des Partners lässt Vertrautheit der Intimität zerbrechen. Der Betrug der Schwester fühlt sich an wie Verrat an der gemeinsamen Kindheit. Solcher Schmerz ist nicht leicht zu bewältigen. Er gräbt sich tief in unsere Seele ein, ist eine Verwundung, die wir in uns tragen. Und solcher Schmerz kann nicht so nebenbei glattgebügelt werden. Auch Schweigen verkleinert ihn nicht.
Anderen vergeben, das ist ein weites Feld. Was Vergebung im persönlichen Umfeld bedeuten kann, lässt sich am besten in Beispielen erzählen. Einige erzähle ich im Folgenden, wobei die Beteiligten und die Situation jeweils so verfremdet sind, dass niemand sie wiedererkennen kann.
Den eigenen Eltern vergeben
Der Mann hat seine Kindheit in schrecklicher Erinnerung. Er war der Älteste von fünf Geschwistern, sie lebten in einer engen Dreizimmerwohnung. Der Vater trank ständig zu viel Alkohol, verlor dadurch immer wieder den Arbeitsplatz. Das Geld war permanent knapp, so lange er denken kann. Am schlimmsten aber war, dass der Vater unberechenbar daherkam. War er betrunken, konnte er weinerlich sein oder plötzlich brutal zuschlagen. Es gab Schläge mit der Hand, mit der Faust, mit dem Gürtel – für die Kinder, aber auch für die Mutter. Der Junge war völlig verzweifelt. Der Vater war ihm kein Vorbild, die Mutter konnte er nicht wirklich schützen, die kleinen Geschwister nur ab und an. Zweimal floh er mit Mutter und Geschwistern ins Pfarrhaus. Der Pfarrer versuchte, mit dem Mann zu reden, aber es änderte sich nichts. Als der Vater früh starb, konnte der Junge, der inzwischen ein junger Mann war, keine Trauer, sondern nur Erleichterung empfinden. Er hasste seinen Vater für das, was er ihm in seiner Kindheit angetan hatte.
Inzwischen ist aus dem Jungen von damals ein älterer Mann geworden. Jahrzehnte konnte er nur mit Bitterkeit und Verachtung an seinen Vater denken. Inzwischen kommen andere Fragen. Warum war der Vater so? Was hat er als junger Soldat im Krieg erlebt?
Ihm wurde klar, dass er eigentlich so gut wie gar nichts über den Vater wusste, Gespräche über persönliche Fragen hatte es nie gegeben.
Wenn er all das betrachtet, wird der Mann rückblickend milder, verständnisvoller. Wirkliche Vergebung ist das noch nicht, aber es sind Schritte auf dem Weg dahin. Die Gedanken an den Vater werden versöhnlicher. Er versucht, ihn zu verstehen.
Vergebung kann ein langer Prozess sein. Sie ist kein Vorgang, der plötzlich geschieht. Mein Eindruck ist: Wenn wir älter werden, stellt sich tatsächlich das ein, was »Altersmilde« genannt wird. Wir können eher nachvollziehen, warum die Eltern damals auf eine bestimmte Art und Weise gehandelt haben. Das bedeutet nicht, dass etwa das brutale Prügeln eines Vaters gerechtfertigt wird. Es geht eher darum, sich in die Person hineinzuversetzen, um das Geschehen zu begreifen.
Ich habe mit großem Interesse die Bücher von Sabine Bode – über Kriegskinder, Nachkriegskinder, Kriegsenkel – gelesen. Sie schreibt: »Wie nicht anders zu erwarten, ist der Blick der Nachkriegskinder auf die Eltern, die häufig schon tot sind, milder geworden. Man zeigt Verständnis für deren Entsetzen über lange Haare, kurze Röcke, laute Musik und Knutschen in der Öffentlichkeit. Keine Frage, man hat den kaum vom Krieg erholten Erwachsenen viel zugemutet. Aber bereut wird es nicht. Die Zeit war überreif, darum war die Veränderung so radikal …«1 Ich kann das inzwischen gut nachvollziehen.
Die Jahre ab 1945 waren für die große Mehrheit der Deutschen entsetzlich schwer. Millionen hatten ihre Heimat verloren, nahezu jede Familie hatte Tote oder Vermisste zu betrauern, die Städte waren zerstört, die Winter waren hart, es ging ums Überleben. So fühlten sie sich als Opfer des Krieges, vielleicht auch der Nationalsozialisten, und konnten schlicht keinen Blick auf eigene Schuld werfen. Nach den Schrecken des Krieges ging es um Wiederaufbau, Nach-vorn-Schauen, das Leben genießen, so gut das möglich war. »Nur nicht zurückblicken«, war für viele die Devise.
Und gleichzeitig waren die Menschen natürlich geprägt von der Ideologie des Nationalsozialismus. Ehre, Pflicht, Treue – damit waren sie aufgewachsen. Der 1934 erschienene und in Millionenauflage verbreitete Erziehungsratgeber Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, geschrieben von der Ärztin Johanna Haarer (1900–1988), hatte geraten, Kinder nicht zu verwöhnen, nicht mit ihnen spielen, nicht zu viel Gefühle zu zeigen. Anstand und Ordnung hatten einen hohen Rang. Der ganze Freiheitsaufbruch der 20er-Jahre war von den Nationalsozialisten hinweggefegt worden. Und ihre auf enge Rollenzuschreibungen reduzierte Familienideologie wie ihre Werteskala spiegelten sich später auch in der Enge der 50er-Jahre wider.
Der Nachkriegsgeneration in der Bundesrepublik erschien das erdrückend. Sie stellte die Elterngeneration infrage, rieb sich an ihr, provozierte. „Wo wart ihr denn im Krieg?“, fragten sie. „Es kann nicht sein, dass ihr nichts mitbekommen habt vom Holocaust! Ihr gehört zu den Tätern, selbst wenn ihr nur geschwiegen habt!“ So kam es Ende der 60er-Jahre zu massiven Auseinandersetzungen und Verwerfungen. Mit langen Haaren, dem Ablegen der BHs, Rock ’n’ Roll und Kriegsdienstverweigerung forderten die jungen Leute die Alten heraus. Heute schmunzeln wir manchmal im Rückblick, aber die Emotionen waren tiefgreifend und heftig. Die Kriegsgeneration fühlte sich infrage gestellt und reagierte auf das Aufbegehren mit massiver Abwehr. Sie hatte nicht gelernt, über Konflikte zu reden, und sie war nicht bereit, sich den Anfragen zu stellen.
In meiner eigenen Familie waren die Debatten gewiss nicht so heftig wie in anderen Zusammenhängen. Aber ich habe auch aufbegehrt, wollte freier leben als meine Eltern. Heute denke ich: Wahrscheinlich hätte ich meine Mutter anders wahrgenommen, hätte ich mir klargemacht, was sie im Krieg erlebt hat. Die Infragestellung aller Überzeugungen, die sie als junge Frau hatte, die Einsamkeit im Internierungslager in Dänemark – ohne zu wissen, ob andere aus der Familie überlebt haben –, das hat sie natürlich geprägt. Und mein Vater? Er wurde, gerade achtzehn geworden, als Soldat ausgebildet und war es bis zu seinem 24. Lebensjahr, dann kam er in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Wir haben ihn als Jugendliche nicht gefragt, was er erlebt hat. Als ich sechzehn war, starb er.
Meinen Vater habe ich als stets liebevoll und zugewandt in Erinnerung. Und ich bin traurig, dass ich so wenig über ihn weiß. Auch ich bin inzwischen natürlich altersmilde geworden gegenüber den eigenen Eltern, so wie Sabine Bode das beschreibt. Aber mir ist klar: Mein Vater war Soldat im Krieg. Und auch er wird getötet haben. Ich hoffe, er war nicht an Massakern beteiligt. Doch ich weiß es nicht.
Wenn ich Freundinnen und Freunde frage, die in Ostdeutschland aufgewachsen sind, sagen sie, deutsche Kriegsschuld sei bei ihnen zu Hause überhaupt kein Thema gewesen. Die Führung der DDR erklärte ihr Land zum besseren deutschen Staat, die Schuldigen waren im Westen. Neben der innerdeutschen Grenze existierte schon vor der Abriegelung gegenüber dem Westen auch eine Mauer des Schweigens.
Mit Kriegsende waren die Schrecken des Krieges ja nicht ausgelöscht, Täter waren immer noch Täter und Opfer immer noch Opfer. Und die Ideologie des Nationalsozialismus, mit der ein ganzes Volk indoktriniert worden war, hatte sich nicht in Luft aufgelöst. Da waren Mütter, die Vergewaltigung ertragen hatten, Väter, die vergewaltigt und gemordet hatten. Und alle versuchten jetzt, irgendwie damit weiterzuleben. Darüber sprechen konnten sie nicht.
Ich frage mich, was das mit den Menschen gemacht hat. Deutsche Soldaten haben beispielsweise beim Massaker in Babyn Jar in der Ukraine nahe Kiew innerhalb von nur zwei Tagen mehr als 33000 Juden ermordet. Kinder, Frauen und Männer wurden erschossen. Lebende Menschen mussten sich auf die Leichen anderer legen. Viele Mädchen und Frauen wurden vor der Erschießung von den deutschen Soldaten vergewaltigt. Angeschossene, noch lebende Menschen wurden beim Sprengen der Ränder der Schlucht lebendig begraben. Die Kleider der Ermordeten wurden anschließend mit 137 Lkw an die NS-Volkswohlfahrt übergeben.
Wenn ich mir in Erinnerung rufe, was ich dazu gelesen und gehört habe, packt mich das Grauen. Und ich überlege auch: Die Männer, die das getan haben, kamen ja teilweise zurück »nach Hause«! Was macht es mit einem Mann, wenn er eine Frau zwingen kann, sich nackt auszuziehen, sie vergewaltigt und anschließend erschießt, ohne dass das irgendeine Konsequenz für ihn hat? Kann er je wieder normale Sexualität leben? Verfolgen ihn nicht in seinen Albträumen ein Leben lang die Schreie der Opfer?
Oder wenn ich an den Vater des Jungen denke, von dem ich erzählt habe: Musste der Vater sich mit Alkohol betäuben, um das alles zu vergessen, zu verdrängen? Hat er den Hass auf sich selbst in Gewalt an Frau und Kindern umgesetzt? Hat er um sich geschlagen, um zu vergessen?
Sabine Bode zeigt in ihren Büchern, dass auch die Generation der Kriegsenkel von den Erfahrungen der Großeltern geprägt ist. Die Traumata wirken fort bis in die Generation meiner Kinder. Auch heute gibt es Kriege. Und die Geflüchteten aus der Ukraine, aus Syrien und Afghanistan, die bei uns Schutz suchen, bringen ihre Traumata mit. Es ist wichtig, sich das bewusst zu machen, Worte dafür zu finden.
Vergeben heißt nicht gutheißen dessen, was geschehen ist, das festzuhalten, ist mir wichtig. Vergebung soll nicht beschönigen, was Täter anderen angetan haben. Aber sie kann es einordnen, sich annähern, vielleicht begreifen, wie es zu den Taten kam. Das ist gewiss nur mit zeitlichem Abstand möglich, nicht in einer akuten Situation. Und vielleicht auch manchmal erst nach dem Tod – beispielsweise dem der Eltern. Dann kann offen thematisiert werden, was damals geschah.
In ihrem Buch Verstehen statt verurteilen zeigen der katholische Mönch und Seelsorger Anselm Grün und der evangelische Arzt und Psychoanalytiker Bernd Deininger, wie Jesus selbst nie andere verurteilt. »Er nimmt den anderen an, wie er ist. Aber er zeigt auch Wege der Heilung und Verwandlung auf. Seine Wege der Heilung beziehen sich zunächst auf den Einzelnen, sie zielen aber letztlich immer auf ein neues Miteinander.«2
In mir hat sich erst eine gewisse Abneigung gegen diese Forderung, den anderen zu verstehen, gezeigt. Muss ich jemanden verstehen wollen, der seine Frau betrügt oder seine Kinder schlägt, das Vertrauen der Schwester missbraucht oder den Freund hintergeht? Bei der Lektüre wurde mir klar: Wenn ich versuche, zumindest zu verstehen, was im anderen vor sich geht, verändert das nicht nur meinen Blick auf den anderen, sondern auch das Gegenüber selbst. Mit einem solchen Blick auf die Situation kann mein Urteil auf eine gute Weise unsicherer werden. Wenn ich mich beispielsweise frage: Hätte ich nicht in einer ähnlichen Situation auch zur Täterin werden können? Oder: Wie verhältst du dich als Soldat, wenn es einen Befehl gibt, den du befolgen musst, weil du dein Leben riskierst, wenn du ihn verweigerst.
Gerne wären wir alle Heldinnen oder Helden. Aber in der Regel sind wir das nicht, sondern haben Angst um unser Leben, um das unserer Lieben, vielleicht auch nur um unsere Reputation. Der Blick auf den anderen kann mir klarmachen: Auch ich bin wankelmütig, habe Fehler gemacht im Leben, Schuld auf mich geladen. Ein solcher Blick relativiert nicht, dass Menschen schuldig werden, macht Schuld nicht weniger schwer. Aber es lässt demütiger auf die Schuld anderer blicken. Eine solche Haltung nimmt die Inbrunst der Überzeugung, genau zu wissen, was exakt richtig gewesen wäre.
Andererseits darf niemals ein Mensch zur Vergebung gedrängt werden, weil es sonst zu einem doppelten Machtmissbrauch kommt. Ich denke an Sabine, eine Frau, die von ihrem Vater sexuell missbraucht wurde. Es war ein grauenvolles Geschehen, das sie mir schilderte: Einmal in der Woche ging die Mutter zum Treffen mit Freundinnen. Das war stets der Abend der Vergewaltigung. Sabine wurde oft vorher krank, erbrach sich, bekam Fieber. Aber niemand erkannte die Symptome. Die Mutter war liebevoll, sorgte sich um die Tochter, begriff aber die Zusammenhänge nicht – oder wollte sie nicht begreifen. Sexueller Missbrauch war kein Thema, so etwas konnte es nicht geben. Davon gab es keine Vorstellung, dafür gab es keine Worte.
Sabine ekelte sich vor dem Vater. Sie entwickelte eine massive Essstörung, wurde ärztlich behandelt; aber niemand wollte offenbar damals in den 60er-Jahren thematisieren, was sich abspielte. Als Sabine dreizehn war, begann sie, sich zu wehren. Hatte vorher der Vater ihr gedroht, wenn sie es der Mutter erzählte, würde sie die Familie zerstören, drohte sie jetzt, es der Mutter, dem Pfarrer, der Lehrerin zu erzählen. Der Vater bekam Angst, sie schloss die Zimmertür ab, es herrschte fortan Schweigen. Mit sechzehn zog Sabine aus, begann eine Ausbildung und fuhr nie wieder nach Hause. Die Mutter litt darunter, verstand es aber nicht. Als der Vater starb, ging Sabine nicht zur Beerdigung.
Erst als vor ein paar Jahren Missbrauchsfälle ein öffentliches Thema wurden, suchte Sabine eine Therapeutin auf. Sie begriff nach und nach, wie der Vater ihr Leben zerstört hatte. Nie war es ihr möglich gewesen, entspannte Sexualität zu leben. Ihr graute davor, mit einem Mann ins Bett zu gehen, sie ekelte sich geradezu, nackt mit jemandem im Bett zu liegen. Jede Beziehung ging über kurz oder lang in die Brüche. Als ihr klar wurde, dass all ihre Empfindungen Folge des Missbrauchs waren, konfrontierte sie ihre alte Mutter damit. Die war völlig am Boden zerstört. Sabine nahm ihr ab, dass sie nichts geahnt, nicht begriffen hatte, was da vor sich ging. Mit der Mutter gab es Versöhnung. »Aber ihm verzeihe ich nie!«, sagt sie mit Blick auf ihren verstorbenen Vater.
Ich finde, eine solche Haltung verdient Respekt. Was dieser Vater seiner Tochter angetan hat, ist für sie lebenslänglich traumatisierend, zerstörend. Und dafür trägt allein er die Verantwortung. Es entschuldigt ihn nicht, sollte er – posthum – die eigene Kindheit ins Feld führen. Viele Täter, das zeigen Studien, sind selbst traumatisiert, haben sexuelle Gewalt erlebt. Das erklärt vielleicht manches. Aber es rechtfertigt in keiner Weise, die erfahrene Gewalt weiterzugeben.
Sabine hat durch die Therapie für sich selbst klären können, was geschehen ist. Sie konnte die eigene Schuldvorstellung begraben, die ihr Vater ihr einpflanzen wollte. Zumindest mit der Mutter konnte sie darüber reden. Manchmal geht es auch darum, als Opfer überhaupt sprachfähig zu werden und so nicht weiter in der Opferrolle festzusitzen.
Das gilt sicher insbesondere für sexuellen Missbrauch. Ich habe Kontakt mit mehreren Opfern, vor allem aus dem kirchlichen Bereich. Sexualität war in diesem Kontext lange Zeit tabuisiert, grundsätzlich als Sünde deklariert, nur »erlaubt« in der Ehe zur Zeugung von Kindern. Das hat dazu geführt, dass Sexualität als »gute Gabe Gottes« (so eine Denkschrift der Evangelischen Kirche Deutschland, EKD, aus dem Jahr 1971) gar nicht gedacht werden konnte. Sexuelles Begehren, erotische Erfahrungen, Lust am eigenen Körper waren in eine Verbotszone des schlechten Gewissens verbannt. Es gab keine Sprache dafür. Umso mehr blieb die Erfahrung sexueller Übergriffe, von Gewalt durch Priester, Pfarrer, Bischöfe und Diakone vollkommen im Bereich des Unaussprechbaren.
So belastend und schockierend die Aufdeckung sexueller Gewalt innerhalb der Kirchen ist, so positiv ist doch, dass endlich darüber gesprochen wird, dass Opfer offen von ihrem Leid erzählen können. Glasklare Aufdeckung der Verbrechen ist notwendig. Denn es geht um schwere Straftaten, die die Opfer ein Leben lang traumatisieren.
Dazu gehört auch: Wir brauchen eine Sprache, die von der Schönheit der Sexualität, von Liebe mit Verantwortung, in Vertrauen und ohne Gewalt erzählt. Dann kann auch ein Kind sich trauen, über das zu sprechen, was ihm angetan wird – weil es weiß, was gut und richtig ist. Und weil es weiß, dass Sexualität nicht etwas ist, über das man nicht sprechen darf.
Ich habe einmal in Brasilien eine Kindertagesstätte besucht, in der Dreijährige ein Lied lernten: »This is my body. No one may touch it, if I do not want it.« Das ist mein Körper. Niemand darf ihn berühren, wenn ich es nicht will. Mich hat das damals erst irritiert. Aber ich habe dann begriffen: Diese Kinder lernen, dass sexueller Übergriff böse ist, falsch, nicht erlaubt. So klein erst, haben sie schon eine Sprache dafür. Das ist gut so, Respekt! Doch dazu mehr im neunten Kapitel.
Opfer müssen nicht vergeben. Wenn sie es können, tut es ihnen sicher gut, verhilft zu innerer Freiheit. Druck dahin ist allerdings nicht hilfreich. Die Geschichten der Opfer müssen gehört werden, das ist entscheidend.
Schwiegerkinder
Für eine alleinerziehende Mutter, nennen wir sie Erika, ist der Sohn ihr ein und alles. Der Vater war nur eine flüchtige Begegnung, er hat nie erfahren, dass er einen Sohn hat. Viel haben Mutter und Sohn miteinander erlebt, es gab wahrhaftig schwierige Zeiten. Umso mehr sind beide eng und liebevoll verbunden.
Als der Sohn heiratet und mit seiner Frau später zwei Kinder bekommt, will die Mutter alles tun, damit es gut läuft mit der Schwiegertochter. Sie backt Kuchen zu den Geburtstagen, brät die traditionelle Gans zu Weihnachten, kümmert sich hingebungsvoll um die beiden Enkeltöchter, die ihr eine helle Freude sind. Uneigennützig macht sie das, aus Liebe, auch wenn es manchmal anstrengend ist neben der fordernden Berufstätigkeit.
Eines Tages führt eine Kleinigkeit zu einem Streit, der eskaliert. Schließlich erklärt die Schwiegertochter, sie habe die ständige Präsenz von Schwiegermutter Erika all die Jahre ertragen müssen. Diese Fürsorge sei ihr immer lästig gewesen, sie gehe ihr einfach nur auf die Nerven. Erika ist schockiert und zutiefst verletzt. Ihr Sohn ist hilflos. Die Enkeltöchter sind verstört. Sie spüren, dass etwas nicht stimmt, und wollen, dass alles wieder gut wird. Doch Erika ist klar: Das wird nie wieder, wie es war. Alle Unbefangenheit ist dahin. »Die Schwiegertochter hat meine Familie zerstört«, sagt sie.
Inzwischen versucht Erika, irgendwie damit klarzukommen. Sie will den Kontakt zu Sohn und Enkelinnen, die ihr unendlich viel bedeuten, nicht riskieren. Aber nie wieder hat sie ein Wort mit der Schwiegertochter gewechselt, es bleibt beim kühlen »Hallo« und »Tschüss«. Die Atmosphäre ist vergiftet, sosehr sie auch versucht, die Kontakte aufrechtzuhalten. Sohn und Enkelinnen spüren: Da ist ein Riss, der tief geht. Vergeben kann Erika der Schwiegertochter den Ton, die Anmaßung, die nachträgliche Herabwürdigung ihres Engagements nicht. Und sie fragt sich: Wie soll es je wieder zu einem guten Miteinander kommen? Doch die Verletzung sitzt zu tief, sie kommt nicht darüber hinweg.
Es ist schwer für Erika, von den heftigen Emotionen Abstand zu gewinnen und zu verhindern, dass die Enttäuschung und Verletzung nicht immer wieder die Oberhand gewinnen. Und doch wäre es gut. »Beim entscheidungsbasierten Vergeben geht es um das Bedürfnis nach Rationalität, also zu verstehen, warum man verletzt wurde«, habe ich in einem Interview mit Sonja Fücker, die als Soziologin an der Freien Universität Berlin tätig ist, gelesen. Und das kann ich nachvollziehen. Am Ende hat Erika genau das getan. Sie hat hingeschaut, was sie verletzt hat. Ihr wurde klar: Es war die offensichtliche Heuchelei der Schwiegertochter über all die Jahre. Im Nachhinein fühlt sie sich massiv belogen. Das verletzt. Und Erika hat eine absolut pragmatische Entscheidung getroffen: Sohn und Enkeltöchter sind ihr die allerwichtigsten Beziehungen in ihrem Leben. Die Schwiegertochter nicht. So tut sie gut daran, die Verbindung nicht abzubrechen. Das wäre für Sohn und Enkelinnen furchtbar, aber vor allem auch für sie selbst. Als Vergebung lässt sich das wohl nicht bezeichnen. Es ist eher ein pragmatischer Umgang mit Verletzung.
Allzu oft gibt es das in Familien. Da sind ausradierte Familiengeschichten, Familiengeheimnisse, Geschwisterkonflikte, die nie thematisiert wurden. Vielleicht, weil das Gefühl war: Wenn wir offen darüber sprechen, ist alles infrage gestellt. Ist Schweigen vielleicht nicht immer nur Schwäche, sondern durchaus Gold im Verhältnis zum Reden, das nach dem Sprichwort eher als Silber daherkommt?
Ich denke auch an eine Familie, nennen wir sie Müller, die vier Kinder hat. Das Jüngste ist irgendwie anders. Alle haben immer vermutet, dass es damals, neun Monate bevor die Kleine geboren wurde, einen sogenannten »Seitensprung« der Mutter gab. Darüber gesprochen wurde nie, auch nicht, als der Vater früh verstarb. Alle hatten Angst, die Familie könnte daran zerbrechen. Inzwischen hat die Mutter das Geheimnis mit ins Grab genommen. Aber es bleibt ein Stachel, es gibt ein ungutes Tuscheln. Familienfrieden ist anders. Die jüngste Tochter spürt das. Sie fühlt sich bei Treffen mit seinen Geschwistern unwohl, hält sich fern, weiß aber gar nicht genau, was die Ursache des Verhaltens ihrer Schwestern und Brüder ist. Wäre es da nicht besser gewesen, die Fakten auf den Tisch zu legen, als alle erwachsen waren? Da musste die Mutter doch noch nicht einmal um Vergebung bitten, sondern bloß die Wahrheit erzählen. Alle Spekulation hätte ein Ende gehabt. Ich denke, für die jüngste Tochter den jüngsten Sohn wäre es eine Erleichterung gewesen. Zumindest aber eine Erklärung.
Manchmal kann es natürlich auch gut sein, sogenannte Familiengeheimnisse zu wahren. Da müssen die Kinder nicht wissen, dass der Vater eine Geliebte hatte. Oder die Vergewaltigung der Mutter, durch die ein Kind zur Welt kam, ist bleibender Schrecken für sie. Aber ein Schrecken, den sie den Kindern nicht weitergeben will. Doch allzu oft meinen die Erwachsenen nur, es wäre nicht relevant, die Geheimnisse zu lüften. Doch sie brodeln unter der Oberfläche und verunsichern. Ich denke, es wäre in den meisten Fällen besser, offen über solche Themen zu sprechen, anstatt sie zu tabuisieren und so neue Traumata zu schaffen.
Kontaktabbruch
In ihrem Buch Löwenmut – Bericht einer verlassenen Großmutter erzählt Elvira Larssen, die offenbar unter einem Pseudonym schreibt, davon, dass durch Streit mit einer Tochter am Ende der Kontakt zu allen drei Töchtern und fünf Enkeln abriss. Sie hat alle seit Jahren nicht gesehen. Es lässt sich nicht genau sagen, wer letztlich Schuld daran hat, was ganz genau dazu führte. Aber wie sehr die Großeltern darunter leiden, das wird sehr deutlich.
Kontaktabbruch ist offenbar immer wieder in Familien der Fall. Mich erreichen von Zeit zu Zeit Schilderungen ähnlicher Geschichten, die tiefe Tragödien offenbaren. Trennungen, die großes Leid verursachen, über Generationen hinweg. Auch auf der Webseite grosseltern.de sind solche Geschichten zu finden.