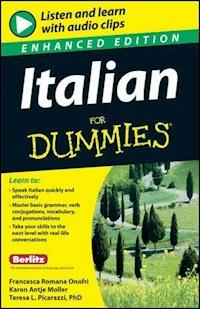Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
This volume presents the current state of knowledge on the topic of behavioural disturbances among young people, in the form of a handbook. It is concerned with children and young adults whose behaviour diverges from society=s expectations in undesirable ways - i.e., young people who show symptoms of neglect, psychosocial disturbances, delinquent behaviour and/or severe anxiety, depression and suicidal tendencies. The authors present effective educational approaches and measures in a clearly arranged way. They describe and evaluate diagnostic procedures, list tested and effective interventional methods and analyse the work and functioning of the relevant institutions. The book thus provides a comprehensive introduction for students and also up-to-date guidance for specialists.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1153
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Norbert Myschker, Roland Stein
Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen
Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Maßnahmen
8., erweiterte und aktualisierte Auflage
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
8., erweiterte und aktualisierte Auflage 2018
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-032966-9
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-032967-6
epub: ISBN 978-3-17-032968-3
mobi: ISBN 978-3-17-032969-0
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhaltsverzeichnis
Aus dem Vorwort zur 1. Auflage
Vorwort zur 8. Auflage
Einleitung
1 Historischer Überblick
1.1 Fünf historiografische Linien
1.1.1 Die sozialpädagogische Linie: Waisenhäuser – Rettungshäuser – Erziehungsheime – Heimschulen
1.1.2 Die kriminalpädagogische Linie: Zuchthäuser – Jugendstrafvollzug – Gefängnisschule
1.1.3 Die schulpädagogische Linie
1.1.3.1 Beobachtungsklassen – Erziehungsklassen – Kleinklassen
1.1.3.2 Sonderklassen – Sonderschulen – Integrierte Fördereinrichtungen
1.1.4 Die pädagogisch-psychiatrische Linie: Einrichtungen der Psychopathenfürsorge – Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie – Klinikschulen
1.1.5 Die berufspädagogische Linie: Arbeitserziehung – Industrieschulen – Fortbildungsschulen – Berufsschulen – Berufsbildungswerke – Benachteiligtenförderung
1.2 Begründer wichtiger Konzepte für die Pädagogik bei Verhaltensstörungen
1.3 Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen in der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur
2 Begrifflichkeit
3 Erscheinungsformen, Klassifikation und Verbreitung von Verhaltensstörungen
3.1 Erscheinungsformen (Symptome und Syndrome)
3.2 Verhaltensstörungen und Lernstörungen
3.3 Mehrfachbehinderung und Verhaltensstörungen
3.4 Verhaltensstörungen und Hochbegabung
3.5 Verbreitung von Verhaltensstörungen
4 Verursachung und Entstehung von Verhaltensstörungen
4.1 Der biophysische Aspekt
4.1.1 Der medizinische Aspekt
4.1.2 Der humanethologische Aspekt
4.2 Der psychologische Aspekt
4.2.1 Der psychoanalytische Aspekt
4.2.2 Der individualpsychologische Aspekt
4.2.3 Der humanistisch-psychologische Aspekt
4.2.4 Der lerntheoretische Aspekt
4.3 Der soziologische Aspekt
4.4 Der pädagogische Aspekt
5 Diagnostik bei Verhaltensstörungen
5.1 Der medizinische Ansatz
5.2 Der psychodynamische Ansatz
5.3 Der lerntheoretische Ansatz
5.4 Der interaktionistische Ansatz
5.5 Der sonderpädagogische Ansatz
5.5.1 Diagnostische Fragestellungen
5.5.2 Diagnostische Verfahren
5.5.2.1 Gespräche, Exploration und Anamnese
5.5.2.2 Verhaltensbeobachtung – Verhaltensbeurteilung
5.5.2.3 Schulleistungstests
5.5.2.4 Intelligenztests und spezielle Leistungstests
5.5.2.5 Persönlichkeitsverfahren und projektive Tests
5.5.2.6 Entwicklungstests
5.5.2.7 Soziografische Verfahren
5.5.2.8 Motodiagnostische Verfahren
5.5.2.9 Neuropsychologische Verfahren
5.5.2.10 Medizinische Verfahren
6 Erziehung, Unterricht, Therapie und Beratung
6.1 Erziehung, Unterricht und Therapie
6.1.1 Der biophysische Ansatz
6.1.2 Der psychoanalytische Ansatz
6.1.3 Der individualpsychologische Ansatz
6.1.4 Der entwicklungspsychologische Ansatz
6.1.5 Der humanistisch-psychologische Ansatz
6.1.6 Der lerntheoretische Ansatz
6.1.7 Der pädagogisch-therapeutische Ansatz
6.1.7.1 Das pädagogisch-therapeutische Erzieher-/Lehrerverhalten
6.1.7.2 Das spezifisch strukturierte Lebens- und Lernfeld
1 Offener Unterricht
2 Freinet-Pädagogik
3 Montessori-Pädagogik
4 Projektunterricht
5 Erziehung zu moralischem Urteilen (und Handeln)
6.1.7.3 Die pädagogisch-therapeutischen Verfahren
1 Pädagogisch-therapeutische Gesprächsführung/Hilfreiche Gesprächsführung
2 Spielen als pädagogisch-therapeutisches Verfahren
3 Pädagogische Kunsttherapie
4 Pädagogische Musiktherapie
5 Pädagogische Verhaltensmodifikation
6 Entspannung und Meditation als pädagogisch-therapeutische Verfahren
7 Pädagogische Mototherapie
8 Interventionen nach neurophysiologischen und neuropsychologischen Erkenntnissen
6.2 Beratung und Supervision
6.2.1 Der psychodynamische Ansatz
6.2.2 Der individualpsychologische Ansatz
6.2.3 Der lerntheoretische Ansatz
6.2.4 Der klientenzentrierte Ansatz
6.2.5 Der systemische Ansatz
6.2.6 Der pädagogische Ansatz
7 Pädagogische Institutionen für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen
7.1 Schulpädagogische Institutionen
7.1.1 Sonderschulen – Förderschulen
7.1.2 Kleinklassen
7.1.3 Integrative und inklusive Förderung
7.2 Sozialpädagogische Institutionen
7.2.1 Kindergärten – Kindertagesstätten
7.2.2 Heime
7.2.3 Heimschulen
7.3 Kriminalpädagogische Institutionen
7.4 Pädagogisch-psychiatrische Institutionen
7.5 Berufspädagogische Institutionen
8 Helfende Berufe bei Verhaltensstörungen
8.1 Ärztinnen und Ärzte
8.2 Diplom-Psychologinnen und -psychologen bzw. B. Sc. Psychologie und M. Sc. Psychologie
8.3 Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen
8.4 Analytische Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutinnen und -therapeuten
8.5 Kinderpflegerinnen und -pfleger – Erzieherinnen und Erzieher – Heilpädagoginnen und -pädagogen – Sozialpädagoginnen und -pädagogen (Diplom, BA, MA) – Pädagoginnen und Pädagogen (Diplom, BA, MA)
8.6 Motopäde/Motopädin – Mototherapeut/Mototherapeutin – Motologe/Motologin (Diplom, Master)
8.7 Förderlehrerinnen und Förderlehrer
9 Spezielle Störungen
9.1 Übermäßige Angst
9.1.1 Begriffsbestimmung
9.1.2 Formen der Angst
9.1.3 Der philosophische Aspekt
9.1.4 Der humanethologische Aspekt
9.1.5 Der psychologische Aspekt
9.1.6 Der soziologische Aspekt
9.1.7 Der pädagogische Aspekt
9.2 Aggression und Aggressivität
9.2.1 Formen der Aggression/Aggressivität
9.2.2 Der humanethologische Aspekt
9.2.3 Der psychologische Aspekt
9.2.4 Der soziologische Aspekt
9.2.5 Der pädagogische Aspekt
9.3 Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen
9.4 Psychophysische Störungen bei Kindern und Jugendlichen
9.4.1 Pica
9.4.2 Anorexia nervosa
9.4.3 Bulimia nervosa
9.4.4 Adipositas
9.5 Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen
9.6 Psychopathologische Syndrome
9.6.1 Schizophrenie
9.6.2 Depressivität
9.6.3 Autismus und Autismus-Spektrum-Störungen
9.6.4 Borderline-Syndrom
9.6.5 Tourette-Syndrom
9.6.6 Epilepsie
9.7 Delinquentes Verhalten – Kriminalität – Drogenabhängigkeit
9.7.1 Jugend-Delinquenz
9.7.1.1 Deliktstruktur
9.7.1.2 Soziokulturelle Merkmale der Straftäter
9.7.1.3 Persönlichkeitsstruktur der Straftäter
9.7.1.4 Erklärungsmodelle kriminellen Verhaltens
9.7.1.5 Maßnahmen
9.7.2 Drogenabhängigkeit
9.7.2.1 Psychotrope Substanzen und ihre Wirkung
9.7.2.2 Erklärungsmodelle
9.7.2.3 Maßnahmen
Verzeichnis der Abbildungen
Verzeichnis der Tabellen
Sachverzeichnis
Literaturverzeichnis
Aus dem Vorwort zur 1. Auflage
Es mag als Hybris aufgefasst und kann als Wagnis angesehen werden, sich angesichts der Komplexität der Thematik und des Umfangs vorliegender Untersuchungen, Konzepte und Theorien als alleiniger Autor mit Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen zu befassen. Der Begriff Hybris (altgriechisch: Übermut, Vermessenheit, Herausforderung der Götter) scheint mir deshalb am Platze zu sein, weil es für einen Einzelnen unmöglich ist, die gesamte relevante Literatur zu bearbeiten und mit eigenen Erkenntnissen und Vorstellungen zu verarbeiten. Es gilt also auszuwählen, Schwerpunkte, Akzente zu setzen und dennoch die Thematik sachgerecht und zeitgemäß, d. h. dem gegenwärtigen Forschungs- und Erkenntnisstand entsprechend, darzustellen. So ist auch das Wagnis gegeben, nicht auf das notwendige Verständnis zu stoßen, insbesondere bei denjenigen Fachkolleginnen und -kollegen, die nicht die entsprechende Berücksichtigung fanden oder andere Aspekte präferieren. Es lässt sich also vieles anders und vielleicht auch besser machen. Ich möchte deshalb den/die Leser/-in bitten, sich mit konstruktiv-kritischen Hinweisen und Anregungen an mich zu wenden.
Trotz der aufgezeigten Problemkonstellation lege ich das Buch vor aus der Überzeugung heraus, dass eine möglichst umfassende – wenn auch in Teilen verkürzte – Darstellung über Verhaltensstörungen im Kindes- und Jugendalter aus pädagogischer Sicht von historischen Betrachtungen bis zur Drogenabhängigkeit notwendig ist, um dem wachsenden Informationsbedürfnis einer breiteren Öffentlichkeit, insbesondere aber der Eltern und all derer zu genügen, die sich professionell mit schwierigen, hilfsbedürftigen jungen Menschen beschäftigen.
Eigene Arbeiten aus früherer Zeit, die auch gegenwärtig relevant erscheinen, wurden überarbeitet in den Text einbezogen.
Berlin, im Januar 1993
Prof. Dr. Norbert F. Myschker
Freie Universität
Vorwort zur 8. Auflage
Das Buch erschien erstmals 1993 und wurde bis zur 6. Auflage 2009 in alleiniger Autorenschaft aktualisiert, überarbeitet und in Teilbereichen ergänzt. Es fand großen Anklang und lohnte deshalb die vielen mit den Neuauflagen verbundenen Arbeiten und Mühen. Es ist also mittlerweile seit 25 Jahren auf dem Markt und wird von einigen Rezensenten als »Standardwerk« bezeichnet.
Ab der 7. Auflage zeichnen nunmehr zwei Autoren verantwortlich. Fachszene und Fachdiskussion haben sich weiter erheblich ausdifferenziert und befinden sich in einer enormen Dynamik. Es schien sinnvoll, die Last der Aktualisierung und der Ergänzung des Buches auf mehrere Schultern zu verteilen. Im Rahmen eines Autorenteams konnte diese Herausforderung angenommen werden.
Auch für die 8. Auflage war wieder viel Arbeitsaufwand nötig. Um eine stets angestrebte möglichst große Aktualität zu halten, musste eine Fülle von Daten in den Tabellen und Abbildungen sowie teilweise auch der darauf Bezug nehmende Text neu recherchiert und aufbereitet werden. Die Dynamik der Diskussion um die UN-Behindertenrechtskonvention und das Thema Inklusion wurde wieder verstärkt mit aufgenommen. Als schwierig gilt nach wie vor, dass sich nicht nur Sichtweisen und Strukturen verändern, dass Organisationsstrukturen wie etwa Beschulungsformen neu gedacht und konzipiert werden, sondern dass sich diese Entwicklung zudem in einem unwägbaren Fluss befindet. Soweit es zum aktuellen Zeitpunkt notwendig und sinnvoll erschien, wurde versucht, beiden Aspekten in der Textüberarbeitung sowie in den Ergänzungen Rechnung zu tragen.
Die Bologna-Reform zog für das Buch einige Konsequenzen nach sich: Berufsbilder und Studiengänge sind in erheblicher Veränderung begriffen; auch dies fand im Hinblick auf die Darstellung zu unterschiedlichen Professionen Berücksichtigung.
Ein herzlicher Dank gilt Sarah Rech und Philipp Hascher, stud. paed., für Anregungen und die gemeinsame kritische Diskussion. Weitere Danksagungen für den intensiven inhaltlichen Austausch im Kontext der Pädagogik bei Verhaltensstörungen sowie nützliche Hinweise gehen an das gesamte Kollegium des Lehrstuhls für Sonderpädagogik V der Universität Würzburg, für diese 8. Auflage besonders an Sophie Holtmann, Msc. Psychologie, sowie Dr. Tony Hofmann, Dipl.-Psych.
Weil am Rhein und Würzburg, November 2017
Norbert Myschker und Roland Stein
Einleitung
Kinder und Jugendliche, die Verhaltensstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensschwierigkeiten – oder wie immer die Problematik bezeichnet werden kann – zeigen, bringen durch ihr Verhalten zum Ausdruck, dass ihre Entwicklung, ihr Leben durch innere und/oder äußere Bedingungen beeinträchtigt, vielleicht sogar bedroht ist. Ihr Verhalten ist als Hilferuf aufzufassen. Noch nicht lange werden Verhaltensstörungen so gesehen und mit Hilfsmaßnahmen beantwortet. In einem historischen Überblick wird deshalb im Kapitel 1 zunächst dargestellt, wie früher mit Kindern und Jugendlichen, die unerwünschtes, als störend empfundenes Verhalten zeigten, umgegangen wurde. Ihnen wurden »Kinderfehler« zugeschrieben, sie galten als böswillig, schwer erziehbar oder gar unerziehbar und wurden hart bestraft. Nach der für »Problemkinder« äußerst schwierigen, ja gefährlichen Zeit der nationalsozialistischen Diktatur kommen erst in der Gegenwart verstärkt Erziehungs- und Unterrichtskonzepte zum Tragen, die den Bedürfnissen und Möglichkeiten dieser Kinder und Jugendlichen weitgehend gerecht werden.
Verhaltensstörungen stellen eine komplexe Problematik dar, die sich sowohl terminologisch als auch definitorisch nur annäherungsweise und unvollkommen fassen lässt. Gerade deshalb ist eine Auseinandersetzung mit relevanten Begriffen notwendig und bedeutsam. Wenn nach eingehender begrifflicher Diskussion eine terminologische Festlegung im 2. Kapitel vorgenommen wird, handelt es sich jedoch weniger um eine Definition im Sinne von etwas Endgültigem als vielmehr um einen Umschreibungsversuch, der für Veränderungen offen ist und seine Legitimation aus der Notwendigkeit zur Verständigung bezieht.
So verschieden, wie die Veranlagungen sind, mit denen Kinder auf die Welt kommen, sind die Bedingungen, unter denen sie aufwachsen und menschengerecht, sozialadäquat erzogen oder auch verzogen, vernachlässigt, misshandelt, missbraucht werden. Diese Verschiedenartigkeit drückt sich in ihrem Sein und – bei pathogenen Bedingungen – in den durch ihr Verhalten demonstrierten Hilferufen aus.
Es wird also ausführlich auf die Erscheinungsformen einzugehen sein – und auch auf die Verbreitung von Verhaltensstörungen, denn nur wenn zu der Prävalenz einer Problematik Aussagen gemacht werden können, werden die notwendigen Ressourcen zu beantragen und evtl. auch zu erhalten sein (Kap. 3).
Ausführlichkeit im Rahmen des Möglichen gebührt auch den Ursachen und der Genese von Verhaltensstörungen (Kap. 4). Dabei ist zu explizieren, dass Verhaltensstörungen sich multidimensional darstellen und multifaktoriell bedingt sind. Das Verhalten des Menschen wird bestimmt durch das interdependente Wirken genetischer, sozialer und arbiträrer Komponenten, d. h. durch Anlage und Vererbung, durch Umweltbedingungen und durch Selbststeuerungsmöglichkeiten und Selbstbestimmungstendenzen. Sowohl die mehr den Vererbungstheorien zuneigenden Forscher (z. B. Mediziner, Humanethologen, Soziobiologen)1 als auch die stärker den Milieutheorien verpflichteten Wissenschaftler (z. B. Soziologen, Tiefenpsychologen, Lernpsychologen) sowie die Vertreter der Selbstorganisation (Kybernetik, Kommunikations- und Systemtheorie) machen bedeutsame Aussagen zu Verhaltensaspekten des Menschen, aber erst die Zusammenschau ihrer Ergebnisse beleuchtet das menschliche Verhalten umfassend. Die Ursachen und die Genese von Verhaltensstörungen lassen sich weder monokausal noch multikausal, sondern nur unter einem komplexen Aspekt erkennen und erklären, der die Einsichten verschiedener monistischer Konzepte einbezieht und auf das interdependente Zusammenwirken der Faktoren abhebt. Ein solcher Aspekt, der hier vertreten wird, versucht das gesamte Erscheinungs- und Bedingungsgefüge zu berücksichtigen und ist somit als ganzheitlich, synthetisch oder integrativ zu bezeichnen.
Unter einem Aspekt wird nachfolgend verstanden, dass phänomenologische und ätiologische Komplexe und Strukturen in den Blick genommen werden, deren Kenntnis die Voraussetzung ist für einen Ansatz, mit dem als Konsequenz Konzepte für Interventionen, praktisches Handeln und Behandeln entwickelt werden.
In Kapitel 5 ist das zentrale Anliegen, einen Überblick zu geben über relevante diagnostische Ansätze und Verfahren und einen vertiefenden Einblick in die Komplexität des theoretischen Konstrukts zu vermitteln, das als Verhaltensstörung(en) bezeichnet wird. Diagnostik wird dabei als prozessorientiert (Förderdiagnostik) verstanden, d. h. ihr wird große Bedeutung für eine evaluierende Begleitung aller Interventionen beigemessen. Im Wesentlichen aus diesem Grund werden viele Verfahren vorgestellt, die beispielhaft für verschiedene diagnostische Bereiche stehen und der Praxis dienlich sein können.
Wer auf Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen einwirken will, muss ein/-e Vielkönner/-in sein. Er/sie muss nicht nur über ein möglichst umfassendes Wissen zu den Erscheinungsformen, zur Verursachung und zur Genese von Verhaltensstörungen verfügen, er/sie muss sich auch Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen, eine in eine unerwünschte Richtung geratene Entwicklung eines Kindes oder Jugendlichen so zu beeinflussen, dass es zu einer psychischen Umorganisation kommt, zu einer Änderung des Lebensplans bzw. zu sozial adäquaten Lerneffekten im Hinblick auf das Verhaltensrepertoire. Diese sehr schwierige Aufgabe ist nur zu bewältigen, wenn auf alle zielrelevanten Möglichkeiten zurückgegriffen werden kann. Junge Menschen mit Verhaltensstörungen brauchen alle Hilfen, die verfügbar, Erfolg versprechend und verantwortbar sind. Sie haben einen Anspruch darauf, dass an erster Stelle von ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten und erst an zweiter Stelle von wissenschaftlichen und theoretischen Erwägungen ausgegangen wird. Fragen nach stringenter theoretischer Ableitung und Begründung von Konzepten und Verfahren – so wichtig sie letztlich sind – erscheinen zunächst als ebenso zweitrangig wie die – nach praktischer Handhabung vorgeschalteten – breiten und genauen Ansprüchen genügenden Effizienzkontrollen bzw. Evaluationsstudien. Zudem kommen Fragen der »Effizienz« in Erziehungskontexten durchaus auch an Grenzen. Nichtsdestotrotz hat Effizienz, häufig unter dem Begriff der »Evidenzbasierung« firmierend, in den letzten Jahren eine durchaus berechtigte verstärkte Aufmerksamkeit gewonnen und muss unbedingt berücksichtigt werden.
Wenn angesichts akuter Problemlagen Handlungsbedarf besteht, muss die Praxis hier und heute im Vordergrund stehen und ihren Aufgaben so gut wie möglich gerecht werden. Die Menschen vergangener Jahrhunderte sorgten für sauberes Trinkwasser, bevor sie etwas über Bakterien wussten. Umweltschutz ist in unserer Zeit zu betreiben, bevor die negative Wirkung aller Faktoren und das Bedingungsgefüge aller Negativfaktoren erforscht sind. Im Sinne dieser Überlegungen werden im 6. Kapitel verschiedene Interventionsansätze und -verfahren behandelt. Sie haben alle – gerade wegen ihrer Verschiedenheit – ihre Berechtigung, auch weil die Menschen, die sie anwenden, wie diejenigen, die von ihnen profitieren sollen, so sehr verschieden sind. Sie bieten als Ganzes oder in Elementen Möglichkeiten, Anregungen, Komponenten für verbindende, auf spezifische Situationen ausrichtbare Konzepte. Mit den Ausführungen insgesamt wird – wie bei der Ursachenbetrachtung von Verhaltensstörungen – für einen eklektizistischen, synthetischen oder integrativen Interventionsansatz plädiert. Mit diesem Ansatz wird der Überzeugung Rechnung getragen, dass Intervention bei Verhaltensstörungen, um den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Kinder und Jugendlichen genügen zu können, multimodal und multiprofessionell sein muss. Deshalb wird neben verschiedenen Ansätzen und Verfahren auch ein flexibel zusammenstellbares und einsetzbares sowie auf Kooperation ausgerichtetes integratives Konzept vorgestellt. Es erscheint zudem sehr bedeutsam herauszustellen, dass es für den Intervenierenden wichtig, ja nahezu lebenswichtig ist, um nicht vorzeitig auszubrennen bzw. eine Burn-out-Symptomatik zu entwickeln, das Interventionskonzept auf die persönlichen Verhältnisse und Möglichkeiten einzustellen, um es adäquat realisieren und sich voll und ganz mit dem eigenen Tun identifizieren zu können. Aus der individuellen Kompetenzabsicherung kann sich dann auch die so notwendige Bereitschaft zur Kooperation ergeben. Zur Verdeutlichung der angemessenen und notwendigen Umsetzung dieser Erkenntnis auf der Ebene der Institutionen und der helfenden Berufe wird nach der Behandlung der für die Intervention bei Verhaltensstörungen wichtigen Institutionen in Kapitel 7 im folgenden Kapitel 8 auf die für die Interventionsmaßnahmen wichtigsten Berufsgruppen eingegangen. Dabei sollte auch deutlich werden, dass die verschiedenen auf dem Gebiet der pädagogisch-therapeutischen Hilfe Tätigen eine Ausbildung auf gleichem Niveau brauchen, woraus auch eine gleiche Bezahlung resultieren sollte. Dadurch würden auch organisatorische Probleme leichter und besser lösbar, und das Betriebsklima allgemein in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen könnte positiv beeinflusst werden.
Im 9. Kapitel über »Spezielle Störungen« werden wichtige Teilbereiche der Thematik mit der möglichen Ausführlichkeit behandelt, die in sich eine gewisse Geschlossenheit haben und deren Integration in den vorausgegangenen Teilen die Darstellung einerseits zu sehr aufgebläht und andererseits zerrissen hätte. Zudem werden Inhalte angesprochen, die – wie Angst und Aggressivität – in allen Lebensbereichen des Menschen und insbesondere bei psychischen Störungen große Bedeutung haben oder Störungen sind, die – wie Suizidalität und Delinquenz – zwar »spezielle«, aber doch allgemeinmenschliche Problemlagen bezeichnen, oder – wie psychophysische und psychopathologische Störungen – alle Menschen mehr oder weniger bedrohen und unerwartet über jeden bzw. über jede Gruppe oder Familie hereinbrechen können.
Die Darstellung versucht
• möglichst umfassend zu sein, ohne dabei alle Theorien, Ansätze oder gar Untersuchungen berücksichtigen zu können, die für die gesamte Thematik bedeutsam sind,
• möglichst anschaulich zu sein, wozu Abbildungen, Grafiken und Beschreibungen herangezogen werden und
• möglichst allgemein verständlich zu sein.
Insgesamt ist eine gewisse Redundanz gegeben, die sich nicht eingeschlichen hat, sondern beabsichtigt ist. Das Buch muss nicht unbedingt systematisch vom Anfang bis zum Ende durchgelesen werden; einzelne Kapitel sollen auch für sich stehen, gelesen und verstanden werden können – unabhängig von den vorausgegangenen Darstellungen.
Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen werden nach den Vereinbarungen der deutschen Kultusminister hierzulande heute zumindest im schulischen Bereich als Schülerinnen und Schüler mit »Förderbedarf im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung« bezeichnet. Das klingt umständlich und ist in diesem Buch auch nicht durchgängig anzuwenden, dient aber evtl. einem Sinneswandel dahin, dass diesen jungen Menschen ihre Schwierigkeiten nicht mehr als Charakteristikum oder gar als Krankheit zugeschrieben werden, sondern dass sie unter dem Aspekt der – häufig entwicklungsbedingten – Hilfs- und Förderbedürftigkeit gesehen werden. Eine solche Absicht verdeutlichte sich schon einmal im 19. Jahrhundert gegenüber einer anderen Klientel, als die später als Lernbehinderte bezeichneten Jungen und Mädchen im schulischen Bereich Hilfsschüler genannt wurden.
1 Wenn im Folgenden aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur die männliche Form eines Begriffs verwendet wird, so sind, wenn nicht ausdrücklich anders erwähnt, sowohl Frauen als auch Männer gemeint.
1 Historischer Überblick
Kinder und Jugendliche, deren Verhaltensweisen die Umwelt als unerwünscht und störend empfindet und die sich selbst in ihrer Lebensgestaltung und Entwicklung beeinträchtigen, hat es in allen Kulturen und zu allen Zeiten gegeben. Bewertungen der Auffälligkeiten und Reaktionen der Umwelt geschahen und werden weiterhin realisiert in Abhängigkeit von gesellschaftlichen Verhältnissen, d. h. insbesondere von kulturellen, religiös-ethischen und nicht zuletzt ökonomischen Bedingungen. Die Reaktionen waren durch die Jahrhunderte hindurch sehr vielfältig und unterschiedlich. Sie reichten im europäischen Kulturraum von den verschiedenen Formen körperlicher Züchtigung über Isolationsmaßnahmen bis hin zur Tötung einerseits und zu verständnisvoller Akzeptanz mit umfassender Hilfe zur Selbstentfaltung andererseits. Die harten Maßnahmen, denen verhaltensabweichende junge Menschen unterworfen wurden, gipfelten in der ideologisch begründeten »Ausmerzung« während des Terrorregimes der Nationalsozialisten in Deutschland.
Soweit das Leben geschont wurde, lassen sich die Reaktionen durch die Jahrhunderte hindurch mit den Begriffen Separieren, Isolieren, Disziplinieren und Normalisieren zusammenfassend bezeichnen (siehe auch Kobi 2004, 107 ff.).
Bereits die ersten Einrichtungen, die sich – wie die Findelhäuser und Klöster – Kindern mit und in Schwierigkeiten pflegerisch und erzieherisch annahmen, waren separierende und isolierende Anstalten mit harter Zucht. Die Schulen, zunächst der Klöster und der Gemeinden, später des Staates, konnten lange auf dauerhafte Separierung und Isolation der »Störenfriede« verzichten. Durch religiös begründete körperliche Züchtigungen erreichten und hielten auch sie Disziplin aufrecht, d. h. ein »Verhalten nach den vorgegebenen Ordnungsgeboten« (Hagemeister 1968, 25). Als dann, erst im 20. Jahrhundert, körperliche Züchtigung in Verruf kam, wurden die »psychopathischen« oder »schwer erziehbaren« Kinder und Jugendlichen in Sonderklassen separiert und isoliert, um sie noch besser disziplinieren und normalisieren zu können. Sie wurden aus der Gemeinschaft der anderen ausgesondert, psychisch und physisch vereinzelt und besonderen Maßnahmen unterzogen, um sie zu befähigen, sich möglichst »normal« zu verhalten, also situativen und übergreifenden Erfordernissen der Gemeinschaft zu genügen und so zu werden wie die anderen.
1.1 Fünf historiografische Linien
Die besonderen Einrichtungen, die für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen entstanden und das Erfahrungsfeld waren für die Entwicklung einer differentiellen Pädagogik, die wir heute als Pädagogik bei Verhaltensstörungen bezeichnen, lassen sich von ihren Ursprüngen über ihre Entfaltung und Konsolidierung oder auch ihren Niedergang in fünf historiografischen Linien verfolgen, und zwar über:
1. die sozialpädagogische Linie:Waisenhäuser – Rettungshäuser – Erziehungsheime – Heimschulen,
2. die kriminalpädagogische Linie:Zuchthäuser – Jugendstrafvollzug – Gefängnisschule,
3. die schulpädagogische Linie:Beobachtungsklassen – Erziehungsklassen – Kleinklassen, Sonderklassen – Sonderschulen – Integrierte Fördereinrichtungen – inklusive Schulen,
4. die pädagogisch-psychiatrische Linie:Einrichtungen der Psychopathenfürsorge – Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie – Klinikschulen,
5. die berufspädagogische Linie:Arbeitserziehung – Industrieschulen – Fortbildungsschulen – Berufsschulen – Berufsbildungswerke (vgl. Myschker 1989).
Innerhalb der einzelnen historiografischen Linien spiegeln sich jeweils spezifische Entwicklungen in theoretischer, praktischer und organisatorischer Hinsicht wieder. Neue Möglichkeiten und Konzepte wurden häufig von Gemeinschaften, Gruppen Gleichgesinnter, aber auch von Einzelpersonen initiiert und getragen. Einige Einrichtungen gibt es nicht mehr: Rettungshäuser, Zuchthäuser und die »Psychopathen«-Fürsorge, Industrieschulen, Fortbildungsschulen gehören der Vergangenheit an. Heime und Heimschulen reduzieren sich oder sind in einigen Bundesländern bereits völlig abgebaut. Das Sonderklassen- und Sonderschulwesen für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen wurde seit Beginn der 2000er Jahre zunächst weiterentwickelt (siehe Opp 2003), befindet sich aber nun in einer neuen Legitimationskrise durch die Inklusionsdiskussion, bei allerdings aktuell bundesweit steigender Feststellung von Förderbedarf, insbesondere im hier relevanten Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung.
1.1.1 Die sozialpädagogische Linie: Waisenhäuser – Rettungshäuser – Erziehungsheime – Heimschulen
Verwaister, verlassener, ausgesetzter, bedrohter oder verwahrloster Kinder und Jugendlicher nahmen sich im Bereich abendländischer Kultur zuerst christliche Ordensleute in Klöstern und Hospitälern, später auch in speziell gegründeten Findelhäusern an. Sie handelten aus der Verpflichtung zur Nächstenliebe heraus und um der Kinder wie der eigenen Seligkeit willen. Diese religiöse Motivation war über Jahrhunderte hinweg tragend. Die mittelalterlichen Mönch-Pädagogen waren tief verwurzelt in der christlichen Anschauung von der »Verderbtheit des Fleisches« und dem »Körper als Sitz des Bösen«. Ihre Erziehung, die sie entsprechend auf Rute und Peitsche gründeten, war »von barbarischer Strenge« (Günther et al. 1976, 57).
Im 15. Jahrhundert stieg mit der Veränderung der ökonomischen Verhältnisse die Zahl verwahrloster, hilfsbedürftiger Kinder stetig an und führte Mitte des 16. Jahrhunderts dazu, dass viele Eltern »selbst ihre Kinder weder regieren und unterrichten, noch sie etwas Gutes lehren können«, und die Kinder nur »rabauten« und betteln lernten (zitiert nach: Scherpner 1979, 33). In dieser Zeit wurden einerseits in vielen Ländern Europas Waisenhäuser in großer Zahl gegründet, andererseits gegen Armut und Bettel verschärfte Gesetze erlassen (Karl Marx: »Blutgesetzgebung«), die Erwachsene und auch Kinder an den Galgen brachten.
Nach der Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges kam es in der Pädagogik zu einer Neubesinnung auf christliche Werte und Lebensgestaltung – auch und gerade mit dem Blick auf heranwachsende junge Menschen. Gottgefälligkeit wurde zur Maxime und bestimmte auch das Handeln der pädagogisch bedeutsamen pietistischen Theologen wie Philipp Jakob Spener (1635–1705) und August Hermann Francke (1663–1727). Beide gründeten Waisenhäuser bzw. Erziehungseinrichtungen mit Vorbild-Charakter. Spener, der »Vater des Pietismus«, und Franke, dessen Hallesche Anstalten ein Großunternehmen und weltberühmt wurden, erkannten die Bedeutung der liebevollen Zuwendung und des engen pädagogischen Bezuges und versuchten, ihre Erziehung entsprechend auszurichten. Ihr Vorbild bestimmte das Handeln späterer neupietistischer Theologen, unter denen Johann Hinrich Wichern (1808–1881) als Gründer des »Rauhen Hauses« in Hamburg und der »Inneren Mission« sowie als kämpferischer Anwalt der Rettungshaus-Bewegung der bekannteste wurde (vgl. Wichern 1956, Lindmeier 1998, Birnstein 2007). Im »Rauhen Haus«, einem differenziert organisierten, neupietistisch geprägten Kinderdorf für »verkommene«, »mißratene«, »sittlich verwahrloste« Jungen und Mädchen waren die drei wesentlichen Faktoren des Rettungswerkes »Familie, Schule und Arbeit«, die »eine organische Einheit bilden« sollten (Wichern 1833 und 1868, Janssen Bd. 2, 33 und 258). Wichern hat in seinen Schriften wie auch in seiner pädagogischen Praxis im »Rauhen Haus« deutlich zum Ausdruck gebracht, dass bei Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensschwierigkeiten nicht Strafe angebracht, sondern liebevolles Akzeptieren in einer tragenden, erziehenden Gemeinschaft vonnöten ist.
Diese Überzeugung verbreitete sich – nicht zuletzt durch die von Wichern initiierte, konzentriert wirkende und die gesamte Kinder- und Jugendfürsorge beeinflussende »Innere Mission«. Sie wirkte sich aus auf das Reichsstrafgesetzbuch (RSTGB) von 1871, das Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr als strafunmündig sowie die 12 bis 17 Jahre alten Jugendlichen als bedingt strafmündig bezeichnete und für diese, wenn sie strafbares Verhalten zeigten bzw. sich ihre Erziehung als gefährdet erwies, mit der Novelle von 1876 auf Anordnung des Vormundschaftsrichters die Unterbringung in einer Erziehungs- oder Besserungsanstalt vorsah. Mit dieser gesetzlichen Regelung »war die Grundlage geschaffen für die sogenannte Zwangserziehung, aus der die heutige Fürsorgeerziehung hervorging« (Scherpner 1979, 162).
Abb. 1: August Hermann Francke und seine Halleschen Anstalten
Von zentraler Bedeutung für alles Erziehungsdenken gerade auch gegenüber »verwilderten« Kindern und Jugendlichen wurde – auch im Hinblick auf Wichern und sein pädagogisches Konzept der Familienerziehung – Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827).
Pestalozzi gehört zu den ersten, dessen Hinwendung zu den alleine gelassenen, schwierigen Kindern und Jugendlichen nicht mehr primär in religiösen, sondern in humanistischen Vorstellungen und einer den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Menschen zugewandten Aufklärung begründet war. Seine Erkenntnisse, die er über Erziehung und Unterrichtung schwieriger Kinder z. B. in dem berühmten Brief an einen Freund über den Aufenthalt in Stans zusammenfasste, wurden für die Pädagogik bei Verhaltensstörungen – in sonder- wie in sozialpädagogischer Ausrichtung – grundlegend und sind auch in der Gegenwart noch höchst bedeutungsvoll. Die Kinder brauchen Zuwendung, Liebe – Liebe auf Vorschuss –, um dem Erzieher zu vertrauen, um ihn akzeptieren zu können. Nicht der »Zwang einer äußeren Ordnung und Ordentlichkeit« oder ein »Einpredigen von Regeln und Vorschriften« (1799, 18) macht ihre Gefühle und Kräfte für eine positive Entwicklung bereit, sondern »die Befriedigung ihrer täglichen Bedürfnisse« (a. a. O., 19). Sozialverhalten lässt sich durch Gewöhnung trainieren; die »Angewöhnung an die bloße Attitüde« kann zum »inneren Halt« (Moor) werden. Das Zusammenleben wie in »einer großen Haushaltung« (a. a. O.), wie in einer großen Familie muss das Ziel öffentlicher Erziehung sein. Mit letzterer Erkenntnis brachte Pestalozzi in die Erziehungs- und Rettungshaus-Bewegung eine Leitvorstellung ein, die als »Familienprinzip« die Entwicklung bis in unsere Zeit charakterisiert.
Abb. 2: Johann Heinrich Pestalozzi (nach einem Gemälde, das F. G. A. Schöner zugeschrieben wird)
Sein kinderfreundliches, kinderförderliches Tun fand später eine Fortführung z. B. in der Arbeit von Johannes Trüper (1855–1821), August Aichhorn (1878–1949), Bruno Bettelheim (1903–1990) und Fritz Redl (1902–1988).
Wenn die historiografische Linie von den Klöstern über Findelhäuser, Rettungshäuser und Erziehungsheime als sozialpädagogisch typisiert werden kann, so lässt sich eine weitere für die heutige Pädagogik bei Verhaltensstörungen relevante Linie als kriminalpädagogisch bezeichnen, die zwar immer einen gewissen Zusammenhang mit der sozialpädagogischen Linie, aber doch auch eine deutliche Eigenständigkeit hatte.
1.1.2 Die kriminalpädagogische Linie: Zuchthäuser – Jugendstrafvollzug – Gefängnisschule
Der Strafvollzug an delinquenten Jugendlichen und Heranwachsenden als Freiheitsentzug und Erziehungsmaßnahme hat eine relativ kurze Geschichte (vgl. Myschker 1982 und 1989b). Über Jahrhunderte wurden selbst Kinder und natürlich auch Jugendliche und Heranwachsende wie Erwachsene behandelt.
Die schweren, gegen die Ehre, den Leib oder gegen das Leben gerichteten Strafen des Mittelalters entsprangen dem Sühnedenken und zielten in brutaler Weise auf Abschreckung. Sie wurden – mit regionalen Unterschieden – auch an Kindern nach Vollendung des siebten bzw. zwölften Lebensjahres vollzogen. Kinder, die einen Menschen getötet hatten, wurden hingerichtet.
Staatlicher Strafvollzug und Freiheitsentzug als Strafmaßnahme kamen erst im 13. Jahrhundert auf. Aber der Freiheitsentzug war als Einsperrung in dunkle, kalte, feuchte Verließe im Turm, im Lochgefängnis, im Karzer oder im Gefängnis mit Fesselung oder gar Ankettung, mit dauerndem Hunger und Krankheiten eher eine häufig zum Tode führende Leib- und Lebensstrafe.
Wirtschaftliche Wandlungsprozesse und ein Überangebot an Arbeitskräften bzw. an besitzlos gewordenen freien »Lohnarbeitern« führten im ausgehenden 16. und beginnenden 17. Jahrhundert infolge des Fehlens öffentlicher Sozialmaßnahmen zu einer Massenkriminalität, auf die die Regierungen mit grausamen Strafen reagierten. In England z. B. wurden unter Königin Elisabeth 300 bis 400 Landstreicher und Diebe auf einmal hingerichtet.
Da einerseits selbst die brutalsten Strafen einen Abstumpfungseffekt hatten und somit an abschreckender Wirkung verloren, sich andererseits die Menschen dagegen zu sträuben begannen, dass die Strafen auch an Kindern und Jugendlichen vollzogen wurden, begann ein Nachdenken über andere Maßnahmen gegen straffällige junge Menschen.
Aus humanitären Motiven delinquenten Kindern und Jugendlichen gegenüber in Verbindung mit der große Verbreitung findenden Glaubenslehre des Reformators Jean Calvin (1509–1564) einerseits und andererseits zum Zwecke der Resozialisierung für einen aufnahmefähigen Arbeitsmarkt wurde 1595 in Amsterdam das erste Zuchthaus (secreete tuchthuis) gegründet; weitere folgten. Im Sinne Calvins waren harte Arbeit, strenge Zucht, Seelsorge und Unterricht die Erziehungsmittel. Es galt, die Seelen der vom rechten Weg abgeirrten Straftäter zu retten. Mit Arbeitsprämien, gemeinsamer Arbeit tagsüber und der Unterbringung in Einzelzellen zur Nacht sowie mit Spiel und Sport nach Arbeit und Unterricht wurde ein für die damalige Zeit erstaunlich fortschrittliches Erziehungs- und Besserungskonzept realisiert. Die Amsterdamer Zuchthäuser wurden zu weithin wirkenden Vorbildern.
Die Zuchthäuser, die nach Amsterdamer Vorbild in ganz Deutschland, vor allem in den Hansestädten gegründet wurden (z. B. in Bremen 1609, in Hamburg 1622, in Danzig 1636), realisierten für männliche wie für weibliche Kinder und Jugendliche ein Arbeits- und Erziehungskonzept. Diese Anstalten können als Vorläufer der Einrichtungen der Fürsorgeerziehung und des Jugendstrafvollzugs angesehen werden.
Merkantilistische Ideen und die äußerst ungünstigen Bedingungen nach dem Dreißigjährigen Krieg brachten in den Zuchthäusern Ausbeutung der Arbeitskraft der Insassen und strafverschärfende Verhältnisse mit sich. Mit dem beginnenden 19. Jahrhundert, als es in Deutschland mindestens 60 Zuchthäuser gab, begann die Entwicklung von einer der Zucht bzw. Erziehung dienenden Einrichtung zu einer Institution schwerer Strafe, die als »Hochschule des Verbrechens« typisiert wurde. Zur Zeit ihrer Auflösung in den Jahren ab 1960 waren die strukturgewandelten deutschen Zuchthäuser Strafanstalten für erwachsene Schwerverbrecher ohne nennenswerte pädagogische Fördermöglichkeiten.
Im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert verstärkten sich wieder Tendenzen, den Strafvollzug allgemein und insbesondere für Jugendliche zu einem Besserungsvollzug zu machen. Beccaria in Italien, Howard in England, Pestalozzi in der Schweiz und Wagnitz in Deutschland gehörten zu den Reformern des Strafvollzugs, die im Sinne humanistischer und aufklärerischer Tendenzen besondere Bedingungen für delinquente Jugendliche und einen systematischen Unterricht in der Gefängnisschule erstrebten und erreichten. Bei Gefängnisneubauten wurden auch Schulen errichtet, wie z. B. in Berlin-Moabit, wo 1846 eine neue Anstalt entstand. Im Vordergrund des Unterrichts standen nunmehr die Kulturtechniken. Es entwickelte sich eine übermäßig optimistische Einstellung, nach der durch intensive Bildungsmaßnahmen nicht nur die Heilung des Schwachsinns, sondern auch eine Besserung der Straftäter erwartet wurde. Die Gefängnisschule wurde zu einer wichtigen Einrichtung innerhalb der Anstalt; die Lehrer gewannen an Bedeutung.
In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts geriet die Gefängnisschule in den Widerstreit der Meinungen. So bezeichnete z. B. 1874 der Anstaltsleiter Krell die Schule als »eine Übertreibung, die zugleich ein Unrecht gegen den freien, ehrlichen Mann ist« (vgl. Myschker 1989, 167). Die Gefängnisschule verlor an Bedeutung; Unterricht wurde zu einer freiwilligen Einrichtung, wurde nunmehr nur ungern geduldet, um den negativen Sozialisationsbedingungen der Anstalt (Prisonisierung) entgegenzuwirken. Diese Auffassung ist auch noch in der Gegenwart in weiter Verbreitung wirksam.
Die als sozialpädagogisch und als kriminalpädagogisch bezeichneten historiografischen Linien griffen an verschiedenen Stellen ineinander, z. B. auch dann, als Wichern und die »Innere Mission« auf die Kodifizierung des Reichsstrafgesetzbuches von 1871 einwirkten, das die Strafunmündigkeit für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr festschrieb und Jugendliche bis zum 17. Lebensjahr als nur bedingt strafmündig bezeichnete. Der Strafvollzug an Jugendlichen sollte getrennt von dem für Erwachsene stattfinden. Mit der Novelle von 1876 wurde die Unterbringung von »Übeltätern« in Erziehungs- oder Besserungsanstalten auf Anordnung eines Vormundschaftsrichters vorgesehen. Der Deutsche Bundesrat formulierte 1897 Grundsätze für den Jugendstrafvollzug, nach denen die jugendlichen Gefangenen in allen Fächern der Volksschule unterrichtet werden sollten.
Um die Jahrhundertwende entwickelten sich unter Juristen im Sinne der Reformpädagogik Bestrebungen, Straftaten Jugendlicher in speziellen, getrennten Verfahren zu verhandeln. Es entsprach ganz den Intentionen der »Jugendgerichtsbewegung«, dass am 1. August 1912 in Wittlich an der Mosel das erste deutsche Jugendgefängnis gegründet wurde. Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Zusammenbruch des Kaiserreichs sowie einem Anstieg der Jugendkriminalität fanden die Forderungen der »Jugendgerichtsbewegung« nach speziellen Gerichtsverfahren und speziellen Anstalten für Jugendliche verstärkt Gehör. Es verbreitete sich die Einsicht, dass Jugendliche – getrennt von den erfahrenen und alle kriminellen Tricks beherrschenden erwachsenen Straftätern – unter annähernd Gleichaltrigen eine ihrem Alter und ihrer Reife entsprechende Erziehung und Bildung erfahren sollten. Im Bereich der Jurisdiktion kam nunmehr eine Entwicklung zum Abschluss, die zum seinerzeit sehr fortschrittlichen Jugendwohlfahrtgesetz (JWG von 1922) und zum Jugendgerichtsgesetz (JGG von 1923) führte. Das JGG schränkte gegenüber Jugendlichen die Straf- und Vergeltungsintentionen zugunsten des Erziehungsgedankens ein. JWG und JGG stellten eine weltweit bedeutende und fortschrittliche Gesetzgebung dar (Kap. 7.2 und Kap. 7.3), die im Wesentlichen die Nazi-Zeit überdauerte und die mit geringfügigen Veränderungen nach dem Zweiten Weltkrieg von der Bundesrepublik Deutschland übernommen wurde. Erst 1990 kam es zu einer völligen Überarbeitung des JWG zu einem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) sowie zu einigen Änderungen des JGG, das aber – zum Verdruss vieler Fachleute – im Wesentlichen beibehalten wurde. Der heutige Jugendstrafvollzug macht weitestgehend von Möglichkeiten des – im JGG vorgesehenen – offenen Vollzugs Gebrauch. Die Gefängnisschule sollte im Vollzug bei Jugendlichen nach dem 1960 von der Kultusministerkonferenz (KMK) beschlossenen »Gutachten zur Ordnung des Sonderschulwesens« eine sonderschulische Einrichtung, »eine Berufsschule von betont heilpädagogischer Prägung« sein. Diese bildungspolitische Aufgabenstellung wurde fallengelassen. In den »Empfehlungen zur Ordnung des Sonderschulwesens« der KMK von 1972 wurde die Schule in der Jugendstrafanstalt nicht mehr berücksichtigt. Sie konnte niemals eine deutliche Struktur und ein ausgeprägtes Selbstverständnis entwickeln, da sie immer im Widerstreit der Meinungen stand, von den Behörden – nicht zuletzt im Hinblick auf die Öffentlichkeit – kurzgehalten wurde und der Entwicklung im übrigen Schulwesen hinterherhinkte. Schüler wie Lehrer leiden nach wie vor unter diesen Umständen.
In den vergangenen Jahren wurde der Jugendstrafvollzug in seiner Struktur dadurch verändert, dass in den Anstalten mehr und mehr ausländische und erwachsene Straftäter einsitzen. Zum Stichtag 31.3.2012 waren von den 5796 Strafgefangenen 2506 21 Jahre und älter. Etwa 90% der Klientel waren nicht mehr Jugendliche und junge Menschen, sondern Erwachsene (Statistisches Bundesamt 2012 f., 14). Es besteht die Gefahr, dass die im JGG fixierten pädagogischen Aufgaben nicht mehr zufriedenstellend erfüllt werden können.
1.1.3 Die schulpädagogische Linie
Auf die Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen und die Etablierung einer eigenständigen akademischen Fachrichtung der Sonderpädagogik beziehen sich die beiden historiografischen Linien, die zum einen Beobachtungsklassen, Erziehungsklassen und Kleinklassen, zum anderen Sonderklassen, Sonderschulen und Maßnahmen integrierter Förderung umfassen und in der Zusammenschau als schulpädagogische Linie zu typisieren sind.
1.1.3.1 Beobachtungsklassen – Erziehungsklassen – Kleinklassen
Spezielle Fördereinrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen wurden seit Mitte der 1920er Jahre in der Schweiz und in Deutschland gegründet, und zwar 1926 in Zürich als »Beobachtungsklassen« und in Berlin 1928 als »Erziehungs-Klassen« (E-Klassen). Zur Gründung dieser Kleinklassen kam es
• zum einen im Zuge von Separierungs- und Isolierungstendenzen, um die übrigen Schüler vor den »psychopathischen« und »schwer erziehbaren« Kindern und Jugendlichen zu schützen, und
• zum anderen im Zuge von Normierungs- und Normalisierungstendenzen, um abweichende Kinder und Jugendliche den übrigen wieder anzugleichen.
Die Kleinklassen bekamen in der Schweiz wie in Deutschland die Aufgabe und Zielsetzung, mit besonders befähigten Lehrern, besonderen Methoden und in kleinen Gemeinschaften im Regelschulwesen als nicht mehr tragbar eingestufte Schüler in einem Zeitraum von zwei bis vier Jahren so zu verändern, dass sie wieder zurückgeschult werden konnten (vgl. Sidler/Moos 1928, Sidler 1937, Fuchs 1930). Die Klassen sollten sich nicht zu Sonderschulen weiterentwickeln, sondern als Durchgangseinrichtungen Teil der Regelschule bleiben. Der Initiator der Berliner E-Klassen, der Magistratsschulrat Arno Fuchs, erklärte ausdrücklich: »Der Ausbau einer aus E-Klassen bestehenden E-Schule kann nicht gutgeheißen werden, da hierdurch die unbedingt innezuhaltende Unauffälligkeit und engste Zugehörigkeit zur Normalschule, sowie der leitende Zweck einer vorübergehenden Heilbehandlung aufgehoben wäre« (Fuchs 1930, 48 f.). Die Organisationsform der Berliner E-Klassen (Kap. 7.1) wurde auch von anderen deutschen Städten übernommen. Sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland bewährten sich diese Klassen, wie z. B. auch die Hilfsschulen und -klassen, die aus ähnlichen Tendenzen heraus entstanden waren.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die E-Klassen, nachdem die Nationalsozialisten sie aus ideologischen Gründen in Deutschland aufgelöst hatten (Kap. 1.3), in Berlin neugegründet und in ähnlicher Form auch in anderen Städten (z. B. in Bremen und Hamburg) eingerichtet. Nach dem »Gutachten zur Ordnung des Sonderschulwesens« der KMK von 1960 sollten sie in der notwendigen Verbreitung Einrichtungen zwischen der Sonderschule für Verhaltensgestörte und der Regelschule sein und Schüler aufnehmen, »die durch ihr Verhalten die Klassengemeinschaft nachhaltig stören, bei denen aber zu erwarten ist, dass durch stärkere Einzelbetreuung die Fehlhaltungen gemildert oder beseitigt und damit eine Rückführung in die allgemeine Klasse ermöglicht oder vorbeugend eine weitere Gefährdung vermieden werden kann« (KMK 1960, 35). Ähnlich organisierte Klassen wurden in den neuen Bundesländern eingerichtet, wo sie auch zu Schulen zusammengefasst werden konnten und sich – insgesamt gesehen – bewährten (vgl. Großmann/Gerth 1990).
Separierende Kleinklassen wurden lange kritisch gesehen und standen in einer Legitimationskrise. Materiell wie personell wurden sie in den Regelschulen nicht adäquat ausgestattet, wurden zu »Rüpelklassen« oder zum isolierten Getto und konnten häufig in der verfügbaren Zeit die Problemkinder nicht wesentlich bessern. Zudem ist der Zug der Zeit auf Inklusion, d. h. auf die gemeinsame Erziehung und Unterrichtung behinderter und nichtbehinderter Schüler ausgerichtet, wobei allerdings Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen die größten Schwierigkeiten bereiten dürften (vgl. Stein/Müller 2015). So ist anzunehmen, dass auf Kleinklassen nicht verzichtet werden kann und diese bei adäquater äußerer wie innerer Organisation auch einen sinn- und effektvollen Platz in einem gestuften schulischen System haben können (Kap. 7.1; Grissemann 1992). Auch in den »Empfehlungen zur emotionalen und sozialen Entwicklung« der Kultusminister der deutschen Länder, die in Ergänzung zu den »Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen in der Bundesrepublik Deutschland. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 06.05.1994« am 10.3.2000 herausgegeben wurden, finden sie ihren Platz: »Schülerinnen und Schüler mit Sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich des emotionalen Erlebens und des sozialen Handelns, für die eine hinreichende Förderung in allgemeinen Schulen nicht gewährleistet werden kann, werden in Sonderschulen oder in Schulen und Klassen für Erziehungshilfe unterrichtet (Die Bezeichnung der entsprechenden Sonderschulen ist in den Ländern unterschiedlich)« (KMK 2000, 23) – allerdings wiederum eingeschränkt durch das Recht auf inklusive schulische Bildung (KMK 2011) im Zuge der Bemühungen um Umsetzung der durch Deutschland ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention (VN-BRK 2008).
1.1.3.2 Sonderklassen – Sonderschulen – Integrierte Fördereinrichtungen
Die öffentlichen »Sonderschulen für Verhaltensgestörte« entwickelten sich in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg aus zunächst als Provisorien eingerichteten Sonderklassen zu voll ausgebauten Systemen. Die Sonderklassen wurden insofern aus einer Notsituation heraus eingerichtet, als – wie z. B. in Bremen – »kriegsgeschädigte« Kinder in den großen Klassen auffällig wurden »durch Nervosität, Unkonzentriertheit, leichte Ermüdbarkeit und durch ihr gestörtes soziales Integriertsein« (Klink 1962, 92). Mit den Jahren veränderte sich die Population der Sonderklassen, und es handelte sich nunmehr um »leistungsgehemmte, lernunwillige bzw. lernentmutigte und leicht erregbare Kinder« (Senator für das Bildungswesen in Bremen, zitiert nach Klink 1962, 113). Die Sonderklassen begannen ein Selbstverständnis als notwendige Einrichtung zur speziellen Förderung besonders schwieriger Schüler und zur notwendigen Entlastung der Regelschule zu entwickeln, und die Regelschulen nahmen die Entlastung zunächst dankbar an und forderten sie später geradezu. Die zu Schulen gewordenen Sonderklassen nannten sich z. B. »Sonderschule für Entwicklungsgestörte«, »…für Erziehungsschwierige«, »…für Verhaltensgestörte«, »für Verhaltensbehinderte« oder – neutraler und heute noch gern verwendet – »Schule für Erziehungshilfe «. Sie wurden, gestützt und gefördert durch das Gutachten von 1960 und die Empfehlungen der KMK von 1972 und 1977, zu gut ausgebauten Systemen, die sich in Abgrenzung zu den Heimschulen der Jugendhilfe dadurch definierten, dass sie nur solche Schüler und Schülerinnen aufnahmen, die den Schulweg selbstständig absolvieren konnten, gruppenfähig waren und ein förderndes Elternhaus hatten. Diese Abgrenzung ist auch gegenwärtig noch relevant, kann aber nicht mehr völlig aufrechterhalten werden, zumal die Schulen auf Zubringerdienste durch Schulbusse oder Taxis zurückgreifen können. Auch geriet die Variante der Halbtagsschule ohne direkten Verbund mit anderen Einrichtungen wie Heimen oder Tagesgruppen zunehmend in die Kritik (Willmann 2007a, 24 ff.). Andererseits haben sich auch Heimschulen, soweit sie nicht wegen ihrer stark separierenden Organisationsform und der Gefahr der Stigmatisierung abgeschafft wurden, auch »externen« Schülern und Schülerinnen geöffnet. Die öffentlichen Sonderschulen versuchen durch ein differenziertes System, von der Einzel- bis zur Großgruppenförderung, von ambulanten Maßnahmen im Regelschulbereich bis hin zum Ganztagsunterricht über mehrere Jahre, das gesamte Aufgabengebiet von den leichteren bis hin zu den schweren Verhaltensstörungen abzudecken (Kap. 7.1). Einige Sonderschulen für Erziehungshilfe haben Dependancen in Regelschulen, in denen Sonderpädagogen in speziell eingerichteten und ausgestatteten Klassen, die als integrierte Fördereinrichtungen verstanden werden können, Schülern je nach Notwendigkeit in pädagogisch-therapeutischer Ausrichtung Teilzeitunterricht mit wenigen Wochenstunden oder auch Vollzeitunterricht geben (vgl. z. B. Soetemann/Wormland 1976, Sarges/Würtl 1976). Einige Einrichtungen arbeiten mittlerweile auch als »Schulen ohne Schüler«.
Eine Untersuchung zur Verbreitung der Sonderschulen in den 1970er Jahren resümierten die Wissenschaftler mit der Feststellung: »Die geringe Anzahl von Städten mit E-Schulen zeigt uns an, dass die schulischen Aktivitäten für verhaltensauffällige Kinder sehr häufig noch in den Anfängen stecken« (Benzel/Kluge 1974, 15). Im Rückblick wird deutlich, dass die Verbreitung der E-Schulen in den Anfängen stecken blieb. Gründe dafür liegen in der grundsätzlichen Problematik der Separierung und in der Empfehlung des Deutschen Bildungsrats von 1973 »Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher«, mit der »der bisher vorherrschenden schulischen Isolation Behinderter ihre schulische Integration« entgegengestellt wurde (Deutscher Bildungsrat/Bildungskommission 1973/1974, 15–16).
Ab 1965 entstand auch eine eigenständige Verhaltensgestörtenpädagogik in der damaligen DDR. Gesellschaftliche Erklärungsversuche für das Entstehen von Verhaltensstörungen waren hier nicht anerkannt; auffälliges Verhalten wurde generell auf intra- und interpersonelle Gründe zurückgeführt und damit in die Familien »verwiesen«. In Chemnitz, Dresden und Leipzig wurden Grundschulen mit Hortunterbringung zur Rehabilitierung und Rückführung von Kindern mit Verhaltensstörungen gegründet. Es bestand insgesamt eine sehr begrenzte rehabilitationspädagogische Arbeit, da nur wenige Menschen von Sonderschulen wissen sollten. Erst 1981 gab das Ministerium für Volksbildung eine »Anweisung über Grundsätze bei der Förderung von Kindern mit wesentlichen physisch-psychischen Störungen im Bereich des Sozial- und Leistungsverhaltens (Verhaltensstörungen)« heraus (vgl. Müller 2014) und räumte somit indirekt das Vorhandensein von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen ein. Als abweichendes und auffälliges Verhalten wurden in der DDR auch Verhaltensweisen bezeichnet, die als systemgefährdend galten (beispielsweise Rowdytum) oder die sich an westlichen Lebensstilen orientierten. Das Verständnis von Verhaltensstörungen entsprach also zumindest in den 1960er und 1970er Jahren nicht den westdeutschen Sichtweisen.
Die pädagogische Auffassung zum Umgang mit Verhaltensstörungen bestand darin, dass unter Berufung auf die erzieherischen Überlegungen Makarenkos Störungen durch den Einsatz korrektiv-erzieherischer Methoden abgebaut werden sollten, um nach drei bis vier Jahren wieder die Beschulung in einer Regelschule zu ermöglichen. Es entstanden Spezialkinderheime für schwererziehbare Kinder. Vormundschaftsgerichte und die Fürsorge waren bis hin zur Berufsausbildung für junge Menschen aus »erziehungsuntüchtigen Milieus« mit daraus resultierenden sozialen »Fehlentwicklungen« verantwortlich. Dies wurde oft stark ehrenamtlich, also wenig professionell realisiert. Zudem bestanden Sonderschulen mit Ausgleichsklassen, in denen Kinder mit Verhaltensstörungen diagnostiziert und in den Klassenstufen 2–4 unterrichtet wurden. Spätestens nach der 4. Klasse musste jedoch wieder der Besuch einer Regelschule erfolgen. Die Schulen verfügten oft über Internate. Zudem entstanden über das gesamte Gebiet der DDR verteilte Jugendwerkhöfe, in die besonders erziehungsschwierige Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren eingewiesen wurden; darunter waren aber durchaus auch Waisenkinder. Wer von den Vorstellungen hinsichtlich Disziplin und Ordnung in diesen Einrichtungen abwich und/oder auch aus diesen mehrfach entwich, wurde in den geschlossenen Jugendwerkhof Torgau verlegt, welcher den Charakter einer Strafanstalt hatte. Jugendliche waren in diesen Einrichtungen in erheblichem Maße der Willkür, verschiedenen Misshandlungen sowie generellem Machtmissbrauch durch Erwachsene ausgesetzt (vgl. Zimmermann 2004, Müller 2014 sowie die differenzierte Aufarbeitung zu Torgau in Beyer/Strobl/Müller 2016).
In Torgau war der geschlossene Jugendwerkhof von 1964 bis zur Wende 1989 in einem großen Gebäudekomplex untergebracht – einem ehemaligen Gefängnis –, durch hohe Mauern und Wachtürme gesichert. Die Fenster der Anstalt waren vergittert, es gab Dunkelzellen und Arrestzellen sowie Gemeinschaftszellen mit Dreistockbetten. Im großen Innenhof fanden der Freizeit- und der Zwangssport statt. Auf Abb. 3 ist die bei den Jugendlichen verhasste sog. Sturmbahn mit einer 2,30 Meter hohen Eskaladierwand zu sehen, wo die Jugendlichen brutalen Strafmaßnahmen ausgesetzt waren (Abb. 3). Die gesamte Anlage war – wohl absichtlich – in einem schlechten baulichen Zustand. Es konnten 60 Jugendliche für maximal sechs Monate aufgenommen werden, die auf zwei Gruppen für männliche und auf eine Gruppe für weibliche Jugendliche verteilt wurden, wobei auf eine strenge Trennung der Geschlechter geachtet wurde. Die Einrichtung war hermetisch von der Außenwelt abgeschlossen, war in der DDR ein Tabu und nahezu unbekannt. Die Jugendlichen mussten sich schriftlich verpflichten, über die Anstalt und ihr Leben dort zu schweigen. Über ihr Martyrium konnten sie erst nach der Wende sprechen. Ein Team von der Universität Würzburg, das ehemalige »Zöglinge« der GJWH Torgau interviewte, kam in der Beurteilung des Effekts der demütigenden, brutalen, unmenschlichen »Umerziehungs«-Maßnahmen zu dem Resümee: »Sie wurden als andere Menschen aus Torgau entlassen – als gebrochene, traumatisierte Menschen. Sie verloren das Vertrauen in andere und können nur schwer jemanden an sich heranlassen; reagieren in bestimmten Situationen mit einem Verhalten, das für Außenstehende nicht immer nachvollziehbar ist« (Beyer/Strobl/Müller 2016, 108; siehe dazu z. B. YouTube.: Schlimmer als Knast – Die Jugendwerkhöfe der DDR – Teil III; Grit Poppe: Weggesperrt, Hamburg 72016, ein gut recherchierter, realistischer Roman).
Die Legitimationskrise der Sonderschulen für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen in Deutschland hält trotz der differenzierenden Organisation und einer von Lehrern wie von Schülern zumeist als erfolgreich eingeschätzten Arbeit an; sie verschärft sich in der aktuellen Inklusionsdiskussion. Die Forderung, auch Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen grundsätzlich gemeinsam mit anderen Schülern in Regelschulen zu unterrichten und dies durch verbesserte Bedingungen im Regelschulbereich und über unterstützende Maßnahmen durch Sonderpädagogen sowie durch eine verbesserte Lehrerbildung zu ermöglichen, hat
Abb. 3: Der Geschlossene Jugendwerkhof Torgau mit der »Sturmbahn« für Zwangs- und Strafsport um 1978 (nach einem Foto der »Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau« oder Archiv DIZ Torgau).
bereits zu vielfältigen Innovationen geführt (vgl. Stein/Müller 2015). Es scheint aber auch heute noch, gerade angesichts der gestiegenen Förderquoten, die Erfahrung des Kollegiums der Wuppertaler Schule für Erziehungshilfe zutreffend zu sein, »dass auch bei sehr günstigen allgemeinen Schulverhältnissen eine nicht unerhebliche Anzahl von Schülern verbleiben wird, die ihren Sozialisierungsprozess oder Resozialisierungsprozess nur in einem besonderen Rahmen werden absolvieren können. Für diese ist die Sonderschule für Erziehungshilfe wohl auch in Zukunft nicht zu entbehren« (Kollegium 1981, 747). Diese Ansicht hatte sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts wohl in der deutschen Schuladministration durchgesetzt. In den »Empfehlungen zum Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung« der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland vom 10.3.2000 ist der sonderpädagogischen Förderung in Sonderschulen ein eigener Abschnitt gewidmet (vgl. KMK 2000, 23–25; Kap. 7.1.1). So ist es konsequent und für die betreffenden Einrichtungen hilfreich, dass zeitgemäße, effizientere Konzepte für die Sonderschule für Erziehungshilfe elaboriert und evaluiert werden (siehe dazu Opp 2003), unter Einschluss gestufter Maßnahmen.
In der Zusammenarbeit der schulischen Sondereinrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen mit den sonderpädagogischen Studienstätten an den Universitäten und Hochschulen haben sich unterschiedliche Konzepte für Erziehung, Unterricht und pädagogisch-therapeutische Interventionen elaborieren lassen. Die wichtigsten Konzepte können wegen ihrer weitgehenden Ausrichtung auf den theoretischen Hintergrund bildende psychologische Ansätze als psychoanalytisch, individualpsychologisch, lerntheoretisch, humanistisch-psychologisch oder wegen ihres Rückgriffs auf verschiedene Ansätze und der Berücksichtigung aller relevanten Erkenntnisse und Gegebenheiten als synthetisch bzw. integrativ bezeichnet werden (siehe Benkmann 1989; Vernooij/Wittrock 2008).
Aktuelle kritische Analysen aus der Fachszene beschäftigen sich auch grundsätzlich mit Fragen schulischer Ausgrenzung und Teilhabe, der Professionalität und interprofessionellen Kooperation, der zukünftigen Rolle von Schule im Hinblick auf Verhaltensstörungen sowie mit den Verbindungen zwischen den hier als »Linien« dargestellten Teilsystemen der Erziehungshilfe (vgl. etwa Herz/Zimmermann/Meyer 2015; Wevelsiep 2015; Zimmermann/Meyer/Hoyer 2016).
1.1.4 Die pädagogisch-psychiatrische Linie: Einrichtungen der Psychopathenfürsorge – Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie – Klinikschulen
Abb. 4: Ärzte, die berühmte Heilpädagogen wurden (Itard, Séguin, Montessori)
Die Beurteilung der Kinder und Jugendlichen, die Schwierigkeiten im Umgang mit sich und der Umwelt zeigen, hat sich im Laufe der Jahrhunderte mehrfach verändert (vgl. für das 19. und 20. Jahrhundert: Göppel 1989, Buchinger 1998). Im Mittelalter – und mancherorts auch später noch – galten sie schlechthin als »böse«, deren sündige Bosheit mit harten Körperstrafen ausgetrieben werden musste.
Im Zuge der Aufklärung verbreitete sich die Erkenntnis, dass Umwelteinflüsse, Mängel in der Bedürfnisbefriedigung und in der Erziehung im Zusammenhang zu sehen sind mit »sittlicher Verwilderung« und »Verwahrlosung« und dass liebevolle Zuwendung, Pflege und planvolle Erziehung vonnöten sind (vgl. Pestalozzi: Stanser Brief, 1799). Unter dem Einfluss von Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) und der Französischen Revolution war es nicht mehr möglich, kindliches Problemverhalten unter dem Aspekt einseitiger Schuldzuweisung zu sehen.
Großes Interesse für »abnorme« Kinder und Jugendliche rief in ganz Europa das Schicksal des »Wilden von Aveyron« hervor. Er war etwa zwölf Jahre alt, lief auf allen Vieren und benahm sich auch sonst wie ein Tier. Jäger hatten ihn 1798 in den Wäldern des französischen Departements Aveyron eingefangen. Der als schwachsinnig eingeschätzte Junge konnte weglaufen, wurde wieder eingefangen und dann dem ersten Versuch zugeführt, »der je gemacht wurde, um ein geistig beschränktes Individuum zu erziehen« (Alexander/Selesnick 1969, 470). In der Taubstummenanstalt von Paris wurde er dem Arzt Jean Itard (1774–1838) übergeben, der – in der Tradition von Pinel und Esquirol – mit viel Zuwendung, Verständnis und Phantasie dem Jungen Sprache und menschliches Benehmen beizubringen versuchte. Mit seinen einfallsreichen und differenzierten Methoden trug er fundierend zur Heilpädagogik bei. Édouard Séguin entwickelte den Interventionsansatz von Itard zu einer physiologischen Sinnesbildung weiter, die wiederum Ausgangspunkt war für Maria Montessori zur Elaborierung ihres psychodidaktischen Ansatzes (Abb. 4). In dem Verständnis von Itard und Séguin liegen die Wurzeln der als pädagogisch-psychiatrisch zu bezeichnenden historiografischen Linie, die mit den Anfängen einer wissenschaftlichen Psychologie und Psychopathologie in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts eine deutliche Ausprägung bekam, als das Bemühen wuchs, problematische Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen zu verstehen und sie als Krankheiten im Vorfeld der Geisteskrankheiten zu sehen. Auf die systematischen Beobachtungen und gesammelten Erfahrungen zur Psychopathologie des Kindesalters ging erstmals ausführlicher W. Griesinger ein, und der Leipziger H. Emminghaus schrieb 1887 das erste Lehrbuch über »Die psychischen Störungen des Kindesalters«. Die bereits von Emminghaus festgestellten extremen Seelenzustände verdichteten dann Pädagogen und Psychiater zum Konstrukt der »psychopathischen Minderwertigkeiten« (vgl. Koch 1891–1893, Trüper 1893). Im Gegensatz zu dem Konzept der »pädagogischen Pathologie« des Philosophen und Pädagogen Ludwig von Strümpell (1890/1910), das über 300 »Kinderfehler im pädagogischen Sinne« darstellte und weite Verbreitung und Anerkennung fand, aber mit dem Ersten Weltkrieg unterging, erwies sich das Psychopathie-Konzept als sehr langlebig und wurde immer mehr verfeinert (vgl. Strohmayer 1910, Ziehen 1926). Es hat vielen Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen in den kinderpsychiatrischen Abteilungen der Nervenkliniken und in den zumeist pädagogisch geleiteten Heilerziehungsanstalten, unter denen das von Trüper gegründete Heim und Sanatorium auf der Sophienhöhe bei Jena international bekannt wurde und weltweite Anerkennung fand, die notwendige Hilfe ermöglicht. Auch durch den »Verein zur Fürsorge für jugendliche Psychopathen« kam es zu positiver Wirkung (vgl. von der Leyen 1923). Die Nationalsozialisten jedoch, die einseitig und übermäßig eine dem Konzept immanente »anlagebedingte Minderwertigkeit« betonten, missbrauchten es für harte Maßnahmen gegen Leib und Leben der als »psychopathisch« diagnostizierten Kinder und Jugendlichen (siehe dazu Abschnitt 1.3). Trotz dieser historischen Hypothek und vieler Ungereimtheiten hielt es sich bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg (vgl. Schneider 1950) und ist rudimentär noch heute wirksam, wurde dann aber seit 1948 durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf empirischer Basis in dem Klassifikationssystem ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) vollständig neu gefasst und findet sich im Wesentlichen für Deutschland in der aktuellen ICD-10-GM Version 2017 in den Untergruppierungen Paranoide Persönlichkeitsstörung und Dissoziale Persönlichkeitsstörung wieder (Kap. 3.1, S. 67–68).
Kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung wurde bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein vorwiegend durch Pädagogen und pädagogische Einrichtungen geleistet. Es waren vor allem die so genannten Rettungshäuser und später die Heilerziehungsanstalten, die »abnorme«, »abartige«, »minderwertige« Kinder und Jugendliche – wie man damals sagte – aufnahmen. Ärzte und Pädagogen arbeiteten gleichberechtigt oder unter pädagogischer Leitung zusammen. Noch in den 1920er Jahren galt es als notwendig, dass der Leiter einer Heilerziehungseinrichtung ein Pädagoge war, da dieser »für die Erziehbarkeit und Bildsamkeit allein zuständig bleibt« und »die heilpädagogischen Maßnahmen bestimmt« (Knauthe 1920, 388/389).
Pädagogen schrieben anerkannte psychopathologische Abhandlungen, wie z. B. Christian Ufer, dessen 1891 erschienenes Buch über »Geistesstörungen in der Schule« von dem Psychiater Ziehen 1926 zu der kleinen Zahl brauchbarer Spezialwerke, die alle Kinderpsychosen behandelten, gezählt wurde. Auch Trüpers Bücher von 1893 über »Psychopathische Minderwertigkeiten im Kindesalter« und von 1902 über »Die Anfänge der abnormen Erscheinungen im kindlichen Seelenleben« hatten Geltung in der Psychiatrie.
Die erste kinderpsychiatrische Einrichtung gründete in Deutschland der als Autor des »Struwwelpeter« berühmt gewordene Nervenarzt H. Hoffmann 1864 in Frankfurt/Main. Später wurden auch eigenständige kinder- und jugendpsychiatrische Kliniken eingerichtet, die weltweit vorbildlich waren.
Nachdem in der Zeit des Faschismus und im Zweiten Weltkrieg die medizinischen Disziplinen wegen ihrer Kriegswichtigkeit besonders gefördert und heilpädagogische Maßnahmen als »marxistische Gefühlsduselei« abgelehnt worden waren, behielt nach dem Ende des Weltkrieges und dem Zusammenbruch des »Dritten Reiches« der Mediziner eine übergeordnete und der Pädagoge bzw. auch der Psychologe verblieben in nachgeordneten Stellungen. In Überbewertung der medizinischen Maßnahmen schien sich zeitweilig Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen gegenüber eine Entwicklung anzubahnen, die ein Buch mit dem bezeichnenden Titel »Pillen für den Störenfried« als verhängnisvoll, inhuman und letztlich ineffektiv kritisierte (vgl. Voss 1983).
Inzwischen wird die Fragwürdigkeit des Griffs nach dem Pharmakon bei Verhaltensstörungen deutlich gesehen, und Heil- und Sonderpädagogen sowie Psychologen bekommen mit ihren Möglichkeiten und Verfahren mehr und mehr Bedeutung im kinder- und jugendtherapeutischen Prozess, allerdings unter der Ägide des Arztes, der allein als weisungsbefugt und verantwortlich angesehen wird. Dabei manifestieren sich allerdings auch Gegentrends, insbesondere in der Diskussion des Umganges mit Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen (Kap. 9.3).
In den gegenwärtigen Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie in den angeschlossenen Klinikklassen und -schulen steht die Arbeit für psychosozial gestörte und psychisch kranke Kinder in der Tradition, die mit Jean Itard (1774–1838) und seiner verständnisvollen und einfallsreichen Erziehung des »Wilden von Aveyron« begann, über Édouard Séguin und Maria Montessori fortgeführt wurde, durch Sigmund Freud eine tiefenpsychologische und durch Kinder- und Jugendpsychiater wie Asperger und Stutte eine heilpädagogische Ausrichtung bekam, die sich in diagnostischen und pädagogisch-therapeutischen Maßnahmen, vor allem aber in einer menschlich warmen, dialogischen Beziehung zwischen Kindern und Jugendlichen und ihren Helfern zeigt. Gegenwärtig haben auch lernpsychologische Konzepte einen wichtigen Stellenwert.
1.1.5 Die berufspädagogische Linie: Arbeitserziehung – Industrieschulen – Fortbildungsschulen – Berufsschulen – Berufsbildungswerke – Benachteiligtenförderung
Junge Menschen mit Verhaltensstörungen haben Schwierigkeiten, sich in die Berufs- und Arbeitswelt einzugliedern. Diese Problematik wird gesehen und zumindest ansatzweise berücksichtigt, seit – mit der beginnenden Neuzeit – die Beschränkung auf Strafmaßnahmen und die Vorbereitung auf ein Bettelleben als inadäquat und unbefriedigend erkannt worden waren. Erziehungs- und Strafanstalten, später dann – mit der Etablierung der allgemeinen Schulpflicht – auch öffentliche Schulen, machten es sich zur Aufgabe, die Jugendlichen durch Arbeit zur Arbeit bzw. für ein unabhängiges, erwerbsfähiges, wirtschaftlich selbstständiges Leben zu erziehen.
Mittelpunkt des Konzepts der Amsterdamer Zuchthäuser, nach deren Vorbild europaweit Gründungen erfolgten, war die, allerdings noch sehr einseitige, Arbeitserziehung. Im Zuchthaus für männliche »Übeltäter« z. B. wurde vorwiegend Holz geraspelt (Rasphuis), im Zuchthaus für Frauen vorwiegend gesponnen (Spinnhuis). Die Inschrift über dem Spinnhaus gibt die damalige Einstellung wieder und charakterisiert das Konzept (zitiert nach Hippel 1898, 457):
»Fürchte dich nicht!
Ich räche nicht Böses, sondern zwinge zum Guten.
Hart ist meine Hand, aber liebreich mein Gemüt.«
Nach der Zeit des Niedergangs infolge des Dreißigjährigen Krieges im 17. Jahrhundert brachte das 18. Jahrhundert insbesondere mit den Pietisten ein weit verbreitetes Engagement für die Erziehung zur Arbeitsfähigkeit und zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit auch schwieriger junger Menschen. In den von Francke gegründeten Halleschen Anstalten war neben der Erziehung zur Frömmigkeit auch die Erziehung zur »Nützlichkeit« ein Hauptziel. Die Kinder und Jugendlichen wurden systematisch in handwerkliches Arbeiten eingeführt.
Mit der aufkommenden Industrieproduktion kam es zur Gründung von arbeitsbezogenes Wissen vermittelnden »Sonntagsschulen« und von »Industrieschulen«, in denen nicht nur arme und verwahrloste, sondern auch schwererziehbare Kinder aus gutsituierten Familien zur »Industriosität« erzogen wurden, d. h. sie sollten die für die industrielle Produktion notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernen. Eine der ersten und mit Vorbildcharakter wirkenden Industrieschulen war die von Pastor Wagemann 1784 in Göttingen gegründete Einrichtung (vgl. Trost 1930).
In dem ebenfalls für ganz Deutschland vorbildhaft wirkenden, 1833 gegründeten neupietistischen »Rauhen Haus« in Hamburg legte Wichern, der Gründer und Leiter der Anstalt, großen Wert auf die Erziehung zur Arbeit durch Arbeit (vgl. Lindmeier 1998, 188 ff.), für ihn der dritte bedeutsame Erziehungsfaktor neben Familie und Schule. Wenn sowohl in den Zuchthäusern als auch in vielen Rettungshäusern und Industrieschulen die Arbeit der Kinder und Jugendlichen einen deutlichen ökonomischen Zweck hatte und nicht selten zur Ausbeutung der Arbeitskraft der jungen Menschen pervertierte, so hat für Wichern die Arbeit der Kinder und Jugendlichen einen eindeutig pädagogischen Zweck, der zum einen »in der durch sie nach festen technischen Regeln geordneten Übung des Willens und der Hand«, zum anderen in der »Vorbereitung auf den künftigen Beruf« liegt (Wichern 1958, 260–261). »Geistlose Arbeiten« wie »Werg-, Ross- und Kuhhaarzupfen, Kopal-, Kaffee- und Wollsortieren, Pappschachtel- und Streichhölzerfabrikation u. dgl.« wurden deshalb ebenso entschieden abgelehnt wie die »Überlassung von Zöglingen an Fabrikanten« (a. a. O., 259). In diesem Sinne war die Erziehung zur komplexen Arbeitsfähigkeit über Charakterbildung und die Aneignung handwerklicher Fähigkeiten ein Grundanliegen der ganz Deutschland erfassenden Rettungshausbewegung. Den Erfolg dieser auf das Arbeitsleben vorbereitenden und in die Berufswelt einführenden Erziehung und Bildung im »Rauhen Haus« dokumentierte Wichern für die Jahre von 1833 bis 1867 mit einer Erfolgsquote von 82%. Von den 604 »ordentlich Entlassenen« betrugen sich 55 schlecht (9,1%), 433 gut (71,7%, »nähren sich redlich mit ihrer Hände Arbeit«) und 62 »mittelmäßig, d. h. schwankend« (10,3%). 54 bzw. 8,9% waren ausgewandert, verschollen usw., konnten also nicht beurteilt werden (Wichern a. a. O., 315). Dieser aus der Sicht Wicherns große Erfolg kann allerdings auch als Manipulation für ein christlich-demütiges, den Produktionsverhältnissen angepasstes und auf einfache Arbeitstätigkeit reduziertes Leben verstanden werden (vgl. Ahlheim et al. 1971, 42–43).
Diese kurz skizzierte erste Phase einer berufspädagogisch-historiografischen Linie, die – wie deutlich wurde – noch in enger Verbindung mit der sozial- und der kriminalpädagogischen Linie zu sehen ist, mündet hinein in eine zweite Phase, die mit den Fortbildungs- und späteren Berufsschulen, mit der Berufsschulpflicht seit 1938 und dem »dualen System« beruflicher Bildung – Betrieb und Berufsschule sind aufeinander bezogene, aber eigenständige Lernorte – eine neue Qualität gewinnt.
Aus allgemeinen Fortbildungsschulen, die seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert der »Nachholung, Wiederholung und Fortbildung« junger Leute mit einer einfachen Schulbildung dienten (Spranger 1949, 67) und anfangs auf Betreiben der Kirche, später auch des Gewerbes gegründet wurden, entwickelten sich seit dem letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts auf Berufsbildung ausgerichtete schulische Einrichtungen, wie spezialisierte Fortbildungsschulen und Gewerbeschulen. Derartige Einrichtungen sahen die engagierten Vertreter der Hilfsschulbewegung, welche die Gründung der als Hilfsschulen bezeichneten schulischen Sondereinrichtungen für die »schwachbefähigten« bzw. »intelligenzschwachen«, auch damals schon – wie sich zeitgenössischen Beschreibungen und Untersuchungen entnehmen lässt – zum großen Teil Verhaltensstörungen zeigenden Kinder und Jugendlichen betrieben, für die berufliche Eingliederung ihrer ehemaligen Schüler als unbedingt notwendig an. Es wurden zunächst – z. B. in Frankfurt seit 1897, in Nürnberg seit 1899 – besondere Kurse für ehemalige Hilfsschüler an Fortbildungsschulen eingerichtet, die dann in besondere Fortbildungseinrichtungen hineinmündeten. Zur Gründung der ersten Hilfsfortbildungsschule Deutschlands kam es 1906 in Berlin. Bis zum Ersten Weltkrieg gab es in vielen deutschen Städten selbstständige Hilfsfortbildungsschulen oder Hilfsfortbildungsklassen, die den Hilfsschulen angegliedert waren. Das Hilfsberufsschulwesen existierte mit gemischten Klassen für lernschwache und schwierige ehemalige Volksschüler zusammen mit Hilfsschülern sowie mit reinen Hilfsschülerklassen bis in die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft hinein, wurde in Nord- und Mitteldeutschland sogar weiter ausgebaut. In den 1920er Jahren änderte sich – der Terminologie der Reichsschulkonferenz entsprechend – die Bezeichnung Fortbildungsschule in Berufsschule.
Mit umfangreichen statistischen Erhebungen bemühte sich der »Verband der Hilfsschulen Deutschlands (VDHD)«, dem die meisten Hilfsschullehrer angehörten, darum, die »Erwerbsfähigkeit« bzw. die erfolgreiche berufliche Eingliederung der ehemaligen Schüler nachzuweisen. Nach einer Statistik z. B., welche die zwischen 1906 und 1909 hilfsschulentlassenen über 9000 Schüler und Schülerinnen erfasste, wurden 71,24% als völlig erwerbsfähig, 22,35% als teilweise erwerbsfähig und nur 6,31% als nicht erwerbsfähig festgestellt. In einer »Berufsstatistik« von 1926, die von insgesamt 44 182 zwischen 1918 und 1925 entlassenen Hilfsschülern 40 963 junge Menschen einbeziehen konnte, wurden 91,33% als erwerbstätig und nur 8,76% als nicht beschäftigt klassifiziert, Zahlen, die angesichts der damals herrschenden großen Arbeitslosigkeit beachtlich sind (siehe dazu ausführlicher Myschker 1969, 144–156).
Mit dem Zusammenbruch des »Dritten Reiches« endete die Existenz selbstständiger Hilfsberufsschulen, deren Tradition jedoch innerhalb des Berufsvorbereitungs- und Berufsausbildungswesens der bundesdeutschen Gegenwart weiterlebt.
In der Aufbauperiode nach dem Zweiten Weltkrieg zeigten die Behindertenpädagogen im Hinblick auf die berufliche Eingliederung ihrer ehemaligen Schülerinnen und Schüler zunächst eine auffallende, allerdings aus den Zeitverhältnissen zu erklärende Zurückhaltung (vgl. Ellger-Rüttgardt 1982, 59). Mit den 1970er Jahren begann in diesem Bereich ein Erwachen, in gewisser Hinsicht auch als Reaktion auf das als unbefriedigend empfundene »Berufsbildungsgesetz« (BBiG) von 1969, dem sich die »Handwerksordnung« (HwO) von 1953 anpasste und das von vielen Erziehungswissenschaftlern vehement kritisiert wurde. Es entwickelte sich ein sich ausbreitendes Engagement, und eine dritte Phase innerhalb der berufspädagogischen Linie begann.
Es ging von nun an nicht mehr nur um Erziehung zur Erwerbsfähigkeit und um Eingliederung in die Bereiche einfacher