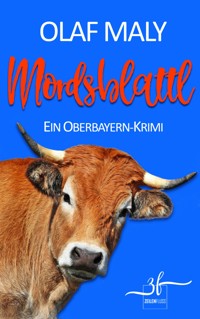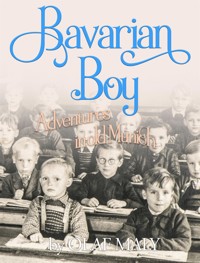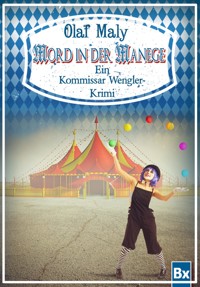3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Wengler
- Sprache: Deutsch
Es ist Ende August und immer noch drückend heiß. Johann Baptist Bernbichler hat eine sehr schlechte Woche hinter sich. Wirklich schlecht. Kommissar Wengler erholt sich gerade vom letzten Fall, den man gerade abgeschlossen hat, mit einer Maß Bier im Biergarten. Doch dann wird er nach Hasenbergl gerufen, einer Gegend in München, in der man die Polizei zwar oft, aber nicht gerne sieht. Man hat ein totes Paar gefunden, doch es gibt nicht viele Anhaltspunkte. Also versucht Kommissar Wengler, das Leben der beiden zu rekonstruieren. Es scheint kein aufregendes Leben gewesen zu sein, das die beiden geführt haben. Die einzigen Hinweise, auf die man sich stützen kann, sind eine Parzelle im Schrebergarten ‚Sonnenblumen e.V.' und eine Telefonnummer, unter der sich die Schwester des Toten meldet. Auch ein Sohn taucht auf. Doch immer mehr deutet darauf, dass der Schrebergarten etwas mit dem vorzeitigen Ableben zu tun hat. Es bleibt der Intuition und akribischen Kleinarbeit der Münchener Mordkommission in Form von Kommissar Herbert Wengler und seinem Assistenten Armin Staller überlassen, dies herauszufinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Verhängnisvolle Tage
Eine Kommissar Wengler Geschichte
Ich möchte mich an dieser Stelle bei zwei Personen bedanken, ohne deren Hilfe dieses Buch nicht zustande gekommen wäre. Da wäre zuallererst meine langjährige Partnerin Marita Stepe, die es stets auf sich nimmt, die erste Fassung meiner Bücher zu lesen, und mit konstruktiver Kritik auf die Handlung Einfluss nimmt. Und dann noch meine Lektorin, Theresia Riesenhuber, die mit Engelsgeduld meine Fehler ausmerzt.BookRix GmbH & Co. KG81371 München1
Für Johann Baptist Bernbichler war dieser Tag Ende August kein guter gewesen. Bei Weitem nicht. Man könnte fast sagen, es war einer der schlechtesten Tage in Monaten. Es war, wie schon seit Wochen, drückend heiß. Eigentlich mehr unausstehlich heiß und schwül. Nicht ganz normal für diese Jahreszeit und schon gar nicht normal für München. Gut, es konnte schon einmal heiß werden. Aber an diesen Tagen tropfte die Feuchtigkeit aus allen Poren, Fugen und Blätterwerken. Die sonst so blind-fahl aussehenden Pflanzen glänzten, als wäre es Weihnachten und Kerzen würden sie zum Schillern bringen. Aber es war August und man zündete im August keine Kerzen an. Außer in der Kirche, da brannten die immer. Und man konnte nicht in die Kälte fliehen, um sich Erleichterung zu verschaffen. Diese gab es um Weihnachten herum, wenn es sowieso kalt war, man also noch mehr Kälte nicht brauchte. Nur in der Kirche, da konnte man sich erholen, in der muffigen Kühle, die die Steine gefangen hielt. Da war's immer kühl. Und leer war die auch immer.
Das Wetter setzte sich also auf das Gemüt eines jeden, wie ein Kaugummi auf das Pflaster der Fußgängerzone. Es war nicht wegzubekommen. Man wollte es zwar nicht, dieses unausstehliche Wetter, aber es umgab einen überall und war einfach da. Hundserbärmlich, erbarmungslos und unausweichlich. Ein Fluch für jeden, der damit zu kämpfen hatte. Es machte einen wünschen, dass es endlich Winter würde. Man mochte zwar den Winter nicht lieber als den Sommer, aber das war einfach zu viel. Wahrscheinlich konnte man sich das so einfach wünschen, da dieser Wunsch, wie so viele andere auch, nicht zu erfüllen war. Nur einige wenige, die es sich leisten konnten, flogen in den Norden, wo es das ganze Jahr über nicht warm wurde. Irgendwo auf eine der Tausenden Inseln in den schwedischen Gewässern. Oder gar in die Arktis. Nur, Johann Baptist Bernbichler gehörte nicht zu der Klasse Mensch, die sich das leisten konnte. Er gehörte zu denen, die fluchend die Tage und Nächte zu erleiden hatten.
Es war Sonntag. Der letzte Sonntag im August. An sich kein Grund, das besonders festzustellen, wären da nicht einige Ereignisse gewesen, die diesen Sonntag zu einem speziellen Tag gemacht hätten. Drei Dinge waren in den vorangehenden Tagen im Leben des Johann Baptist Bernbichler passiert, die ihn - neben dem Wetter natürlich – irgendwie aus der Bahn geschmissen hatten.Das erste war ein Gespräch mit seinem Chef in der Firma gewesen, in der er arbeitete, seit er denken konnte. Am Donnerstagvormittag. Gleich nachdem er es sich in seinem Bürostuhl dort unten im Kellergewölbe bequem gemacht hatte. Alle in den oberen Stockwerken beneideten ihn auf einmal um diesen Platz, da er der einzige war, wo man nicht vor Hitze zerlief. Sonst, an gewöhnlichen oder gar kalten Tagen, hielt sich der Neid in Grenzen.
Es war ein altes, klammfeuchtes Gewölbe, in einer alten Firma. Meist war es blankgelegtes Mauerwerk, das man, um es menschlicher zu gestalten, weiß überstrichen hatte. Man sah die Ziegelsteine, die man vor mehr als 100 Jahren dort übereinander geschichtet hatte, und die immer noch ihren Dienst taten. Sie mussten alles darüber halten, den oberen Stockwerken ein Fundament geben. Während des Krieges hatten die Räume als Luftschutzbunker gedient. Hätte man nicht die weiße Farbe darüber gemalt, würde man das Geschriebene noch sehen, das die Leute, die dort nächtelang hatten ausharren müssen, hinterlassen hatten. Nur interessierte man sich nicht mehr für diese Zeugnisse der Menschlichkeit, des Verzagens an derselben, und die Angst, die man damals gehabt hatte. Das war vorbei. Man musste in die Zukunft blicken. Es half niemandem, sich immer wieder daran erinnern zu müssen. Als der Wahnsinn endlich vorbei gewesen war, stellte man dort im Keller alles ab, was man 'oben' nicht mehr brauchen konnte. Einige Jahre später, als man in der Firma mehr Platz brauchte, unter anderem eben auch Johann Baptist Bernbichler. Und mehrere andere, die es nicht geschafft hatten, oben einen Platz zu bekommen.
Bernbichler war an sich ein fleißiger, ordentlicher Mitarbeiter, der zwar ab und an immer wieder einmal zu spät kam oder vielleicht auch nicht immer ganz bei der Sache war. Aber als Sachbearbeiter in einem Büro mit etwa 10 anderen Kollegen war er einer der beständigsten. Was in diesen Zeiten schon etwas zu bedeuten hatte. Die Fluktuation war gewaltig, deshalb konnte man nie sagen, wie viele Personen dort im Keller eigentlich arbeiteten. Manche hielten es gerade einmal zwei Wochen aus, manche 2 Monate. Meistens kamen sie dann morgens ins Büro, schmissen ihre kleinen Koffer auf den Tisch, fingen an ihre Fäuste zu ballen, herumzuschreien und mit unflätigen Ausdrücken auf das 'von oben' zu schimpfen. Dann nahmen sie ihre kleinen Koffer wieder, sagten allen, die ihnen zugesehen hatten, was sie doch für elende Ratten seien, in diesem Loch zu arbeiten, und verließen die Stätte, ohne jemals wiederzukehren. Das waren die, die den Absprung schafften.
Viele konnten es eben nicht länger als ein paar Wochen aushalten, irgendwelche Papiere zu sortieren und in die Ablage zu schicken. Sie sahen diese Arbeit als erniedrigend und komplett sinnlos an – was sie wahrscheinlich auch war. Nicht jedoch Johann Baptist Bernbichler. Er hatte mit seiner Arbeit kein Problem. Nun gut, dass heißt, meistens hatte er damit kein Problem. Er war vor vielen Jahren einmal als Hilfskraft in der Buchhaltung eingestellt worden, in der Hoffnung, dort weiter aufzusteigen. Die Hoffnung darauf hatte auf beiden Seiten bestanden: Bei ihm ebenso wie auf der Seite der Firma. Nur hatte sie sich nicht erfüllen lassen, diese Hoffnung. Seine Verständnis hinsichtlich Zahlen hielt sich sehr in Grenzen, was besonders in Bezug auf Kontoführung und Buchhaltung nicht sehr von Vorteil war. Da man jedoch jemanden brauchte, der die Erwartungen erfüllen konnte, blieb keine andere Wahl. Man musste ihn, wollte man ihn nicht entlassen, einfach in eine andere Abteilung versetzen. Erst versuchte man es mit der Registratur. Dort gab es nach wenigen Tagen mit der dort schon seit vielen Jahren tätigen Mitarbeiterin, der Maria Brandweser, jedoch permanent Streit, da er das System, dass sich Maria über die Jahre ausgedacht und mehr oder weniger erfolgreich praktiziert hatte, und das nur von ihr beherrscht wurde, von Johann Baptist nicht übernommen wurde. Er wollte sein eigenes System einführen, von dem er absolut und ohne Zweifel total überzeugt war. Bevor nun die Registratur einen totalen Kollaps erlitte, sah man sich gezwungen, die Entscheidung zu revidieren und Johann Baptist schlussendlich in die Ablageabteilung zu versetzen. Das war die Abteilung, in der nicht nur alle Akten und Papiere ihr Ende fanden, sondern auch alle Mitarbeiter, die man nirgendwo anders mehr einsetzten konnte. Die Räume dieser Abteilung waren, wie bereits gesagt, im Keller des Hauptgebäudes untergebracht. Wenn man mit dem Aufzug fuhr, hatten alle Knöpfe der Stockwerke, die von 'E' wie Erdgeschoss nach oben gingen eine deutliche Spur von Abnutzung. Die meisten Zahlen musste man sogar erraten, je nachdem, in welcher Position der Reihe sie standen. Wollte man zum Beispiel in den vierten Stock, musste man sich an der 3 und 5 orientieren, Ziffern, die noch einigermaßen erkennbar waren. Je höher die Zahlen wurden, desto weniger waren sie abgegriffen. Die letzte Ziffer, die 8, war sehr deutlich zu lesen. Dort residierte der Vorstand, und dieser war meist nicht sehr oft im Haus. Benutzte also auch den Aufzug nicht in dem Umfange, in dem ein Abgreifen der Zahl im Aufzug sichtbar geworden wäre. Auch der schwarze Aufkleber für das 'U' wie Untergeschoss war frisch wie am ersten Tag. Schwarz und gestochen scharf hob es sich vom silberfarbenen Grund ab, als hätte man es erst gestern dort aufgeklebt. Es gab nicht viele, die dort hin mussten. Außer eben denen, die dort ihren Tag verbrachten. Wie Johann Baptist Bernbichler.
Letzten Donnerstag also rief ihn sein Chef, der im sechsten Stock arbeitete und dort sein tägliches Domizil hatte, zu sich nach oben.
„Herr Bernbichler, wir müssen reden“, sagte er am Telefon bedeutungsschwer und in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete. 'Was der Depp wohl von mir will?', dachte sich Johann Baptist und begab sich zum Aufzug. Darin angekommen, drückte er die Nummer 6 und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Oben öffnete sich die Tür und gab den Blick auf eine nicht gerade freundliche Vorzimmerdame frei, die an einem kleinen Tisch vor einer Tür saß, an der er den Namen 'Johannes Kerber' lesen konnte.
„Er erwartet Sie schon, gehn's nur rein. Keine Scheu, der beißt nicht“, meinte sie, überraschenderweise nicht ganz unfreundlich.
Wahrscheinlich sah man Johann Baptist an, dass ihm nicht sehr wohl war in seiner Haut. Er hatte keine Erfahrung mit solchen Gesprächen und wollte auch keine erlangen. Er dachte sich immer, wenn man mit ihm reden wolle, dann sicher nicht, um ihm zu irgendwas zu gratulieren. Oder ihm einen Preis zu übergeben. Wie 'Angestellter des Monats' oder so. Mit einem Monat reserviertem Parkplatz vor dem Eingang. Nun, dafür hätte er ohnehin keine Verwendung gehabt, da er nicht einmal ein Auto besaß. Also störte es ihn nicht besonders, dass er eine solche Auszeichnung nicht bekam. Außerdem, dachte er sich, machen die das ohnehin nur immer unter sich aus und dann liest man davon in der Hauspost. Von ihm hatte man noch nie in der Hauspost gelesen.
„Setzen Sie sich doch, Herr Bernbichler“, meinte Herr Kerber jovial, der eigentlich nicht sein richtiger Chef war, sondern der stufengemäß Vierte und damit rangmäßig auch Letzte in der Personalabteilung.
Da man keine Person gefunden hatte, die sich dafür aufopferte, die Leute im Keller zu beaufsichtigen, hatte man eben einen in der Personalabteilung mit dieser Verantwortung betraut. Es war immer der vierte Mann, die Neuen, die dann irgendwann abgelöst wurden. Sie kannten sich nicht, Johannes Kerber und Johann Baptist Bernbichler. Das war auch gut so, meinte man in der Personalabteilung. Zu viel Kennen war der Disziplin abträglich. Im schlimmsten Fall konnte man ja auch noch Freunde werden. Und das war auf keinen Fall gewollt. Als Bernbichler sich auf den dunkelblauen, gepolsterten Stuhl gesetzt hatte, harrte er der Dinge, die da kommen sollten. Er hatte so einen teuren Stuhl bisher nur in den Reklameheften gesehen, die bei ihm unten im Keller landeten. 'Einmal auf so was sitzen!', hatte er oft zu sich selbst gemeint. 'Nur einmal'. Und jetzt hatte sich sein Wunsch also erfüllt. Er befühlte mit den Händen den Stoff, den schwarzen Stahlrahmen, sah sich die Stuhlbeine an. 'Ein schöner Stuhl', dachte er für sich. Herr Kerber erkundigte sich nach der Ehefrau, wie es ihr denn wohl ginge und ob alles in Ordnung sei. Er hatte bemerkt, dass Herr Bernbichler gedanklich ein wenig abwesend war und nicht ganz bei der Sache zu sein schien. Die Frage nach seiner Frau jedoch brachte ihn zurück in die Realität.
„Sie haben doch mei Frau noch nicht einmal g'sehen, Herr Kerber. Was fragen's denn so? Sie woll'n doch gar net wissen, wie's der geht, oder? Sie haben doch mir was zum sagen, haben's g'meint, und nicht meiner Frau. Also, was is? Ich hab eine Arbeit zum tun.“
Herr Kerber sah ein wenig bestürzt drein, hatte er es doch normalerweise mit zivilisierteren Personen zu tun als einem Herrn Bernbichler. Er hatte einfach eine Atmosphäre der kollegialen Zweisamkeit schaffen wollen, damit das, was er zu sagen hatte, nicht so harsch klänge. Jedenfalls hatte er das so in den endlosen Seminaren, an denen er immer pflichtbewusst teilgenommen hatte, gelernt.
„Nun gut, da Sie es so wollen, kommen wir eben gleich zur Sache. Wir werden die Abteilung, in der Sie derzeit beschäftigt sind, auflösen und somit Ihre Position eliminieren.“
Es entstand ein Moment der Ruhe, in dem Kerber mit dem Ende eines Kugelschreibers langsam und rhythmisch auf seinen grauen Einheitsschreibtisch klopfte. Das Gestell war aus Stahlrohr, dunkelgrau, die Platte aus Resopal, etwas heller gehalten. Mehr gediegen als schön. Nützlich, eben. Und irgendwie passend zu den Stühlen. Blau und grau.
„Eliminieren wollen's mich?“, fragte Bernbichler nach ein oder zwei Minuten. Er musste das erst einmal in seinen Kopf bekommen, die ganze Tragweite dieses Satzes begreifen. Und das ging nicht von einer Sekunde auf die andere. Der Satz allein hatte ihm ein flaues Gefühl im Magen verursacht. Irgendwie tat es ihm nicht gut, was immer es war, das wusste er.
Kerber hatte es sich in seinem Drehstuhl bequem gemacht, der auch ein Neigen nach hinten erlaubte. 'Wie im Reisebus', dachte sich Bernbichler, 'wenn's den Sitz nach hinten klappen, dass keiner mehr eine Luft bekommt, weil's so eng wird.' Er kannte das, da er öfter mit dem Bus in die Berge gefahren war, meistens zum Königssee, weil es immer diese Sonderfahrten gab, bei denen man dann Heizdecken oder mechanische Mixer kaufen konnte. Spottbillig, natürlich, und einmalig nur dort zu erwerben. Gelegenheiten, die man sich dann auch nicht entgehen lassen wollte. Deswegen hatte er mittlerweile 6 Handmixer, 12 Decken und mehrere andere unnütze Apparaturen, die hauptsächlich Gemüse in kleinste Teile zerhackten. Und das nur mit einem einzigen Druck auf den Deckel. In Sekundenschnelle. Und die im Keller, in Originalverpackung, darauf warteten, weggeschmissen zu werden.
„Nein, Herr Bernbichler, nicht Sie werden wir eliminieren, keine Angst, nur die Position, die Sie bekleiden.“
„Ich bekleid nix. Ich hab eine Arbeit und des hab ich schon immer g'habt hier. War's des dann?“
Damit gedachte Bernbichler, sich von seinem Stuhl, der sich letzten Endes doch nicht als sehr bequem herausgestellt hatte, aufzustehen und sich wieder seinen Akten im Untergeschoss zu widmen. Halb aufgerichtet verharrte er in dieser Position, da Kerber ihm andeutete, dass das noch nicht alles gewesen sei und er sich doch bitte wieder setzen sollte. Kerber hatte sich von seiner Rücklage wieder nach vorne gearbeitet und seine Ellbogen auf den Tisch vor sich aufgestützt.
„Ja, was denn noch?“
„Herr Bernbichler, weil wir eben diese Position eliminieren, müssen wir Sie damit auch freisetzen. Wir werden die Tätigkeiten, die Sie jetzt ausführen, auf einem Computer...“
„Rausschmeißen wolln's mich also. Ja, des is ja sauber! Ja, jetz bin ich aber..., des muss ich schon sagen. So viele Jahr hab ich hier g'arbeitet und jetz kommt da ein Computer und ich bin weg.“
„Sehen Sie es doch mehr als eine Chance, Herr Bernbichler. Sie sollten das als einen neuen Anfang sehen, nicht als ein Ende. Ich bin mir...“
Auch diesen Satz hatte er in diesen Seminaren bis zur geistigen Selbstaufgabe trainiert. In allen Variationen durchgespielt. Er kam ihm wie Olivenöl über die Lippen. Irgendwie war er sogar stolz darauf.
„Sie reden ja einen Schmarren, des muss ich schon sagen, Sie Stumpen, Sie! Haben's des auf irgendeiner Schul' g'lernt, dass man des denen sagt, die man rausschmeißt?“
Mehr wollte Bernbichler nicht wissen. Es hatte keinen Sinn, sich zu wehren. Warum auch? Er war zu alt, um jemals wieder etwas zu finden. Das wusste er, wenn er auch nicht gerade ein Musterbeispiel quirliger Intelligenz war. Ohne ein weiteres Wort stand er auf, ging an der jetzt doch grimmig dreinschauenden Assistentin vorbei zum Aufzug und fuhr in seinen Bereich. Seinem Freund, dem Kornmüller Schorsch, war das vor ein paar Wochen ebenso passiert. Es war ihm immer noch frisch in Gedanken und kam umso frischer wieder nach oben, als er sich nun in derselben Situation befand.
Sie hatten, wie jeden Donnerstagabend, beim Schwaiger am Stammtisch gesessen und die Probleme der Welt diskutiert, für die jeder der Teilnehmer eine eigene Lösung hatte. Wie unter Freunden üblich, hatten sie am Ende keine gemeinsame Lösung gefunden, also das Thema auf den nächsten Donnerstag verschoben. Nur an jenem Abend gab es etwas für die Runde zu besprechen.
„Mich haben's gestern g'feuert“, hatte der Schorsch ruhig und gelassen gesagt. Dann hatte er einen großen Schluck Bier aus seinem Glas genommen, langsam den Krug abgesetzt, sich mit dem Hemdsärmel seinen Mund abgewischt und alle Beteiligten einzeln angesehen.
„Ja, so ein Scheiß“, hatte der Gruber Hans gemeint, der als erster das Wort ergriffen hatte.
„Und, was machst dann jetz?“, hatte der Krumminger Toni gefragt, der weitaus Jüngste in der Truppe. Er hatte den begehrten Stammplatz an diesem Tisch von seinem Vater geerbt, der vor ein paar Jahren ganz einfach umgefallen und nicht mehr aufgestanden war. Beim letzten Mal, an dem er noch am Stammtisch teilgenommen hatte, hatten ihm die anderen versprechen müssen, seinen Sohn in ihre Mitte aufzunehmen, damit die Krumminger Tradition fortgesetzt werden konnte – was später den Verdacht aufkommen ließ, dass das plötzliche 'Umfallen' doch nicht so plötzlich gekommen war, wie es aussah.
Wie an bayerischen Stammtischen so üblich, hatte sich die ganze Diskussion rund um die Verkündung vom Kornmüller Schorsch entwickelt. Er war also ohne Arbeit. Schlimm, aber kein Grund, traurig zu sein. Die Stammtischbrüder zeigten Interesse, das war nicht zu leugnen. Interesse und Mitgefühl. Man hatte ihn bedauert, ihm Trost zugesprochen, obwohl jeder wusste, dass ihm das nicht helfen würde. Also hatten sie schließlich wieder zu anderen Themen übergewechselt, die auch brennend waren und mehr die Weltpolitik betrafen als den Verlust einer Arbeit, die einem Brot und Leben gab. Wie zum Beispiel den depperten Politikern, die keine Ahnung hatten, wie des hier in Bayern so ablief. Und von denen im Norden wollte man sowieso nicht regiert werden.
Daran musste Johann Baptist Bernbichler denken, als er seinen Kalender, die Vereinsflagge des TSV 1860 München, deren absolut treuer und blind ergebener Mitstreiter er war, und seine Kaffeetasse einsammelte. Dann sah er sich noch einmal in Ruhe um, fegte mit einem Wisch sämtliche Papiere von seinem ehemaligen Schreibtisch, nickte sich selbst zustimmend zu und verließ den Raum seines bisherigen Lebens. Da er die weiteren Anwesenden nicht gerade gut kannte, sondern eigentlich nur neben ihnen gesessen hatte, gab es auch keinen Grund für eine großartige Verabschiedung.
„Servus dann“, war alles, was er herausbrachte, bevor er mit dem Aufzug ins Erdgeschoss fuhr und die Tür nach draußen benutzte, die sich automatisch vor ihm öffnete.
„Als würd die sich noch auch freuen, dass ich geh, die blöde Tür“, sagte er laut zu sich selbst. Die Leute, die ihm zufällig gerade ins Gebäude entgegenkamen, sahen sich zum Teil nach ihm um und schüttelten leicht den Kopf. Draußen angekommen blieb Bernbichler kurz stehen, sah sich noch einmal um, klemmte dann seine abgenutzte Aktentasche unter den Arm, murmelte noch etwas von 'Deppenhaufen' in seinen Bart und ging langsam und bedächtig zur Straßenbahn.
2
Das zweite Dilemma folgte dann am Samstagabend geradewegs auf den Fuß. Oder auf zwei Füßen. Den Füßen seiner Frau sozusagen. Der Kreszenz Bernbichler. Geborene Schneiderhauser.
„Ja, sauber, jetz ham's dich rausg'schmissen. Ja, du Depp du, wie hat jetz des passieren können? Hab ich mir's doch denkt, weilst gestern nicht in der Arbeit warst. So eine dumme Ausred, dass dich des zusammen g'haut hat die Gripp'n, des hab ich dir ja sowieso nicht abg'nommen. In dem Wetter hat man keine Grippen. Schon gar nicht, wenn man so blöd is wie du.“
Die Kreszenz Schneiderhauser kam nicht gerade aus gutem Haus, aber dennoch hatte ihr die Mutter schon am ersten Tag, als sie ihr den Johann Baptist vorgestellt hatte, gemeint, dass der nicht der Richtige sei. Sie habe das im Gefühl, dass aus dem nie etwas werden würde, hatte sie gemeint, wann immer man darüber sprach. 'Nur Ärger wirst haben, mit dem Deppen. Der is doch nix und kann nix. An Installateur sollst dir suchen. Die sind immer weg, und des Geld kommt immer von selber heim. Da kannst dann machen damit, was'd willst. Sei net so blöd und heirat' so an Schnösel.'
Sie hatte nicht auf ihre Mutter gehört. Wie viele Töchter eben nicht auf ihre Mütter hören, wenn es um Sachen geht wie Liebe und den Rest des Lebens, den man noch vor sich hat. Man weiß nicht, woher sie kommt, diese Liebe, die einem den Verstand raubt, aber wenn sie einen erst einmal in den Fängen hat, ist man nicht zugänglich für Argumente. Im Gegenteil. Kreszenz hatte immer daran gedacht, wenn sie sich in Rage geredet und ihrer Mutter die Vorzüge des Geliebten klarzumachen versucht hatte. Er war die große Liebe für sie gewesen. Deswegen kamen dann auch Schlüsse zustande, die einfach keinen Sinn ergaben. Wenn man gezielt darüber nachdachte. Eigentlich ergab alles keinen Sinn, aber wie gesagt, die Liebe blendet und man sieht nur noch die Sonne und den blauen Himmel. Auch wenn die dunklen Wolken bereits im Westen stehen und nur darauf warten, ihre Reise gen Osten anzutreten, um dann ihre gesamte Ladung über dieser Liebe abzulassen.
Nun aber stand sie als Kreszenz Bernbichler an der Balkontür und sah sich an, was sie vor so vielen Jahren als so erstrebenswert empfunden hatte. Sie sah, wie ihr Mann so da saß, seine Zigaretten rauchte und das Bier in sich hineinschüttete. Das Unterhemd, das er anhatte, spannte sich straff über seinen Bauch, der jeden Tag größer zu werden schien. Tropfen von allem, was er zu sich nahm, das aber den Mund verfehlte, waren darauf zu sehen. Die gesamte Speisekarte der letzten Tage. Und nun musste sie es ihm einfach einmal sagen. Alles, was sich so aufgestaut hatte. Dies war der Moment, an dem alles herauskommen musste. Sie sah es als ihre Pflicht an, ihm das zu sagen, ihn auf den Boden der Tatsachen zu bringen, auf den er gehörte.
Johann Baptist hörte zu und nickte ab und an zu dem, was sie ihm sagte. Nur was die Tatsache, dass er nicht sehr intelligent war, mit dem Tatbestand einer Grippe zu tun haben könnte, die man deswegen nicht bekam, war ihm nicht ganz begreiflich. Aber man musste ja auch nicht alles wissen, meinte er zu sich selbst. Vielleicht würde es ihm seine Frau ja auch noch erklären. Später. Im Laufe der andauernden, jedoch sehr einseitigen, Diskussion. Kreszenz' Worte, die er sich anhören musste, kamen nicht so ruhig und gefasst über ihre Lippen. Es war eher ein Ausbruch von verbaler Gewalt, oder man könnte auch sagen, sie hat einfach gekeift, was ihre Lunge und ihre Stimmbänder hergaben. Da sie selbst auch ein wenig auf der schwereren Seite ihres BMI war, hatte ihr Körper auch die dementsprechende Resonanz zu bieten. Sogar die Nachbarn hatten immer wieder ihre feierabendliche Unterhaltung. Es folgten weitere Beschimpfungen, die Johann Baptist sich weiterhin in Ruhe anhörte. Sie gingen an ihm vorbei wie die Sirene der Feuerwehr, wenn sie durch die dunklen Straßen der Nacht fuhr und das einzige war, was man wahrnahm. Man wusste, dass es irgendwo brannte, aber wusste auch, dass es nicht da war, wo man sich gerade aufhielt. Es ging einen sozusagen nichts an, da man nicht davon betroffen war. So sah er das.
Er saß auf der dunkelbraunen, mit Samt bezogenen Couch, die auch schon bessere Tage gesehen hatte, ein Glas Bier in der Hand und die Zigarette im Mundwinkel. Ab und zu zog er an der Zigarette und schnippte die Asche auf den verbrauchten, grünen Teppichboden, der an Flecken von Bier und Essensresten alles hergab, was er die letzten Jahre hatte ertragen müssen. Angezogen war Bernbichler mit einem bequemen, dunkelblauen Trainingsanzug, der an den Knien schon seine Farbe verloren hatte. Die Hose hing schlapp auf seinen Hüften, der obere Teil, die Jacke, war offen, womit eben sein Unterhemd voll zur Geltung kam. Der ganze Frust, alle Unzulänglichkeiten, das ganze sinnlose Leben schienen in diesem Aufzug voll zur Geltung zu kommen. Dann sah er manchmal zu seiner Frau, die nicht nur verbal entsetzlich war, sondern auch noch so aussah. Ihre Erregung hatte ihr aufgedunsenes Gesicht feuerrot werden lassen. Sie schwitzte, Wasser lief ihr über das Gesicht und nahm dabei die schwarze Schminke um ihre Augen mit. Er hasste sie in diesen Momenten und konnte nicht verstehen, dass er sie einmal geliebt haben sollte. Er hatte schon immer den Verdacht, dass sie ihm das nur eingeredet hatte, damit sie ihn bekam. 'Vielleicht war des alles nur ein böser Traum', meinte er zu sich selbst, 'und jetz muss ich halt aufwachen'.
So saß er auf seiner Couch, an diesem schwül heißen Abend, bei geöffneter Balkontür, die nichts anderes als die heiße Luft der Nacht sehr gemächlich ins Wohnzimmer strömen ließ. Eigentlich strömte es nicht. Es war eher mehr ein Säuseln, das ab und zu den Vorhang leicht schwingen ließ. Immer wenn ein Vogel schrie oder eine Motte gegen das Licht flatterte, sah er in die entsprechende Richtung. Nur um sich abzulenken und dem Ganzen einen Sinn zu geben. Was seine Frau ihm zu sagen hatte, ergab keinen Sinn. Wie vieles, was sie die letzten Jahre zu ihm gesagt hatte, nie einen Sinn ergeben hatte. Jedenfalls nicht für ihn. Irgendwann stand er gemächlich auf, stellte sein Glas auf den Tisch und ging auf seine Frau zu, die seit Beginn ihrer Ansprache in der Tür zum Balkon gestanden und sich nicht weiter bewegt hatte. Dann schnippte er den Rest seiner Zigarette über die Balkonbrüstung und sah sie an. Blickte streng in ihr Gesicht, was sie abrupt zum Schweigen brachte. So hatte sie ihn noch nie gesehen. Dann holte er mit seinem rechten Arm aus und schlug ihr von links nach rechts mit voller Wucht ins Gesicht.
Was er zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, und ihm auch nicht in den Sinn kam, war die Tatsache, dass verbale Folter sehr wohl vor Gericht akzeptiert werden würde, wenn er erzählte, wie seine Frau mit ihm umgegangen war. Nicht nur diesen Samstagabend, sondern all die vergangenen Jahre. Eigentlich schon seitdem sie sich kannten oder spätestens seit sie verheiratet waren. Nur sein Gelöbnis, das er abgelegt hatte, als er mit seiner großen Liebe vereint wurde, nämlich jenes: 'Bis dass der Tod euch scheide', hielt ihn davon ab, sie einfach zu verlassen. Er war christlich erzogen worden und ein Gelöbnis wie dieses, das man vor Gott abgegeben hatte, konnte man nicht zurücknehmen. Niemals. Das hatte ihm der Pfarrer bei der Trauung mit auf den Weg gegeben.
Das war am Samstag gewesen. Gestern. Seit seiner Entgleisung, die ihm, trotzdem er seine Frau einmal geliebt hatte, nicht im Geringsten leid tat, lag sie nun in ihrem Ehebett, wohin er sie noch getragen hatte. Sie war nach dem Schlag ins Gesicht unglücklich auf die Balkonbrüstung gestürzt und hatte sich den Kopf verletzt. Blut hatte man nicht viel gesehen, jedenfalls nichts von Bedeutung, also nahm er an, dass es nicht so schlimm sein konnte. Sie lebte noch, daran war nicht zu zweifeln. Er konnte sie atmen hören. Nur die Augen waren geschlossen und sie schien auf seine Fragen, was denn los sei, nicht zu reagieren. Und das war er gewohnt. Er hatte auch nur einmal gefragt, wollte nicht wieder eine große Diskussion anfangen, die eh zu nichts führen würde. Einen Arzt oder den Krankenwagen zu rufen, darauf ist er nicht gekommen. 'Wird schon wieder werden, bis morgen früh is alles wieder gut', meinte er zu sich selbst und legte sich neben sie ins Bett.
Der nächste Morgen brachte nichts Gutes. Nur Probleme. Kreszenz atmete nicht mehr. Er stellte das fest, da er versuchte mit ihr zu reden und sie nicht reagierte, was normalerweise nicht der Fall war. Sie lag neben ihm, einfach so, ohne sich zu regen. Er stieß sie mehrmals an, nur um zu sehen, ob sie noch Leben in sich hatte. Vergebens. Er musste einsehen, dass die Verletzungen wohl doch schlimmer waren, als er angenommen hatte. Er stand auf, da er überlegen musste, was er als Nächstes tun sollte. Irgendwie war ihm alles zu viel. 'Erst einmal hinsetzen und nachdenken', meinte er zu sich selbst. Also tat er das. Er ging zum Kühlschrank, nahm sich eines der letzten zwei Biere, die er dort fand, öffnete die Balkontür, zündete sich eine Zigarette an und setzte sich auf die Couch. Es dauerte nicht lange und es klingelte an der Tür. Ein kurzer Blick auf die Uhr, die im Regal, direkt über dem Fernseher stand, sagte ihm, dass es für Besuch doch noch ein bisschen früh sei. Besonders am Sonntag. Nicht, dass sie viel Besuch bekamen, ganz im Gegenteil. Aber trotzdem kam es ihm viel zu früh vor. Was er noch nicht wusste, war, dass dies das dritte Dilemma war, das ihn erwartete. Erst der Rausschmiss, dann das mit seiner Frau, und jetzt auch noch das. An diesem Tag, dem Sonntag. Und auch das letzte.
3
Kommissar Wengler war seit frühem Nachmittag im Augustiner Biergarten. Es war Dienstag. Wieder einer dieser Tage, die er einfach zu ertragen hatte. Er war früh aufgestanden, in der Gewissheit, dass es ein ruhiger Tag werden würde. Als er seine Augen geöffnet hatte und aus seinem Dachfenster sah, das ihm jeden Morgen ein Stück des bayerischen Himmels bescherte, war nur kristallblauer Himmel zu sehen. Die Schwüle, die immer einen Schleier über das Blau legt, und bei der man meinen konnte, man müsse erst durch Dampf waten, um an sein Ziel zu gelangen, war über Nacht verschwunden. Weggeblasen. Wie er später in der Morgensendung erfuhr, von Sieglinde. Dem Hoch aus dem Westen, von Südfrankreich rüber. Dies konnte in München nur zwei Folgen haben. Beide waren nicht sehr vielversprechend. Die erste war, dass der Sommer endgültig vorüber war. Der Herbst kündigte sich an. Zwar hatte Wengler absolut nichts gegen den Herbst, da dieser die klaren, schönen Stunden brachte, in denen man es noch einmal so richtig genießen konnte, draußen zu sitzen und noch eine Maß Bier zu trinken. Was man selbstverständlich auch im Sommer tun konnte, aber eben nur spät am Abend, wenn es erträglicher wurde und die Hitze nachließ. Die zweite Konsequenz war, dass auf den schönen Spätsommer unweigerlich der Winter folgen würde. Und das machte den Kommissar missmutig. Nein, eher total sauer. Stocksauer. Er fluchte vor sich hin, den ganzen Morgen, und konnte mit sich nicht ins Reine kommen. 'So eine Sauerei', meinte er zu sich selbst, 'jetz hat's es wieder. Erst is so heiß, dass ma fast zerlauft und jetz kommt der saublöde Winter.' Also kam er schon schlecht gelaunt ins Büro. Armin kannte das und wusste, was das Problem war. Er sprach ihn nicht darauf an, es hatte keinen Sinn. Er gab ihm nur einen kurzen Abriss über den Bericht, den er gerade in seinen Computer tippte.
Der Mord, oder besser gesagt, Totschlag, an einem Gemüsehändler in der Kauffingerstraße. Man hatte sehr schnell herausgefunden, dass es ein 'Freund aus der Heimat' war, der ihm den Stand abnehmen wollte, da dieser schon angefangen hatte, den neuen Wagen dort aufzubauen, bevor man den Toten in seiner Wohnung fand. Die Nachbarn, die man befragte, wussten zu berichten, dass der Verstorbene einen Gemüsewagen in der Innenstadt hatte. Und das sich die zwei immer gestritten haben, eben über einen Standplatz. Und das sein Nebenbuhler gerade aus der Wohnung gekommen war. Nun musste man also nur den Gemüsewagen finden und den Mitstreiter, dem der Platz, den er hatte, scheinbar nicht gefallen hat. Sie gingen also in die Fußgängerzone, fragten sich bei den anderen Händlern durch und suchte nach dem Konkurrenten, der, als man ihn fand, nicht davon abließ, den Wagen, den er gerade eingefahren hatte, zu bestücken. Ordentlich platzierte er die Tomaten, den Sellerie, den Radi und alles andere von seinem kleinen Transporter auf den grünen, flachen Handwagen. Auf die Frage, ob er etwas von dem Tod seines Bekannten erfahren habe, meinte er mit starkem, östlichem Akzent und schlechtem Deutsch, ohne sich auch nur im Geringsten für die Polizei zu interessieren.
„Das doch die halbe Stadt weiß. Dort“, und damit wies er auf einen anderen, grünen Gemüsewagen, der wie der seine aussah, „das ist Wagen von dem Idiot. Jetzt muss wohl jemand abholen, diese Kiste.“
Der Kommissar hatte gefragt, ob er dazu etwas zu sagen habe, da man gesehen hatte, wie er vor ein paar Stunden die Wohnung des Toten verlassen habe. Ungefähr um die Zeit, als dieser gestorben war.
„Aber ja war ich da!“, meinte der Gemüsehändler.
Seine Rechtfertigung war, dass man in seinem Land – und das war ein Land weit im Osten des Kontinents – solche Sachen eben so regelte. Das sei nichts Besonderes und man solle sich nicht so darüber aufregen. Er müsse nun endlich seinen Stand fertig aufbauen und anfangen das zu tun, was er schon immer hatte tun wollen: in der Münchener Innenstadt Gemüse und Obst verkaufen. Er hätte das auch zu Hause so gemacht. Und dann ging er in Ruhe weiter seiner Arbeit nach, das Gemüse und Obst ordentlich auf dem Wagen zu verteilen.
Nur durch gutes Zureden hatte man ihn schließlich davon überzeugen können, dass man eben nicht in jenem so fernen Land mit seinen so eigentümlichen Gebräuchen sei, sondern in München, Bayern, Bundesrepublik Deutschland. Und das es eben hier Gesetze gebe, die verbieten, Konkurrenten gewalttätig aus dem Weg zu räumen. Und schon überhaupt nicht dadurch, dass man sie umbringt. Was der Mann am Stand partout nicht verstehen wollte. Das sei schließlich eine Angelegenheit zwischen ihm und seinem Kontrahenten, nichts weiter. Und man solle ihn endlich in Ruhe lassen. Man habe das im Familienrat so beschlossen und er habe es nur ausgeführt. Man brauche dabei keine Polizei.
Man musste Verstärkung holen, da sich der Mann standhaft weigerte, seinen Stand zu verlassen, mit dem Hinweis, dass man ihm dann alles klauen würde. Man könne doch keinem hier trauen. Nicht einmal der Polizei, wie man ja sah. Der Kommissar meinte, dass das wohl in diesem Moment sein kleinstes Problem sei und er dafür sorgen werde, dass sein Wagen hier nicht zu Schaden komme. Das hatte den Gemüsehändler dann soweit beruhigt, dass man mit ihm ins Präsidium fahren konnte.
Es war also nicht gerade viel los im Büro an diesem Morgen. Immer wenn man einen Fall gelöst hatte – und dieser war in zwei Stunden erledigt worden – hatte man etwas Pause. Statistisch gesehen, kam es nie vor, dass am selben Tag mehrere Taten verübt wurden. Also sagte der Kommissar zu Armin, dass er das, was er machen wollte – nämlich seine Süddeutsche lesen – auch im Biergarten tun könne und eben dafür nicht unbedingt im Büro zu sitzen habe. Armin Staller, sein Assistent und auch schon Vertrauter, stimmte dem hundertprozentig zu.
„Das sehe ich auch so“, meinte er. Sah den Kommissar an und wünschte ihm noch einen schönen Nachmittag.
Der Augustiner Biergarten, auch bekannt als Augustiner Bierkeller, ist einer der ältesten Biergärten in München. Schon seit Anfang des neunzehnten Jahrhunderts kommen die Leute, um sich eine frische Maß Bier zu genehmigen. Früher hatte man sogar noch sein eigenes Essen mitbringen können, was im Zuge der modernen Zeiten jedoch abgeschafft worden war. Heute stellte man sich in lange Schlangen, bestellte einen Radi, oder auch Rettich genannt. Vielleicht auch noch ein Obazden, was eigentlich nur ein ausgedrückter Camembert war, gemischt mit Quark und Emmentaler. Und vielen Zwiebeln. Dazu noch eine Brezen und dann bezahlte man. Dann holte man sich sein Bier und versuchte, möglichst geschickt alles zusammen an den Tisch zu bringen, ohne es zu verlieren. Was nicht gerade einfach war, da die Pappdeckelteller immer weicher wurden und das gute Essen nicht lange halten konnten. Aber man konnte es schaffen. Wenn man denn einen freien Platz fand – was besonders im Sommer und an Tagen, an denen die Sonne schien, ziemlich anstrengend werden konnte. Besonders bekannt ist der Augustiner Biergarten auch wegen der alten, kräftigen Kastanien, die den ganzen Bereich in einen grünen Himmel verwandeln. Über hundert sollen dort stehen und jedes Jahr den Garten mit weißen Blüten übersähen. Blüten, die auch schon einmal in den Maßkrug fallen konnten. Was dem Geschmack des Bieres allerdings nicht schadete. Und es gab ja auch noch die Filzdeckel, die man über das Glas legen konnte, damit nichts hinein geriet, was nicht hinein gehörte.
Dort saß der Kommissar also an einem der Tische und stellte sein geliebtes Augustiner darauf ab, das goldig gelb, mit einer kleinen Schaumkrone darauf wartete, endlich genossen zu werden. Dann schlug er die Zeitung auf und fing an, die Geschichten seiner Stadt zu lesen, die nie aufhörten ihn zu begeistern. Einer der Leute, die viel zu diesen Geschichten und für viele Jahre zum Besonderen der Münchener Szene beigetragen haben, war Sigi Sommer. Auch er – der liebe Gott hab ihn selig – hatte sich, ebenso wie der Kommissar, diesen Biergarten als zweite Heimstätte auserkoren. Heute steht ein schönes Denkmal vom Sigi direkt in der Fußgängerzone. Als Spaziergänger, den er als Journalist porträtierte und durch den er den Münchenern immer erzählte, was in der Stadt so los war. Nicht die aufregenden Dinge, die man auch woanders lesen konnte, nein. Eher die kleinen, unbedeutenden Geschichten von kleinen, unbedeutenden Menschen. Geschichten, die dennoch interessant und schön waren. Spannend und manchmal traurig. Oder auch zum Schmunzeln. Einfach besonders. Geschichten, die sich nur in München ereignen konnten. Nur dort.
Vertieft in seine Zeitung bemerkte der Kommissar zuerst nicht, dass neben seinem Tisch zwei Gestalten standen. Was er aus dem Augenwinkel sah, waren dünne, weiße Beine in viel zu großen Lederhosen. Da sie dort einfach standen und sich nicht bewegten, blickte der Kommissar schließlich auf. Wollte er doch sehen, was da los war. 'Japaner, ja sauber', sagte er zu sich selbst. Jedenfalls dachte er, es seien Japaner. Er konnte sie nie auseinanderhalten, diese Asiaten. Alle sahen gleich aus für ihn. 'Die mit den Schlitzaugen', wie er immer sagte. Japaner, Chinesen, Vietnamesen, alle waren eben Asiaten. Er machte keinen Unterschied. Er hatte einmal gelesen, dass es denen mit uns genauso ging. Dass sie auch keinen Unterschied ausmachen konnten zwischen uns. 'Keinen Unterschied!', dachte sich da der Kommissar. 'Seh ich vielleicht aus wie Branslauer Toni? Da könnt ich ja gleich von der Brücke springen'.
Dort standen sie also, neben ihm, in hellen Lederhosen und dunkelbraunen Hosenträgern mit einem roten Herzen auf dem Brustschild zwischen den Riemen. Die rot karierten Hemden, ein weiß-blaues Tuch um den Hals, machten aus dem Ganzen einen asiatischen Bayern. Weiße Socken mit blauem Rand und Tennisschuhe rundeten das Gesamtbild des Schreckens vollständig ab. Und der schwarze Hut mit Entenfedern, den man auch nicht vergessen hatte. Sie lächelten ihn mit ihren braunen Zähnen an und sagten etwas für ihn total unverständliches. 'Gute Zähn haben die ja nicht, die Japanischen', dachte sich der Kommissar, der die beiden erstaunt ansah. Es mag Englisch gewesen sein, mit starkem asiatischem Akzent, was die beiden gesprochen hatten. Der Kommissar jedoch konnte weder Englisch noch irgendeine andere Sprache, und schon überhaupt nicht Asiatisch. Eben nur Bayerisch. Und das hatte ihm bisher immer gereicht. Also konnte er sich auf das, was sie ihm sagen wollten, absolut keinen Reim machen. Da aber einer der beiden immer auf den Tisch zeigte, deutete der Kommissar das als Frage, ob sie sich dort hinsetzen könnten.
„Warum denn net?“, sagte er im freundlichsten Ton, der ihm gerade einfiel, und widmete sich umgehend wieder seiner Lektüre.
Dem geneigten Leser, besonders denen aus nördlicheren Gefilden, mag es vielleicht nicht gerade überschwänglich nett vorgekommen sein, aber wenn man die bayerische Mentalität besser kennt, weiß man, das dies durchaus freundlich gemeint war. Im normalen Falle geht in Bayern eine aufregende Konversation unter guten Freunden etwa so: Beide sitzen am Tisch, vor sich eine Maß Bier und schauen in ihren Krug. Die Hände umklammern den Krug fest und bestimmt. Immerhin will man immer parat sein, das Glas zu erheben. Dann hebt einer seinen Kopf und sagt:
„Servus, Franz Joseph. Ois klar?“
Das Gegenüber ließ sich mit der Antwort auf die Frage, ob alles klar sei, selbstverständlich Zeit. Auch er hatte sein Haupt nach unten gesenkt und sein Bier angesehen. Nichts sollte man übereilen, um dem Fragesteller auch eine richtige, passende Antwort zu geben. Das will gut überlegt sein. Dann hebt auch er seinen Kopf ein wenig nach oben und antwortet:
„Scho. Und bei dir?“
Was so viel heißt wie 'Schon, ja'.
Auch der erste der Fragenden denkt dann für einige Minuten darüber nach, was er auf die Gegenfrage zu antworten gedenke.
„Eh klar. Ois im grünen Bereich.“
Damit wäre also geklärt, dass alles in Ordnung – oder eben 'im grünen Bereich' sei – und man sich nun den wichtigeren Dingen im Leben zuwenden konnte. Wie zum Beispiel, einen großen Schluck aus dem Glas zu nehmen, dass vor einem stand und nur darauf wartete, endlich geleert zu werden. Und sei es nur, um Platz zu schaffen für das nächste Bier.
„Dann Prost, Franz Joseph!“ - was spontan mit „Prost Schorsch“ beantwortet wird. Dann stößt man mit beiden Krügen an, dass man denken könnte, die Krüge würden zerbrechen. Nur die Dicke des Glases verhinderte dies. Man nimmt also einen kräftigen Schluck, stellt die Maß wieder mit einem kräftigen Knall auf den Tisch und wischt sich den Schaum mit dem Hemdsärmel vom Gesicht. Diese aufregende Unterhaltung hat bis dahin gut und gerne eine viertel Stunde gedauert.
Kommissar Wengler saß also an seinem Tisch, wunderte sich über die Verunglimpfung seiner geliebten Tracht und wünschte sich, in Japan mit einer Samurai-Ausrüstung durch den Wald zu reiten. Als Vergeltung sozusagen. Er hatte das einmal im Fernsehen gesehen, wie so etwas aussah. Vor vielen Jahren. Irgendwie hatte ihn das fasziniert. Aber auch wieder nicht. Er dachte sich nur, dass es ziemlich schwer gewesen sein mochte, sich in diesen Gewändern fortzubewegen. Aber das muss es auch für unsere Ritter gewesen sein, wie er meinte, wenn er so darüber nachdachte. Und außerdem würde er sowieso nie nach Japan reisen. Schon weil es da nichts Richtiges zum Essen gab. Jedenfalls nichts, was in seinen Magen passte. Er aß immer lieber was, was vorher mit Beinen auf der Erde herumgelaufen war, und nicht so gerne das Schwimmende der Fauna. Und schon gar nicht roh. Und schon überhaupt nicht mit Reis. 'Was bei uns wachst, soll man essen', meinte er immer, wenn ihn jemand danach fragte: 'Erdäpfel, Semmelknödel, Kartoffelknödel, vielleicht noch Nudeln oder Schwarzwurzeln, aber doch nicht einen Reis'.
Langsam neigte sich die Sonne hinter die Bäume, die schon anfingen, ihre Blätter bunt zu färben. Die laue Luft der letzten Wochen wurde abgelöst von einem frischen Wind, der aus dem Norden kam. Wie vieles, was kalt und ungemütlich zu sein schien, immer aus dem Norden kam. Der Kommissar hatte nichts gegen den Norden, nur dass er eben noch nie gehört hatte, dass sich warme Luft vom Norden aus nach Bayern ausdehnte. Das war so unwahrscheinlich wie die Nachricht, dass es auf Sylt zwei Tage nicht geregnet hatte. Der Kommissar sah in den stahlblauen Himmel mit den wenigen Wölkchen, die sich nicht zu bewegen schienen, und schüttelte langsam den Kopf. Die Vögel, besonders die Schwalben, fingen an, immer tiefer zu fliegen. Man sagt, wenn die Schwalben tief fliegen, kommt das schlechte Wetter. Als der Kommissar daran dachte, stöhnte er leise vor sich hin, faltete seine Zeitung zusammen und war im Begriff aufzustehen, als sich jemand neben ihm aufbaute.
„Herr Kommissar, jetz hab ich Sie g'funden. Hab's doch gewusst, dass Sie hier sind.“
„Ja, der Andreas! Andreas, wenn ich dich seh, dann kann das nur bedeuten, dass ihr mich braucht's, weil ihr wieder einen gefunden habt's, der nicht mehr laufen kann. Und, weil er auch nicht mehr schnaufen kann. Und damit man laufen kann, muss man schnaufen. Ein großes Problem kann des ja nicht gewesen sein. Ich mein, mit dem Finden. Der Armin hat doch g'wusst, wo ich bin.“
„Aber verraten wollt er's uns nicht, Herr Kommissar. Gemeint hat er, dass wir sie in Ruhe lassen sollen, wo's doch eh schon auf Abend zugeht. Aber, hab ich g'sagt, der Herr Kommissar wird sich dem Fall annehmen, weil der nämlich keinen Abend nicht kennt, wenn man einen Fall hat. Der Kommissar, hab ich ihm g'sagt, wird nicht sehr glücklich sein, wenn wir da hinfahr'n und ihn nicht mitnehmen. Das hat er dann, wie er eine Minuten drüber nachdenkt hat, auch eing'sehen, Ihr Assistent.“
Mittlerweile war der Kommissar aufgestanden, hatte sich seine Zeitung unter den Arm geklemmt und wollte gehen. Dann besann er sich eines Besseren. Zumindest für den Moment.
„Andreas“, sagte er, wobei er leise sprach und nahe an Hauptwachtmeister Potschenrieder herantrat, „wo du recht hast, hast du recht. Sag einmal, gibt es eigentlich eine Handhabe, die zwei Japaner da am Tisch wegen irgendwas festzunehmen? Vielleicht wegen Verunglimpfung von einer Tracht, die an denen so fürchterlich ausschaut, das man des schon als gemeingefährlich anschauen könnt?“
„Ich glaub nicht, Herr Kommissar, dass es da ein Gesetz gibt, das einem verbietet, sich in aller Öffentlichkeit zu blamieren. Des haben wir doch jeden Tag. Da könnt ma ja die halbe Stadt festnehmen. Schaun's sich doch einmal die jungen Weiber an, wie die rumlaufen. Mit rote Haar, kaputte Hosen und schlampige Blusen, die nur wie Fetzen runter hängen. Manchmal müsst man meinen, die ganze G'sellschaft fällt auseinander.“
„Andreas, auch da hast du wieder recht. Dann lassen wir denen ihre Freud. Und jetz sag, was los is, was so wichtig is, dass du mich aus'm Biergarten holen musst.“
„Noch dazu aus'm Augustiner.“
„Ja, des auch. Also?“
„Ja, wir haben da einen Anruf bekommen von einer Frau in so einem Hochhaus im Hasenbergl. Sie hat g'meint, dass des da so streng riechen würd bei den Nachbarn.“
„Nein, Andreas, des hat die nicht so g'sagt. Die hat bestimmt g'sagt, dass des da stinkt wie die Sau. Stimmt's? Da brauchst du keine Rücksicht nicht nehmen, Andreas. Da kenn ich schlimmere Wörter.“
„Na ja, so ungefähr. Ich wollt des halt ein bisserl gepflegter sagen, wissen's eh. Also, sind wir da hin und haben nachg'schaut. Dort in der Wohnung. Und da haben wir zwei Tote g'funden. G'stunken hat des, des können's sich nicht vorstellen. Wie die Sau.“
„Sag ich doch.“
„Ja, also, einen Mann und eine Frau haben wir da g'funden. Er war im Gang g'legen und sie war im Bett.“
Der Kommissar sah den Andreas Potschenrieder eindringlich an, als wartete er auf weitere Auskünfte.
„Ja, Herr Kommissar, des is alles, was ich weiß. Dann haben wir den Doktor g'rufen und den Armin. Der is schon dort. Der Armin, mein ich. Und der Dr. Brunner auch. So gut wie, jedenfalls. Jetz fehlen nur noch Sie.“
„Ja, dann fahr'n wir doch einmal dort hin.“
Damit machten sie sich auf den Weg zum Auto, das schon mit Blaulicht am Eingang zum Biergarten wartete. Sie hatten Probleme, sich gegen den Strom der Menschen durchzusetzen, die versuchten, sich den Abend mit Bier und Blasmusik zu vertreiben. Die Blaskapelle, die im Sommer jeden Abend spielte, brachte gerade 'Ein Prosit der Gemütlichkeit' zum Besten, wozu alle Anwesenden bierselig grölten.
„Da haben wir des ja grad noch g'schafft, Andreas, bevor die Humpta Musik losgeht. Des wird dene Japaner g'fallen. Ich hab einmal g'lesen, dass im Hofbräuhaus nur noch Amerikaner und Australier sind. Die haben des total in Besitz genommen. Keine Bayern mehr. Außer im Winter, wenn die Stadt eh nur uns g'hört. Und es soll sogar ein Hofbräuhaus in dem Las Vegas geben, da in der Wüste, in Amerika, hat mir einer erzählt. Original nachgebaut, wie des hier bei uns daheim is. Kannst du dir des vorstellen Andreas, ein Hofbräuhaus in Las Vegas? Jetz brauchen wir nur noch den Canyon da her bauen, dann sind wir wieder quitt. Vielleicht da am Starnberger See, dann könnten wir die ganzen Bonzen da rein schmeißen.“
Damit stiegen sie in den grünen Wagen.
„Und schalt bitte deine Musik ein, dass die aus dem Weg gehen, da.“
Was Andreas Potschenrieder nur zu gerne machte. Er liebte es, mit Blaulicht durch die Stadt zu fahren. Manchmal machte er das nur so, um schneller an seinen geliebten Stand am Viktualienmarkt zu gelangen. Dann hieß es immer beim Löwenbräu, 'Macht's des Bier fertig, der Andreas is gleich da'.
4
„Armin, was haben wir hier?“
Der Kommissar war gerade angekommen im vierten Stock eines Sozialbaus aus den sechziger Jahren. Damals hatte man aus Mangel an günstigem Wohnraum im Stadtgebiet angefangen, vor der Stadt diese Siedlungen zu bauen. Nicht nur dort, sondern in all den Gegenden, wo es nicht so weit her war mit der Schönheit des Umlandes, in denen es Fabriken gab, Lagerhäuser und Autobahnen. Wo man, wenn man aus dem Fenster sah, nicht die grünen Tannen sah, sondern nur die grünen Tonnen, die schon am nächsten Tag, nachdem die Müllabfuhr sie wieder einmal geleert hatte, vor Plastiktüten, leeren Kisten, Flaschen und schmutzigen Kinderwindeln überquollen. Eigentlich wohnten hier Menschen, denen es nicht immer sehr gut ging, aber nach dem Müll zu schließen, den sie in die Tonnen – oder daneben – warfen, gehörten sie dennoch zur Wegwerfgesellschaft. Eines dieser Viertel war das Hasenbergl.