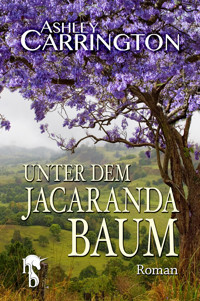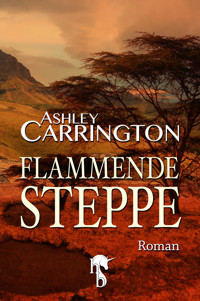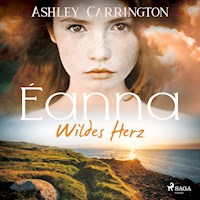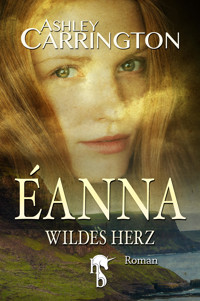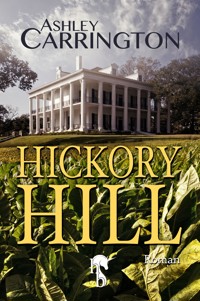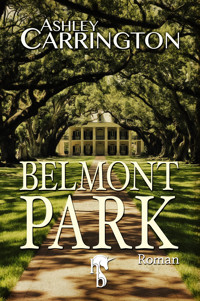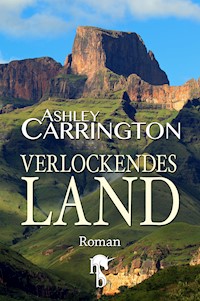
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hendrik McAlister, der jüngste Sohn eines Krämers im südafrikanischen Grahamstown, erträgt die ständige Unterdrückung und Tyrannei seiner älteren Brüder nicht mehr und verlässt nach einem erbitterten Streit sein Elternhaus. Am Fuße der Snow Mountains begegnet er dem alten, eigenbrötlerischen Burenfarmer Hermanus. Mit vereinten Kräften bringt Hendrik dessen heruntergekommenen Hof wieder auf Vordermann. Dabei gewinnt er nicht nur Hermanus’ Respekt, sondern auch den der Buren, die sich von der britischen Regierung am Kap zunehmend unterdrückt fühlen. Als Hendrik sich in die Farmerstochter Franziska van Wyken verliebt, steht das Glück der beiden unter keinem guten Stern, denn Franziskas Familie versucht alles, um ihre Liebe zu verhindern. Hat der Zwist zwischen Hendrik und Franziskas Familie etwas damit zu tun? Die Ereignisse überschlagen sich, als die Buren Hendrik auch noch in eines ihrer großen Geheimnisse einweihen: Sie wollen die Kolonie verlassen und der Bürde der britischen Besatzung entkommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ashley Carrington
Verlockendes Land
Roman
Dedicated to Margaret and Douglas McMaster, Ladysmith, Natal. Thank you for a wonderful time!
Teil 1: Grahamstown
1
Die kühlen Schatten auf dem Hinterhof schmolzen mit der steigenden Sonne wie Kerzenwachs auf einer glühenden Herdplatte. Der Dezemberhimmel über Grahamstown und dem Farmland am Great Fish River war von Horizont zu Horizont wolkenlos und leuchtete schon am frühen Morgen mit einer blauweißen Helligkeit, die den Augen schmerzte. Dieser Montag versprach ein besonders heißer Sommertag zu werden.
Hendrik McAllister spürte die Sonne auf dem Rücken und den nackten Armen, während er auf dem Hof dem ersten der drei alten Fässer mit der groben Bürste zu Leibe rückte, doch sie machte ihm nichts aus. Er hatte schon viele extrem heiße Sommer hier im östlichen Grenzgebiet der Kap Kolonie erlebt. Mit der brennenden Sonne Südafrikas war er aufgewachsen, siebzehn Jahre und neun Monate, um genau zu sein, und sie gehörte so selbstverständlich zu seinem Leben wie das schwere Gehörn zu einem Zugochsen.
Die Vorstellung, dass im gut siebentausend Meilen entfernten England die Jahreszeiten völlig auf den Kopf gestellt waren und die Monate zwischen November und März von Nebel und Regen, Kälte und Schnee und einem scheinbar ewig trüben Himmel bestimmt wurden, ließ ihn schaudern. Im Gegensatz zu seinen drei älteren Brüdern Stuart, Kevin und Colin hatte er nie auch nur den Anflug eines Wunsches verspürt, einmal England oder Schottland zu sehen, das die Heimat ihres Vaters gewesen war. Vielleicht lag das daran, dass er der Einzige der vier Brüder war, der auf afrikanischem Boden gezeugt und zur Welt gekommen war. Dass er zwar denselben Vater hatte wie sie, seine Mutter jedoch eine Treckburin gewesen und nach zwei Jahren Ehe davongelaufen war, hatten Stuart, Kevin und Colin ihn schon von Kindesbeinen an kaum einen Tag vergessen lassen. Sie hatten ihm immer das Gefühl gegeben, dass das burische Blut, welches in seinen Adern floss, ein Makel war, und ihr Vater, James McAllister, hatte sie noch darin bestärkt. Es hatte lange gedauert, bis er das Gefühl, minderwertig und an dem Verrat seiner Mutter irgendwie mitschuldig zu sein, überwunden hatte. Jetzt war er stolz auf seine Herkunft mütterlicherseits, hütete sich jedoch, das vor seinem jähzornigen Vater und insbesondere vor seinen Brüdern zu zeigen – nicht aus Feigheit, sondern aus der Erkenntnis heraus, dass es sinnlos war. Damit würde er sie nur zu noch mehr Gemeinheiten herausfordern, und er hatte es auch so schon schwer genug, sich zu behaupten.
Bei dem Gedanken an seine drei Brüder nahm Hendriks Gesicht einen grimmigen Ausdruck an, und er scheuerte die Dauben so hart, als wollte er ein Loch in die Wandung bürsten. Dass Colin, mit seinen fast vierundzwanzig Jahren der älteste der McAllister-Söhne, ausgerechnet ihn mit der Säuberung der alten Fässer beauftragt hatte, war typisch. Die Dreckarbeiten blieben immer an ihm hängen.
Hendrik richtete sich kurz auf, um für einen Moment dem Übelkeit erregenden Gestank zu entkommen, der den alten Fässern entströmte und ihn an einen verwesenden Tierkadaver erinnerte. Er wünschte, er könnte jetzt draußen auf dem veld sein, wie die Buren das weite, offene Land nannten. Er sehnte sich nach der Arbeit auf Highlands zurück, der Farm von Douglas Mackenzie im Kariega-Tal, zu Pferd eine knappe Stunde südlich von Grahamstown. Das Leben eines Krämers, das alle anderen McAllisters für so erstrebenswert hielten, verabscheute er, mochte ein Laden wie McAllister’s Emporium auch noch so groß und gewinnbringend sein. Er liebte die Arbeit unter freiem Himmel, die Weite der Felder und Weiden, wo allein der ferne Horizont den Blick begrenzte. Aber wann hatten seine Brüder oder sein Vater auch schon etwas darauf gegeben, was er fühlte und wünschte.
Zornig versetzte er dem Fass einen Tritt und wollte sich wieder an die Arbeit machen, als die Hintertür des langgestreckten, weißgekalkten Gebäudes aufflog und sein Bruder Colin erschien, in dunkelgrauen Tuchhosen und einem makellos weißen Hemd, über dem er eine braune Weste trug. Er hatte die kantige, stämmige Figur ihres Vaters geerbt, wie auch Kevin und Stuart, und war ihm mit dem dunklen, drahtigen Haar, den starken Brauen und der kurzen, breiten Nase wie aus dem Gesicht geschnitten. Und er führte sich auch ebenso herrschsüchtig auf, als hätte er schon jetzt als ältester Sohn die Nachfolge angetreten. »Hendrik!«, rief er im Befehlston.
Dieser warf ihm einen verdrossenen Blick zu. »Was ist?«
»Das würde ich ganz gern von dir wissen!«, herrschte Colin ihn an. »Warum ist das Schaufenster noch nicht geputzt und die Veranda nicht gefegt?«
Hendrik beherrschte seinen aufsteigenden Ärger. »Du hast gesagt, ich soll mir die Fässer vornehmen, und genau das habe ich getan.«
»Aber das Schaufenster und die stoep kommen morgens immer zuerst dran«, blaffte Colin zurück. »So viel wirst du ja wohl noch in deinem burischen Farmerschädel behalten können!«
»Ich kann eine ganze Menge mehr als das behalten, so zum Beispiel, dass dies bisher die Aufgabe meines liebreizenden Bruders Stuart gewesen ist und ich nicht euer Kuli bin, wenn es um Arbeiten geht, bei denen man sich die Finger schmutzig macht!«, begehrte Hendrik auf.
Colin funkelte ihn böse an. »Werd bloß nicht unverschämt, sonst bring’ ich dir Manieren bei!«, drohte er ihm mit scharfer Stimme Prügel an. »Wenn Vater nicht im Haus ist, bestimme ich, wer was zu tun hat! Stuart und Kevin habe ich für wichtigere Arbeiten im Laden eingeteilt. Also wirst du gefälligst das Schaufenster putzen und vor dem Haus fegen!«
Stuart, zwei Jahre älter als Hendrik, tauchte hinter Colin auf, ein gehässiges Lächeln auf dem Gesicht. Er hatte natürlich jedes Wort mitbekommen und kostete die Situation weidlich aus. In der rechten Hand hielt er den Besen und in der linken das lederne Putztuch.
»Ich glaube, das hast du vorhin vergessen, mit nach draußen zu nehmen, Bruderherz«, höhnte er und warf ihm erst den Besen vor die Füße und dann den Lappen vor die Brust. Hendrik war einen Moment lang versucht, sich auf ihn zu stürzen. Doch er wusste, dass Stuart und Colin nur darauf warteten, ihn grün und blau zu prügeln. Diesen Vorwand wollte er ihnen nicht geben. Deshalb bezähmte er sich und rührte sich nicht von der Stelle. Es gelang ihm sogar, ein Lächeln auf sein Gesicht zu zwingen.
»Wie tröstlich, wenn man solche Brüder hat, auf die immer Verlass ist«, sagte er mit beißendem Sarkasmus.
»Rührend, nicht wahr? Aber werd uns jetzt bloß nicht zu sentimental, Kleiner«, sagte Stuart mit einem breiten Grinsen und zeigte dabei die Lücke in seinen oberen Vorderzähnen, die er einer Rauferei verdankte. Fäuste waren sein liebstes Argument.
Colin machte eine unwillige, herrische Handbewegung. »Genug der Rederei, mach dich an die Arbeit, Hendrik!«, befahl er. »Und ich will hinterher keine Schlieren auf der Scheibe sehen, verstanden?« Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte er sich um und verschwand wieder im Gebäude.
Stuart spuckte in den Sand zu seinen Füßen, warf seinem Halbbruder einen hämischen Blick zu und schloss die Tür, die ins Lager führte, hinter sich.
Hendrik wartete einen Augenblick, dann stieß er eine Verwünschung aus und schleuderte die Bürste gegen die Tür. Es war eine Geste der Ohnmacht. Die Hände zu Fäusten geballt und die Lippen zusammengepresst, stand er auf dem Hof und starrte auf die Tür.
»Nicht mehr lange!«, schwor er sich. »Lange macht ihr das nicht mehr mit mir!«
Dann hob er Lappen und Besen auf, füllte den Holzeimer an der Wasserpumpe zwischen Stall und Remise mit frischem Wasser und begab sich über die Seitengasse nach vorn zur Vorderfront von McAllister’s Emporium.
2
Als Hendrik um die Ecke bog und die drei Stufen zur überdachten stoep hinaufging, wie längst auch britische Siedler und Farmer zur Veranda sagten, herrschte auf der Hauptstraße, die Grahamstown durchschnitt, schon reger Betrieb. Er erhaschte einen kurzen Blick auf eine Abteilung regulärer Dragoner, wegen ihrer roten Uniformen allgemein Rotröcke genannt, und eine Gruppe schwarzer Hottentottensoldaten, die sechs Häuserblocks die Straße weiter unten den staubigen Kirchplatz überquerten. Schwarze Bedienstete und Straßenhändler, bis auf einige angolanische und madagassische Sklaven, zumeist Hottentotten, waren ebenfalls schon mit ihren bauchigen Bastkörben, Bauchladen und Handkarren unterwegs. Mehrere Reiter und offene Kutschen bevölkerten die Straße. Und von oben sah er zwei schwere Planwagen in die Stadt kommen, von jeweils zwölf bulligen Ochsen mit mächtigem Gehörn gezogen. Feldschoner hießen diese klobigen, aber ungemein robusten Gefährte, die bis zu neun Tonnen Fracht auf ihre Achsen nehmen konnten und je nach Beschaffenheit des Geländes vierzehn und mehr Zugochsen benötigten, um ein Dutzend Meilen pro Tag zu bewältigen. Von den Buren schon vor über hundertfünfzig Jahren als ein langsames, aber für das wilde und so gut wie straßenlose Land mit seinen Halbwüsten und zahllosen Bergketten als das einzig verlässliche Transportmittel befunden, waren auch alle anderen Kolonisten dem Beispiel der Buren gefolgt. Die Hauptstraßen wurden in den Siedlungen deshalb so angelegt, dass ein Feldschoner mit einem Gespann von vierzehn Ochsen ohne Problem wenden konnte.
Hendrik stellte Eimer und Besen ab, während die beiden Feldschoner näher kamen und mit ihnen das Knallen der Peitsche über den Köpfen der Ochsen sowie das Rumpeln der Wagen lauter wurde. Barfüßige Hottentottenjungen in kurzen, ausgefransten Hosen liefen als voorloper an der Spitze eines jeden Gespanns.
Widerwillig musste Hendrik eingestehen, dass sein Vater als Geschäftsmann ein gutes Gespür gehabt und eine hervorragende Wahl getroffen hatte, als er vor zwölf Jahren nach Grahamstown gekommen und diese Parzelle nahe des Kirchplatzes erstanden hatte, um McAllister’s Emporium zu eröffnen, das 1816 natürlich kaum mehr als eine etwas größere Lehmhütte gewesen war.
Grahamstown wurde 1812 nach dem blutigen 4. Kaffernkrieg als starker, vorgeschobener Militärposten gegründet, um das abgelegene Siedlungsgebiet am Great Fish River, der die Ostgrenze der Kapkolonie darstellte, besser vor den Überfällen der Xhosa zu schützen. Damals ahnte niemand, dass ausgerechnet diese Siedlung, die doch keine fünfzehn Meilen von der gefährlichen Grenze zum so genannten Kaffernland, dafür aber sechshundert Meilen von Kapstadt, dem politischen und wirtschaftlichen Zentrum der Kolonie, entfernt lag, dass ausgerechnet diese Neugründung im Distrikt Albany nach Kapstadt die am schnellsten wachsende Stadt der Kolonie sein würde.
Hendrik bezweifelte, dass sein Vater diese Voraussicht besessen hatte, was aber nichts daran änderte, dass er auf das richtige Pferd setzte, als er Swellendam verließ und an die Ostgrenze nach Grahamstown kam. Jetzt, im Dezember 1828, war Grahamstown jedenfalls eine geschäftige Garnisonsstadt mit über vierhundert Häusern und mehr als zehnmal so viel Einwohnern, die umliegenden Farmen nicht gerechnet. Bis nach Port Elizabeth am Indischen Ozean waren es zudem nur siebzig Meilen. Und seit der Gouverneur vor wenigen Jahren endlich erlaubt hatte, dass von Port Elizabeth aus direkt mit England Handel getrieben werden durfte, hatte der Hafen für den wirtschaftlichen Aufschwung des östlichen Hinterlandes noch mehr an Bedeutung gewonnen.
Die Ochsenwagen zogen langsam vorbei, und Hendrik fegte die Terrasse. Dann machte er sich daran, das lange Sprossenfenster zu putzen. Er ließ sich Zeit. Die drei stinkenden Fässer konnten warten. Sein Vater hatte sie von seiner letzten Fahrt nach Port Elizabeth mitgebracht und ganz stolz verkündet, für welch einen Spottpreis er sie im Hafen erstanden hatte. Sie hatten ihn nicht mal halb so viel gekostet, wie Jacob Pretorius, der Fassbinder, für seine Fässer nahm. Und er hatte sich lang und breit und voller Missgunst darüber ausgelassen, dass Pretorius angeblich viel zu teuer war und seine Kunden übervorteilte. Colin, Kevin und Stuart hatten ihm natürlich beigepflichtet, denn sie hatten dieselbe Krämerseele wie ihr Vater. Sie dachten von morgens bis abends an nichts anderes als daran, wie sie einen möglichst großen Profit machen konnten, reagierten aber missgünstig und redeten von Preistreiberei, wenn andere für ihre Arbeit einen ehrlichen Lohn verlangten. Bei ihnen drehte sich alles um Geld. Ihre Bibel war das große schwarze Rechnungsbuch, wo jeder ausgegebene und eingenommene Penny eingetragen wurde. Und wenn die wöchentliche Bilanz am Samstagabend einen hübschen Gewinn erbrachte, dann war ihnen das wichtiger als alles andere auf der Welt. Am liebsten hätten sie den Laden auch sonntags noch geöffnet, um Geschäfte zu machen.
Hendrik dachte, wie eng und armselig solch ein Leben doch war. Er jedenfalls hasste es aus tiefster Seele, und er würde nicht zulassen, dass sein Vater und seine Brüder ihn dazu zwangen, sein Leben hinter einer Ladentheke zu verbringen. Als er den Lappen wieder einmal im Holzeimer auswusch und dabei den Kopf wandte, sah er Emily Dickson. Zielstrebig kam sie auf das Geschäft zu. Eine gefältelte weiße Haube, kappie oder Schute genannt, schützte ihr rundes, rosiges Gesicht vor der intensiven Sonne. Hendrik fand, dass ihr kastanienbraunes Kleid, das sich unten wie eine Glocke öffnete und einen üppig gerüschten Saum besaß, ihrer etwas molligen Figur nicht unbedingt zum Vorteil gereichte.
Emily Dickson schien ihn völlig zu übersehen, als sie ihre Röcke raffte und die drei Stufen zur stoep hinaufschritt. Sie hielt den Kopf sogar leicht abgewandt, als wollte sie ihm zu verstehen geben, dass er Luft für sie war.
Das war ihm doch zu dumm. »Tag, Emily!«, grüßte er deshalb betont fröhlich.
Sie hielt im Schritt inne, und ihr Kopf fuhr scharf zu ihm herum, wie der einer Schlange, die im nächsten Moment zubeißen und ihr Gift verspritzen will. »Miss Dickson, wenn ich bitten darf!«, belehrte sie ihn spitz, und ihr wütender, strafender Blick schien ihn durchbohren zu wollen.
»Wie bitte?«
»Ja, du hast mich richtig verstanden. Ich verbitte mir deine Vertraulichkeiten!«, fauchte sie ihn an. »Es wird Zeit, dass dir jemand Umgangsformen beibringt, Hendrik McAllister!«
Hendrik sah sie verblüfft an. Sie waren fast gleichaltrig! Emily war sogar noch ein halbes Jahr jünger als er, und sie kannten sich von Kindesbeinen an. Also, was sollte dieses affige, hochnäsige Getue?
Doch plötzlich verstand er, warum sie ihn zuerst ignoriert hatte und dann so von oben herab behandelte, als wäre er es nicht mal wert, sie bei ihrem Vornamen zu nennen. Sie war wütend auf ihn, weil er vorletzten Sonntag nach dem Gottesdienst zufällig Zeuge ihres peinlichen Gesprächs mit Jan de Waal, dem ältesten Sohn des Wagenbauers, geworden war.
Er hatte den alten und fast blinden Farmer Caspar Langeveld aus der Kirche und zu seinem Wagen geführt, wo sein Hottentottenkutscher auf ihn wartete und sich seiner annahm. Als er danach durch die Reihen der auf dem Kirchplatz abgestellten Wagen und Einspänner spazierte, riss ihm ein Schnürsenkel. Er ging in die Hocke, um mit dem längeren Ende den Schuh provisorisch zuzubinden. Und als er da hinter einem klobigen Kastenwagen hockte und sich mit seinem Schuhriemen beschäftigte, hörte er plötzlich hastige Schritte und dann Emilys Stimme.
»Jan, warte!«, rief sie gedämpft.
»Was ist?« Die Stimme des Mannes klang so, als fühlte er sich belästigt.
Er blickte von seinem Schuh auf und sah durch einen Spalt zwischen zwei Pferden, dass es sich bei dem Mann, dem Emily Dickson nach dem Gottesdienst so eilig gefolgt war, um Jan de Waal handelte, der mit seinen zweiundzwanzig Jahren in etwa so alt wie Kevin war. In seinem schwarzen Sonntagsstaat sah er recht attraktiv aus.
»Du hast es heute so eilig, nach Hause zu kommen, Jan. Ich dachte, du würdest nach dem Gottesdienst noch eine Weile bei den anderen stehen und … und vielleicht noch ein paar Worte mit meinen Eltern wechseln.«
»Ich habe heute keine Zeit.«
O je, das klingt ja reichlich distanziert und kurz angebunden, dachte Hendrik und schmunzelte bei dem Gedanken, dass Emily ein Auge auf Jan de Waal geworfen hatte.
»Gestern auch nicht? Ich habe den ganzen Abend auf dich gewartet«, sagte Emily mit vorwurfsvollem Schmollen. »Und ich habe extra eine schöne neue opsitkers bereitgehalten.« Bei den Buren und mittlerweile auch bei allen anderen in der Kolonie war es Brauch, dass die Eltern ihrer heiratsfähigen Tochter eine Kerze schenkten, wenn ein junger Mann um sie zu werben begann. Besuchte der junge Mann das Mädchen seiner Wahl, was meist am Samstagabend der Fall war, zogen sich Eltern und Geschwister nach einer Weile des Zusammenseins zurück und ließen das Paar allein in der Wohnstube, wo dann die opsitkers entzündet wurde. War die Kerze niedergebrannt, verlangte es die Sitte, dass der Mann ging. Erwiderte das Mädchen die Gefühle des um sie werbenden Mannes, sorgte sie an diesen kostbaren Abenden stets für eine möglichst lang brennende opsitkers. Wollte sie ihn dagegen entmutigen, ohne ihn mit Worten zu verletzen, fand der Mann nur einen Kerzenstummel vor, was aber nicht immer das Ende sein musste. Oft genug war eine kurz brennende Kerze auch nur ein Test für die Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit des Mannes, und nach einer Zeit mickriger Talgstummel konnten daraus wunderschöne Kerzen erwachsen, die viele Stunden Licht und Freude spendeten, wenn das Mädchen während des gegenseitigen Kennenlernens eine immer stärkere Zuneigung entwickelte.
Dass Emily Dickson für Jan de Waal die besten Opsitkerzen bereitgehalten hatte, verwunderte Hendrik nicht. Der Sohn des Wagenbauers, gut aussehend und als ausgezeichneter Handwerker geachtet wie sein Vater, konnte seine Wahl zweifellos unter den Töchtern vieler gut situierter Familien aus Grahamstown und Umgebung treffen – und kaum ein heiratsfähiges Mädchen würde ihn bei seinem ersten Besuch mit einem Kerzenstummel begrüßen.
»Tut mir leid, aber ich kann mich nicht erinnern, dir versprochen zu haben, dass ich kommen würde«, erwiderte Jan reserviert.
Hendrik fand, dass diese Worte deutlich genug waren. Jan hatte, aus welchen Gründen auch immer, kein Interesse mehr an ihr. Das kam immer wieder vor, und dafür waren die Abende, an denen man zusammensaß und sich besser kennenlernen konnte, auch da. Er nahm an, dass Emily klug genug sein würde, es dabei zu belassen.
Dem war jedoch nicht so. Emily wollte sich nicht damit abfinden, wie ihr Insistieren verriet. »Aber du bist doch in den letzten drei Monaten jeden Samstagabend gekommen, Jan. Warum auf einmal nicht mehr?«
»Emily, bitte! Wir haben uns gegenseitig nichts versprochen.« Jan klang nun verlegen und ärgerlich zugleich. »Lassen wir es dabei.«
»Was ist es, was dich plötzlich anderen Sinnes sein lässt?«, bohrte sie nach, nicht bereit, ihre Träume, seine Frau zu werden, so einfach aufzugeben.
»Ich glaube nicht, dass ich dir darüber Rede und Antwort stehen muss, Emily.«
»Doch, du musst!«, beschwor sie ihn, und Hendrik tat es fast körperlich weh, mit anhören zu müssen, wie sie sich ihm aufdrängte und dabei allen Stolz und alle Selbstachtung verlor. »Wenn es etwas gibt, was dir an mir missfällt, brauchst du es mir nur zu sagen, Jan. Ich kann es abstellen. Ich werde mich ändern und so sein, wie du mich haben möchtest. Ich bin dir zu dick, nicht wahr? Ich werde nicht mehr so viel essen, das verspreche ich dir. Ich weiß, das habe ich mir schon mehrmals vorgenommen, doch diesmal mache ich es bestimmt wahr!«
»Es hat keinen Sinn, Emily! Wir passen nicht zusammen, und damit hat es sich!«, entgegnete Jan hart. »Finde dich endlich damit ab, und mach dich nicht selbst herunter. Ich will dir nicht wehtun. Also benimm dich nicht wie ein lästiger Hund, dem man einen Tritt versetzen muss, damit er aufhört, einem nachzulaufen.«
Damit sprang er in seinen Einspänner und fuhr los. Emily sah ihm mit leichenblassem Gesicht nach. Dann stampfte sie zornig mit dem Fuß auf und murmelte in ohnmächtiger Enttäuschung: »Fahr doch zum Teufel, Jan de Waal! Du bist es ja gar nicht wert, dass ich dir auch nur eine Träne nachweine!«
Und dann stürmte sie durch die Lücke zwischen den beiden Wagen, hinter denen Hendrik war. Er fand keine Zeit mehr, sich abzuwenden oder ihr gar aus dem Weg zu gehen, damit sie nicht merkte, dass er jedes Wort mitbekommen hatte.
Abrupt blieb sie stehen, als sie ihn sah.
Er fühlte sich ertappt wie ein gemeiner Lauscher. Es war ihm peinlich, und er wusste nicht, was er sagen sollte. Das Einzige, was ihm in diesem Moment einfiel, war: »Mir ist der Schnürsenkel gerissen.« Und dabei hielt er das andere, kurze Ende wie zum Beweis hoch, dass er ihrem Gespräch mit Jan de Waal rein zufällig zugehört hatte.
Emily öffnete den Mund, schnappte nach Luft, ohne jedoch einen Ton herauszubringen. Das Blut schoss ihr ins Gesicht, und sie wurde rot bis hinter die Ohren.
»Ist ja nicht das Ende der Welt, Emily«, sagte er, weil er glaubte, irgendetwas zu diesem Thema von sich geben zu müssen. Er meinte es nur gut, hätte jedoch gar nichts Falscheres sagen können.
»Untersteh dich!«, zischte sie, ohne auszuführen, wovor genau sie ihn warnte, und bedachte ihn mit einem wütenden Blick. Dann hastete sie davon …
Hendrik hatte in den folgenden Tagen gar nicht mehr daran gedacht, weil er genug eigene Probleme hatte. Sie war ihm in der Woche auch nicht wieder begegnet, selbst gestern beim Gottesdienst nicht, wie ihm jetzt bewusst wurde. Und wenn Emily ihm gerade nicht so affektiert gekommen wäre, hätte er sich auch nichts weiter gedacht und sich gleich wieder seinen eigenen Überlegungen gewidmet. Doch ihre plötzlich hochnäsige Art und besonders dieser wütende, strafende Blick, als hätte er sich irgendetwas zuschulden kommen lassen, hatten ihm die peinliche Auseinandersetzung zwischen ihr und Jan am vorletzten Sonntag nachdrücklich in Erinnerung gerufen.
»Ich bitte untertänigst um Entschuldigung, Miss Dickson«, sagte er jetzt und öffnete ihr die Tür zum Geschäft, während er eine tiefe Verbeugung machte, ein breites Grinsen auf dem Gesicht, denn das hatte sie verdient. »Wünsche einen schönen Einkauf, Miss Dickson. Fragen Sie doch meinen Bruder nach unseren besonders schönen Opsitkerzen. Aber nein, vermutlich haben Sie im Augenblick wenig Bedarf dafür. Dennoch, einen schönen Tag, Miss Dickson.«
Emily sog die Luft vor Empörung scharf ein, vermochte jedoch nicht, mit einer schlagfertigen Erwiderung auf seinen Spott zu antworten. Mit roten Flecken im Gesicht rauschte sie an ihm vorbei in den Laden, und Hendrik machte sich mit einem vergnügten Lachen wieder an die Arbeit, die letzten Sprossenfenster zu putzen. Er vergaß den Vorfall schnell und hing seinen Gedanken nach, die sich mit seiner Zukunft in Grahamstown beschäftigten. Und wie er es drehte und wendete, seine Aussichten erschienen ihm alles andere als rosig.
3
Wenige Minuten später ging die Tür auf, und als Hendrik Kevin den Kopf mit geringschätziger Miene zur stoep herausstrecken sah, wusste er instinktiv, dass Ärger in der Luft lag. »Komm rein! Colin will mit dir reden.«
»Was ist?«, fragte Hendrik, warf den Lappen in den Eimer und wischte sich die nassen Hände an der Hose ab. »Hat Emily Dickson sich beschwert?«
»Schlechtes Gewissen, was?«
»Du kannst mich mal«, murmelte Hendrik.
»Pass auf, was du sagst!«, raunte Kevin ihm zu und verpasste ihm eine Kopfnuss, als er an ihm vorbeikam.
Hendrik fuhr zu ihm herum. »Das nächste Mal bekommst du dafür eins auf die Nase!«, zischte er.
»Ich kann’s gar nicht erwarten, Kleiner«, erwiderte Kevin mit einem abfälligen Grinsen. »Und jetzt troll dich zu Colin hinüber, sonst reißt der dir deinen Burenschädel vom Hals, bevor ich es tun kann.«
Und schon schallte Colins schneidende Stimme durch den langgestreckten Raum, der mit Regalen und Verkaufsvitrinen aller Art vollgestellt war. »Beweg dich, Hendrik! Wir warten auf dich!«
»Aye, aye, Sir«, brummte Hendrik und begab sich zu Colin hinter die lange Verkaufstheke, die sich fast vor der gesamten hinteren Längsfront erstreckte.
Wann immer Hendrik den Laden betrat, fühlte er sich von der Vielzahl der Waren, die von den schweren Deckenbalken hingen, auf dem Dielenboden aufgestapelt waren sowie Dutzende Regale füllten, regelrecht erdrückt. Ob Gewürze, Stoffe, Lebensmittel, Farben, Werkzeug, landwirtschaftliche Geräte oder zweifelhafte Heiltinkturen – in McAllister’s Emporium konnte man finden, wonach man suchte und woran man gar nicht gedacht hatte. Jede Ecke war genutzt, um irgendeine Ware zu präsentieren, ob es sich nun um dreibeinige schwarze Kaffernkessel in verschiedenen Größen handelte, die wie die Schinken in ihren Leinensäcken und die gebündelten Trockenkräuter von der Decke hingen, oder um Knöpfe und Hutbänder. Der Geruch im Laden war eine eigenartige Mischung aus Lebensmitteln wie Mehl, Öl, Zucker, Salz, sonnengetrocknetem Fleisch namens biltong, Stoffen aller Art, Talg, Fett und gewachstem Holz sowie kaltem Tabakrauch. Ein Geruch, der angenehm war, wenn man sich nur eine kurze Weile im Geschäft aufhielt, auf Hendrik auf die Dauer jedoch abstoßend wirkte und ihm Kopfschmerzen bereitete.
Colin bedachte ihn mit dem gereizten Ausdruck eines Mannes, dessen Geduld und Gutmütigkeit über Gebühr strapaziert worden ist, der sich aber dennoch weiterhin um Nachsicht bemühte. Ein Benehmen, das Colin ganz besonders gern in Gegenwart von Kunden an den Tag legte.
»Ja?«, fragte Hendrik und warf Emily einen schnellen Blick zu. Sie stand auf der anderen Seite der Theke, den Kopf hochmütig in den Nacken gelegt. Vor ihr auf dem polierten gelben Holz des Ladentisches lag ein Ballen dunkelblauen, teuren Tafts. Stuart und Kevin lehnten rechts von ihr an zwei Fässern. Aus ihren Mienen sprach unverhohlene Schadenfreude. Colin sah ihn grimmig an und wandte sich dann wieder Emily zu. Mit dem routinierten Höflichkeitslächeln des Verkäufers, der einer guten Kundin fast um jeden Preis recht zu geben gewillt war, bat er sie: »Ich wäre Ihnen dankbar, Miss Dickson, wenn Sie Ihre Beschwerde in Gegenwart meines Bruders noch einmal wiederholen würden.«
»Nun ja«, zierte sie sich. »Es lag eigentlich gar nicht in meiner Absicht, mich zu beschweren, denn so etwas kann ja immer mal vorkommen. Ich wollte es nur erwähnt haben …«
»Himmel«, murmelte Hendrik und verdrehte die Augen. Er war von seinen Halbbrüdern ja eine Menge gewöhnt, aber er hätte nie geglaubt, dass Colin aus dieser Bagatelle solch eine Affäre machen würde.
»Halt den Mund!«, herrschte Colin ihn an, und mit einer entschuldigenden Beugung des Kopfes zu Emily sagte er: »Bitte fahren Sie fort, Miss Dickson.«
Emily räusperte sich. »Es ist wegen der Nägel, die ich vor zehn Tagen hier für meinen Vater gekauft habe. Ihr Bruder hat mich bedient.«
»Erinnerst du dich?«, fragte Colin scharf.
»Ja, sicher«, antwortete Hendrik verständnislos, hatte er doch erwartet, dass sie sich wegen seines Verhaltens vorhin auf der stoep beschwert hatte.
»Fünf Pfund Nägel zu sechs Inch, und auf ein Pfund gehen genau siebzehn Nägel«, fuhr Emily belehrend fort.
»Richtig, siebzehn auf ein Pfund«, bestätigte Colin.
»Das wären also fünfundachtzig Nägel gewesen. Doch als ich zu Hause nachgezählt habe, waren es nur neunundsiebzig. Es fehlten sechs Nägel, was immerhin gut ein Drittelpfund weniger ist, als ich bezahlt habe.«
»Das kann nicht sein!«, widersprach Hendrik: »Ich weiß ganz genau, dass ich zweimal nachgezählt habe, wie ich das immer tue. Sie will doch nur …«
Emily fiel ihm mit schriller, gehässiger Stimme ins Wort. »Es waren sechs Nägel zu wenig! Und ich verbitte mir, dass man die Wahrheit meiner Worte in Zweifel zieht!«, plusterte sie sich auf.
»Es waren genau fünfundachtzig 6-Inch-Nägel!«
»Soll das heißen, dass ich eine Lügnerin bin?«, empörte sich Emily, sah dabei aber Colin an.
Bevor Hendrik wusste, wie ihm geschah, landete Colins Hand in seinem Gesicht. Die Ohrfeige war so kräftig, dass er gegen das Regal mit den Stoffballen taumelte.
»Wage es nicht noch einmal, dir solch eine Unverschämtheit gegenüber unseren Kunden herauszunehmen!«, fuhr Colin ihn zornig an. »Es ist schon schlimm genug, dass man kein Vertrauen in deine Arbeit haben kann und dass du zu solch unangenehmen Beschwerden Anlass gibst! Hol ein Pfund von diesen Nägeln, und zwar ein bisschen flott!«
»Das hat sie ja bloß gesagt, um mir was anzuhängen, weil ich …«, setzte Hendrik zu einem wütenden Protest an.
»Ihr Bruder nennt mich wahrhaftig eine Lügnerin!«, zeterte Emily.
Colin schlug ihn ein zweites Mal. Hendrik riss den Arm hoch, um sich zu schützen, doch seine Aufmerksamkeit und Empörung hatten einen Augenblick zu lange Emily gegolten. Colins Handrücken traf, und der schwere Siegelring, den sein Halbbruder am Mittelfinger trug, ließ seine Unterlippe im rechten Mundwinkel aufplatzen.
»Du taugst zu gar nichts! Es ist eine Schande mit dir! Geh uns bloß aus den Augen!«, schrie Colin ihn an, packte ihn und stieß die Tür zum Lager auf.
»Hab’ ja schon immer gesagt, dass unser kleiner Halbbruder unseren guten Namen noch mal in Verruf bringt«, bemerkte Stuart hämisch.
Bevor Colin ihn aus dem Geschäft in das Halbdunkel des Warenlagers stieß, sah Hendrik noch den triumphierenden Blick in Emilys Augen. Sie hatte ihm seinen Spott auf ganz gemeine, niederträchtige Art heimgezahlt, und bessere Partner als seine Halbbrüder hätte sie sich dabei gar nicht wünschen können.
Die Tür fiel krachend hinter ihm zu.
Blinde Wut kochte in Hendrik. Ihm wurde fast übel vor ohnmächtigem Zorn, als er hörte, wie Colin sich wortreich bei Emily entschuldigte und sie ihm mit zuckersüßer Stimme versicherte, dass sie es ihnen nachsehen werde und froh sei, sagen zu können, dass sie bei allen anderen McAllisters bisher nie auch nur den Hauch eines Anlasses zur Klage gehabt habe und sicher sei, dass es auch in Zukunft so sein würde. Und sie bedauere, dass der »junge McAllister«, wie sie ihn herablassend nannte, als wäre er ein dummer Bengel und sie eine reife Frau, es sehr an Höflichkeit und Wahrheitsliebe mangeln lasse.
Hendrik stand hinter der Tür, schmeckte Blut auf der Zunge und spürte, wie seine Unterlippe schmerzhaft pochte und anschwoll. Er presste die Fäuste gegen die Stirn und wäre am liebsten wieder ins Geschäft gestürzt. Aber seine Vernunft war stärker als seine Wut.
Es gab nichts, was er gegen Emilys Verleumdungen und die Voreingenommenheit seiner Brüder hätte ausrichten können. Colin, Stuart und Kevin begrüßten jede auch noch so fadenscheinige Gelegenheit, ihm eins auszuwischen und ihm zu verstehen zu geben, dass er in ihren Augen kaum mehr als ein Bastard war.
Als er noch klein gewesen war, hatten sie ihn auf andere Weise tyrannisiert. Wenn er sich ein Spielzeug geschnitzt oder ein Pferd aus Ton geformt hatte, war einer von ihnen absichtlich drauf getreten. Mehr als einmal hatten sie ihm sein Taschenmesser oder etwas anderes, was ihm teuer gewesen war, gestohlen oder für immer »ausgeliehen«. Sie hatten ihm Kot in seine Stiefel und Ungeziefer in sein Bett gekippt und ihn mit Skorpionen und Schlangen zu Tode erschreckt. Ihre Phantasie war unerschöpflich gewesen, wenn es darum gegangen war, ihm einen bösartigen Streich zu spielen und ihn vor ihrem Vater in ein schlechtes Licht zu stellen. Er hatte sich gewehrt, so gut es eben ging, doch da er von jeher sehniger, schlanker Figur war und es immer mit wenigstens zweien von ihnen auf einmal zu tun hatte, hatte er nie eine reelle Chance gehabt. Auch wenn Colin, Stuart und Kevin sich untereinander stritten und ihre Meinungsverschiedenheiten hatten, gegen ihn hielten sie immer zusammen. Daran hatte sich auch in späteren Jahren nichts geändert, und deshalb war es für ihn geradezu eine Erlösung gewesen, als sein Vater, der ewigen Zankerei und seiner wohl auch sonst überdrüssig, ihn mit zehn zu Douglas Mackenzie nach Highlands geschickt hatte, damit er bei ihm etwas lernte und sich auf der Farm nützlich machte. Dass er ihn nicht zu jemandem in Grahamstown in die Lehre gegeben, sondern auf eine Farm am Kariega River abgeschoben hatte, war bezeichnend gewesen. Sein Vater hatte ihn aus den Augen haben wollen, und ihm war es mehr als recht gewesen. Highlands war zu seinem Zuhause geworden. Praktisch war er die letzten siebeneinhalb Jahre auf der Mackenzie-Farm aufgewachsen, bis sein Vater ihn im Oktober nach Grahamstown zurückbefohlen hatte, und seitdem hatte er vor seinen Brüdern nicht einen Tag Ruhe gehabt.
Innerlich aufgewühlt, ging Hendrik durch das Lager hinaus auf den Hof, wo die stinkenden Fässer auf ihn warteten. Alles begehrte in ihm auf, und er beschloss spontan, sich den Tag nach eigenem Gutdünken einzuteilen und auf der Stelle nach Highlands ins Kariega-Tal zu reiten. Was hatte er denn schon noch groß zu verlieren? Auch wenn er sich hier den Rest des Tages abschuftete, würde Colin noch dafür sorgen, dass sein Vater wütend auf ihn sein würde, wenn er morgen aus Salem zurückkam.
Hendrik tat alle inneren Bedenken mit einem Schulterzucken ab. Sein Entschluss war gefasst. Er würde dorthin gehen, wo er willkommen war und die glücklichste Zeit seines Lebens verbracht hatte – auf Highlands. Er lief in den Stall, sattelte Whisper, seine geliebte dreijährige Fuchsstute, und wollte schon aus dem Hof reiten, als ihm einfiel, dass er beinahe etwas Wichtiges vergessen hätte – und zwar die Zuckerstangen für den kleinen Robin Mackenzie und seine beiden Geschwister Tim und Lena, den Tabak für Douglas und irgendeine Kleinigkeit für dessen junge, warmherzige Frau Rachel.
Er sprang aus dem Sattel, band die Zügel an den Pfosten neben der Hintertür und tätschelte der Stute den Hals, als sie ungnädig über die Verzögerung schnaubte. Es schien, als spürte sie, wohin er mit ihr wollte.
»Keine Sorge, es dauert nicht lange. Ich bin sofort wieder zurück«, sagte er, öffnete vorsichtig die Tür und schlich sich auf Zehenspitzen ins Warenlager. Er kannte sich gut genug aus, um zu wissen, wo er das Gesuchte finden würde.
Fünf Minuten später saß er wieder im Sattel und preschte im Galopp aus dem Hof.
4
Auf dem Rücken seines Pferdes fühlte sich Hendrik gleich um einiges besser. Er ritt die Straße hinunter. Die Sonne ließ die weißgekalkten Häuser, von denen manche im typischen kapholländischen Stil mit auffälligen Giebeln erbaut waren, intensiv leuchten. Den Büschen und Blumenrabatten vor den Häusern und den Gärten mit den Obstbäumen entströmte ein schwerer sommerlicher Duft, der sich mit dem von frischem Pferde- und Ochsendung auf der Straße vermischte.
Hendrik atmete tief durch, grüßte einige burgher im Vorbeireiten, wich auf dem Kirchplatz dem Einspänner eines Offiziers aus, der in Begleitung einer hübschen jungen Frau war und es offensichtlich eilig hatte, und gelangte Augenblicke später zum outspan von Grahamstown. Hier konnten die Farmer und Händler, die mit ihren schweren Feldschonern und einem Gespann von zehn, zwölf Ochsen in die Stadt kamen, die Zugtiere ausspannen, sie mit Futter und Wasser versorgen und die Wagen abstellen. Der outspan war zudem in jeder Stadt und Siedlung der Kolonie der Ort, wo man sich traf, um Geschäfte abzuwickeln, Klatsch auszutauschen und über die wirtschaftliche wie politische Lage zu diskutieren.
Ein gutes Dutzend Wagen und zwei klobige Einspänner, die mit Sicherheit nicht aus den Werkstätten der hoch angesehenen Wagenbauer von Grahamstown kamen, hatten sich an diesem Morgen schon auf dem outspan eingefunden. Und bei den langen Tränken stand eine Gruppe Männer und Frauen zusammen. Es waren überwiegend Buren, das sah Hendrik auf den ersten Blick.
Die burischen Farmer und besonders die Treckburen, die als wandernde Viehzüchter mit ihren Herden weit über die Grenze der Kolonie hinaus über die Grasebenen zogen und sich in ihrer Rastlosigkeit und Freiheitsliebe von jeher jeder Kontrolle durch Verwaltungsbehörden widersetzten, diese Buren erkannte man leicht an ihrer traditionell selbst hergestellten Kleidung, die von Kopf bis Fuß aus Leder bestand. Auch im Sommer trugen die Männer ihre derben Lederhosen und -jacken sowie Hüte, deren riesige Krempen an Wagenräder erinnerten. Es waren große, stämmige Gestalten mit bärtigen Gesichtern, von denen manche so aussahen, als wären sie geradewegs dem Alten Testament entsprungen, auf dem ihr strenger calvinistischer Glaube beruhte und das sie als das einzig gültige Gesetzbuch akzeptierten. Die Frauen, züchtig in ihren schmucklosen Kleidern in gedeckten Farben und alle mit makellos sauberen Schuten, standen ihren Männern durchweg an Robustheit in nichts nach. Und mit dem boer roer, dem schon legendären Vorderlader, ohne den ein Bure im Grenzgebiet keinen Schritt vor die Tür setzte und den er sogar mit zum Pflügen aufs Feld nahm, verstanden diese Frauen kaum schlechter umzugehen wie ihre Väter, Männer und Brüder.
Erregte Stimmen drangen von den Buren, die bei den Tränken standen, zu Hendrik herüber, und seine Neugier war geweckt. Er ritt mit Whisper zum outspan hinüber, glitt dann aus dem Sattel und führte die Stute am Zügel nur zwei Pferdelängen von der kleinen Ansammlung zur Tränke. Die Männer und Frauen, von denen ihm einige mit Namen und viele vom Gesicht her bekannt waren, ließen sich in ihrer erregten Diskussion nicht von ihm stören. Einige nickten ihm sogar beiläufig zu, als ihr Blick auf ihn fiel, schenkten ihm darüber hinaus jedoch keine weitere Beachtung.
Hendrik sah, dass offensichtlich Willem Bickenstroem, ein breitschultriger Farmer mit zottigem Vollbart, das Wort führte. Er stand auf dem disselboom, der Deichsel seines Wagens, so dass er alle anderen gut zwei Kopflängen überragte.
»… und es ist so, wie ich es sage, Freunde. Wir hier im Osten sind nicht nur die vergessene Provinz, sondern die verratene Provinz der Kolonie!«, verkündete er erregt. »Wir müssen nicht nur die Fehler und Ignoranz der Gouverneure in Kapstadt ausbaden, sondern wir Buren müssen auch noch die Verachtung und Verleumdungen der rooineks in England hinnehmen.«
Zustimmendes Gemurmel erhob sich, und der Bäcker Carl Koosten sagte: »Nur zu wahr, Mijnheer Bickenstroem. Seit die verdammten Rotröcke sich unsere Kolonie mit Gewalt angeeignet und ihrem Empire einverleibt haben, sind wir Buren, die wir dieses Land mit dem Blut unserer Väter und Vorväter, ja und mit dem unserer toten Kinder und Frauen erschlossen und besiedelt haben, seitdem sind wir Buren für alles die Sündenböcke.«
»Ja, es ist eine Schande, was sie mit uns treiben!«, rief Martha, die burschikose Ehefrau des Farmers Isaac Reyneveld. »Und diese 50. Ordinance des Gouverneurs ist ein Schlag ins Gesicht! Den Hottentotten dieselben bürgerlichen Rechte einzuräumen wie uns weißen Christenmenschen ist ebenso lächerlich wie ungeheuerlich.«
»Schon gut, Weib«, versuchte ihr Mann sie zu beruhigen. »Es gibt wohl keinen, der mit dir darin nicht einer Meinung ist.«
»Aber es muss auch ausgesprochen werden!«, fuhr Martha erbost fort. »Die Engländer wollen uns alles nehmen, woran wir glauben! In unserem eigenen Land ist nicht länger unsere taal die offizielle Sprache. Aber damit hat die planmäßige Zerstörung unserer Kultur nicht begonnen, und damit wird sie auch nicht aufhören.«
»Recht haben Sie, Mevrouw Reyneveld!«, unterstützte Willem Bickenstroem sie. »Überall im Land muss unser Protest gehört werden. Die Hottentottengesetze von 1809 und 1812 mit ihren Passvorschriften und festen Arbeitsverpflichtungen für die Schwarzen haben schon ihren Sinn gehabt. Wir alle wissen doch nur zu gut, was jetzt geschehen wird, nachdem den Hottentotten die gleichen bürgerlichen Rechte wie uns zugesprochen worden sind. Sie können jetzt ihren Arbeitgeber nach Belieben wechseln und brauchen keinen Pass mehr, wenn sie von der Farm ins Dorf oder sonst wohin wollen. Im fernen England klingt das nur recht und billig. Aber wozu wird das hier bei uns führen?« Seine Frage war rein rhetorischer Natur, denn jeder Farmer und Siedler, der Hottentotten beschäftigte, wusste um die Folgen, die die 50. Ordinance haben würde.
»Natürlich zu noch mehr Vagabundentum und einem drastischen Anstieg von Viehdiebstählen!«, rief David Joubert, ein anderer Farmer, grimmig und unter beipflichtendem Stimmengewirr. »Als wäre es mit dem Herumlungern und den Diebereien der Hottentotten, Kaffern und Buschmänner auch ohne diese schändliche 50. Ordinance nicht schon schlimm genug.«
»In den Augen der Engländer sind wir ja alle Sklavenhalter, die ihre Sklaven und Hottentotten bis aufs Blut ausquetschen und von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang schuften lassen«, warf ein anderer erzürnter Bure ein. »Die Gräuel, die die Herren in London aus ihren Kolonien auf den Westindischen Inseln und auf Mauritius über die dortigen Plantagenbesitzer zu hören bekommen – und das sind durch die Bank alles Engländer! – diese Gräuelgeschichten übertragen sie unverschämter Weise blind auf die Kapkolonie und auf uns Buren. Sie haben ihr Urteil über uns gefällt, ohne auch nur das Geringste über unser hartes, gottgefälliges Leben zu wissen, denn wir leben nach dem Wort und den Geboten der Heiligen Schrift!«
»So ist es!«
»Der Allmächtige ist unser Zeuge!«
»Noch nie in meinem Leben habe ich einen meiner Sklaven oder Hottentotten ausgepeitscht«, nahm Willem Bickenstroem den Faden auf. »Ganz im Gegensatz zu vielen britischen Marineoffizieren, denn auf den Kriegs- und Handelsschiffen Seiner Majestät gehört das gnadenlose Auspeitschen mit der neunschwänzigen Peitsche schon für das kleinste Vergehen bekanntlich zum Alltag auf See. Aber nein, wir sind es, die als brutale Tyrannen ungestraft weltweit gebrandmarkt werden dürfen!«
»Ja, dank der jahrelangen Verleumdungskampagne der Philanthropen und Missionare, denen die blutrünstigen Kaffern mehr am Herzen liegen als wir Buren, mehr auch als ihre eigenen britischen Siedler!«, erinnerte Martha die Umstehenden.
»Fünf blutige Kaffernkriege in nicht einmal fünfzig Jahren haben wir hier im Osten am Great Fish River schon durchstehen müssen«, meldete sich ein gedrungener alter Mann mit schlohweißem Bart zu Wort. »Ich war vierzehn, als 1781 die Kaffern zum ersten Mal plündernd und mordend über unsere Farmen herfielen, und seitdem habe ich vier weitere Kaffernkriege erlebt. Immer und immer wieder haben die Kaffern den Great Fish River als vereinbarte Grenze ignoriert, haben bei Nacht den Fluss überschritten und sind über uns hergefallen. Durch die Assegais der Xhosas sind zwei meiner Söhne, eine Tochter und meine zweite Frau gestorben. Doch es ist nicht ihr Tod, der mich so bitter macht, es ist die Tatenlosigkeit unserer neuen Herren in London. Seit zwei Jahrzehnten haben uns der Gouverneur in Kapstadt und der Kolonialminister immer wieder versprochen, dass sie die Grenze zum Kaffernland unter stärkeren militärischen Schutz stellen und unsere Farmen und Siedlungen vor den ständigen Übergriffen schützen werden. Aber es ist nie dazu gekommen. Es hat immer nur zu halbherzigen Taten gereicht. Wir werden uns selbst überlassen. Aber wenn wir uns zu wehren und unser geraubtes Vieh zurückzuholen versuchen, ist die Empörung groß, und man gibt uns die Schuld an allem, allen voran die Missionare, die lieber ins Land der Heiden gehen als eine der vielen unbesetzten Predigerstellen in den Siedlungen ihrer eigenen Landsleute auszufüllen. Sie sind ganz besessen von der Idee der Philanthropen, dass es sich bei den Kaffern und all den anderen schwarzen Stämmen um unverstandene ›edle Wilde‹ handelt, denen man nur Gottes Wort und reichlich Geschenke von der billigen Art der Glasperlen und bunten Tücher zu bringen braucht, um sie ihre Kriegslust und ihren viehischen Aberglauben vergessen zu machen. Und wenn man in den vornehmen Salons dieser britischen Ladies und Gentlemen sitzt, fällt es diesen Freunden der ›edlen Wilden‹ sicherlich auch nicht schwer, an ihren eigenen Unsinn zu glauben.«
»Ja, ein Jahr sollten sie hier bei uns leben und mindestens ein, zwei Xhosa-Überfälle mitmachen!«, rief der Sattler Erik Onkruidt voller Groll. »Dann würden die meisten von ihnen ein böses Erwachen erleben.«
Hendrik hatte dem erregten Hin und Her gebannt zugehört. Noch vor ein, zwei Jahren hatte er sich für Politik und die wachsende Unzufriedenheit der burischen Kolonisten so gut wie nicht interessiert. Doch in letzter Zeit nahm er alles, was die Buren und alle anderen Vorgänge in der Kapkolonie anging, begierig in sich auf.
Er wünschte, noch länger Willem Bickenstroem und den anderen zuhören zu können. Doch er wollte ja auch noch zu Douglas nach Highlands, und das war ein Ritt von einer guten Stunde. Es war ratsam, nicht länger zu warten, wenn er nicht mit Whisper in die ärgste Hitze geraten wollte. So führte er sein Pferd widerstrebend von den Buren fort, schwang sich in den Sattel und ritt in südlicher Richtung aus der Stadt.
5
Hendrik genoss den Ritt durch das Hinterland von Grahamstown, das von vielen Hügelketten durchzogen war und noch immer einen guten Waldbestand aufwies, trotz der vielen neuen Farmen und Siedlungen, die seit der Niederlassung von fast fünftausend britischen Siedlern im Jahre 1820 auf dem Zuurveld zwischen Grahamstown und der Küste entstanden waren.
Das weite Land mit seiner roten, schweren Erde und den allgegenwärtigen Schirmakazien und Eukalyptusbäumen sowie den manchmal fast mannshohen Aloen, Proteenfeldern, Kaffernbäumen und Dornenbüschen lag grün und wellig wie die schwere Dünung einer wogenden See unter der afrikanischen Sonne. Hier und da fiel der Blick auf Ziegen-, Schaf- und Rinderherden, die von Hottentotten gehütet wurden, sowie auf Viehkraals und bescheidene Gehöfte mit Farmhäusern, die man hartebeest huisje nannte. Die Mauern dieser Häuser wurden mit einem Gemisch aus Stroh und Lehm errichtet, das in mehreren Schichten auf ein Grundgerüst aus Balken und ineinander verflochtenen Ästen aufgetragen wurde. Der Boden im Innern des Hauses bestand aus Ochsendung und Lehm, der ausgetrocknet so hart wie Stein war. Gedeckt waren die Dächer mit einer dicken Lage Reet. Warum aber ausgerechnet das Hartebeest, die elegante Kuhantilope, die auf dem veld häufiger als jede andere Antilopenart anzutreffen war, diesen Häusern ihren Namen geliehen hatte, das hatte Hendrik noch keiner erklären können.
Die Straße, die ins Kariega-Tal führte, verdiente diese Bezeichnung kaum, war sie in Wirklichkeit doch nichts weiter als zwei sandige Spurrillen, die sich durch das auf- und absteigende Land wanden, von den Rädern schwer beladener Ochsenwagen aus dem struppigen Gras gekerbt. Gelegentlich bogen andere sandige Fahrspuren nach rechts und links ab, um zu Farmen zu führen, die jenseits dieser Hügelgruppe oder jener Waldzunge lagen.
Je weiter er sich von Grahamstown entfernte, desto ruhiger wurde er innerlich und desto mehr fielen Zorn und Bedrückung von ihm ab. Unter freiem Himmel zu sein und Whisper unter sich zu spüren, gaben ihm das befriedigende Gefühl der Sicherheit und Ausgeglichenheit, ja erweckten in ihm sogar vorübergehend die trügerische Empfindung, sein Leben unter Kontrolle zu haben. Er wusste jedoch nur zu gut, dass dies eine Illusion war, denn in Wirklichkeit war er weit davon entfernt, die Geschicke seines Lebens nach seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen gestalten zu können. Ja, in gewisser Weise wusste er noch nicht einmal zu sagen, was genau er wollte und wer er eigentlich war und wo er seinen Platz im Leben suchen sollte. Was er dagegen mit absoluter Sicherheit wusste, war, dass er niemals das Leben eines Händlers führen und im Laden seines Vaters unter Colin das Dasein eines Krämers in Grahamstown oder anderswo fristen würde. Niemals und um keinen Preis!
Diese und ähnliche Gedanken beschäftigten ihn, während er nach Süden ritt und immer neue Hügelketten überquerte. Einmal sah er vier, fünf Springböcke von einer Wasserstelle davonstieben und im Handumdrehen mit dem Busch verschmelzen. Er begegnete auch einem Schabrackenschakal mit orangebraunem Fell an Körper und Läufen und schwarzer Rückenfärbung. Der Schakal lief, einen verendeten Vogel in seinen Fängen, über den steinigen Hang eines Berges und verschwand ohne Hast in einem großen Dornendickicht. Am Himmel bemerkte er einen Schwarm Marabus und später, als er das Tal am Kariega River erreicht hatte, einen Fischadler, der hoch oben majestätisch seine Kreise zog.
Hier war das Land flacher und entschieden weniger bewaldet als am Great Fish River, und wenn Hendrik einen Ort hätte benennen sollen, mit dem er den Begriff Heimat verband, dann war es das Kariega-Tal und dort die Farm der Mackenzies, die ihn wie einen Sohn aufgenommen hatten und die ihm näherstanden als sein Vater und seine drei Halbbrüder, so bitter es auch war, das von sich zugeben zu müssen.
Anderthalb Meilen vor der Abzweigung nach Highlands bemerkte Hendrik auf einem Feld zu seiner Linken eine kleine Herde von rund drei Dutzend Ziegen. Die schmächtige Gestalt, die auf einem Felsbrocken hockte und offensichtlich die Ziegen hütete, erkannte er sofort. Es war Katharina, das jüngste Kind von Johannes Marik, dessen Farm Welverdient im Westen an Highlands grenzte. Die Mackenzies und die Mariks waren gut befreundet, und er, Hendrik, hatte mit Katharinas Bruder Martin, der nur ein paar Monate älter war als er, so manch arbeitsame wie auch fröhliche Stunde verbracht.
Katharina konnte noch keine zehn sein, wie Hendrik sich in Erinnerung rief, und es verwunderte ihn, sie hier draußen allein anzutreffen. Denn außer ihnen beiden war niemand sonst weit und breit zu sehen. Er ritt zu ihr hinüber.
Katharina schnitzte gerade die Rinde von einem Stock, als Hendrik zwischen den Hügeln auftauchte. Als sie den Kopf hob und ihn auf sich zukommen sah, winkte sie mit dem Messer in der Hand.
Hendrik bemerkte die Flinte, die in Reichweite an den Felsen gelehnt stand. Sie erinnerte ihn nachdrücklich daran, dass man hier im Grenzland jederzeit auf einen Überfall der Xhosas vorbereitet sein musste. Fünf blutige Kaffernkriege hatten die Siedler entlang der Ostgrenze schon erlebt. Ungezählt dagegen waren die Viehdiebstähle kleiner Kafferngruppen, die sich zumeist bei Nacht anschlichen und das Vieh davontrieben. Aber auch tagsüber hatte es schon genug dreiste Übergriffe gegeben. Ein Farmer hatte sein Gewehr deshalb immer griffbereit in seiner Nähe, ob er nun seine Felder pflügte, einen Kraal ausbesserte oder auf seiner stoep saß. Und ein Viehhirte ohne Waffe war im Land am Great Fish River so selten wie ein Kaffer mit blondem Haar.
Dunkelblonde Haare lugten dagegen unter Katharinas Strohhut hervor, der löchrig und an den Rändern schon sehr ausgefranst war. Nicht weniger zerschlissen sah auch ihr schlichtes Kleid aus grauem, grobem Leinen aus. Die Mariks von Welverdient waren alles andere als auf Rosen gebettet. Ihre Farm war um einiges kleiner als die der Mackenzies, und dabei zählte Highlands wahrlich nicht zu den großen Farmen. Der Getreiderost, der in den Jahren von 1820 bis 1825 südlich von Grahamstown fast alle Ernten vernichtet hatte, sowie die Heuschreckenplage und die lange Dürreperiode vor drei Jahren hatten den Mariks schweren Schaden zugefügt.
»Hendrik!«, rief Katharina erfreut. »Kommst du wieder nach Highlands zurück?«
»Nein, ich mache nur einen Besuch.« Der schon lange überfällig war, aber sein Vater und seine Brüder hatten ihm keine Gelegenheit dazu gegeben, nicht einmal an den Sonntagen. »Heute Abend muss ich wieder nach Grahamstown zurück.«
Katharina machte ein betrübtes Gesicht. »Ich glaube, Martin vermisst dich.«
Hendrik seufzte. »Und ich ihn.«
»Warum gehst du dann in die Stadt zurück?«
»Weil es mein Vater so will.«
Katharina schüttelte verständnislos den Kopf, dass ihr Zopf über ihren schmalen Schultern hin und her flog. »Die Städter tun mir richtig leid, so dicht aufeinander, wie sie zu leben gezwungen sind.«
»Ich glaube nicht, dass sie dir leidtun müssen, Katharina. Den meisten gefällt es so.«
»Bestimmt nicht. Ameisen wären doch auch lieber Antilopen oder Adler, wenn sie die Wahl hätten, oder etwa nicht?«, hielt sie ihm mit der einzigartigen Logik eines Kindes entgegen.
Er schmunzelte. »Sehr wahrscheinlich.«
Sie nickte nachdrücklich, als hätte er reichlich lange dafür gebraucht, etwas zu verstehen, was doch ganz offensichtlich war. »Ohm Willem hat mich erst letzten Sommer, kurz nach Mutters Tod, mit nach Grahamstown genommen. Er hat es gut gemeint, aber ich habe es noch weniger gemocht als früher, als Mutter noch lebte und ich sie manchmal begleitet habe. Sie ist jedes halbe Jahr nach Grahamstown gefahren. Ich habe nie verstanden, was sie so oft in der Stadt wollte.«
»Die Menschen sind nun mal verschieden. Die einen lieben eben das Leben in der Stadt und fühlen sich auf einer Farm todunglücklich. Frag mal meine Halbbrüder.«
Unerschütterlich in ihrer Überzeugung, winkte sie ab. »Ach was, die sind doch bloß neidisch auf uns Landleute und wollen es nicht zugeben!«
Hendrik lachte. »Vielleicht ist da was dran.«
»Und ob, Hendrik!«
»Sag mal, wo ist Josh?«, wollte er dann wissen. Josh war der Hottentotte, der gewöhnlich die Ziegenherde der Mariks hütete.
»Er ist weg, zusammen mit Carl und Edo.«
Hendrik war betroffen. »Ihr habt drei von euren fünf Hottentotten verloren?«
»Ja, sie sind einfach auf und davon, als sie erfahren haben, dass sie wegen dieser Organz des Gouverneurs all diese neuen Rechte haben und kommen und gehen können, wie es ihnen beliebt.«
»Du meinst die Ordinance.«
»Ja, die mit der Nummer 50«, sagte Katharina grimmig. »Ohm Willem meint, dass das eine Ohrfeige der Engländer in das Gesicht von uns Buren ist. Und Vater sagt, dass es bald mehr vagabundierende als arbeitende Hottentotten geben wird.«
Hendrik wollte sich an den Spekulationen nicht beteiligen. »Es sind schwere Zeiten für uns alle, das ist sicher. Aber dass ausgerechnet du die Ziegen hier draußen ganz allein hüten musst, gefällt mir gar nicht.«
»Mir macht es nichts. Ich kann die Ziegen so gut hüten wie jeder andere, und mit dem Vorderlader weiß ich auch umzugehen!«, erklärte sie stolz. »Hast du dich geprügelt?« Sie deutete auf seine verletzte Unterlippe.
Er zuckte scheinbar gleichgültig mit den Schultern. »Eine kleine Meinungsverschiedenheit mit meinen Brüdern. Und jetzt muss ich weiter, sonst komme ich heute nicht mehr nach Highlands.«
Sie trugen einander auf, Grüße auszurichten, und Hendrik wollte Whisper schon zurück zu den Spurrillen lenken, als ihm die Süßigkeiten einfielen. »Oh, da hätte ich doch beinahe etwas ganz Wichtiges vergessen. Ich habe da doch noch was für dich.«
»Ja?«, fragte sie und sah ihn mit großen, erwartungsvollen Augen an, während er die Satteltasche öffnete und sich darin zu schaffen machte.
Katharinas Gesicht leuchtete förmlich auf, und sie sprang vom Stein, als seine Hand mit drei Zuckerstangen aus der Tasche zum Vorschein kam.
»Für mich?«, rief sie, als könnte sie an so viel Glück nicht glauben.
»Ja, alle drei.«
»Oh Hendrik, danke!« Sie strahlte ihn an und hielt die drei Zuckerstangen mit beiden Händen vor ihrer Brust wie ein Ministrant eine geweihte Kerze.
Hendrik erreichte Highlands eine gute halbe Stunde später. Das geräumige Farmhaus, die Nebengebäude, die Rundhütten der Hottentotten sowie die beiden Viehkraals, nach der simplen Hartebeest Methode errichtet und im September erst wieder neu gekalkt, fielen schon von Weitem ins Auge. Wie Kreidewürfel hoben sich die Gebäude von dem Immergrün der Eukalyptusbäume, dem Silber der Dornenbüsche und dem dunklen Rot der Erde ab.
Sein Herz machte vor Freude einen Sprung und wurde zugleich weit vor Sehnsucht, als er auf den Hof ritt. Hier hatte er die schönste Zeit seines Lebens verbracht. Jeder Baum und Strauch und jede Gerätschaft, auf die sein Blick fiel, waren mit Erinnerungen verbunden.
Der achtjährige Robin, gefolgt von seiner sechsjährigen Schwester Lena, lief ihm entgegen. »Mom! … Mom! … Hendrik ist da!«, rief er lauthals, was Lena, die in allem wie ihr angehimmelter Bruder sein wollte, sofort mit ihrer glockenklaren Stimme wiederholte. Lena war Robins wandelndes Echo.
»Da ist ja der Schrecken aller Erdwölfe und Iltisse!«, rief Hendrik lachend und sprang aus dem Sattel, denn ganz wie bei seinem Vater war die Jagd Robins größte Leidenschaft.
»Letzte Woche habe ich meine erste Hyäne geschossen!«, verkündete Robin stolz.
»Robin hat seine erste Hyäne geschossen«, wiederholte Lena so triumphierend, als hätte sie selbst solch eine großartige Tat vollbracht.
»Sie hatte das Gebiss eines Löwen, hat Dad gesagt!«
»Mit dem Gebiss eines Löwen!«, betonte Lena noch einmal.
»Was ihr nicht sagt!«
»Ich habe sie auf achtzig Schritt Entfernung mit dem ersten Schuss erlegt!«
»Auf achtzig Schritt Entfernung mit dem ersten Schuss!«
»Als hätte ich es gewusst, dass du eine besondere Belohnung verdient hast, Robin«, sagte Hendrik lobend und zwinkerte Lena zu. »Und du natürlich auch.«
Hendrik verteilte die Zuckerstangen bis auf eine, als Rachel Mackenzie in einem weiten, geblümten Kleid aus dem Stall kam, den zweijährigen Tim auf dem Arm und den Leib von ihrem vierten Kind geschwollen, das seit sieben Monaten in ihr heranwuchs.
»Wie schön, dass du uns besuchen kommst, Hendrik!« Ihre Augen strahlten vor Freude.
»Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich schon vor vielen Wochen gekommen. Aber sie haben es nicht erlaubt.« Er machte eine halb grimmige, halb lachende Miene. Obwohl sie wusste, wie schwer es ihm gefallen war, Highlands zu verlassen und sich dem Wort seines Vaters zu beugen, fühlte er sich doch schuldig, als hätte er sie verraten.
»Du Ärmster.« Rachel drückte ihn mit ihrer freien Hand an sich. »Wir vermissen dich hier sehr, Junge.« Sie richtete ihren Blick auf seine geschwollene Unterlippe, sagte jedoch nichts.
»Und ich euch erst«, seufzte Hendrik und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. Tim lachte ihn mit blauen Augen und dicken Bäckchen an.
Rachel roch nach Milch. Sie kam aus einer alten Burenfamilie und war eine robuste Frau von siebenundzwanzig Jahren, mit breiten Hüften, vollen Brüsten und kräftigen Armen und Händen, die zuzupacken wussten, aber auch mit viel Empfindsamkeit Tränen trocknen und Zärtlichkeit schenken konnten. Ihr Gesicht war rund und rosig wie ein saftiger Pfirsich, und in ihren braunen, lebhaften Augen hatte Hendrik noch nie einen bösartigen Blick gesehen. Sie war ebenso tüchtig wie warmherzig.
Als Hendrik mit zehn nach Highlands gekommen war, hatte Rachel mit Robin gerade ihr erstes Kind zur Welt gebracht, keine elf Monate nach ihrer Heirat mit Douglas Mackenzie. Und obwohl Rachel da noch keine zwanzig Jahre alt gewesen und zum ersten Mal Mutter geworden war, hatte sie ihn wie ihr eigenes Kind behandelt und war ihm vom ersten Tag an die Mutter gewesen, die er bis dahin so sehr vermisst hatte. Daran hatte sich auch später nichts geändert. Dafür würde er ihr ewig dankbar sein.
»Hier, das ist für dich«, sagte Hendrik und drückte dem kleinen Tim die letzte Zuckerstange in die fleischige Faust. Dann holte er aus der Satteltasche, was er für Rachel mitgebracht hatte: eine Haarbürste, die reich mit Schildpatt verziert war, sowie ein Dutzend hübsche Perlmuttknöpfe.
»Mein Gott, Hendrik! Das kann ich nicht annehmen. Nimm das wieder mit!«, rief sie, doch sie wäre nicht die Frau gewesen, die er kannte und liebte, wenn ihre Augen beim Anblick dieser kleinen Kostbarkeiten nicht aufgeleuchtet hätten.
Er lachte. »Kommt gar nicht in Frage, und ich will kein Wort darüber hören!«
Rachel seufzte lächelnd, nur zu bereitwillig dazu überredet, die Geschenke anzunehmen. »Mit dieser Bürste werde ich Mühe haben, abends beim Ausbürsten bei hundert Strichen aufzuhören. Und wie wunderschön die Knöpfe schillern! Ich werde sie an mein Sonntagskleid nähen, und alle werden mich beneiden.«
»Wie du es verdient hast«, sagte Hendrik, der sich mit ihr freute. Und nach einer Weile, als Ross, ein Hottentottenjunge, Whisper schon zur Tränke geführt hatte, fragte er: »Wo steckt denn Douglas? Er ist doch heute hoffentlich nicht weggeritten.«
»Nein, keine Sorge, Hendrik«, beruhigte Rachel ihn und sagte ihm, wo er ihn finden konnte. »Was wird er sich freuen, dich zu sehen.«
»Soll ich Whisper holen?«, bot Robin sich an.
»Nein, ich möchte lieber gehen.«
Hätte er sich zu Pferd zu Douglas begeben, Robin hätte ihn mit Sicherheit begleitet. Doch bei der Wärme den Weg zu Fuß zu machen hatte für Robin wenig Verlockendes, und so blieb er bei seiner Mutter und seinen Zuckerstangen. Hendrik war es recht so. Er ging den Weg über die Farm, die so lange sein Zuhause gewesen war, gern allein.
Wie herrlich es war, die warme Erde und das Gras unter seinen Füßen zu spüren.