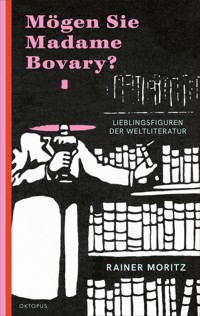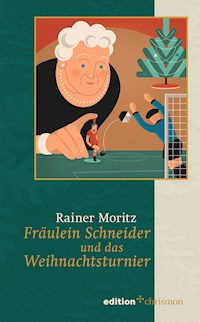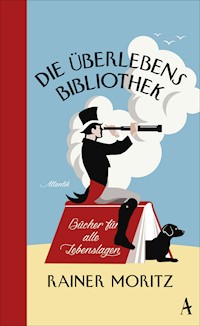Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: OKTOPUS by Kampa
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bernard Vautrot hat genug. Von den Krisen der Welt, von Klimawandel und Krieg. Seine Frau ist vor einiger Zeit gestorben, mit seinem Sohn besteht loser Kontakt. Jahrelang hat Bernard einen Weinladen am Montmartre geführt, doch auch die Lust an seinem Beruf ist ihm vergangen. Mit Anfang sechzig will er nicht mehr mitmachen, ohne Groll. Sich klar werden über sein Leben, das möchte er. Bernard verlässt sein altes Viertel und zieht in den Osten von Paris. Nun lebt er direkt am berühmten Friedhof Père-Lachaise. Tag für Tag – manchmal auch in der Nacht – streift er durch den Gräberpark, weist Touristen den Weg zu Oscar Wilde oder Édith Piaf und denkt darüber nach, was es heißt, seine letzte Ruhe zu finden. Bis er Aurélie trifft, eine junge Fotografin, die mit ihrer Kamera den Père-Lachaise erobert und Bernard an seinem Rückzug zweifeln lässt. Vielleicht ist das letzte Wort ja noch nicht gesprochen … Eine Geschichte über einen Ort, wo das Leben endet, und die nichtsdestominder vom Leben in seinen buntesten Farben erzählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rainer Moritz
Vielleicht die letzte Liebe
Roman
Oktopus
Et si mon cœur ne peut être
pour toi le premier
j’attendrai afin d’être
dans ta vie le dernier.
Johnny Hallyday: Tes tendres années
1
Füchse, ja, Füchse, keine Frage. Zuerst die Unsicherheit, als er im hohen Gras zwischen umgestürzten Grabsteinen ein Rascheln hört, im Halbdunkel der frühen Abendstunden. Katzen, das müssen Katzen sein, die heimlichen Herrscher über den Friedhof. Überall streifen sie herum, die Besucher keines Blickes würdigend. Im Sommer machen sie sich auf den Grabplatten breit, lecken ihre Pfoten und lassen sich den Bauch von der Sonne bescheinen. Nein, Katzen sind das nicht. Er erkennt ein funkelndes, auf ihn gerichtetes Augenpaar, dann ein zweites, rotbraunes Fell blitzt auf, und binnen weniger Sekunden endet der Spuk, verschwinden die Füchse, ja, wirklich Füchse, irgendwo auf der Avenue des Peupliers.
Bernard weiß, dass die Füchse nach und nach die Großstädte erobern, bislang nur die Außenbezirke, doch es wundert ihn nicht, dass auch ein so großer Friedhof mitten in Paris einen guten Lebensraum für sie abgibt. Am Tag sind sie unsichtbar, überlassen das Feld den Katzen, denen sie ohnehin aus dem Weg gehen. Da lohnt es sich also, die Nacht auf dem Friedhof zu verbringen. Zum dritten oder vierten Mal ignoriert er die offizielle Schließzeit. Als um Viertel vor sechs die Klingel ertönt, die die Besucher zum Verlassen des Friedhofs auffordert, versteckt er sich in einer der kleinen Kapellen, deren Türen aus den Angeln fallen, zwischen bröckelnden Steinwänden mit unleserlichen Inschriften. Jean-Luc und Alain, zwei der agents d’accueil et de surveillance, die ihn beinahe als ihresgleichen behandeln, hat er vorsichtig ausgefragt, nach abendlichen Kontrollgängen, nach Überwachungskameras. Sie haben lediglich mit den Achseln gezuckt. Wie soll das zu bewerkstelligen sein, an Personal mangelt es an allen Ecken und Enden, Friedhofswärter, das gilt nicht als attraktiver Beruf. Nein, auf den über vierzig Hektar sei es ein Leichtes, sich zu verstecken, doch wer, so Alain, wäre verrückt genug, sich auf einem Friedhof die Nacht um die Ohren zu schlagen?
Bernard hat genickt, einen Schlafsack versteckt, in einer der Divisionen, wo keine bekannten Künstler oder Politiker ruhen, und auf eine laue Sommernacht gewartet. Seiner Schwester hat er erzählt, dass er bei einem alten Freund auf dem Montmartre übernachte. Dort, wo ein Vierteljahrhundert lang sein Zuhause gewesen ist. Dass er die Nacht auf dem Friedhof verbringt, hätte seine Schwester überfordert, zumal sie sowieso voller Unverständnis für ihren verschrobenen Bruder ist. Früher warst du ein angesehener Geschäftsmann, und jetzt hast du nichts Besseres zu tun, als tagein, tagaus über den Friedhof zu wandern, als würdest du dich für einen würdigen Grabplatz interessieren. Unter die Erde, Bernard, kommst du früh genug, ruft sie aus, schlägt sich mit der Hand gegen die Stirn und schaut ihren Bruder halb mitleidig, halb verächtlich an. Catherine, gut zehn Jahre jünger als er, führt ein anderes Leben.
Er entgegnet nichts, murmelt vor sich hin, dass es ihm gut damit gehe und dass es nichts schade, sich auf die ewige Ruhe vorzubereiten. Seine Toten erzählen ihm viele Geschichten. Catherine hört ihm längst nicht mehr zu. Seit fast drei Jahren hält er es so, vor über zwei Jahren hat er beschlossen, sein Leben auf den Kopf zu stellen. Er wollte nicht mehr dazugehören, damals.
2
Mit einer theatralischen Geste, die er für feierlich hielt, überreichte er den jungen Leuten die Schlüssel, Ende März 2014, ja, er erinnerte sich gut, obwohl ihm das alles wie das Kapitel eines Buches erschien, dessen Inhalt mit ihm nichts mehr zu tun hatte. Das junge Pärchen aus der Provence kaufte ihm den Laden, seine Cave de la Butte, kurzerhand ab. Keine Ahnung, woher sie das Geld dafür hatten. Sympathische Menschen, zu deren Familie, wie sie stolz erzählten, Weinbauern vom Mont Ventoux gehörten. Menschen, die das Interieur seines Geschäfts mit einem nachsichtigen Blick bedachten, als käme er aus einem verblichenen Zeitalter und verstünde nicht das Geringste davon, wie man heutzutage Weine zu präsentieren habe.
Dass er unterhalb seines Tresens ein ausgewähltes Sortiment an ausländischen Bieren führte, registrierten sie ungläubig. Während sie die Flächen ausmaßen, redeten sie davon, wo sie künftig eine Käsetheke und eine Schiene für Hartwürste aus der Auvergne unterbringen würden. Wein, sagten sie lachend, würde es weiterhin geben, keine Sorge, wenngleich man dem Laden wohl einen anderen Namen verpassen müsste. Cave de la Butte, das klinge irgendwie … ja, verstaubt, wenn er verstehe.
Er lächelte ihnen zu, wünschte Glück. An Weinläden mangelte es nicht in der Gegend, doch es war ihm all die Jahre gelungen, seine – mit ihm älter gewordene – Stammkundschaft zu pflegen und ein Auskommen zu finden. Ein Metzger, ein Traiteur, Cafés, ein Franprix, zwei Bäcker, ein Antiquariat, dessen Inhaber sich nicht entscheiden konnte, ob er sein Geld mit Büchern, Zeitungen oder Schreibwaren verdienen wollte … und natürlich drei Immobilienbüros, die hier in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen waren. Mit den kleinsten Appartements ließen sich am Montmartre satte Gewinne einfahren. Bernard hatte es sich abgewöhnt, die Anzeigen in den Schaufenstern zu studieren und sich darüber zu wundern, welche Summen für eine winzige Wohnung in der Rue Custine oder Rue Caulaincourt verlangt wurden.
Er wusste, dass es ihm schwerfallen würde, jemals das Viertel, seine immer noch günstige Altbauwohnung in der Rue des Saules, gerade mal fünf Minuten von seinem Geschäft entfernt, zu verlassen. Warum er denn verkaufe, hatte ihn die junge Frau aus der Provence lachend gefragt, er sei doch in den besten Jahren. Er begann zu stammeln. Etwas Neues wolle er ausprobieren, solange es noch gehe … man könne nicht bis in alle Ewigkeit Corbières oder Crozes-Hermitage unter die Leute bringen … Doch während er unsicher zu Ausführungen ansetzte und hoffte, von Nachfragen verschont zu bleiben, war ihm bewusst, dass er nicht die Wahrheit sagte. Nein, er wollte nichts Neues ausprobieren, sich etwas beweisen oder sich neu erfinden, wie es neuerdings hieß. Aber wie hätte er das den beiden, die Zuversicht und Zukunft ausstrahlten, erklären sollen? Wie ihnen verständlich machen, dass er genug hatte, sich danach sehnte, sich vom gesellschaftlichen Leben zu verabschieden? Sofern das möglich war …
Mit dem morgigen Tag wäre er nicht mehr der geschätzte, für seine Seriosität bekannte Weinhändler Bernard Vautrot. Ob er diesem geregelten Alltag bald nachtrauern würde? Finanziell brauchte er sich keine Sorgen zu machen. Das Pärchen hatte für das Geschäft einen anständigen Preis bezahlt, der sogar über den Erwartungen des Maklers lag. Zudem gab es da diese Erbschaft, mit der Tante Paulette ihn und seine Schwester vor ein paar Jahren überrascht hatte. Sie hatten Kontakt gehalten mit Paulette, der Pensionsbetreiberin aus Angers, sie gelegentlich besucht, wenn ein Wochenendausflug in die Bretagne anstand. Immerhin hatte sie der Versuchung widerstanden, ihr nicht unansehnliches Vermögen dem Tierheim zu vermachen, wie viele alleinstehende Damen es taten.
Catherine investierte ihren Erbteil in aufwendige Urlaube in Weltgegenden, die Bernard nur mit Mühe auf dem Globus hätte lokalisieren können. Er tat nichts dergleichen. Seit dem Tod seiner Frau verreiste er ungern. Allenfalls im August, wenn halb Paris aus der Stadt flüchtete, verbrachte er zwei Wochen in Départements, die weniger angesagt waren, machte sich zu abgelegenen Seen auf, besichtigte Kirchen und verkostete Weine, die er nicht kannte, aus Berufsgründen gewissermaßen.
Bernard öffnete die Schließanlage seiner Wohnung – ein überteuertes, mit mehreren Riegeln ausgestattetes System wie in einem Hochsicherheitstrakt, das er Mireille zuliebe angeschafft hatte. Vier Zimmer für zwei – ihr Sohn Maxime hatte bis kurz vor Mireilles Tod bei ihnen gelebt, ehe er sich als Reiseleiter selbstständig gemacht und sich quasi aus der Familie verabschiedet hatte –, das hatte gepasst, doch nach Mireilles Tod fand er sich in den vertrauten Räumen nicht mehr zurecht, fühlte sich verloren.
Er nahm, erstmals als Weinhändler im Ruhestand, auf dem Sofa Platz und schaffte es nicht, sich um ein Abendessen zu kümmern. Meistens nahm er, wenn er über Mittag die metallenen Rollläden seines Ladens heruntergelassen hatte, einen plat du jour in einem der zahllosen Cafés zu sich, in einer der Seitenstraßen, für die sich die Touristen nicht interessierten. Dann genügte ihm abends ein Käsesandwich zu seinem Bier. An bayerischen und englischen Bieren würde es ihm künftig nicht fehlen, die jungen Leute wollten ihm seine Restbestände überlassen.
Die Rollläden seines Ladens … das stimmte nicht mehr … Wie würde er seine Mittagspause künftig verbringen, nachdem das Wort seinen Sinn verloren hatte, wenn er gegen drei am Nachmittag sein Geschäft nicht mehr aufschließen und Empfehlungen geben würde? Welcher Wein zu einem blanquette de veau, zu einem Pastagericht am besten passte …
Bernard streifte sein Samtjackett ab, eines von den vielen, die er besaß. Nie wäre er nur im Hemd oder Pullover vor seine Kundschaft getreten, das fügte sich nicht in sein Bild eines Kaufmanns, dem die Leute vertrauten. Er griff nach dem dunkelgrünen Kissen, auf dem Mireille, wenn sie von der Arbeit im Rathaus heimgekommen war, die Beine ausgestreckt ein Schläfchen gehalten hatte. Mireille … ein Foto von ihr stand auf dem Regal, ohne schwarze Trauerschleife.
Vor fünf Jahren … es war so schnell gegangen, die Krebsdiagnose aus heiterem Himmel, sie hatte über heftige Magenschmerzen geklagt, sie, die nie Krankgewesene, und war, was sie sonst vermied, in den Laden gekommen, zögernden Schrittes, um ihm in ihrer ruhigen Art mitzuteilen, dass sie nicht mehr als ein halbes Jahr zu leben hatte. Acht Monate später war sie tot, eine Frau von einundfünfzig Jahren, unerträglich ihre Qualen in den letzten Wochen, das Ende in einem Hospiz. Bernard hatte Abend für Abend ihre Hand gehalten, unfähig, sie zu trösten. Fast schien es, als wäre sein Weiterleben ohne sie ihre größte Sorge.
Bernard trat auf den schmalen Balkon. Einmal, in einer Sommernacht, hatten sie sich da geliebt, ohne sich um die Nachbarn zu kümmern. Wie lange das her war. Mireille und er hatten einander vertraut. Aus ihrer Liebe war unaufgeregte Zuneigung geworden. Sie stritten selten, und in ehrlichen Momenten gestand sich Bernard ein, dass er kein guter Liebender mehr war, dass er die Rolle des Ehemanns wie ein routinierter Schauspieler gab. Früher hatte sich Mireille darüber erregt, ihm Vorwürfe gemacht. Irgendwann gab sie das auf, vergrub sich in ihrem Job, übernahm ehrenamtliche Tätigkeiten und traf sich mit Freundinnen, mit denen sie mehr Zeit verbrachte als mit ihm.
Eine Ehe wie viele, keine schlechte, keine verzweifelte. Mireille blieb in seinen Gedanken gegenwärtig, Tränen hatte er nur in den ersten Wochen vergossen. Vielleicht hatte es damals, vor fünf Jahren, begonnen, dass er sich dazu zwingen musste, ein soziales Wesen zu bleiben. Er gab sich den Anschein eines verhalten trauernden Witwers, um sich die besorgten Nachbarn vom Leib zu halten, sich vor Nachfragen zu schützen. Er unterhielt sich mit ihnen auf der Treppe, ließ sich von der Concierge alle Ungeheuerlichkeiten erzählen, die sich die Menschheit und vor allem die anderen Mieter erlaubten, und war froh, Zuflucht in seiner Cave zu finden. Nun hatte sich auch das verändert.
3
Hello, hello, could you help us? Zwei Männer, um die dreißig, stürzen auf ihn zu und wedeln mit einem eingerissenen Friedhofsplan. Kurz nach neun, noch ist es ruhig. Der Ansturm setzt später ein, der Ansturm derjenigen, die von weither anreisen, um den Père-Lachaise abzugehen und ein Prominentengrab nach dem anderen abzuhaken. Zuhause würden sie nie freiwillig einen Friedhof betreten, doch ein Paris-Trip ohne Eiffelturm, Sacré-Cœur und Père-Lachaise ist undenkbar für sie.
Amerikaner, keine Frage, kurze Hosen, Sweatshirts mit University-Aufschrift, Sandalen, eine Nummer zu groß. Bernard lächelt ihnen aufmunternd zu, inzwischen kann er die Nationalitäten der Besucher leicht auseinanderhalten. Vielleicht sollte er bei einem Fernsehquiz als Experte auftreten.
What’s your problem? Bernard kommt mit dem Englischen klar. Schon in der Cave de la Butte ließ es sich nicht vermeiden, die Sprache zu wechseln, wenn Engländer, Amerikaner oder Australier nach dem teuersten Champagner verlangten. Oder nach einem Rotwein, für sie musste es immer ein Bordeaux, am besten ein Mouton Rothschild sein. Sein Englisch holpert trotzdem vor sich hin, er gibt sich keine Mühe, seiner Aussprache den Akzent auszutreiben. Wozu auch? Er ist Franzose.
Oscar Wilde, ruft der Jüngere der beiden aus, Oscar Wilde, you know him?, und lässt seinen Zeigefinger auf dem Friedhofsplan kreisen. Ohne Orientierung, als hätte er einen Strickmusterbogen vor sich. Bernard tätschelt seinen Unterarm und zeigt Richtung Norden. Ganz falsch seien sie hier, nicht in der neunten Division liege Wilde, sondern in der neunundachtzigsten. Er nimmt einen Bleistift aus der Jackentasche und zeichnet mit dünnen Strichen auf, welchen Weg es einzuschlagen gilt. Was schwerfällt, so zerfetzt, löcherig und mit obskuren Flecken durchsetzt der Plan ist, den die Amerikaner wohl schon seit Jahren benutzen und den sie gleich wieder hektisch zusammenfalten. Sie bedanken sich überschwänglich und biegen mit einem We’ve got to visit so many graves in die Avenue latérale du Sud ein. Immer geradeaus, ruft Bernard ihnen hinterher, immer geradeaus.
Was es nur auf sich hat mit diesem Grab, denkt er. Eine der Attraktionen des Friedhofs, vor den Lippenstiftabdrücken der Verehrer Wildes inzwischen mit Glasscheiben geschützt, was würdelos aussieht. Eine Art Sphinx mit Flügeln, deren mächtige Genitalien vor Jahren auf rätselhafte Weise verschwanden. In einem Geheimfach, das allein der Direktor öffnen dürfe, seien sie aufbewahrt, sagen die einen; andere behaupten, dass ein schwules belgisches Paar sie abgeschlagen habe und als Briefbeschwerer verwende. Bernard kennt die Geschichte vieler Gräber, aber es kommen jeden Tag neue hinzu, und seine anfängliche Furcht, irgendwann alle zu kennen, ist verflogen. Auf diesem Friedhof steht nichts still, alles wächst und verändert sich jeden Tag. Der Stoff wird ihm nie ausgehen.
Bernard freut sich an der morgendlichen Ruhe. Kurz nach acht betritt er den Friedhof, mal über diesen, mal über jenen Eingang. Das pompöse Hauptportal am Boulevard de Ménilmontant meidet er. Entweder nimmt er die Porte des Amandiers an der Metrostation Père-Lachaise, oder er wählt die Porte du Repos, nur wenige Schritte von dem Haus entfernt, wo er seit gut drei Jahren lebt.
Er kommt als Untermieter seiner Schwester zurecht. Das große Zimmer, die wenigen Dinge, die er aus seinem früheren Leben mitgenommen hat, genügen ihm. Catherine reist umher, bleibt tagelang bei ihrem aktuellen Freund, der ein sündhaft teures Loft am Parc Monceau bewohnt. Ich lasse nichts aus, mein eigenwilliger Bruder, wozu lebt man, und gut, dass du dich um die Katze kümmerst. Dass ihre Wohnung in der Rue du Repos liegt, mit Blick auf die Friedhofsmauern, hat ihm von Anfang an gut gefallen. Dann hab ich es nicht weit, Catherine.
Außer ihr kennt er bis heute kaum jemanden hier, die Gemüsehändlerin, den Patron in dem portugiesischen Restaurant am Boulevard de Charonne, mit dem er, wenn er Hühnchen oder Thunfisch bestellt, ein paar Worte wechselt, nie Persönliches. Manchmal sehnt er sich zurück in sein Stammlokal am Montmartre, das Sagittaire in der Rue Lamarck, wo er fast jeden Freitag aß, mit Mireille und später ohne Mireille. Touristen kehren da selten ein, sie verlassen die Metrostation und biegen nach rechts ab. Links, wo das Sagittaire liegt, gibt es nichts zu entdecken und zu fotografieren.
Benoît, der immer in Schwarz gekleidete Wirt, begrüßte ihn mit Handschlag, irgendwann waren sie sogar zu Geschäftspartnern geworden, und Bernard belieferte ihn mit soliden Weinen, einem Sauvignon aus dem Loiretal oder einem Côtes du Rhône Villages, der teurer schmeckte, als sein Einkaufspreis vermuten ließ. Einmal im Monat trafen sie sich bei ihm zum Abendessen in größerer Runde, darunter ein Freund, der wie er ohne Abschluss Önologie in Colmar studiert hatte und seitdem einen Cateringservice betrieb. Das lag lange zurück, wie alles.
Sobald die Friedhofstore aufgeschoben werden, steht Bernard oft schon bereit. Argwöhnisch hat man ihn anfangs gemustert, diesen lässig gekleideten Mann, über dessen Schulter ein leichter Rucksack hängt, ein Mann, der tagein, tagaus seiner Wege geht. Wenn er nicht gleich über Nacht bleibt, was die Wärter inzwischen wissen und, obwohl die Friedhofsordnung das nicht erlaubt, nicht kommentieren. Sie müssten ihn zur Rechenschaft ziehen, auf das Verbotene seines Tuns hinweisen. Jean-Luc und Alain haben ihn als Erste angesprochen, um sich davon zu überzeugen, dass sie es nicht mit einem Querulanten, einem Herumtreiber zu tun hatten. Mittlerweile kennen ihn alle, selbst der junge Direktor, der sich als Monsieur le Conservateur ansprechen lässt, nickt ihm freundlich zu. Als sei er sein Angestellter.
Bernard dreht wie immer seine erste Runde, eine große, gut zwei Stunden dauernde Runde entlang der Friedhofsmauern und malt sich die Biographien der Toten aus. Wie viele Selbstmörder hier wohl liegen … Er denkt an den Wärter, der sich – wie Alain in variierenden Ausschmückungen erzählt – auf dem Père-Lachaise umgebracht haben soll. Mit einer Pistole, einer Browning, vor über einem halben Jahrhundert. Georges Thomas, ein Mann von fünfzig Jahren, habe, ohne ein Wort zu verlieren, seinen Posten beiläufig verlassen und sich in einer der Kapellen, deren bemalte Glasfenster dabei zersplitterten, das Leben genommen. Ein Schuss in die Schläfe. Er sei zu Boden gestürzt und mit blutendem Kopf gegen einen Steinsockel geprallt. Aufsehen hatte die Tat erregt, persönliche Probleme hätten ihn dazu getrieben, mutmaßte man seinerzeit. Persönliche Probleme … eine merkwürdige, nichtssagende Formel. Sich auf einem Friedhof zu töten, das kommt Bernard unpassend vor, anmaßend beinahe gegenüber denjenigen, deren Gebeine unter der Erde nach Ruhe suchen.
Bernard geht weiter, nach wenigen Minuten hören seine Gedanken zu kreisen auf. Er liebt die Stille auf seinen Gängen zwischen den mittags oft belebten Avenuen und den kleinen, fast uneinsehbaren Pfaden, der Lärm, der außerhalb der Mauern herrscht, existiert nicht mehr, als hätte er nie existiert. Er ist bei sich, biegt ohne Ziel in eine x-beliebige Division ein, seine Nachmittagsroute stets verändernd. Er hebt ein Schokoladenpapier auf, lässt sich von einer Katze anstarren und zückt sein Notizbuch, das fünfte, das er in den Jahren mit seiner feinen, winzigen Schrift gefüllt hat.
Langweilig ist ihm nie. Er führt Selbstgespräche, erzählt sich leise, was er sieht. Da sind die Vergessenen, deren Gräber niemand mehr besucht oder mit einem Strauß Blumen bedenkt. Verblichen die Inschriften, die Lebensdaten schwer lesbar. Und wenn die Konzession erlischt, werden die Gräber aufgelassen, schlägt der Tod endgültig zu.
Ja, er weiß, wo Colette, Molière, Chopin oder Proust liegen. Weiß über sie Bescheid. Schließlich steht er als Auskunftsperson zur Verfügung. Mit seinen Halbschuhen, seiner Kordhose und der ärmellosen, wattierten Weste wirkt er so, als würde er zum Père-Lachaise gehören. Bewusst angestrebt hat er das nie, er bevorzugt praktische Bekleidung.
Als junger Mann schon hat er in fremden Städten Friedhöfe besucht, während sich seine Freunde aufmachten, angesagte Geschäfte oder Kneipen abzuklappern, und sich wohl über ihn lustig machten. Von der Rue des Saules waren es nur wenige Schritte zum Saint-Vincent-Friedhof gewesen, ein übersichtliches, von Mietshäusern eingeschlossenes Areal, und auf dem Montmartre-Friedhof verbrachte er unzählige Sonntage, immer seltener mit Mireille an seiner Seite, die ihn mit einem »Sag Dalida einen schönen Gruß« entließ, ihre zunehmende Erleichterung nicht verbergend, den Nachmittag ohne ihn verbringen zu dürfen.
Der Tod macht ihm Angst, nicht ständig, schubweise kommt das Gefühl einer lähmenden Beklemmung über ihn. Mit vierzehn, fünfzehn Jahren, wenn er abends im Bett lag und Musik hörte, überfiel ihn manchmal ohne Vorankündigung der Gedanke, dass er irgendwann nicht mehr existieren würde. Was soll das heißen, fragte er sich damals, nicht mehr ich zu sein, ein ausgelöschtes Bewusstsein? Im Lauf der Jahre lernte er, auf diese Schübe von Todesangst vorbereitet zu sein, wusste, dass sein Lebensmut, sein Lebenswille wieder die Oberhand gewinnen würde.
Der Friedhof macht ihm keine Angst. Er fühlt sich lebendiger als in den Zeiten als Weinhändler, der Woche für Woche bedächtig seinen Umsatz auf die kommenden Monate hochrechnete. Wein, sagte Mireille, würden die Leute nie aufhören zu trinken. Er solle sich glücklich schätzen, keine Tabakwaren zu verkaufen. Einen kleinen Supermarkt mit Bio-Produkten zu betreiben – das Angebot bekam er einmal –, das liege ihm nicht, wo er sich so schwer damit tat, einen Pfirsich von einer Nektarine zu unterscheiden. Vielleicht war er nur bei seinem Wein gut aufgehoben.
Gegen Mittag nimmt Bernard auf einer Bank Platz. Mehr davon müsste es geben, das wird er dem Direktor bei nächster Gelegenheit sagen. Ein belegtes Brot, eine Tafel Schokolade, Wasser oder Kaffee, mehr braucht er nicht für den Tag. Man kommt mit wenig aus, denkt er. Wenn Regenwolken aufziehen, stülpt er sich einen dünnen Kunststoffponcho über, der sich auf Portemonnaiegröße zusammenfalten lässt. Mit einem Schirm über den Friedhof zu gehen, das kommt ihm unpraktisch, ja lächerlich vor.
Wer es im Leben zu Prominenz gebracht hat, wird nicht so schnell vergessen. Was es den Menschen gibt, andächtig vor der schwarzen, nicht leicht auffindbaren Marmorplatte mit der Aufschrift Marcel Proust zu stehen, das erschließt sich ihm nicht. Als würde der Tod die Erinnerung zementieren, als würde das Grab erst das Ende beglaubigen und auf wenigen Quadratmetern fixieren, was im Leben ein haltloses Flattern war. Ja, die täglich frequentierten Gräber, vor denen sich Schlangen fotografierwütiger Menschen bilden, kennt er fast alle. Er sieht es als seine Aufgabe an, nach dem Rechten zu sehen, Getränkeflaschen, die Édith-Piaf-Verehrer ins Gras geworfen haben, beiseitezuräumen oder geschmacklose Plastikherzchen heimlich in den Müll zu werfen. Tote verdienen Respekt.
Lieber sind ihm die Gräber, vor denen niemand innehält. Das sind die meisten. Er hat seine zweite Runde beendet, ist wieder an der Porte du Repos angelangt und geht ziellos weiter, an der Einfriedung zum Boulevard de Ménilmontant entlang, festen Schrittes. Schlendert er, flaniert er? Er weiß es nicht.
Wind kommt auf, ein Rabe trippelt über den Kies. MarcelKLEIN, 1908 geboren, 1978 gestorben, steht da auf einem schwarzen Täfelchen, in Schreibschrift ein Repose en Paix darunter, schräg verankert in einem halben Dutzend mit Moosflecken überzogener, grauer Steinplatten. Braunes Laub, Aststückchen und eine weiße, mumifiziert aussehende Kriechpflanze, der es gleichgültig ist, ob sie Wasser abbekommt oder nicht.
Wer war dieser Monsieur Klein? Knapp fünfzig Jahre erst ist er tot, niemand erinnert sich wohl an ihn, nicht einmal an Allerheiligen, wenn der Friedhof vor Andächtigen überquillt, bleibt einer an seinem Grab stehen und legt eines der überteuerten Blumenbouquets ab, die es in der Gegend überall zu kaufen gibt. Einen Meter von der schwarzen Plakette entfernt ein Naturstein in ähnlicher Größe mit verblasster Schrift.
Bernard beugt sich hinunter, glaubt ein Claire Klein entziffern zu können, geboren im selben Jahr wie Marcel, fünf Jahre vor ihm gestorben. Ein Ehepaar vermutlich, doch warum sind sie nicht auf einer Tafel vereint? Ist seine erneuert worden? Die glänzende goldene Inschrift deutet darauf hin. Und warum sieht ihr Namenszug so verblichen aus, als stammte er aus dem 19. Jahrhundert? Wäre er ein Schriftsteller, denkt Bernard, würde er sich ihr Leben zusammenreimen, ein kinderloses vermutlich, eines, das keine Spuren hinterlassen hat, die Verwandten verstreut in allen Regionen, die Nachbarn längst verstorben, wie die Kleins.
Concession à perpétuité