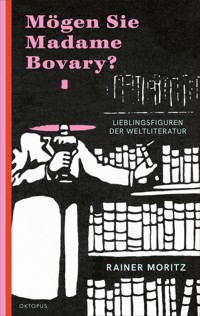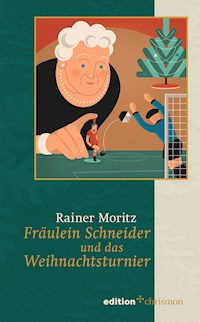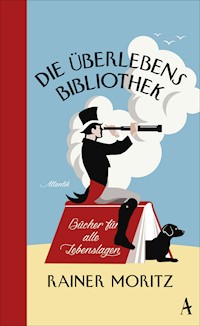Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: OKTOPUS by Kampa
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Schlösschen im Südwesten Frankreichs, mit Blick auf die Pyrenäen. Lange war es im Besitz angesehener Familien, doch als Jean Durand, der letzte Schlossherr, stirbt, verfällt das Anwesen zusehends. Jeans Witwe, Madame Germaine, ist gezwungen zu verkaufen, an ein Münchner Ehepaar, das das Schloss saniert und zu einer Tagungsstätte mit Chambres d'hôtes ausbaut. Germaine, die die neunzig längst überschritten hat, erhält lebenslanges Wohnrecht, umsorgt von den neuen Besitzern und dem Personal, das die alten Gemäuer im Sommer mit Leben erfüllt, an dem Germaine aber nicht teilnimmt. Seit Jahren schon verlässt sie ihr Zimmer nicht mehr. Morgens hört sie Radio Vatican, abends schaut sie sich Western mit John Wayne an. Die übrige Zeit verbringt sie damit, auf den Tod zu warten, ihren verschwommenen Erinnerungen nachzuspüren und sich die Frage zu stellen, welchen Sinn ihr Leben besaß - und noch besitzt. Bis zwei junge Frauen und ein im Schloss Station machender Schriftsteller sie aus der Reserve locken. Wird der Tod noch eine Weile warten müssen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rainer Moritz
Das Schloss der Erinnerungen
Roman
Oktopus
»Vivre, c’est perdre du terrain.«
E.M. Cioran
1
Ich sterbe, ich sterbe, es ist so weit … Germaine schlug mit ihren zarten, kindlichen Fäusten gegen die Eichentür. Sie hätte gern laut aufgeschrien, doch mehr als ein hektisches Flüstern brachte sie nicht heraus. Ihr rosafarbenes Nachthemd fiel an ihrem dünnen Leib herunter wie ein verwaschener, brüchiger Vorhang, den zuzuziehen sich niemand mehr traute. Sie spürte keine Kälte, obwohl in diesen Februarwochen nur wenige der Zimmer beheizt wurden und das Schloss im Winterschlaf dämmerte. Die Mühlbergers waren noch in ihrem Haus irgendwo in Süddeutschland, wo genau, wusste Germaine nicht, sie kannte sich in diesen Regionen nicht aus, und gleichgültig war es ihr auch. Vor Anfang März würden sie nicht zurückkehren. Nur die beiden jungen Männer waren da, die über die Wintermonate das Schloss einhüteten und sie versorgten. Wie hießen sie nur … Anthony oder Alexandre der eine, der andere vielleicht Julien …
Mitten in der Nacht war sie aufgewacht aus einem federleichten Schlaf. Ihr Brustkorb hatte sich zusammengezogen, ihr Herz ein wildes Klopfen, sie rang nach Luft. Ja, mein Gott, ich komme, ich bin bereit, flüsterte sie, schob sich aus ihrem Bett, das doppelt so alt war wie sie selbst, zweihundert Jahre bald, schlüpfte in ihre Samtpantoffeln und tastete sich, ohne Licht zu machen, auf den Gang hinaus. Sie wollte nicht alleine sterben, sie wollte den Männern Mitteilung davon machen, das Ganze beglaubigen, so wäre es fassbarer, als wenn sie nur für sich in ihrem Zimmer den letzten Atemzug tat.
Ich sterbe, hört mich denn keiner … Sie hielt sich am Türrahmen fest, als sie Schritte vernahm, und plötzlich stand einer der beiden, Anthony, ja, so hieß er, vor ihr und sah sie fragend an. Madame Germaine? Was ist mit Ihnen? Er behandelte sie mit einer Höflichkeit, die ihr jedes Mal schmeichelte. Als wäre sie noch immer die Schlossherrin, die keinen Widerspruch duldete und das Erbe ihrer Familie verteidigte, bis zum Ende, bis zum Ende, das nun gekommen schien. Kinder hatte sie keine, und dass ihr das Schloss längst nicht mehr gehörte, wusste sie natürlich, doch es gefiel ihr, wenn alle sie wie eine Regentin behandelten, eine Regentin ohne Reich.
Gott ruft mich zu sich, Anthony, stehen Sie mir bei. Sie schaute ihn an, suchte nach Unterstützung in seinem Blick. Er nahm ihre Hand, umschloss sie, geleitete sie zu dem ausgedienten Kamin und drückte sie sanft auf eine blassgrüne Récamiere. Keine Angst, Madame Germaine, so schnell geht das nicht, es ist mitten in der Nacht. Gott hat sicher Dringenderes zu tun, atmen Sie tief ein und aus, ich mache Ihnen einen Kaffee.
Germaine erwiderte nichts. Ihre Augen gewöhnten sich an das Halbdunkel. Sie wollte sterben, lang genug hatte sie gelebt. Nein, sie versagte es sich, ihrem Schöpfer Vorwürfe zu machen, das gehörte sich nicht. Doch warum ließ er sie warten, war dreiundneunzig denn kein Alter, um abberufen zu werden?
Sie begann zu frösteln. Ihr Nachthemd, das sie vor vielleicht vierzig Jahren in Paris gekauft hatte, nicht weit entfernt von der Église Saint-Sulpice, war der Jahreszeit nicht angemessen, zu kurz, zu dünn der Stoff. Madame, was machen Sie hier? Der andere – Julien oder Romain? – stand plötzlich neben ihr, schien zu lächeln. Warum schlafen Sie nicht? Sie nickte, wiederholte ihre Todesahnung nicht und schüttelte dann den Kopf, der sich wie ein sanft angestoßenes Pendel bewegte.
Vorsicht, sehr heiß! Anthony – oder Julien – reichte ihr ein Porzellantässchen. Sie erkannte das Service sofort. Madeleine hatte es von einem ihrer Verehrer zum Geburtstag bekommen, damals, als sie sich noch für Männer interessierte. Germaine war froh, dass solche Gedanken nur stumm in ihrem Kopf kreisten. Sie auszusprechen wäre Sünde. Diese Familie, ob die Larrouys, die Reclus’ oder die Durands, wusste seit jeher zu unterscheiden zwischen den Dingen, mit denen man sich schmückte, und denjenigen, die man so lange verbarg, bis man glaubte, es gäbe sie nicht. Das Unausgesprochene existierte nicht. Allenfalls kehrte es in Träumen wieder oder in Gedichten.
Anthony, ich trinke nie Kaffee, wollte sie sagen, als er ihr die Tasse, keinen Widerspruch duldend, zum Mund führte. Das wird Sie stärken, und das mit dem Sterben passt heute sowieso nicht. Morgen kommt Sandrine, Ihre neue Physiotherapeutin, da wollen Sie sicher keinen schlechten Eindruck machen. Germaine nippte an der Tasse, unwillig darüber, dass Anthony sie nicht ernst zu nehmen schien. Der Tod war doch keine Sache, die man auf die leichte Schulter nahm. Der Kaffee duftete überraschend gut, stark war er, und Germaine betrachtete fasziniert, wie die Flüssigkeit sich schwerfällig in ihrer Tasse bewegte … oder, nein, in der Tasse der Mühlbergers. Ihr gehörte nichts mehr, außer den Dingen, die sich in ihrem Zimmer anhäuften.
Sie nahm einen zweiten Schluck, spürte die Hitze, wie sie langsam durch ihren Körper strömte. Das fühlte sich gut an. Anthony lächelte noch immer, forderte sie auf, mehr zu trinken. Er habe eine ganze Kanne gekocht. Sie wollte widersprechen, fragen, warum das vonnöten sei. Doch sie schwieg, leerte die Tasse und zog sich die Filzdecke über die Schultern, die ihr Julien – sie hatte beschlossen, dass er so hieß – reichte. Das Getränk tat ihr wohl. Ein Gefühl, das nicht zum Sterben passte. So sicher war sie gewesen, dass diese Februarnacht die letzte ihres Lebens sein würde. Eines Lebens, dessen sie so überdrüssig war.
2
Vorsichtig legte sie den schwarzen Hebel um und drückte auf den grün leuchtenden Knopf. Ein Brummen ertönte, und Sekunden später floss ein schwarzer Strahl in eine Tasse, in die Tasse, aus der Jean jeden Nachmittag getrunken hatte. Gegen vier Uhr, wenn er sein Arbeitszimmer verließ und sich mit ihr unterhielt, nie länger als eine Viertelstunde.
Germaine konnte sich nicht sattsehen am Anblick des heißen Kaffees, der aus dieser Zaubermaschine strömte. Gleich nach ihrer ausgebliebenen Begegnung mit dem Tod hatte sie Anthony beauftragt, ihr in Orthez ein solches Gerät zu besorgen, einen leicht zu bedienenden Apparat, der in ihrem Zimmer keinen Platz wegnähme. Sie hatte Werbung dafür gesehen im Fernsehen, eine lachende ältere Dame, die die Tasten eines solchen Apparats bediente und ihr Glück nicht zu fassen schien. Wenige Handgriffe nur hatte es gebraucht, bis sie wusste, wohin sie diese merkwürdigen, glänzenden Kapseln zu stecken hatte. Seitdem füllte Anthony jeden Morgen den Wassertank auf, und nun gönnte sie sich täglich vier Tassen Kaffee, die sie zu festen Zeiten zubereitete. Selbst gekocht hatte sie in ihrem Leben nie, das gehörte sich nicht für eine Schlossherrin, und in Paris, als Jean und sie bei ihren Eltern wohnten, wohnen mussten, hatte sich Maman um alles gekümmert.
Dass man in ihrem Alter zur Kaffeetrinkerin werden konnte! Zeitlebens hatte sie Tee vorgezogen, nicht weil er ihr schmeckte, sondern weil es sich um ein elegantes Getränk handelte. Kaffee war in ihren Augen eine proletarische Angelegenheit, und als die Mühlbergers ins Haus kamen und ihr Kaffee vorzusetzen versuchten, hatte sie demonstrativ die Mundwinkel verzogen und nach ihrem Tee verlangt. Auf die parfümierten Teemischungen der Frères Dammann, die sie alle zwei Monate aus Paris kommen ließ, wollte sie während ihrer nachmittäglichen Plauderstunde im Salon nicht verzichten.
Und nun das.
Das letzte Mal hatte sie ihr Zimmer vor acht Jahren verlassen. Eines Morgens war ihr aufgegangen, dass es keine Notwendigkeit mehr gab, einen Fuß über ihre Zimmerschwelle zu setzen. Sie hatte Madame Mühlberger, die sie damals noch nicht mit ihrem Vornamen Luise anredete, ihren Entschluss mitgeteilt, keine Widerrede geduldet. Die Angestellten der Schlossküche oder Luise selbst brachten ihr seitdem die Mahlzeiten aufs Zimmer. Sie nahm wenig, ja fast nichts zu sich, doch sie legte Wert darauf, dass keine Nachlässigkeit aufkam, man ihr die kaum gesalzenen Gerichte mit Stil servierte und die silberne Servierglocke vor ihren Augen gelüftet wurde.
Sie brauche Bewegung, und sei es nur hinüber zum Gemüsegarten, ein Ausruhen auf den Gartenstühlen würde ihr guttun. Als wüsste Madame Mühlberger, was ihrem Befinden zuträglich wäre. Alle Beschwörungen hatte sie mit einer Handbewegung beiseitegewischt. Nein. Mehr war dazu nicht zu sagen.
Sie empfing keine offiziellen Besuche. Lediglich eine Hilfe sah jeden Morgen nach ihr, eine Portugiesin, die sie der Einfachheit halber Clara nannte. Neuerdings kam da noch eine andere Frau, Sandrine, die sie aufforderte, ihre Beine und Arme in alle Himmelsrichtungen zu strecken, und dazu alberne Lieder sang. Und einmal die Woche schaute ihr Verwalter, Monsieur Quiniou, vorbei, der ihr den neuesten Klatsch aus der Umgebung erzählte und sie von der Sicherheit ihrer Geldanlagen überzeugte. Viel zu verwalten gab es nicht mehr.
Ebenso regelmäßig machte ihr Leibarzt seine Aufwartung, Docteur Vercel aus Sauveterre, der sie seit Jahrzehnten betreute und nicht daran zu denken schien, seine Praxis aufzugeben. Zum Glück, dachte Germaine jedes Mal, wenn er umständlich Mantel und Hut ablegte und sich so tief verbeugte, dass sie Angst bekam, er könnte sich aus dieser Demutshaltung nicht mehr befreien … Einem anderen Arzt hätte sie ihren Körper, dieses magere, verfallene, runzlige Etwas nicht gezeigt.
Clara half ihr bei der Morgentoilette. Eine gute halbe Stunde brauchte es, bis sie angekleidet und ihr Haar gerichtet war. Mit geschickten Handgriffen toupierte sie die dünnen, weißen Strähnen. Ist die Kopfhaut wirklich nicht zu sehen, Clara? Sie durfte nicht durchscheinen. Wie schütter ihr Haar inzwischen geworden war. Freude hatte sie daran nie gehabt. Irgendwo unter den Stößen, die sich auf allen Tischen und Sesseln ansammelten, lag die Zeichnung dieser polnischen Malerin … Kazimiera … der Nachname fiel ihr nicht ein. Mitten im Krieg, in Rom, hatte sie ihr Modell gesessen, dieser Polin, die Papst Pius Dutzende Male porträtiert hatte.
Das Bild besaß nichts Natürliches, sie lächelte gequält, erinnerte sich gut daran, wie sie stundenlang posiert hatte, ihrem Vater zuliebe. Keine zwanzig war sie damals gewesen, ihr dunkles Haar aufgebauscht in kunstvoll drapierten Rollen, als hätte man vergessen, die Lockenwickler herauszunehmen. Die Polin hatte ihr einen ausladenden Hut mit langen Schleifen in die Hand gedrückt und sie aufgefordert, mit den Bändern zu spielen: ungezwungen, ganz ungezwungen. Sie mochte diese Zeichnung nicht. Manchmal wäre es ihr lieber gewesen, alle Gemälde, alle Fotografien von ihr wären verloren gegangen, verbrannt. Nie erkannte sie sich darauf wieder, und nie hatte sie Gefallen daran gefunden, sich malen zu lassen. Ganz anders als ihre Schwiegermutter Marie und als Tante Madeleine, die sich schon als junge Mädchen zu inszenieren wussten. Ja, Madeleine vor allem, um die sich alles drehen musste, die jeden Nachmittag die Garderobe wechselte und Hof hielt, ohne sich für einen ihrer Verehrer zu entscheiden. Sie hingegen …
Rom damals, ja … Sie vertrieb die Erinnerungen daran, obwohl ihr Leben fast nur aus Erinnerungen bestand, aus Bildern und Gesprächen, die in ihrem Kopf verschwammen, sich miteinander vermengten, wie die Jahrzehnte, wie die Landschaften, wie die Straßen in Paris, wo sie so lange gelebt hatte. Manchmal wollte sie nichts mehr wissen von dem, was vor einem halben Jahrhundert geschehen war. Auch die Gegenwart interessierte sie immer weniger. Warum Neues erleben? Es genügte, auf den Tod zu warten.
Sie biss in ihre Baguettescheibe wie jeden Morgen, weiches Brot, das den Zähnen keinen Widerstand bot, dünn bestrichen mit Erdbeerkonfitüre und neuerdings mit einer Marmelade aus Kiwis. Die würden in der Gegend angebaut, behauptete Luise. Was schwer zu glauben war. Kiwis hatte es früher nicht gegeben, und hier schon gar nicht.
Clara sah ihr beim Essen zu, schien damit beauftragt zu sein, ihre Nahrungsaufnahme zu beaufsichtigen. Germaine machte es ihr nicht leicht, kaute betont langsam, tat so, als sei es unmöglich, eine zweite Scheibe Brot zu sich zu nehmen, und seufzte auf, was Clara Angst machte. Sie wirkte jedes Mal erleichtert, wenn sie abräumen und sich verabschieden konnte. Ihr abgehacktes Französisch, vermischt mit béarnaiser und baskischen Brocken war Germaine zuwider. Sie gab sich längst keine Mühe mehr, dieses Kauderwelsch zu korrigieren. Was Clara sagte, war nicht wichtig. Hauptsache, sie erzählte irgendwelche Geschichten aus Sauveterre oder Salies, ließ Namen fallen, die mitunter eine vage Erinnerung an irgendetwas wachriefen.
Froh, wieder allein zu sein, ordnete sie ihre Papiere, wie sie es nannte, wissend, dass es sich um eine Beschäftigung handelte, die nie abgeschlossen wäre. Seit Jeans Tod hatte sie es aufgegeben, für Ordnung zu sorgen. Die Berge von Briefen, Fotografien, Notizen und Büchern waren ihr Leben. Als die Mühlbergers sich für das Schloss zu interessieren begannen, ging es ihr nicht um Geld allein. Alles, so hatte sie ihrem Verwalter eingeschärft, müsse an seinem Platz bleiben, nichts dürfe weggeworfen werden – solange sie lebte. Alle paar Wochen bat sie Quiniou darum, sich unauffällig in den Räumen umzusehen und ihr Missstände mitzuteilen. Zu ihrer Überraschung meldete er selten Anstößiges, die Mühlbergers gaben sich offenbar alle Mühe, ihren vorletzten Willen zu respektieren. Anständige Deutsche – erstaunlich.
Sie griff nach ihrem Stock, tapste zu ihrem Radiogerät, das von zwei Vasen eingerahmt war, von leeren Vasen. Blumen wollte sie nicht um sich haben, der Blütenstaub würde sich auf ihre Bronchien legen, sie langsam ersticken … Ihre Lieblingssender waren voreingestellt, Luise hatte sie mit einem roten und grünen Punkt markiert. Am Vormittag hörte sie Radio Vatikan, während sie gegen Nachmittag zu Radio Notre Dame wechselte. Sie schloss die Augen, faltete die Hände, wenn die Choräle erklangen und gebetet wurde, für den Papst in ihrem Rom, wenngleich ihr dessen Auffassungen zu modern erschienen … und der Herr wird ihn bewahren und beim Leben erhalten und es ihm lassen wohlgehen auf Erden und ihn nicht preisgeben dem Willen seiner Feinde … Regelmäßig unterbrach Radio Notre Dame seine Sendungen, um eine helle Frauenstimme den Wahlspruch des Senders, oder wie man das nannte, aufsagen zu lassen: Das Leben bekommt einen Sinn …
Germaine schüttelte jedes Mal bedächtig den Kopf. Was sollte das bedeuten? Der Sinn des Lebens, was war das? Als junge Frau hatte sie geglaubt, dass sie darüber spätestens im Alter genau Bescheid wüsste. Nun war sie eine sehr alte Frau, eine Greisin, deren Gesicht, wie sie fand, gespenstische Züge annahm, und immer noch fühlte sie eine Unsicherheit, die von Jahr zu Jahr wuchs. Hatte ihr Leben je einen Sinn gehabt? Was hielt ihr Leben zusammen? Diese Gedanken bedrängten sie, wenn sie sich ihnen zu lange hingab, so übertrug sie Gott die Aufgabe, Sinn zu stiften. Wenn sie lauthals betete und die Hände zur Zimmerdecke reckte, verlor sie für eine Weile ihre Zweifel.
Je ungestümer sie Gott anrief, desto größer ihre Hoffnung, erhört zu werden. Sterben wollte sie, ja, aber nicht ohne mit sich im Reinen zu sein. Mit sich im Reinen sein – wie sollte das aussehen, sofern man sich nicht mit Lügen zufriedengab? Vielleicht hatte sie vieles falsch gemacht, die Ehe mit Jean, nein … der Gehorsam gegenüber ihren Eltern, die Wertschätzung, die sie ihrem Vater zeitlebens entgegengebracht hatte? Ein Mann von Rang war er gewesen, und obwohl er seit sechzig Jahren tot war, schüchterte der Gedanke an ihn sie immer noch ein. Monsieur Léon Bérard, ein Name, der in der Welt nicht vergessen war. Hoffte sie.
Kinder, vielleicht wäre es mit Kindern einfacher gewesen. Sie hatte keine, weil Jean … ja, weil Jean … Sie verbot sich diesen Gedanken, drehte das Radio lauter. Der Kopf sank auf ihren Oberkörper, als seien Frühstück und Mittagessen zu schwere Kost für sie gewesen. Das magere Hühnerbein in Sahnesoße, die beiden Kartoffeln und zwei Gabeln von dem roten Mais, den sie so mochte. Grand Roux, eine Maissorte, die lange verschollen gewesen war, ehe sie, wie Docteur Vercel erzählt hatte, von einem Bauern in einem baskischen Kloster zufällig wiederentdeckt wurde. Deutlich weniger Wasser als der herkömmliche Mais brauche der Grand Roux. Das hatte sie sich gemerkt, während sie so vieles andere vergaß, kaum dass sie es gehört hatte. Warum behielt man das eine und das andere nicht? An der Bedeutsamkeit lag es offenkundig nicht.
Den Nachmittag über dämmerte sie dahin, ohne dass das Radio sie gestört hätte. Die abgegriffene Bibel, die aus dem Besitz von Jeans Großvater Paul Reclus stammte, rutschte zu Boden, und sie wachte erst auf, als sie den Kies knirschen hörte. Offenbar ein schwerer Wagen, der vor dem Haus zum Stehen kam. Die Mühlbergers! Nun war es vorbei mit der winterlichen Stille. Bis in den Oktober würden sie bleiben und das Schloss zum Leben erwecken. Germaine freute sich darauf, wenngleich sie diese Regung anderen gegenüber niemals zugegeben hätte. Sie kam zurecht mit der Eintönigkeit der Wintermonate, mit Anthony und Julien, mit Clara, früher war mit dem anbrechenden Frühjahr ihre Kraft zurückgekehrt, eine verloren geglaubte Neugier. Als hätte sie noch viele Frühlinge vor sich, als sei der Gedanke ans Sterben einer, der nur in der dunklen Jahreszeit aufkam.
Sie postierte sich hinter den Vorhängen. Ihr Zimmer – darauf hatte sie seinerzeit bestanden – ging hinaus auf die Auffahrt und die Steinstufen, sodass sie alles in Blick nehmen konnte. Wenn sie zwischen Vorhang und Fensterrahmen nach unten spähte und verfolgte, wer im Schloss ein und aus ging, war sie peinlich darauf bedacht, dass niemand sie sah. Sonst käme man womöglich auf den Gedanken, dass es ihr besser ginge. In ihrem Alter, erklärte sie Luise regelmäßig, sei es sinnlos, von einem gesundheitlichen Aufschwung zu reden. Wenn man Glück hatte, ging es nicht bergab, und es war klüger, die Leute im Glauben zu lassen, dass sich nichts bessere. Sonst hieße das ja, dem Tod ließe sich ein Schnippchen schlagen.
Autotüren schlugen zu. Sie sah, wie Thomas, Luises Mann, den Kofferraum öffnete, ein halbes Dutzend Gepäckstücke heraushievte, wie Luise und Anthony sich umarmten, wie der Hund der Mühlbergers, dessen Rasse und Namen Germaine über den Winter immer vergaß und der von Jahr zu Jahr an Gewicht zulegte, sich von der Rückbank quälte und sich der Sonne entgegenblinzelnd wohlig in den Kies eingrub.
Nun waren sie wieder da, diese Menschen, denen das Schloss seit über fünfzehn Jahren gehörte, keine Béarnaiser, nicht einmal Franzosen, Menschen, die eigentlich nichts mit diesem Schloss und seiner Geschichte zu tun hatten und denen es dennoch geglückt war, Germaines Herz zu gewinnen. Lange Zeit hatte es gedauert, bis sie mutig genug war, sich das einzugestehen. Vercel und Quiniou gegenüber hielt sie sich mit solchen Bekenntnissen zurück. Luise hatte ihr gefehlt in den letzten Monaten. Was sie ihr selbstverständlich nicht zeigte, wenn diese nach dem Abendessen bei ihr anklopfen würde. Die neue Schlossherrin machte der alten Schlossherrin ihre Aufwartung. Das gefiel Germaine.
3
Madame Germaine! Wir sind ja so froh, wie- der hier zu sein. Thomas wollte erst nächste Woche fahren, aber nicht mit mir! Es gibt Unmengen zu tun, schließlich haben wir im Sommer einiges vor. Gut sehen Sie aus, Germaine! Anthony hat mir erzählt, dass sie neuerdings auf Kaffee schwören. Das macht einen munterer als der fade Tee, nicht wahr, selbst wenn der aus dem Marais kommt …
Luise redete auf Germaine ein, tätschelte ihren faltigen, mageren Arm, den eine brüchig gewordene Seidenbluse kaschierte. Sie versprühte eine Energie, als wollte sie schon an ihrem ersten Abend das Schloss aus den Angeln heben. Ohne Punkt und Komma erzählte sie von ihren Kindern: vom Sohn, der als Sportfunktionär ein wichtiges Amt übernommen habe, von den Enkeln, die im August zu Besuch kämen, und von den Seminaren, die in den nächsten Monaten stattfinden würden. Eines über Simenon, den Krimiautor, eines über Wildkräuter, eines über ökologische Verantwortung im Lichte des Philosophen Hans Jonas und eines über spirituelle Atemtechniken, das würde sie doch sicher interessieren. Ein junger Pariser Koch – Gabriel – und seine Freundin Selina, eine Schweizerin, hätten außerdem ihr Kommen zugesagt und würden den Sommer über alle verköstigen. Der Gemüsegarten müsse dringend neu angelegt werden, und Thomas habe ihr versprochen, die Boule-Bahn, die in katastrophalem Zustand sei, herzurichten … Und dann, liebe Germaine, machen wir ein Spielchen; wie ich Sie kenne, werden Sie uns das Nachsehen geben …
Germaine setzte ein dünnes Lächeln auf, das ihrem Gegenüber einerseits Höflichkeit zollen, andererseits eine gewisse Erschöpfung andeuten sollte. Manche Wörter hakten sich umgehend in ihrem Kopf fest, Wörter, die es früher nicht gegeben hatte. Atemtechniken – was sollte das sein? Sie hatte sich über das Atmen nie Gedanken gemacht, war froh, wenn sie überhaupt Luft bekam und morgens den sanften Windzug spürte, der durch ihr nur angelehntes Fenster ins Zimmer drang. Welche unterschiedlichen Techniken sollte es beim Atmen geben? Durch die Nase oder durch den Mund, ja gewiss, aber sonst …
Nein, meine liebe Luise, machen Sie sich keine Hoffnung, dass ich Ihnen und Ihrem Mann das Boule-Spielen beibringe. Dazu müsste ich ja mein Zimmer verlassen. Wofür ich entschieden zu schwach bin, wie Sie wissen. Wahrscheinlich geht es in diesem Sommer mit mir zu Ende. Ich hätte nichts dagegen. Niemand braucht mich mehr, erwiderte sie, ein Luftholen Luises ausnutzend.
Sie sprach mit einer hohen Fistelstimme, die sie sich kurz nach ihrer Heirat antrainiert hatte. So zu reden zeugte von herrschaftlicher Klasse, ja, von einer gewissen Noblesse. Obwohl es sie mittlerweile anstrengte, diese Sprechweise beizubehalten, hätte sie anderen gegenüber darauf nie verzichtet. Nur wenn sie für sich war, ihre Erinnerungen herbeizitierte, betete oder lauthals rekapitulierte, was Vercel ihr zugetragen hatte, verfiel sie in eine tiefere, entspanntere Tonlage, die ihr keine Anstrengung abverlangte.
Boule … wie kam Luise darauf, dass sie am helllichten Tag mit Metallkugeln nach dem Cochonnet werfen und sich lächerlich machen würde. Irgendwann in einem Sommer, fiel ihr plötzlich ein, hatte sie Jean zu einem Spiel aufgefordert. An einem der Wochenenden, als wieder einmal zahllose Gäste das Schloss bevölkerten und im Park lustwandelten, mit einem Glas schweren Béarnaiser Rotwein oder Jurançon in der Hand. Ein einziger vernichtender Blick hatte ausgereicht, ihr die Absurdität ihres Ansinnens vor Augen zu halten.
Jean war ein guter Mann gewesen, doch keiner, der jemals über seinen Schatten sprang. Und das, obwohl er als Soldat jahrelang zur See gefahren war, sogar nach ihrer Heirat. Sich das Jackett abzustreifen, gar die Hemdsärmel hochzukrempeln und um einen Boule-Sieg zu kämpfen, das passte nicht zu ihm. Sie selbst hätte gern den Mut gehabt, sich über Konventionen hinwegzusetzen, hinunter zum Bach zu laufen, die Ställe der Bauernhöfe zu durchstreifen. Warum hatte sie das so selten getan?
Germaine atmete kräftig aus, bemerkte erst in diesem Moment, dass Luise noch immer an ihrer Seite saß und ihr zwei Blättchen der Kirchengemeinde reichte. Müde sei sie nun, hauchte sie, und ja, ein kleines Stück Seehecht morgen, das nähme sie gern zu sich, falls sich Appetit einstellen würde.