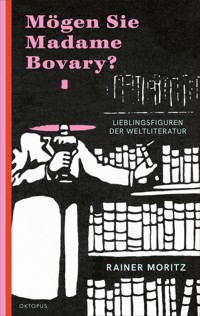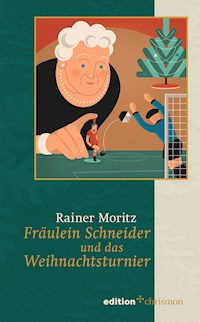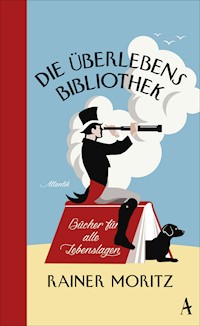Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: OKTOPUS by Kampa
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Es gibt keinen treueren Freund als ein Buch«, sagte schon Ernest Hemingway. Und wie bei unseren Freunden aus Fleisch und Blut wollen wir natürlich auch die aus Papier immer besser kennenlernen und wissen, welche verschlungenen Wege sie zurückgelegt haben, ehe sie bei uns landen. Was tun Agenturen? Welche Bücher helfen uns, guten Schlaf zu finden? Was macht das Fernsehen mit der Literatur? Warum ist es so schwer, über Sex zu schreiben? Welche Bücher schenken wir uns zu Weihnachten? Was steht im Duden? Sind Eselsohren abzulehnen? Was sind Nackenbeißer? Fragen über Fragen, die dieses Buch beantwortet, kurzweilig, abschweifend und informativ - und dank seiner alphabetischen Gliederung auch noch schnell. Es entführt die Leserinnen und Leser in fast alle Ecken und Winkel des Literaturbetriebs - und profitiert da von, dass der Autor die meisten davon gut kennt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rainer Moritz
Das Buch zum Buch
Ein Blick hinter die Kulissen
Oktopus
Dieses Buch enthält kein --> Motto, keine --> Widmung
und keine --> Danksagung.
Ein Wort vorweg
Bücher handeln von vielem. Von Liebe, Schmerz, Abenteuer, Krieg, Großstadt, Landleben, Freude, Einsamkeit, Schulhof, Altersheim, Seefahrt, Waldspaziergängen … Dieses Buch freilich kreist um keines dieser reichhaltigen Themen. Es ist ein Buch zum Buch, und es widmet sich allem Möglichen, was den Buchmarkt und den Literaturbetrieb ausmacht, was zum Entstehen und Erscheinen von Romanen oder Sachbüchern gehört und was sich zu deren Material, zur Sprache, sagen lässt.
Subjektiv, kurzweilig, ernst, ironisch, bissig und informativ soll es in diesem Bücher-Buch zugehen. Es basiert auf dem, was ich in gut drei Jahrzehnten im literarischen Kosmos erlebt habe – als Lektor, Verlagsleiter, Kritiker, Moderator, Autor, Übersetzer, Literaturhausleiter, Podcaster und als Aushilfskraft im Buchhandel, wo es mir im »Endkundengespräch« bisweilen vergönnt war, meine Lieblingslektüren unter die Leute zu bringen. Das Buch zum Buch entführt die Leserinnen und Leser in fast alle Ecken und Winkel des Metiers und profitiert, hoffentlich, davon, dass der Autor die meisten dieser Ecken und Winkel ganz gut kennt.
Von meiner Leidenschaft zeugt dieses Buch also bestenfalls. Schon als Schüler war mir klar, »irgendwas mit Büchern« im »späteren Leben« machen zu wollen. Dazu ist es zum Glück gekommen, und dafür bin ich dankbar. Und ich wünsche mir, dass von diesem Feuer etwas überspringt auf die Leserinnen und Leser.
Gegliedert ist dieses Buch alphabetisch – von »Adventure Writing« bis »Zwiebelfisch« – in Stichworten, die mal seriös und mal weniger seriös klingen. Möge die Lektüre dieses ABCs also die Erkenntnis fördern, wie in diesem ganz besonderen Geschäft das eine mit dem anderen zusammenhängt.
Rainer Moritz
Im April 2023
Adventure Writing
Nennt man ein Subgenre des »Travel Writing«, das spätestens mit Jon Krakauers In eisige Höhen. Das Drama am Mount Everest (1998) aufkam. Es weckte Verlegerbegehrlichkeiten und generierte bald darauf Unmengen von Büchern mit Wüstendurchquerungen, Polumrundungen und Vulkanbesteigungen. Ein Trend, der dann wieder abflaute. Auch um Reinhold Messner ist es ruhiger geworden.
Agenturen
Agenten, seltener Agentinnen, gab es lange Zeit nur in Filmen und Büchern, wenn Joseph Conrad, Ian Fleming, John le Carré oder Javier Marías zur Feder griffen. Bis Ende des 20. Jahrhunderts hierzulande auffiel, dass sich auch mit dem Beruf des literarischen Agenten Geld verdienen lässt – ein Job, der im angloamerikanischen Bereich seit Langem existierte.
Literaturagenten, häufig -agentinnen, nehmen sich warmherzig der oft heimatlosen Schriftsteller an, die nicht über schnöde Dinge wie Tantieme, Honorare, Vorschüsse etc. sprechen wollen, handeln Verträge mit Verlagen aus und kassieren in der Regel fünfzehn Prozent der eingespielten Gelder. Verleger aus altem Schrot und Korn wie Suhrkamp-Chef Siegfried Unseld wollten von Agenturen nichts wissen und bauten auf das innig persönliche Verhältnis zu ihren schreibenden Zöglingen. Durchhalten ließ sich diese Haltung nicht. Agentenlose Schriftsteller sind eine aussterbende Spezies.
Autor
Nein, nichts Grundsätzliches an dieser Stelle dazu, was »Autorschaft« ist, ob der Autor oder die Autorin tot sind und wann die Künstliche Intelligenz alles bisher Vertraute dazu auf den Kopf stellen wird.
Nein, es geht um eine Beobachtung, die sich seit Jahren machen lässt – sei es bei Veranstaltungen an buchaffinen Orten, sei es im Feuilleton oder bei Alltagsplaudereien. Es geht um etwas sehr Einfaches, es geht um die Deklination des Substantivs »Autor«. Welche Regeln da gelten, ist ganz leicht erklärt:
Nominativ: der Autor
Genitiv: des Autors
Dativ: dem Autor
Akkusativ: den Autor
Obwohl das – wie es früher hieß – so klar wie Kloßbrühe ist, grassiert hier seit Längerem Verwirrung. Oft orientiert man sich nun beim Deklinieren offenbar lieber am Beispiel »Journalist« (der Journalist – des Journalisten – dem Journalisten – den Journalisten). Folglich sind in Buchhandlungen, Bibliotheken oder gar Literaturhäusern Sätze zu hören wie: »Das neue Buch des Autoren hat uns gut gefallen« oder »Wir freuen uns sehr, den Autoren XY heute Abend begrüßen zu dürfen«.
Solche Torheiten schmerzen uns, und wir wollen sie weder hören noch lesen. Könnten sich das bitte alle zu Herzen nehmen? Sonst fängt der Duden bald an, diese Idiotie als umgangssprachliche Variante zu akzeptieren.
Ich werde diese Verfallserscheinung genau im Auge behalten. Wer mich also künftig zu einer Lesung einlädt, möge mich bitte korrekt begrüßen. Auch über gut gemeinte Wendungen wie »Meinem Lieblingsautoren Rainer Moritz heute Abend zuhören zu dürfen ist mir eine große Freude« werde ich nicht hinwegsehen.
Wer statt meiner sicherheitshalber eine »Autorin« einlädt, hat ein Problem weniger. Da kann man bei der Deklination nichts falsch machen.
Autofiktion
Ein Begriffsübel jüngeren Datums. Texte, die zwischen Autobiographie und Fiktion lavieren und sich weder zum einen noch zum anderen eindeutig bekennen, sind keine Erfindung unserer Tage. Dem französischen Autor und Literaturwissenschaftler Serge Doubrovsky wird attestiert, in den 1970er-Jahren den Begriff »Autofiktion« gezielt verbreitet zu haben. Wie es überhaupt vor allem Franzosen wie Didier Eribon, Édouard Louis oder Annie Ernaux waren und sind, die mit ihren Texten diese Schublade zum Bersten bringen.
Was »autofiktional« von »autobiographisch« unterscheidet, ist schwieriger zu fassen, als man denkt. Auf jeden Fall klingt das Erstere intellektueller und chicer und wird deshalb seit einiger Zeit in Verlagsvorschauen blindlings und zum Erbrechen oft verwendet – egal ob es um Tove Ditlevsen, Monika Helfer oder Julia Schoch geht. Auch Graphic Novels, Eva Müllers Scheiblettenkind etwa, sind inzwischen »autofiktional«. »Autobiographisch« hingegen stirbt als Anpreisungsvokabel quasi aus. Wahrscheinlich zählt auch Goethes Dichtung und Wahrheit inzwischen zur Autofiktion, das vorliegende Buch zum Buch sowieso.
Bei all diesem Getue um die Autofiktion lob ich mir den Schweizer Peter Stamm, der in seinem Roman In einer dunkelblauen Stunde eine Figur Folgendes sagen lässt: »Dieses ganze autobiographische, autofiktionale Zeug, wozu soll das gut sein. Diese geheuchelte Authentizität, die verlogener ist, als jede Erfindung es je sein könnte. Nie lügt man so schamlos, wie wenn man von sich selbst erzählt.«
Autorenfoto
Ich weiß, dass man Menschen nicht nach ihrem Aussehen beurteilen soll. Fand meine Mutter auch, ehe sie sich über die Küchenschürze der Nachbarin oder das Doppelkinn von Onkel Hermann mokierte. Innere Werte sind es, die zählen. Klar. Doch in unserer verdammt schnelllebigen Zeit bleibt dafür nicht genügend Muße. Und auch nicht dafür, ständig Romane von über 500 Seiten zu lesen. Stattdessen halten wir uns an den Schweizer Pfarrer Johann Caspar Lavater, der im 18. Jahrhundert die Mode der Physiognomik aufbrachte, Schädel- und Nasenformen studierte und das Innere des Menschen im Äußeren gespiegelt sah. Warum soll das heute nicht mehr gelten? Ab einem bestimmten Alter sei man für sein Gesicht verantwortlich, heißt es in Albert Camus’ Roman Der Fall. Woran wir uns, im Gegensatz zu Boris Becker, halten wollen. Wie Autoren auftreten, wie sie sich präsentieren, ob sie »highly promotable« sind oder eher nicht abgebildet werden sollten, das nimmt in der Verlagsarbeit breiten Raum ein. Kleider und Gesichter machen Leute. Denken Sie an Günter Grass’ Cordanzug oder Daniel Kehlmanns dezent schmollende Unterlippe.
Wie man Autorinnen und Autoren in Verlagsvorschauen oder Umschlagklappen zeigt, ist Teil des Marketings und unterliegt modischen Strömungen. Schon literarische Großfürsten wie Thomas Mann und Gerhart Hauptmann wussten sich zu inszenieren, und die Art und Weise, wie Ingeborg Bachmann 1954 als Covergirl des Spiegel dreinschaute, hat die Rezeption ihrer Werke mitgeprägt. Dass man, wie die Bachmann, als ernsthafter Autor oder ernsthafte Autorin seriös in die Welt zu blicken habe, ist eine bis heute verbreitete Auffassung. Wer plump lacht auf Fotos, macht sich – wenn es sich nicht um Bücher von Otto Waalkes handelt – verdächtig. Folglich sind Aufnahmen, die Autoren nachdenklich, melancholisch und mit verhangenem Blick zeigen, gelegentlich immer noch gepaart mit der Rodin’schen Denkpose.
Die Inszenierungen fallen ganz unterschiedlich aus. Da gibt es den Hutträger Martin Walser, der sich von niemandem etwas vorschreiben lässt, oder Ilja Leonard Pfeijffer, der sich ebenfalls von niemandem etwas vorschreiben lässt, seine Haarmähne aber nie unter einem Hut verstecken würde. Da gibt es die supercoolen Typen wie Donald Ray Pollock, Helge Timmerberg, Virginie Despentes, Richard David Precht, Peter Buwalda oder Karl Ove Knausgård, die entweder zeigen, dass sie im Leben einiges durchgemacht haben, oder irgendwie ahnen, dass sie über erotische Ausstrahlung verfügen. Da gibt es Figuren wie Arno Geiger, Dora Heldt, Wolf Haas oder Bernadine Evaristo, die beim Fotografiertwerden kein Gedöns machen und deshalb mit ihrer »natürlichen« Ausstrahlung punkten.
Abgenommen hat die Tendenz, sich ironisch oder unironisch auf Verlagsfotos in großer Pose zu zeigen. Sibylle Berg hat das, mit den Usancen des Geschäfts spielend, in ihren Anfängen gezielt gemacht. Auf dem Cover ihres Erstlings Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot sehen wir sie leicht bekleidet und rauchend auf einem Bett, auf dem ihres Romans Amerika posiert sie bestens frisiert im schwarzen Barbara-Stanwyck-Abendkleid mit Dogge an ihrer Seite, aufgenommen im Zürcher Edelhotel Dolder. Mittlerweile nimmt Sibylle Berg von solchen Inszenierungen Abstand; ihre Bücher kommen eher schmucklos daher.
Vorbei auch die Zeiten, als in Verlagen und Zeitungsredaktionen ein latenter Sexismus waltete und Autorinnen nicht zuletzt nach ihrem Aussehen taxiert wurden. Von altgedienten Marketingleitern ausgesprochene Sätze wie »Die nehmen wir vorne auf die Vorschau« fallen heute kaum noch; fehlen tun sie niemandem.
Zu »korrekt« freilich muss es auf Autorenfotos dennoch nicht zugehen, und so bin ich Peter Stamm sehr dankbar dafür, dass er sich in letzter Zeit mit Zigarette ablichten ließ. Ja, ja, wir wissen von der Schädlichkeit des Nikotins und von der Vorbildfunktion, die Schriftsteller verkörpern sollen (aber oft nicht verkörpern wollen), trotzdem gefällt mir der lässige Raucher Peter Stamm gut. In Büchern, das wird heutzutage oft vergessen, geht es ja zum Glück auch selten »korrekt« zu, und rauchende Männer sind nicht zwingend uninteressanter als nicht rauchende Männer.
Bindestrich
Lesende sind oft empfindsame Menschen. Sie sind leicht verletzbar und stören sich an Dingen, die anderen Menschen schnurzegal sind. Verletzungen überwindet man bisweilen dadurch – dafür gibt es in der Weltliteratur viele Beispiele –, dass man über sie schreibt. Deshalb das Folgende:
Mein Ärger darüber setzte früh ein. Wahrscheinlich Anfang der 1980er-Jahre, als ich einem frisch entfachten Interesse für mittelalterliche Literatur folgte und Mitglied der – so dachte ich – Oswald-von-Wolkenstein-Gesellschaft wurde. Lange hielt die Freude darüber nicht an, denn ich musste schmerzhaft erkennen, dass es diese hochnoble, vor allem aus Germanisten zusammengesetzte Gesellschaft vorzog, sich Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft zu nennen und bei der Publikation ihres Jahrbuchs gar auf jeglichen Bindestrich zu verzichten.
Meiner früh entwickelten Oberlehrerneigung nachgehend, monierte ich das in einem strengen Brief, doch der Vorstand zeigte sich uneinsichtig, sodass ich nicht umhinkam, der Gesellschaft den Rücken zu kehren. Seit dieser Zeit begleitet mich das Leiden am fehlenden Bindestrich, diesem so wichtigen Satzzeichen, das anzeigt, dass Dinge zusammengehören und nicht wie einsame Bojen in den Sprachgewässern umhertaumeln.
Dabei könnte alles so einfach sein, wie ein Blick in die amtlichen Rechtschreibvorgaben zeigt. Das Deutsche verfügt bekanntermaßen über die herrliche Fähigkeit, bei Bedarf ständig neue Substantivkomposita zu bilden, ohne dass diese sich sofort im Wörterbuch niederschlagen müssten. »Ölleckschlauch«, »Rindfleischetikettierungsverordnung« oder »Seuchenbekämpfungsmaßnahmen« sind somit gängige Wortbildungen, die ausländische Betrachter in Angst und Schrecken versetzen. Der erstaunte Mark Twain nannte sie »alphabetische Prozessionen«.
Da solche buchstabenreichen Verbindungen mitunter zu Unübersichtlichkeit neigen, zeigt sich der Duden großzügig und lässt zu, dass der Lesbarkeit wegen Bindestriche komplexe Zusammensetzungen strukturieren. Gegen »Lotto-Annahmestelle« oder »Umsatzsteuer-Tabelle« ist also nichts zu sagen. Erforderlich freilich ist ein solcher Bindestrich nur in wenigen Fällen, doch eine Zeit lang schien es so, als würden Zusammenschreibungen eine generelle Überforderung darstellen, und Wendungen wie »Golf-Platz« oder »Fehl-Alarm« breiteten sich unschön aus.
Viel schlimmer als die unnötigen Bindestriche ist der seit Jahren grassierende Verzicht auf das elementare Satzzeichen. Wohin man auch blickt, überall umzingeln einen rätselhafte Aneinanderreihungen von Substantiven, die hilflos wie Hänsel und Gretel durch den Wald irren. Ein paar Beispiele gefällig? Der Steakspezialist Eugen Block bietet ein »Zauber Gewürz« an, natürlich in »Block House Qualität«; auf Speisekarten – ein Hort der Bindestrichabstinenz – begegnen uns »Kinder Portionen«, »Spargel Salate«, »Frühlings Eisbecher«, eine »Skins on Fries Tüte« oder »Extra Gedecke«, und resigniert lenke ich meinen Wagen in eine »Autowasch Straße« (oder: »Auto Wasch Straße«). Mancherorts wird diese Erscheinung deppenverachtend Deppenleerzeichen genannt.
Das allgemeine Tohuwabohu nimmt überall zu, zumal selbst hoch offizielle Institutionen gedankenlos agieren und den Bindestrich nach Belieben setzen. Da verleiht die Evangelische Akademie in Tutzing einen Marie Luise Kaschnitz-Preis, das PEN-Zentrum einen Kurt Sigel-Lyrikpreis, und Benennungen wie Hermann Hesse-Wanderweg sorgen kaum noch für Erregung, ganz so, als hieße der Hesse-Wanderweg Hermann mit Vornamen.
Selbst die ehrwürdige Frankfurter Universität hieß jahrelang unfasslicherweise Johann Wolfgang von Goethe-Universität, ehe man sich – wohl nicht mir zuliebe – in Goethe-Universität umbenannte. Und kaum öffne ich meine Emails, stoße ich in Signaturen auf einen »Univ. Prof.« oder einen »Dipl. Ing.«. Dass mich die »Hamburg Tourismus GmbH« neulich zu einer »Kick-off Veranstaltung« einlud, sei der Ordnung halber nicht verschwiegen. Zumutungen wie die Binnenmajuskel in »BahnCard« wollen wir übergehen.
Zu tun hat diese sinnfreie Willkür mit einer insbesondere bei Typographen und Werbeagenturen weit verbreiteten Abscheu vor dem Bindestrich, der als unschönes, die gestalterische Kreativität einengendes Element verschrieen ist – mit der Folge, dass uns auf Buchcovern gerne mal ein Fontane Lexikon oder Das Marcel Proust Alphabet begegnen. Substantivverbindungen mit Bindestrich durchzukoppeln, das gilt irgendwie als spießig und unelegant, ablesbar daran, dass selbst Institutionen, Gesellschaften oder Unternehmen den klärenden Bindestrich meiden wie der Teufel das Weihwasser.
Irrige Schreibungen wie »S. Fischer Verlag«, »BVB Fanclub«, »Anthony Powell Gesellschaft«, »ETAHoffmann Theater«, »Allianz Arena« und »Humboldt Forum« verfolgen uns auf Schritt und Tritt. Sie gehen insgeheim davon aus, dass Bindestrichwörter provinziell wirken und international nicht vermittelbar sind. Natürlich hat der subversive Einfluss des Englischen seinen Beitrag dazu geleistet und der Bindestrichphobie in die Hände gespielt. Wenn in Liverpool oder Boston »service station« oder »hand car wash« korrekte Schreibungen sind, kann, so der fatale Glaube, eine »Service Station« in Weinsberg oder Pontresina nicht falsch sein.
Wer diese Phänomene beklagt, gerät rasch in den Verdacht, an überzeitliche Normierungen zu glauben und den »natürlichen« Sprachwandel zu verkennen. Und ja, die Sprachgemeinschaft geht unwillkürlich den Weg des geringsten Widerstands und formuliert so, wie es am einfachsten ist. Das Unkomplizierte obsiegt auf lange Sicht, und so werden aus starken Verben gern schwache, ist der Dativ nach »wegen« kein Grammatikverstoß mehr. Selbst das Unbehagen, das manchen überfällt, wenn die Konjunktion »weil« in gesprochener Sprache einen Haupt- und keinen Nebensatz mehr nach sich zieht, wird ein vorübergehendes sein.
Überall freilich sollten wir diese Nachsicht nicht walten lassen. Substantivverknüpfungen nicht mehr zusammenzuschreiben oder mit Bindestrichen zu koppeln widersetzt sich der Logik, etwas miteinander zu verbinden, was verbunden gehört. Ein Leberwurstbrot ist eben nicht das Gleiche wie ein »Leber Wurst-Brot« oder ein »Leber Wurst Brot«, und »Social Media-Aktivitäten« besagen nicht das, was sie besagen wollen: Social-Media-Aktivitäten. Vielleicht signalisiert die Scheu vor dem Bindestrich ja die Zerrissenheit unserer Gesellschaft: Wo wir über das Fehlen von Gemeinsamem und Verbindendem klagen, da täte uns der Bindestrich gut. Ihn zu setzen würde den Zusammenhalt in unserem Land fördern. Manchmal verweisen Rechtschreibprobleme offenbar auf größere Probleme.
Unbelehrbar zeigt sich – ich komme darüber nicht hinweg – die den Südtiroler Dichter und Sänger Oswald von Wolkenstein in Ehren haltende Vereinigung: Sie nennt sich bis heute Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft.
Bodywriting
Vielleicht hat es mir an Mut gefehlt. Vielleicht wäre aus mir ein ganz anderer Kerl geworden, ein Schriftsteller, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat. An den Literaturinstituten in Hildesheim oder Leipzig, da hätte ich studieren müssen; da hätte man mir die richtigen Fingerzeige gegeben. Oder, noch besser, in Wien, an der »schule für dichtung/vienna poetry school«. Was diese – so Friederike Mayröcker – »überaus wertvolle« Dichterakademie anbietet, hat mich früh fasziniert.
Zum prominent besetzten Lehrkörper gehörte vor vielen Jahren die Schriftstellerin Ginka Steinwachs. Ihr in Wien angebotenes Seminar beeindruckte mich seinerzeit sehr; den Ankündigungstext habe ich mir gemerkt: »Schreiben ist Körperarbeit. Schreiben ist bodywriting im Sinne von genitivus subjectivus und genitivus objectivus, der Körper schreibt (subjectivus) und der Körper wird beschrieben (objectivus). Der Körper selbst ist das zu beschreibende weiße Blatt. Daher nach Literatur im Liegen (Grundkurs), jetzt Literatur im Gehen (Aufbaukurs die Meisterklasse). Im Klassenzimmer eine Diagonale zum Auslaufen und ein Berg zum Aufstieg.«
Sechs Tage im Wiener September hätte damals diese Bodywriting-Unterweisung gedauert, zwei Stunden täglich. Mir fehlte das Zutrauen. Möglicherweise vermisste ich zwischen »Liegen« und »Gehen« den Kurs »Literatur im Stehen«. Eventuell war ich zu geizig, 1000 Schilling hätte mich Frau Steinwachs’ Seminar gekostet.
Eine verpasste Chance, so sehe ich das heute. Aus Neugier habe ich mir das aktuelle Programm der »schule für dichtung« angesehen, das unverändert exquisit ist. Thomas Meinecke und Raphaela Edelbauer bieten Kurse an. Am meisten interessiert mich die Klasse der Choreographin und Autorin Christine Gaigg; »orgasmisches schreiben« ist sie betitelt. Es geht darin um »entgrenzung und kontrollverlust durch techniken psychischer und physischer ekstase«. Das würde zu mir passen. Leider fand Frau Gaiggs Kurs bereits im November 2022 statt. Wieder eine verpasste Chance.
Brezel- und Buchpreis
Bücher seien zu teuer – diesen Satz hört man immer wieder, obwohl er einer der törichtsten Sätze ist, die man äußern kann. Warum? Lassen Sie mich mit der Laugenbrezel argumentieren, dieser Krönung des Bäckerhandwerks. Die Rheinpfalz hat vor einiger Zeit die Brezelpreisentwicklung in Speyer während der letzten Jahrzehnte dokumentiert. Demnach kostete das Gebäck 1950 fünf Pfennige, 1960 zwölf, 1971 zwanzig. 1988 musste man bereits 40 Pfennige auf den Ladentisch legen, und nach der Euro-Einführung stieg der Preis 2014 etwa auf stattliche 60 Cent. Heute kostet eine Laugenbrezel in Speyer oder anderswo gut und gerne einen Euro, und die Preissteigerungen bei den Rohstoffen Mehl, Wasser oder Butter, von den Energiekosten ganz zu schweigen, werden den Brezelpreis weiter in die Höhe treiben. Welche prozentuale Erhöhung das seit Konrad Adenauers Zeiten bedeutet, lässt sich selbst ohne Taschenrechner leicht feststellen.
Die Preise für Bücher haben an dieser Entwicklung so gut wie keinen Anteil gehabt. Selbst die Euro-Umstellung hat daran nichts geändert. Während wir es in Restaurants klaglos hinnehmen, für ein Glas hundsgewöhnlichen Grauburgunder neun Euro zu zahlen, dümpeln die Ladenpreise für Bücher vor sich hin. Während man vor dem Euro beispielsweise einen Hardcoverroman von 300 Seiten für 39,90 D-Mark bekam, kostete dieser bis vor Kurzem maximal 23 oder 24 Euro. Das Ungleichgewicht zur Laugenbrezelpreisentwicklung liegt auf der Hand. Wenn man zum Beispiel bei meinem Lieblingsitaliener, dem Lamm in Dettenhausen, für eine Pizza respektable (und durchaus berechtigte) vierzehn oder fünfzehn Euro hinblättern muss, lässt sich daraus nur eines folgern: Büchern müssen teurer werden!
Buchhandlung, Atmosphäre der
Ein unwirtlicher Tag. Es regnet unablässig, Windböen wirbeln das Laub auf, und kalte Luft setzt sich im Gesicht fest. Höchste Zeit, einen Unterschlupf zu finden. Und da tut sich plötzlich ein Ort auf, der Geborgenheit verspricht. Wer eine Buchhandlung betritt, klinkt sich aus der Welt aus und hofft insgeheim, dass dieser Zustand anhält, dass eine Rückkehr in den fordernden Alltag nicht nötig sein wird.
Doch Vorsicht! Buchhandlungen unterscheiden sich stark voneinander. Da gibt es die weitläufigen Läden der Filialisten, die selten Charme versprühen. Im Eingangsbereich locken sie mit Stapeln reduzierter, austauschbarer Ware, dem sogenannten modernen Antiquariat. Gleich dahinter lauert Krimskrams, Geschenkartikel, die für schnellen Umsatz sorgen.
Um solche Kaufhäuser des Buches, die vor allem die gängigen Bestseller unter die Leute bringen wollen, geht es nicht. Wir meinen vielmehr jene überschaubaren Geschäfte, die sofort das Gefühl vermitteln, man zähle zu den langjährigen Stammkunden – selbst wenn man nie zuvor einen Fuß in dieses Paradies der Bücher gesetzt hat. Ein Kopfnicken der Buchhändlerin an der Kasse, die klug genug ist, die Eintretenden in Ruhe ankommen zu lassen und sie nicht mit einem »Kann ich Ihnen helfen?« zu überfallen – und schon richtet man sich ein.
Buchhandlungen wollen anfangs sorgsam mit Blicken erkundet werden. Da vorne ein Tisch mit Neuerscheinungen, die Titel so angeordnet, dass ungewöhnliche Cover ins Auge springen. Daneben vielleicht eine Drehsäule mit kleinformatigen Kochbüchern, und hinten an der Wand stehen die leicht wiederzuerkennenden Buchreihen wie Zinnsoldaten nebeneinander: die gelben Reclam-Hefte, die handlichen Manesse-Klassiker der Weltliteratur oder die Naturkunden von Matthes & Seitz, die einem unterschätze Fauna und Flora, Esel oder Brennnessel zum Beispiel, nahebringen.
Ein paar Minuten braucht es nur, bis sich ein Zugehörigkeitsgefühl einstellt. Was draußen ist, zählt nicht mehr. Behutsam tastet man sich vor, nimmt die ersten Bücher in die Hand, studiert ihre Klappentexte, lässt sich von einer Ecke in die nächste treiben und stößt auf gänzlich unvertraute Romane oder Sachbücher, die zu erstehen plötzlich zur unaufschiebbaren Angelegenheit wird. Ein Sessel, ein altmodisches Sofa – jede Sitzgelegenheit wird freudig begrüßt, gilt es doch, sich in den einen oder anderen Titel zu vertiefen, um zu sehen, ob der Inhalt mit dem einladenden Umschlag mithalten kann. Vielleicht gibt es sogar eine Tasse Kaffee dazu, um sich wie zu Hause zu fühlen.
Buchhandlungen wollen, wie die Verlegerin Inge Feltrinelli schrieb, zuerst die »Kunden verführen«, ihnen unaufdringlich zeigen, dass das Leben nicht nur aus Notwendigkeiten besteht, dass es vielmehr seinen Reiz daraus zieht, sich von Neuem ansprechen zu lassen. Wie sie das tun, dafür gibt es keine Norm. Mal ist es ein akkurates Ordnungssystem, das uns zielsicher von den Krimis zu den Biographien führt. Mal macht ein heilloses Durcheinander den Zauber aus: schiefe Büchertürme, auf denen Druckfrisches und Angestaubtes eine selbstverständliche Allianz eingehen.
Das gedämpfte Licht, das Parkett, die Sitznische, das Ineinandergreifen der braunen Regalwände – alles ist ausgerichtet, um die Menschen in Einklang zu bringen mit der magischen Aura des Ortes. Hektische Einkäufe lassen sich andernorts erledigen. Hier geht es um den Moment freudiger Anspannung, hier geht es darum, wie die Autorin Caroline Lamarche, Kundin der Brüsseler Buchhandlung Tropismes, schrieb, auf den »Liebesruf der Bücher« zu warten, keine bewusste Wahl zu treffen, sondern sich ergreifen zu lassen.
Irgendwann freilich heißt es, aus der Einsamkeit des stillen Blätterns herauszutreten und das Gespräch zu suchen – mit der unaufdringlichen Buchhändlerin, dem dezenten Buchhändler. Denn wer neugierig auf Literatur ist, will sich darüber austauschen, will seine Eindrücke teilen und eine Gemeinschaft mit anderen Lesenden bilden. So werden Buchhandlungen zu Stätten eines anregenden Austauschs. Laut geht es dabei nicht zu, allenfalls in den Kinderbuchabteilungen herrscht Lärmen.
Sich ein Stündchen in einer Buchhandlung aufzuhalten, sie dann heiteren und zugleich schweren Herzens mit einem Stoß Lesestoff zu verlassen, das wappnet für die Herausforderungen vor der Tür, für Nieselregen, Eiseskälte oder Autolärm. Und an manchen Abenden verwandeln sich diese Orte, wo alles so zueinanderpasst, in Lesebühnen. Wenige Handgriffe genügen, um Tische zu verschieben, Stuhlreihen aufzubauen und aus einem Laden eine kleine Lesebühne zu machen. Dann treten Autorinnen und Autoren auf, lesen aus ihren Werken, nippen am obligatorischen Wasserglas und kommen mit den Gästen ins Gespräch. Keine Performance, kein Event, nein, die intime Erfahrung vorgetragener Texte und das Kennenlernen derjenigen, die sie geschrieben haben. Am nächsten Morgen kehrt die alte Ordnung wieder zurück, lockt die Buchhandlung aufs Neue mit ihrem Sortiment und spricht eine Einladung zur Einkehr aus.
Buchmessen
Buchmessen gibt es sehr viele auf der Welt, ob in Beijing, London, Wien oder Bologna. Konzentrieren wir uns deshalb auf das, was Deutschland zu bieten hat, auf Frankfurt und Leipzig. Nach der Wiedervereinigung galt es lange als fraglich, ob man sich zwei Buchmessen im Jahr leisten könne, und hinter vorgehaltener Hand mäkelten nicht nur Verlagscontroller an den unnötigen Kosten herum, die diese »Ostmesse« bereite.
Das änderte sich erst Mitte der 1990er-Jahre, als plötzlich ein frischer Luftzug durch Leipzig wehte und binnen kürzester Zeit die überraschendsten Aufbruchssignale zu hören waren. Da erregte der neue Hauptbahnhof mit seiner ungewohnt ausladenden Einkaufsmeile Aufsehen; da wurde in Anwesenheit des Bundespräsidenten Roman Herzog das gläserne Messegelände im Norden der Stadt eingeweiht, und auch die Literatur hatte Anlass zur Freude: durch das Haus des Buches am Gerichtsweg, zu dessen Eröffnung sogar Bundeskanzler Helmut Kohl hätte sprechen wollen, wenn starker Nebel ihn nicht daran gehindert hätte.
Wer die Atmosphäre in Leipzig seinerzeit miterlebte, spürte einen Wind, der aus zweierlei Richtungen blies. Zum einen träumten viele davon, dass das Etikett »Buchstadt« nicht nur nostalgische Bedeutung besitzen, sondern für die Zukunft gelten möge. Zum anderen war ebenso klar, dass man im Westen mit diesem Hochhalten der Vergangenheit wenig anzufangen wusste und keinen zwingenden Grund sah, an der Leipziger Buchmesse festzuhalten. Lag in dieser Veranstaltung nicht gar eine Gefahr, das große Frankfurter Herbstevent zu schwächen?
So dachte man in den Verlagskonzernen der alten Bundesrepublik, doch da es in offiziellen Verlautbarungen darum ging, den armen Osten nicht hängen zu lassen und von blühenden Kulturlandschaften in Sachsen und Thüringen zu schwadronieren, hielt man sich mit offenen Herabwürdigungen der putzigen Leipziger Buchmesse zurück, äußerte sich spöttisch nur hinter vorgehaltener Hand. Selbst als die Buchmesse ihren verwinkelten Standort am baufälligen Messehaus am Markt aufgab und in die elegante Glashalle zog, hielt sich die Begeisterung in Münchner oder Hamburger Verlagshäusern in Grenzen. Man schickte ein kleines Team nach Leipzig, zu denen die Verleger nur selten gehörten, und richtete sich in possierlichen Alibiständen ein, die selten Ähnlichkeit mit den Frankfurter Prachtbauten besaßen. Wenn man nicht den Aufbau- oder den Henschel-Verlag repräsentierte, ertrug man die Leipziger Messe, ohne sich für sie ins Zeug zu legen.
Erst nach und nach gelang es den Leipziger Verantwortlichen, das Blatt zu wenden und manchen peinlichen Eindruck zu verwischen. So verzichtete man 2004 auf die Verleihung des Deutschen Bücherpreises, der aus einer sechs Kilogramm schweren, von Günter Grass gestalteten Bronzetrophäe, dem »Bücher-Butt«, bestand. Und der Verleihungszeremonie, bei der das Fernsehballett des Mitteldeutschen Rundfunks auftrat und die bedauernswerte Nana Mouskouri von Wunderkerzennebel begleitet »Freude schöner Götter- funken« singen musste, trauerte keiner nach.