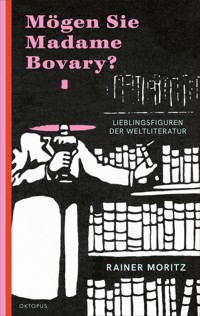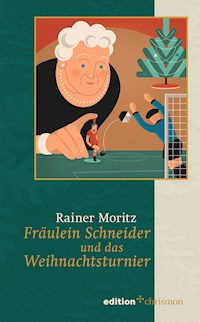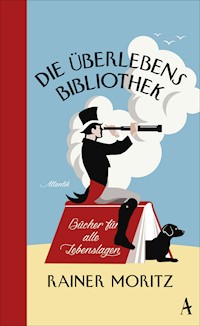
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer im Leben bestehen will, braucht Bücher. In seiner Überlebensbibliothek schreibt Rainer Moritz über Romane, die die Macht haben, seine Leser zu verändern und in allen Lebenslagen zu begleiten. Nicht selten ersetzen sie den besten Freund - oder den Therapeuten. So hilft Philip Roths Sabbaths Theater bei Fragen zu Sex im Alter weiter, während Elfriede Jelineks Die Klavierspielerin all die-jenigen lesen sollten, die beabsichtigen mit ihrer Mutter zu leben. Und wer nach Geld und Gut strebt, der ist mit F. Scott Fitzgeralds Der große Gatsby bestens beraten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Rainer Moritz
Die Überlebensbibliothek
Bücher für alle Lebenslagen
Atlantik
Die Überlebensbibliothek
»Stell dir das vor, Lukas. Stell dir vor, in der Botanik stehe einer auf und sagt, man könne über die Flora meinetwegen des Ammerlands bessere Beobachtungen und Aufschlüsse gewinnen, wenn man statt eines Mikroskops irgendein verschwärmtes Naturgedicht über die Veilchen im Frühjahr oder was weiß ich heranzieht. Nichts gegen die Literatur. Aber alles zu seiner Zeit. Alles an seinem Platz.«
KLAUS MODICK, Moos
»Aber es kam schon nicht mehr darauf an, was ich las und welche Meinung ich hatte, viel wichtiger war, dass ich nicht allein war, wenn ich las, dass andere ebenso dachten und hofften wie ich und vor mir das formuliert hatten, was ich nicht formulieren konnte, und dass ich in diesen Sätzen meine Gedanken erkannte, ohne mich bei dieser Art Aneignung anstrengen zu müssen, vielmehr das bebende Glück des Lesenden fühlte: im Text eines anderen so viel Eigenes zu finden, sogar auf der Sportseite.«
FRIEDRICH CHRISTIAN DELIUS, Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde
»Sie las jedes Buch als Beschreibung des eigenen Lebens, lebte dabei auf; rückte mit dem Lesen zum ersten Mal mit sich selbst heraus; lernte, von sich zu reden; mit jedem Buch fiel ihr mehr dazu ein. So erfuhr ich allmählich etwas von ihr.«
PETER HANDKE, Wunschloses Unglück
»Haben Sie es nicht zuweilen erlebt, in einem Buche einer bestimmten Idee zu begegnen, die man verschwommen und unklar längst in sich selbst trägt? Wie aus der Ferne schwebt sie nun mit einem Male auf einen zu, gewinnt feste Umrisse, und es ist einem, als stehe man vor der Offenbarung seines tiefsten Ichs …«
GUSTAVE FLAUBERT, Madame Bovary
Warum (diese) Bücher lesen?
Eine Einleitung nebst Inhaltsverzeichnis
Warum beschäftigt man sich mit Büchern, die auf den ersten Blick ohne praktischen Nutzen sind? Warum lesen, was nicht sinnvolle Anweisungen gibt, wie man seinen Hamster pflegt, einen wohlschmeckenden italienischen Rinderschmorbraten zubereitet oder eine Fernbeziehung führt? Was verleitet Menschen dazu, sich erfundene Geschichten anzuhören, die keine konkrete Anweisung zum Handeln geben und sich von der realen Lebenswelt lösen? Eine seltsame Macht scheint von diesem Erfundenen auszugehen; auf verschlungene Art und Weise berührt uns oft, was sich Autorinnen und Autoren ausgedacht haben, und verbindet sich mit unserem Leben, ohne dass wir genau zu sagen wüssten, wie und weshalb.
Aber: Ist es überhaupt sinnvoll, Romane und Erzählungen wörtlich zu nehmen und sie – in welcher Form auch immer – als Hilfestellung fürs Leben zu betrachten? Zum Beispiel um die unzähligen Unzulänglichkeiten, die sich mit der eigenen Person verbinden, in den Griff zu bekommen:
Wer sich selbst unterschätzt, lese:Hans Christian Andersen, Das hässliche Entlein
Wer davon träumt, auf würdige Weise alt zu werden, lese:Theodor Fontane, Der Stechlin
Wer als Übergewichtiger, Neureicher oder Brillenträger Trost braucht, lese:René Goscinny, Der kleine Nick
Wer sein musikalisches Unvermögen beklagt, lese:Franz Grillparzer, Der arme Spielmann
Wer sich selbst fad, langweilig und unattraktiv findet, lese:Marlene Faro, Die Vogelkundlerin
Wer in Rente geht, lese:Heimito von Doderer, Die erleuchteten Fenster
Wer die eigene Kindheit für unbedeutend hält, lese:Gerhard Henschel, Kindheitsroman
Wer – bevor die Erinnerungen einsetzen – etwas über die Art des Sich-Erinnerns erfahren will, lese:Marcel Proust, Combray
Ja, Bücher leisten Erste Hilfe – das behauptet dieses Buch, ohne Umschweife. Sich mit Literatur zu befassen und sie nur als Anlass für theoretische Erörterungen zu nehmen hat mich nie befriedigt. Der große Reiz des Lesens (und auf fiktionale Prosa will ich mich beschränken) besteht darin, dass die Literatur andere Sichtweisen anbietet, eine Brücke zum Leben der Leser schlägt und dennoch keine simplen Gebrauchsanleitungen gibt. Ja, darin liegt vielleicht das Paradox: Es geht mich persönlich an, wenn Stendhal das Innenleben eines intriganten Aufsteigers plausibel macht, wenn Thomas Bernhard Merkwürdiges aus einem Ohrensessel berichtet oder Jane Austen Gesellschaftsrituale ausbreitet, die auf den ersten Blick mit den gegenwärtigen nichts zu tun haben. Auf den zweiten allerdings sehr wohl.
Wer unter Eifersucht leidet, lese:Marcel Proust, Eine Liebe Swanns
Wer für seinen Fußballwahn eine intelligente Begründung sucht, lese:Friedrich Christian Delius, Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde
Wer nicht alle dicken Bücher aller Autoren lesen kann und etwas für zwischendurch sucht, lese:Thomas Mann, Das Eisenbahnunglück
Wer heftig nach Geld und Gut strebt, lese:F. Scott Fitzgerald, Der große Gatsby
Wer abschreckende Beispiele von Völlerei zur Einhaltung seiner gesunden Lebensweise benötigt, lese:Siegfried Lenz, Kummer mit jütländischen Kaffeetafeln
Wer dem Verzehr von Geflügel feindlich gegenübersteht, lese:Burkhard Spinnen, Langer Samstag
Wer dem Verzehr von Geflügel aufgeschlossen gegenübersteht, lese:Wolf Haas, Der Knochenmann
Wer Sorgen mit Likör bekämpft, lese:Wilhelm Busch, Die fromme Helene
Die Literaturwissenschaft ist in dieser Hinsicht oft reichlich schreckhaft: Ein »wissenschaftlicher« Zugang zu den Texten verbiete es, Werke der Weltliteratur als Identifikationsangebote zu lesen, als Projektionsfläche für ein »Sich-Wiederfinden«. Das stimmt einerseits, denn wer Literatur als Leitartikel oder Psychotipp versteht, verfehlt das, was sie ausmacht, und selbstverständlich sind Kunstwerke historisch eingebettet und ihrer Entstehungszeit verpflichtet. Andererseits ist es töricht, zu leugnen, dass die kleinen und großen Geschichten der Weltliteratur uns nicht persönlich betreffen, betreffen können – über alle Zeiten und Ländergrenzen hinweg. Wer Goethes Leiden des jungen Werther liest, ohne über unerfüllte Liebe und über Freitod nachzudenken, ist ein armseliger Leser.
Wer die Wirklichkeit nicht gegen Träume ausspielen will, lese:Alain-Fournier, Der große Meaulnes
Wer von der Allmacht der Bücher noch nicht ganz überzeugt ist, lese:Helene Hanff, 84, Charing Cross Road
Wer dazu neigt, die gleichen Fehler wieder und wieder zu begehen, lese:Patrick Hamilton, Hangover Square
Wer es nicht für möglich hält, was ein altes Gemälde auszulösen vermag, lese:Donna Tartt, Der Distelfink
Wer das Telefon als menschenunwürdiges Kommunikationsmittel ablehnt, lese:Karl Valentin, Buchbinder Wanninger
Wer der Welterkenntnis beim Spazierengehen auf die Schliche kommt, lese:Gerhard Meier, Land der Winde
Wer ein Entkommen aus dem Berufsleben sucht, lese:Herman Melville, Bartleby
Wer nicht glaubt, dass traurige (Lese-)Erfahrungen glücklich machen können, lese:William Trevor, Turgenjews Schatten
Wer Ruhe sucht und alle Dinge ernst nimmt, lese:Adalbert Stifter, Der Nachsommer
Wer in Erwägung zieht, ein Häuschen vor der Stadt zu beziehen, lese:Richard Yates, Zeiten des Aufruhrs
Die Überlebensbibliothek versucht eine Balance zwischen den Polen zu wahren. Sie tut, bewahre, nicht so, als seien Romane Allround-Heilmittel, die ein gutes Leben garantierten. Und ich möchte, bewahre, keinen neuen Kanon bedeutender Prosawerke aufstellen; nein, es geht mir darum, glückliche Lesemomente ins Gedächtnis zu rufen, an siebzig bekannte und unbekannte Bücher zu erinnern und diese – manchmal mit leise ironischem Unterton – hoffentlich so lebendig vorzustellen, dass sie Leserinnen und Lesern in bestimmten »Lebenslagen« hilfreich werden könnten. Die Auswahl ist durch und durch subjektiv, doch jeder, der eine Wahl trifft, hofft insgeheim darauf, dass er Gesinnungsfreunde findet, sei es in Oberschwaben oder Griechenland.
Wer die Heimat nicht vergessen will, lese:Maria Beig, Rabenkrächzen
Wer vom guten Leben in der Provinz träumt, lese:Egon Gramer, Gezeichnet: Franz Klett
Wer Belgien unterschätzt, lese:Brigitte Kronauer, Verlangen nach Musik und Gebirge
Wer Schafe (und Island) sehr gernhat, lese:Hallgrímur Helgason, Vom zweifelhaften Vergnügen, tot zu sein
Wer einen Wüstentrip gebucht hat und damit nicht recht glücklich wird, lese:Karen Duve, Regenroman
Wer altmodisches Reisen schätzt, lese:Erhart Kästner, Ölberge, Weinberge
Keine Angst also, Literatur wird hier nicht als von den Krankenkassen anerkannte Therapieform verstanden. Es scheint mir nur so, als seien ihre in Sprache gefassten Geschichten durch nichts anderes zu ersetzen. Ja, Lesen ist lebensnotwendig, und wenn es mir zu zeigen gelingt, warum dem so ist, dann hat Die Überlebensbibliothek ihren Sinn vielleicht erfüllt. Literatur – so meine Erfahrung, seitdem ich vor über fünfundvierzig Jahren zu ersten Expeditionen in die (Heilbronner) Stadtbücherei aufbrach – verstört, verblüfft, verwirrt und bereichert – obwohl man manchmal erst viel später erkennt, was Bücher in einem bewegten. Warum haben mich Bücher wie Die kleine Hexe, Unser Sturmvogel hat Räder, Bei uns ist immer was los oder Hans Erich Nossacks geheimnisvolle Erzählung Das Federmesser seinerzeit so aufgewühlt? Ich weiß es auch heute nur in Annäherungen zu beschreiben, doch früh wurde mir klar, dass ich in diesen – qualitativ so unterschiedlichen – Texten fand, was ich nirgendwo anders finden konnte, in ihnen Charakteren begegnete, die ich nirgendwo sonst traf.
Wer seine Mitmenschen für tolle Typen hält, lese:Sibylle Berg, Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot
Wer weiß, dass nur Freunde das Leben lebenswert machen, lese:Sammy Drechsel, Elf Freunde müsst ihr sein
Wer sich scheut, mit seinen Kindern zusammenzuleben, lese:Julien Green, Adrienne Mesurat
Wer beabsichtigt, dauerhaft mit seiner Mutter zusammenzuleben, lese:Elfriede Jelinek, Die Klavierspielerin
Wer es für eine sinnvolle Idee hält, die Eltern jedes Wochenende zu besuchen, lese:Pierre Bost, Ein Sonntag auf dem Lande
Wer einfach nur angerührt werden möchte, lese:Carson McCullers, Das Herz ist ein einsamer Jäger
Wer von einer Abhängigkeit in die nächste rutscht, lese:Brigitte Schwaiger, Wie kommt das Salz ins Meer
In Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit heißt es: »In Wirklichkeit ist jeder Leser, wenn er liest, eigentlich der Leser seiner selbst. Das Werk des Schriftstellers ist lediglich eine Art von optischem Instrument, das der Autor dem Leser reicht, damit er erkennen möge, was er in sich sonst vielleicht nicht hätte sehen können.« Auf Anhieb leuchtet diese Sentenz ein, bestärkt sie doch einen Leseeindruck, den viele kennen: Ein Roman spricht uns an, weil wir eigene Erfahrungen in ihm gespiegelt sehen und weil wir uns mit seinen Figuren und deren Handeln zu identifizieren beginnen. Texte, die kaltlassen, bewegen nichts, bewegen uns nicht. Und doch ist Prousts Erkenntnis nicht ohne Abgründigkeit.
Wer mal wieder an die Durchschaubarkeit der Welt glauben will, lese:Arthur Conan Doyle, Ein Skandal in Böhmen
Wer manchmal an seinen Familienerinnerungen irrewird, lese:Kirsty Gunn, Regentage
Wer manchmal allen Erinnerungen misstraut, lese:Julian Barnes, Vom Ende einer Geschichte
Wer zuhören will, wie sich gesellschaftliche Werte auflösen, lese:Arthur Schnitzler, Leutnant Gustl
Wer den Glauben an persönliches Engagement wenigstens ab und zu gestärkt sehen will, lese:Antonio Tabucchi, Erklärt Pereira
Wer an der Gerechtigkeit der Welt (ver)zweifelt, lese:Friedrich Glauser, Wachtmeister Studer
Wer seinen artigen Kindern etwas (aber nicht zu viel) Auflehnungsgeist einzuflößen wünscht, lese:Mark Twain, Tom Sawyers Abenteuer
Eine Frage bleibt dennoch: Sind Lesende, die bei der Lektüre nur im Buch ihres Innenlebens blättern, überhaupt in der Lage, neue Erfahrungen zu machen, sich von Erfahrungen anderer leiten zu lassen, die ihr Ich zuvor nicht kannte? Oder besteht der Reiz der Lektüre nicht darin, unbekanntes Terrain kennenzulernen und sich nicht nur im vertrauten Sumpf zu bewegen? Der Schriftsteller als »optisches Instrument«, das als Sehhilfe fungiert: für neue Ansichten vom eigenen Ich. Das ist ein schönes Bild – und eine treffliche Bestimmung dessen, was »schöne« Literatur sein kann.
Wer darüber nachdenkt, sich dauerhaft mit Juristen einzulassen, und an deren Weltsicht zweifelt, lese:Albert Drach, Untersuchung an Mädeln
Wer Pro- und Contra-Argumente für das moralisch noch nicht völlig akzeptierte Leben mit zwei Partnern sucht, lese:Wilhelm Genazino, Die Liebesblödigkeit
Wer darauf spekuliert, das Glück anderswo zu finden, lese:Eduard von Keyserling, Wellen
Wer lebenslängliches Liebesglück nicht für HollywoodKitsch hält, lese:Ian McEwan, Saturday
Wer liebt und nicht auf Erfüllung hoffen darf, lese:Johann Wolfgang Goethe, Die Leiden des jungen Werther
Wer als Mann eigenen Torheiten vorbeugen will, lese:Adolf Muschg, Noch ein Wunsch
Wer einer vergangenen Liebe nachtrauert, lese:Cees Nooteboom, Mokusei!
Wer Weib oder Mann seines/r Nächsten begehrt, lese:Hans Erich Nossack, Spätestens im November
Wer daran glaubt, lese:Hanns-Josef Ortheil, Die große Liebe
Wer Sex im Alter für normal hält, lese:Philip Roth, Sabbaths Theater
Wer Trennungen für ein Unglück hält, lese:Tim Krabbé, Drei auf dem Eis
Wer nicht genau weiß, warum es mit der ersten Liebe nichts wurde, lese:Theodor Storm, Immensee
Wer der ersten Liebe eine zweite Chance geben will, lese:Elizabeth Taylor, Versteckspiel
Wer eine wunderbare Geschichte der ersten Liebe kennenlernen möchte, lese:Martin Walser, Ein springender Brunnen
Wer sich als »Homme à Femmes« sieht, lese:Stephen Vizinczey, Wie ich lernte, die Frauen zu lieben
Freilich sind Bücher kein Allheilmittel; sie bewahren uns nicht davor, außerhalb der bedruckten Seiten zu leben – bis zum Tod. Dieser ist, wie die Liebe, ein unerschöpfliches Thema der Literatur. Er ist nicht zu (be)greifen, er führt viele in die Verzweiflung, und keiner, auch der Gläubigste nicht, weiß, was er wirklich bedeutet. Gerade deshalb handelt die Literatur davon:
Wer ahnt, dass jeder für sich allein stirbt, lese:Erich Kästner, Fabian
Wer die Angst vor dem Tode ein wenig verlieren möchte, lese:Hermann Lenz, Verlassene Zimmer
Wer noch mehr Angst vor dem Tode verlieren möchte, lese:Klaus Modick, Moos
Wer eine Schuld abzutragen hat und nicht weiß, wie, lese:William Maxwell, Also dann bis morgen
Wer sich mit dem Tod des Partners nicht abfinden mag, lese:Georges Rodenbach, Das tote Brügge
Wer die Mutter verliert, lese:Peter Handke, Wunschloses Unglück
Wer den Vater verliert, lese:Matthias Politycki, Tag eines Schriftstellers
Wer nirgendwo mehr ein Hoffnungslichtlein sieht, lese:Karen Duve, Weihnachten mit Thomas Müller
Die Überlebensbibliothek ist ein Plädoyer für die Macht der Lektüre. Und dennoch seien die Augen nicht vor schädlichen Begleiterscheinungen verschlossen. Nicht immer ist Lesen dem Glück zuträglich; auch das wurde in der Literatur bedacht:
Wer erfahren will, dass Lesen nicht automatisch eine persönlichkeitsfördernde Beschäftigung sein muss, lese:GUSTAVE FLAUBERT, Madame Bovary
Mit sich selbst zurechtkommen
Wer sich selbst unterschätzt, lese:
HANS CHRISTIAN ANDERSEN, Das hässliche Entlein
Märchen spielen in der pädagogischen Unterweisung von Kindern eine wichtige Rolle, und clevere Eltern verstehen es, den Sinn der Geschichten so lange zu drehen und zu wenden, bis er auf den Alltag der lieben Zöglinge passt. Rotkäppchen oder Schneewittchen erfreuen dadurch, dass das Böse seiner gerechten Strafe zugeführt wird, und als jugendlicher Aschenputtel-Leser genießt man den Trost, natürliche Bescheidenheit am Ende obsiegen zu sehen. Hans im Glück wiederum liefert eine Lehre, die sozial dämpfend wirkt und nahelegt, den Wert irdischer Güter nicht zu überschätzen. Der tölpelhafte, aber freundliche Hans klammert sich nicht an Materielles und genießt sein Leben, obwohl er vom bürgerlichen Gewinndenken her betrachtet ein rechter Versager ist.
Nicht alle Märchen funktionieren so einfach, und nicht alle Märchen lesen sich so, als sei ihre Handlung wirklich für Minderjährige ersonnen. Ludwig Bechsteins so düster-mittelalterliche Märchen wirken unheimlich, und Ludwig Richters Illustrationen mildern diesen Eindruck nicht. Auch der Däne Hans Christian Andersen (1805–1875) ist keiner von den »kindgerechten« Autoren. Seine einfallsreichen Erzählungen finden bis heute bei Erwachsenen viel Zuspruch, ja manchmal scheint es so, als ob der Schuhmachersohn Andersen gar nicht zum Märchenonkel für Kinder tauge.
Das hässliche Entlein ist eines seiner berühmtesten Märchen, und es ist wunderbar geeignet, über Sein und Schein nachzudenken und unterentwickeltes Selbstbewusstsein zu stärken. Worin liegt der Charme dieser rührenden Geschichte mit Happy End? Andersens Hauptfigur weckt vom ersten Moment an Mitleid: Noch ehe das Entlein das herrliche Landlicht erblicken darf, sitzt beziehungsweise liegt es bereits auf der Strafbank. Seine vom langen Brüten recht erschöpfte Mutter muss sich dazu zwingen, dieses dicke Ei, das trotz allen Zuredens nicht aufplatzen will, nicht links liegenzulassen. Endlich ist es so weit: Ein ungemein unschönes, kaum entenähnliches Etwas bricht hervor, und vom ersten Atemzug an erlebt dieses Demütigungen, deren Begründungen einfachster Art sind: »›Ja, aber es ist zu groß und eigenartig!‹, sagte die Ente, die biss, ›und deshalb muss es gepufft werden.‹«
Andersens Märchen ist ein Lehrstück über Vorurteile. Das Anderssein des Entchens genügt, um es aus dem sozialen Kontext auszuschließen; selbst seine Mutter, die anfänglich tapfer versucht, sich ihr Kind schönzureden (»… wie schön es die Beine gebraucht, wie rank es sich hält! Es ist mein eigenes Kind! Im Grunde ist es doch ganz hübsch, wenn man es richtig anschaut«), und ihm ein »herzlich gutes Gemüt« bescheinigt, weiß bald nichts mehr mit dem Fremdling anzufangen. Dem gebissenen, gepufften und beschimpften Tier bleibt nur die Flucht, ein Umherirren, das es schließlich in ein Bauernhaus führt, zu Frau, Henne und Kater. Auch dort regiert die Ignoranz: Als das Entlein vom Schwimmen und Tauchen zu schwärmen beginnt, erntet es heftige Rügen aus dem Mund des sich weltläufig gebenden Huhns. Je kleiner die Welt, desto enger der Horizont – diesen Zusammenhang führt Andersen eindringlich vor, versehen mit klarer Erkenntnisanleitung für sein Publikum und doch so liebevoll, dass man die Hartnäckigkeit, mit der hier moralische Lehren verkauft werden, gerne übersieht.
Das hässliche Entlein – ein Enterich zum Glück, denn da mache, wie die Mutter frohlockt, das Äußere nicht »so viel« aus – zählt zu den positivsten Helden der Weltliteratur. Nie lehnt es sich auf, nie wehrt es sich, ja wo immer es geht und steht, versucht es das Beste aus seinem Elend zu machen: »›O gottlob!‹, seufzte das Entlein, ›ich bin so hässlich, dass selbst der Hund mich nicht beißen mag.‹« Auch am Ende, als die wunderbare Metamorphose einsetzt und aus der falschen Ente ein prächtiger, »königlicher« Schwan wird, verliert dieser seine Demut nicht und fühlt sich »ganz beschämt« von so viel Glück.
Natürlich kann man gegen Andersens Märchen allerhand einwenden und die wundersame Wandlung als Beruhigungstropfen für gesellschaftliche Außenseiter sehen, die bitte schön auf eine ferne Zukunft hoffen sollen. Doch wer will den Reiz der Geschichte auf diese Weise zerstören? Zu angenehm ist es – für kleine und für große Kinder –, davon zu hören, dass Niedertracht nicht das letzte Wort im Weltenlauf haben muss und dass es möglich ist, sich auch aus misslichsten Lagen zu befreien. Die Natur ist – wenigstens im Hässlichen Entlein – manchmal so eingerichtet, dass sich die Waagschalen von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ausgleichen. Nicht alle Schieflagen müssen von Dauer sein, nicht alle Deklassierungen sind unüberwindlich. Und wer sich erinnert, wie es war, als man dieses Entenmärchen zum ersten Mal hörte, der weiß um das wohltuende Gefühl, welches die Schwanwerdung in Kinderohren auslöst. Wie grausam war es doch auch, das Schicksal des Entleins, von Mutter und Geschwistern getrennt, ganz allein auf der Welt und fern allen Glücks … bis zur märchen- und zauberhaften Wendung. Selbst wenn nicht aus allen ästhetisch unbefriedigenden Säuglingen Modellathleten und Glamourgirls werden können: Ohne Hoffnung auf den nächsten Tag, an dem, wennschon nicht alles, dann wenigstens ein bisschen was anders wird, geht es nicht.
HANS CHRISTIAN ANDERSENSDas hässliche Entlein erschien 1843 im dänischen Original (unter dem Titel Den grimme Ælling). Auf Deutsch liegt das Märchen (manchmal auch als Das hässliche junge Entlein) in zahlreichen Übersetzungen vor, zum Beispiel in der von Floriana Storrer-Madlung in der Manesse-Bibliothek der Weltliteratur.
Wer davon träumt, auf würdige Weise alt zu werden, lese:
THEODOR FONTANE, Der Stechlin
Sagen Sie nicht, liebe Leserin, dass Sie später eine »unkonventionelle Alte« werden wollen! Davon haben wir wirklich genug, ja mittlerweile scheint es Mode geworden zu sein, auf spleenige, schräge Weise seinen Lebensabend zu beschließen. Wann, wer und womit das angefangen hat, lässt sich schwer sagen, mit Filmen wie Harold und Maude oder Lina Braake, mit Udo Jürgens’ Mit 66 Jahren? Mit nervenden Talkshow-Auftritten von Lotti Huber, Brigitte Mira, Inge Meysel oder Johannes Heesters, den man auch in diese Schublade stecken darf? »Älter werde ich später«, dieses penetrante Motto, mit dem Iris Berben vor ein paar Jahren ein Frischhalte-Ratgeberbüchlein betitelte, scheinen sich alle auf die Fahnen zu schreiben, die von den Gesetzen des Vergehens nichts wissen wollen und schnell vergessen, dass Unkonventionalität leicht in Lächerlichkeit umschlägt.
Nun ja, Iris Berbens Lieblingsschriftsteller sind, wie sie zwischen Gurkenmaskensitzungen und Wohltätigkeitsauftritten bekannte, Pasolini, Jelinek und Shakespeare; kein Wort hingegen von Theodor Fontane (1819–1898) und dessen Roman Der Stechlin – wen wundert’s. Wer sich die Muße nimmt, dieses langsam voranschreitende, fein gebaute Buch zu lesen, bekommt eine Ahnung davon, was es heißen mag, die Stationen des Lebens ernst zu nehmen und seinen Weg mit Würde zu gehen. Den Stechlin zu loben fällt nicht schwer. Während Fontanes Zeitgenossen ihre liebe Müh und Not damit hatten, das Ungewöhnliche dieser aus vielen Dialogen zusammengesetzten Figuren- und Gesellschaftszeichnung zu goutieren, gilt Der Stechlin heute – neben Effi Briest – als Fontanes Meisterwerk. Hier klingt etwas aus, hier hat es sich ein Schriftsteller zum Ziel gesetzt, ein Resümee in Romanform vorzulegen, wiewohl es ihm nicht vergönnt war, das Erscheinen seines Alterswerks in Buchform zu erleben.
Freunde komplexer Handlungselemente und spannungsreicher Intrigen werden sich für den Roman kaum erwärmen. Während Effis Schicksal durch den Ehebruch, den »Schritt vom Wege«, mit ordentlich Dramatik aufwartet, geschieht im Stechlin herzlich wenig. Fontane war sich dieser Eigentümlichkeit bewusst und konnte den Inhalt seines umfangreichsten Romans in einem oft zitierten Brief mühelos zusammenfassen: »Zum Schluss stirbt ein Alter, und zwei Junge heiraten sich.« Ein bisschen täuscht das, denn das eine oder andere geschieht überdies auf Schloss Stechlin, wo der »Alte« Dubslav von Stechlin lebt, oder in Berlin, wo Sohn Woldemar seiner späteren Gemahlin Armgard den Hof macht. Immerhin lässt sich Dubslav sogar als Kandidat im Wahlkreis Rheinsberg-Wutz für die Reichstagswahlen aufstellen und muss – so sind die Zeiten – damit zurechtkommen, dass er als Konservativer dem sozialdemokratischen Widersacher unterliegt.
Dennoch: Fontane betritt in seinem letzten Roman Neuland, einen Blick in das neue Jahrhundert riskierend und dessen ästhetische Revolutionen andeutend. »… die Dinge an sich sind gleichgültig. Alles Erlebte wird erst durch den, der es erlebt«, heißt es an einer Stelle, und dieses unscheinbare Dialogstück verrät, wohin sich die Neugier des alten Fontane wendet: Noch ist es nicht der moderne Bewusstseinsfluss, der alle Ereignisse durch die Wahrnehmung einer Person filtert, doch einen Schritt in diese Richtung tut Der Stechlin: Das Gespräch als hohe Form menschlichen Verstehens und Sich-Näherkommens wird zum Medium für die – nicht wenigen – Romanfiguren, Klarheit über sich und die Welt zu gewinnen.
An Themen mangelt es dabei nicht: Dubslav von Stechlin weiß, dass der gute alte Adel, den er mustergültig repräsentiert, auf verlorenem Posten steht und dass die »neue Zeit« vor dem Ufer des unterschwellig brodelnden Stechlin-Sees nicht innehalten wird. Er versteht es, mit diesem Wissen umzugehen und nicht in dogmatisches Wehklagen zu verfallen. Alles in diesem Roman sei, so Fontane, »Plauderei«, und dieses Hin und Her der Argumente und Anschauungen bringt es mit sich, dass nicht auf der Richtigkeit eines Urteils bestanden wird. »Wenn ich das Gegenteil gesagt hätte, wäre es ebenso richtig« – darin bündelt sich, bei aller leisen Koketterie, Dubslavs Alterssicht, die weder ein Laisser-faire noch ein starrsinniges Beharren auf den alten Werten predigt.
Darin liegt ein Zauber des Romans: Man lauscht Gesprächen über Friedrich den Großen, Krammetsvögel, Bienenzucht, technische Neuerungen, Katholizismus, die Kunst der Sängerin Jenny Lind, Feuerwerke, Englands Attraktionen, Arnold Böcklin, die märkische Landschaft, den Tod … und hat das Gefühl, an einem Für und Wider teilzuhaben, das zu einer Synthese der Anschauungen führt, zum Erkennen dessen, was den »großen Zusammenhang der Dinge« ausmacht, ausmachen könnte. Einzelne Gespräche werden zu dramatischen Höhepunkten, etwa wenn Pastor Lorenzen, der christliche und sozialistische Ideen zusammenführen möchte, mit Armgards Schwester Melusine – ein Name, der, bezeichnend für die Literatur um 1900, an Meerjungfrauen und das sinnliche Element des Wassers erinnert – die preußische Geschichte des 19. Jahrhunderts rekapituliert und beide großen Gefallen an ihrem »revolutionären Diskurse« finden.
Der Stechlin ist ein Roman über Geschichte und über Geschichtsphilosophie, der seine spezielle Note dadurch erhält, dass wir alles mit den Augen eines Mannes sehen, der das Neue nicht mehr erleben wird. »Solange ich hier sitze, so lange hält es noch. Aber freilich, es kommen andere Tage« – Dubslavs nüchterne Erkenntnis hat nichts Verhärmtes an sich, freilich auch nichts Gleichgültiges. Wenngleich Fontane seinen letzten Roman weitgehend in Adelsgefilden ansiedelte, verfolgte er die Angelegenheiten des »vierten Standes« sehr genau und wusste um die bevorstehenden Umbrüche. Bereits die berühmte Auftaktszene, in der die Kamera des Erzählers über die »Stechline« – den See, den Wald, das Dorf, den Hausherrn – schwenkt, verrät die Doppelbödigkeit des Gesehenen. Ganz »still« wirkt der See, und doch wissen alle, die mit ihm vertraut sind, dass die Ruhe trügerisch ist: Wann immer irgendwo, »sei’s auf Island, sei’s auf Java«, die Natur in Unordnung gerät und sich Vulkane regen, gerät der Stechlin-See in Wallung. Die (Nach-)Beben des historischen Wandels berühren jeden und verschonen die Grafschaft Ruppin und deren Herrenhäuser nicht. Das zu wissen ist schon einiges, und damit zu altern ist unkonventionell genug.
THEODOR FONTANES Roman Der Stechlin erschien zuerst 1897 in der Zeitschrift »Über Land und Meer« und 1898 im Verlag Friedrich Fontane, Berlin.
Wer als Übergewichtiger, Neureicher oder Brillenträger Trost braucht, lese:
RENÉ GOSCINNY, Der kleine Nick
Keine Frage: Anderswo ist es meistens schöner, strahlt die Sonne wärmer, schmeckt das Bier besser, gedeihen die Rosen prächtiger, sind die Kirschen süßer und leben Eltern mit ihren Kindern in bester Eintracht. Der Mensch neigt – so ist er von Natur aus – dazu, die Malaisen seines eigenen Lebens überdeutlich zu sehen, sich vom Schicksal gepeinigt zu wissen und all die schönen Menschen um sich herum für Privilegierte zu halten. Natürlich hat das vor allem damit zu tun, dass man die Defizite vor und hinter der eigenen Haustür viel besser kennt und vom Leben der anderen oftmals nur die äußere Fassade – den brandneuen Sportwagen, die adretten, höflichen Kinder. Die Literatur hat folglich auch die einfache Aufgabe, diesen schönen Schein kritisch zu beäugen und die Abgründe derjenigen zu zeigen, denen alles leicht von der Hand zu gehen scheint.
Allein deshalb erfreuen sich Familiengeschichten – von den Buddenbrooks bis zu Eugen Ruges In Zeiten des abnehmenden Lichts – so großer Beliebtheit. Wir schauen hinter die fest verschlossenen Wohnungstüren und nehmen Platz am Tisch derjenigen, die wir um ihren unermesslichen Reichtum, ihr täglich praktiziertes Sexleben oder ihre innere Schönheit beneiden. Und plötzlich erkennen wir, wie dünn das Eis ist, auf dem die Göttergünstlinge sich bewegen, hören wir gerne von deren Sorgen und Nöten und kehren am Ende des Buches nicht mehr ganz so unfroh in die Realität der eigenen vier Wände zurück, wissend, dass nicht alles Gold ist, was beim Nachbarn glänzt.
Ein Meisterstück hilfreicher Literatur dieser Art sind die Geschichten vom kleinen Nick, die sich René Goscinny (1926–1977) ausgedacht und Jean-Jacques Sempé (*1932) aufs Feinste illustriert hat. Was dieser französische Junge, der mal sieben und mal eher zehn ist, an kleinen und großen Abenteuern erlebt, ist in all seinen Übertreibungen ein Trostspender für alle Eltern, die sich für Versager halten, und für alle Kinder, die mit sich selbst und der Welt im Unreinen sind.
René Goscinnys Nick lebt in einer überschaubaren Welt voller schulischer und familiärer Katastrophen und darf sich dennoch darauf verlassen, dass selbst die schlimmsten Verwicklungen nie zu einem völligen Zusammenbruch seines sozialen Gefüges führen werden. Von heute aus betrachtet, atmen diese urkomischen Geschichten – ohne irgendwie muffig zu wirken – den Geist des unwiederbringlich Verflossenen. Ja, so ging es damals zu, nicht nur in Frankreich: Fernseher und Telefon waren kostspielige Errungenschaften; eine Reise mit dem Flugzeug galt als Sensation; vor Urlaubsfahrten schützte man die staubgefährdete Wohnzimmergarnitur mit Schonbezügen, und wenn die häusliche Speisekarte ein Vorspeisen-Highlight aufweisen sollte, zauberte Mutter Schinkenröllchen mit Mayonnaise und Füllung (wir tippen auf grüne Erbsen aus der Konserve) auf den Abendbrottisch.
Nick fühlt sich eingebunden in einen Freundeskreis, der aus charakterstarken Typen besteht: Otto zum Beispiel, ein stark übergewichtiges Kind, dessen Denken ausschließlich um Croissants, Butterbrote, Marmeladentöpfe und Gulasch kreist. Oder Franz, der Pausenhofkonflikte auf seine Weise löst: »Der Franz, der ist sehr stark, und er haut seinen Freunden gern eins auf die Nase, und er beklagt sich manchmal, dass seine Freunde so harte Nasen haben, und er tut sich weh dabei.« Und nicht zu vergessen Chlodwig, das Klassenschlusslicht, Georg mit seinen sehr reichen Eltern nebst Butler und Primus Adalbert, der der Lehrerin nach dem Mund redet und als Brillenträger bedauerlicherweise bei Klassenkeile nur bedingt zum Opfer taugt.
Mädchen kommen in dieser Jungswelt nur am Rande vor, doch wenn sie auftauchen, wohnt ihnen – wie Nicks Nachbarin Marie-Hedwig – ein Zauber inne, der erste seelische Verwirrungen hervorruft und andeutet, dass die Welt vielleicht nicht nur aus Fußball, Pommes frites und Auf-Bäume-Klettern besteht. Marie-Hedwig, die blonde Haare hat (»… und blonde Haare sind toll, vor allen Dingen bei Mädchen«), betört Nick und macht ihn zum Gespött seiner Mitschüler, als sie ihm die Erträge ihres Gesangs- und Tanzunterrichts vorführt: »Dann hat sie sich auf die Zehenspitzen gestellt und hat sich gedreht, in den Begonien von Mama, und das ist super gewesen. Ich hab noch nie so was Hübsches gesehen, nicht mal bei Chlodwig im Fernsehen – vielleicht außer dem Cowboyfilm von voriger Woche.« Noch gesteht sich Nick seine Gefühlsaufwallung nicht ein – »Ich und verliebt? Dass ich nicht lache! Als ob man in ein Mädchen verliebt sein kann – das geht nicht mal bei Marie-Hedwig!« –, doch lebenserfahrene Leser ahnen, dass die Balletteinlage der blondgelockten Nachbarin ihre Wirkung nicht verfehlt hat.
Schule und Familie, das sind die Eckpfeiler der Nick’ schen Welt. Hier die Strafarbeiten, die Prügeleien wegen nichts und wieder nichts, die Angst vor mäßigen Zensuren und die strafenden Blicke des Aufsichtslehrers Hühnerbrüh (»Bouillon« im Original), der die Sisyphusarbeit des schlichtenden Pädagogen jeden Morgen mit neuem Elan auf sich nimmt. Und da der Ein-Kind-Haushalt mit nicht berufstätiger Mama, die in regelmäßigen Abständen damit droht, zurück zu ihrer Mutter zu gehen, und dem sich abrackernden Vater, der abends seine Ruhe haben will, sie selbstverständlich nicht bekommt und Gattin und Kind dafür verantwortlich macht, was die Hausfrau wiederum dazu bringt, ihr Schicksal zu beweinen: »Mama hat gesagt, solche Abende lassen sie um Jahre altern.« Man fährt in Urlaub, wo sich am ersten Tag unversehens Sandburgendebakel abspielen, hat ermüdende Kleiderkäufe zu tätigen, erlebt Familienfeiern, die das Haar ergrauen lassen, sieht den Vater als Berufstätigen, der seinen Rang in der Hierarchie der Arbeitswelt schönt, und trägt Fußballspiele aus, bei denen sich niemand als Schiedsrichter hergeben möchte … bis Adalbert, der Ungeliebte, sich auch noch auf dem grünen Rasen zum Sündenbock machen lassen muss.
Keine Frage, wir befinden uns in einem – sympathischen – Tollhaus, und die hehre Absicht der Erwachsenen, die Kinder zu »nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft« zu machen, findet in der Realität nur begrenzte Entsprechung. Wenn Nicks Vater sich mit den Nachbarn anlegt und Heckenstreitigkeiten zum Anlass für wutschnaubende Briefwechsel nimmt, unterscheidet sich dieser ungebärdige Trotz kaum von dem seines Sohnes, der nach Schokoladenkuchen lechzt und seinen Erziehungsberechtigten androht, sie umgehend zu verlassen. Darin steckt das charmant verpackte subversive Element in Goscinnys Geschichten. Deren ziemlich heile Welt fußt auf Übereinkünften, die stillschweigend davon ausgehen, dass das Eindeutige im Irdischen keinen Platz hat: »Das Leben ist kompliziert, mein Lieber.«
Die Geschichten vom kleinen Nick arbeiten natürlich mit Stereotypen und spielen mit Klischees. René Goscinny ist ein Meister der Wiederholung, der es seinen Lesern leicht macht, Figuren wiederzuerkennen und sich alsbald bei den Nicks wie zu Hause zu fühlen. Ottos Gefräßigkeit ist ein solcher »Running Gag«, der in zahllosen Variationen abgerufen wird. Mit einem »Ich glaube, ich habe euch schon mal von ihm erzählt« ironisiert Goscinny sein Erzählverfahren und schafft unentwegt neue Situationen, um vom Immergleichen zu berichten. Als Nachbar Bleder beispielsweise den Kindern bei einem Waldspaziergang die »Wunder der Natur« ans Herz legen will, fordert er Otto, um die Heimkehr zu sichern, auf, »kleine Brotstückchen auf den Weg fallen zu lassen wie der Hänsel im Märchen«. Schlimmeres, so zeigt die Antwort, hätte er Otto nicht abverlangen können: »Ich soll was von meinem Butterbrot fallen lassen, spinnst du?«
Die Komik der Nick-Abenteuer ist einerseits inhaltlicher Natur. Sie trägt mitunter eine ganze Geschichte – etwa wenn männliche Hypochondrie aufgespießt wird (»Und Papa hat gesagt, er liegt in Agonie und seine Familie weigert sich, seinen Zustand zur Kenntnis zu nehmen. Ich weiß zwar nicht, was das ist, ›Agonie‹, aber ich denke, das bedeutet, dass Papa Schnupfen hat«). Und sie zeigt sich andererseits in unscheinbaren Nebensätzen – etwa wenn es um die Hackordnung auf dem Spielplatz geht: »›Eigentlich müssen wir einen Häuptling haben‹, hat Georg gesagt. ›Ich schlage vor, das bin ich.‹« Dreißig Jahre später, wenn Georg auf dem Weg ist, einen gutdotierten Managerposten zu ergattern, wird er kaum anders argumentieren. René Goscinny wusste, dass der Glaube der Menschen an die Veränderbarkeit ihrer Natur selten mit der Realität in Einklang kommt. Aus dem kleinen Nick wird ein großer Nick, der wiederum in Verzweiflung darüber geraten wird, was die neuen kleinen Nicks aushecken … das ist tröstlich, irgendwie.
RENÉ GOSCINNY und JEAN-JACQUES SEMPÉ veröffentlichten ihre erste Nick-Geschichte 1959 in der Zeitung »Sud-Ouest Dimanche«. Kurz darauf erschienen die rund 80 Geschichten in Frankreich in Buchform. In Deutschland erregten die ersten, bei Mohn erschienenen Texte kein großes Aufsehen; erst als der Diogenes Verlag in den 1970er Jahren Hans-Georg Lenzens grandiose Übersetzung in fünf Bänden (Der kleine Nick, Der kleine Nick und seine Bande, Der kleine Nick und die Ferien, Der kleine Nick und die Schule, Der kleine Nick und die Mädchen) herausbrachte, wurden diese Geschichten auch hierzulande zum Klassiker. 2004 tauchten völlig überraschend aus dem Goscinny-Nachlass weitere 80 Geschichten auf, die in Frankreich unter dem Titel Histoires inédites du Petit Nicolas und 2005, wieder bei Diogenes, als Neues vom kleinen Nick auf Deutsch erschienen. Und weil das Finden von verschollenen Schätzen so schön ist, tauchten 2006 und 2009 neue Geschichten auf, die als Der kleine Nick ist wieder da! und Der kleine Nick und sein Luftballon (beide Diogenes) erschienen.
Wer sein musikalisches Unvermögen beklagt, lese:
FRANZ GRILLPARZER, Der arme Spielmann
Nicht immer ist das, was mit großer Lust und Laune betrieben wird, eine Freude für diejenigen, die in den Genuss dieses Treibens kommen. Leidenschaftliche Hingabe bedeutet nicht zwangsläufig, dass diese Liebe erwidert wird, und so dilettieren die Menschen in diesem und jenem vor sich hin … und gehen ganz in ihrem Dilettantismus auf. Indes, auch wenn der Hobbymaler oder die Gelegenheitsdichterin von ganz falschen Vorstellungen bestimmt sein mögen, ist es denkbar, dass er und sie von ihrer Kunst ein recht zutreffendes Bild besitzen – ungeachtet dessen, ob sich die Ausführung in der Praxis daran messen lassen darf.
Die Literatur des 19. Jahrhunderts ist reich bestückt mit Sonderlingen, mit Käuzen, Hagestolzen oder armen Wohltätern, die mit dem schneller voranschreitenden Erwerbsleben nicht zurechtkommen und sich mit ihren Schrullen und Marotten an den Rand der Gesellschaft zurückziehen, belächelt oft und gleichzeitig mit einer Menschlichkeit ausgestattet, die ihnen zumindest in der Literaturgeschichte einen festen Platz einräumt.
Der vor allem als Dramatiker bekannte Wiener Franz Grillparzer (1791–1872) hat in seiner Erzählung Der arme Spielmann ein Paradebeispiel einer Sonderlingsexistenz vorgestellt, eines Lebens, das reich an Enttäuschungen ist, unumgänglicherweise tragisch endet und dennoch großen Glanz ausstrahlt. Grillparzer lässt einen Ich-Erzähler, »dramatischer Dichter« im Hauptberuf und von »anthropologischem Heißhunger« getrieben, am Kirchweihfest im Wiener Vorort Brigittenau teilnehmen. Begierig, in die wilden und nicht ungefährlichen Volksmassen einzutauchen, die an diesen Tagen keine Standesunterschiede zu kennen scheinen, macht er sich auf den beschwerlichen Weg, als ihm ein Bettelmusikant auffällt, der sich ganz anders aufführt als seine Kollegen.
Jakob, so der Name des Spielmanns, müht sich selbst im größten Getümmel, nach Noten zu spielen, und entlockt seiner Violine dennoch nur ein markerschütterndes Kratzen. Des Abends, noch ehe die profitabelste Zeit für Musikanten seines Schlages beginnt, packt er zusammen und macht sich, ohne nennenswerte Einnahmen vorweisen zu können, von dannen. Sofort weckt dies die Neugier des Dichters, und es gelingt ihm, den Musikanten in seiner ärmlichen Wohnung, die er mit zwei unflätigen Handwerksgesellen teilen muss, ausfindig zu machen. Seine »Geschichte« will der Erzähler unbedingt erfahren, und hier setzt die Binnenerzählung des Armen Spielmanns ein.
Zur Verblüffung seines Zuhörers ist Jakob der Sohn eines angesehenen Hofrats, der es zu höchsten Staatsämtern brachte. Anders als der Vater und seine Brüder kommt Jakob jedoch mit den praktischen Anforderungen des Lebens nicht zurecht. Der Vater bricht, nachdem Jakob in einer Prüfung versagte, den Kontakt zu ihm ab, und der verstoßene Sohn kann froh sein, in einer Kanzlei als Abschreiber unterzukommen. Sein Leben verändert sich, als er Barbara, die Tochter eines Grieslers, eines Kolonialwarenhändlers, bemerkt, die mit glockenheller Stimme Lieder singt und Jakobs Liebe zur Musik entfacht. Nach langem Zögern nimmt er endlich allen Mut zusammen und macht sich in den Laden auf, wo Barbaras Vater den Sohn des Hofrats als möglichen Geldgeber aufs Herzlichste begrüßt.
Barbaras Verhältnis zu Jakob bleibt zwiespältig. Einerseits schätzt sie den aufrechten Charakter ihres Verehrers; andererseits weiß sie, dass dessen Ungeschick ihr keine gesicherte Existenz ermöglichen wird – zumal als sich herausstellt, dass Jakob das Erbe, das ihm nach dem Tod des Vaters zuteilwurde, an einen Betrüger verlor. Es kommt, wie es kommen muss: Barbara hat sich um ihr Auskommen zu kümmern und heiratet einen soliden Fleischer, mit dem sie die Stadt verlässt. Jakobs sozialer Abstieg geht weiter, und trotzdem findet er volles Genügen im Violinenspiel, Komponieren und Improvisieren – zum Leidwesen seiner Nachbarn, die das unsägliche Musizieren tapfer ertragen: »So habe ich mich, obzwar ärmlich, aber redlich fortgebracht bis diesen Tag.«
Nach Jahren kehrt Barbara mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen nach Wien zurück, erinnert sich an Jakob und verpflichtet ihn als Geigenlehrer für ihren Ältesten, auch Jakob genannt. So endet die Geschichte, die der Ich-Erzähler zu hören bekommt, und erst als er von einer Reise zurückkehrt, erfährt er von ihrer tragischen Fortsetzung. Sein wunderlicher Gesprächspartner kommt um, als die Donau über die Ufer tritt und die Leopoldstadt, wo Jakob haust, überflutet. Barbara übernimmt die Beerdigungskosten, und als der Erzähler ihr Jakobs alte Violine abkaufen möchte, weist sie dies entrüstet zurück. Im Gehen sieht er, was sich in Barbara, nach all den Jahren, abspielt: »Da nun zu gleicher Zeit die Magd mit der Suppe eintrat und der Fleischer, ohne sich durch meinen Besuch stören zu lassen, mit lauter Stimme sein Tischgebet anhob, in das die Kinder gellend einstimmten, wünschte ich gesegnete Mahlzeit und ging zur Tür hinaus. Mein letzter Blick traf die Frau. Sie hatte sich umgewendet, und die Tränen liefen ihr stromweise über die Backen.«
Grillparzers Der arme Spielmann ist eine traurige Geschichte, die von Verzicht, verfehltem Leben und einer inneren Gestimmtheit erzählt, die sich noch mit dem Übelsten arrangiert. Gewiss, Jakobs Herz gehörte Barbara, doch mehr – eine anmutige Szene – als ein Kuss durch eine Glasscheibe sollte zwischen beiden nicht geschehen. Die Musik ist es, die sein vom bürgerlichen Blickwinkel aus gesehen verkorkstes Leben zusammenhält. Das mag hilflos sein, so wie der Kreidestrich, den Jakob auf den Boden seiner Behausung malt, um sich von seinen Mitbewohnern abzugrenzen. Die Musik, die er unablässig spielt, rettet ihn. »Ich zitterte vor Begierde nach dem Zusammenhang« – das trieb den Erzähler in Jakobs Wohnung, als er dessen Geschichte hören wollte. Es sind verworrene, traurige und hoffnungsvolle Zusammenhänge, die sich da auftun. Wie im richtigen Leben.
FRANZ GRILLPARZERS Erzählung Der arme Spielmann erschien 1847 im Almanach »Iris«.
Wer sich selbst fad, langweilig und unattraktiv findet, lese:
MARLENE FARO, Die Vogelkundlerin
Frauenromane – diese Gattungsbezeichnung verspricht manchmal stattliche Verkaufszahlen und bringt oft dünne, klischeegesättigte Romänchen hervor, die, als der Feminismus nicht mehr angesagt war, von »Superweibern« oder Männern, die »wie Schokolade« sind, erzählten. Freilich ist es auch leichtfertig, alle Romane, die nicht nach dem Büchner-Preis schielen und sich intelligente Unterhaltung auf ihre Fahnen schreiben, vorschnell dem Gruselkabinett der Hera-Lind-Erbinnen zuzuordnen.
Die Wienerin Marlene Faro (*1954) debütierte 1996 mit einem beschwingten Roman, dessen Titel – Frauen die Prosecco trinken – zum Programm einer ganzen Frauengeneration wurde. So locker Marlene Faro mit Gefühlsverwirrungen, Diätproblemen, Cellulitisansätzen und Beziehungsdesastern umging und damit Stoff zur schmunzelnden Identifikation lieferte, so deutlich war, dass sie mit ihren Büchern nicht nur die aus Frauenmagazinen sattsam vertraute lackierte Oberfläche abbilden wollte.
Rheingard Droste, Protagonistin ihres dritten Romans Die Vogelkundlerin, verkörpert einen Frauentypus, der aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Die promovierte Ornithologin lebt bei ihrer Mutter, hält Universitätsseminare zu packenden Themen wie »Das Brutverhalten der Säbelschnäbler im rumänischen Donaudelta«, ist trotz ihrer dreißig Jahre sexuelle Novizin und befindet sich somit auf dem besten Weg, als alte, schrullige Jungfer zu enden.
Marlene Faro stattet ihre stille Heldin mit viel Sympathie und Selbstironie aus. Rheingard – schon der hausbackene Vorname ist Programm – ist ein Mauerblümchen, wie man es sich in seinen fadesten Träumen vorstellt. Niemand beachtet sie; alle unterschätzen sie, und dennoch ist Rheingard kein Unglückskind. In ihrer Familie weiß sie sich aufgehoben, und die Verbindung zu ihrer lebenslustigen Freundin Ursula, einer Dolmetscherin, die konsequent den falschen Männern vertraut, funktioniert, weil sich beide Frauen nicht ins Gehege kommen. Rheingard sieht sich nicht als vom Unglück geschlagen; sie versteht es, die Stille ihres Lebens zu genießen, und strebt nicht danach, sich im Jetset-Glamour zu aalen und den Tag auf jeden Fall mit Prosecco ausklingen zu lassen. Und dennoch wäre sie manchmal gern anders, würde sie gern selbstbewusst auftreten und die beschauliche Nische ihres Lebens zumindest eine Zeitlang verlassen. Rheingard und Ursula, das sind unterschiedliche Entwürfe, die Marlene Faro scharf konturiert aufeinander bezieht. Der Roman versucht nicht, jede Gedankenwindung seiner Figuren auszuleuchten oder mit unnötigen erzählerischen Komplikationen zu befrachten. Viel klingt zwischen den Zeilen an und spiegelt sich in Rheingards ruhigem Blick auf ihre gehetzte Umgebung.
Als sie mit Ursula und ihrem aktuellen Partner, dem natürlich verheirateten Othmar, zu einer gemeinsamen Ferienreise auf die Azoren aufbricht, die wirken, »als ob das Allgäu im Meer schwimmen würde«, verändern sich die Dinge mit einem Mal: Zum einen interessiert sich der gutaussehende Lukas, ein Vulkanologe, für die unscheinbare Akademikerin, und zum anderen ist diese zum jähen Handeln gezwungen, als sie auf einer einsamen Inselwanderung von einem Mann verfolgt wird. Am Rande einer siedend heißen Quelle des Furnas-Sees, die die Einheimischen nutzen, um regionale Spezialitäten zu kochen, kommt es zu einem Handgemenge, und als Rheingards Ellbogen den Wüstling vor die Brust stößt, verliert dieser das Gleichgewicht und verendet elend im brodelnden Wasser.
So schockiert Rheingard von diesem Erlebnis ist: Der Befreiungsschlag auf den Azoren ist ein letzter Anstoß, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Nach Hause zurückgekehrt, ist sie entschlossen, aus der zweiten Reihe auszuscheren. Sie bewirbt sich auf die Stelle ihres akademischen Lehrers, den es in die Politik zieht, und sie darf darauf hoffen, dass Vulkanexperte Lukas sie nicht nur als Urlaubstechtelmechtel betrachtet. Mitunter, so die Schlusssequenz des Romans, dient es dem Lebensglück, über seinen beruflichen Tellerrand hinauszublicken und nicht ausschließlich über Weißbürzel-Strandläufer und anderes Federvieh nachzudenken. Küssen zum Beispiel kann eine gute Abwechslung sein.
Die Vogelkundlerin ist kein Roman, der feministische Thesen ausbreitet, und der Todesstoß, den Rheingard auf den Azoren ausübt, keine Aufforderung zur Beseitigung des männlichen Geschlechts. Es geht darum, aufzumuntern und den Glauben daran zu stärken, dass man nicht auf immer und ewig dazu verdammt ist, in den einmal gesteckten Grenzen seines Lebens auszuharren. Und selbst wenn einem Rheingards Neugeburt eine Spur zu märchenhaft erscheint, ist es für latent unzufriedene Leserinnen schön, einer fein erzählten Geschichte vom selbstbestimmten Leben zuzuhören.
MARLENE FAROS Roman Die Vogelkundlerin erschien 1999 im Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg.
Wer in Rente geht, lese:
HEIMITO VON DODERER, Die erleuchteten Fenster
Was tun, wenn sich das Berufsleben dem Ende zu neigt? Wenn der langersehnte Ruhestand näher rückt und man endlich, wie man Freunden schon Jahre zuvor kundtat, jenen herrlichen Beschäftigungen nachgehen kann, zu denen man des schnöden Broterwerbs wegen partout keine Zeit fand? Auf Weltreise gehen, alle Zimmer tapezieren, die Kinder besuchen, entlegene Fremdsprachen lernen, Robert Musils Mann ohne Eigenschaften einschließlich der Fragmente lesen, den Dachboden aufräumen – ungezählt die Vorhaben und groß die Vorfreude auf den paradiesischen Zustand, frei von allen Büro- und sonstigen Berufspflichten zu sein.