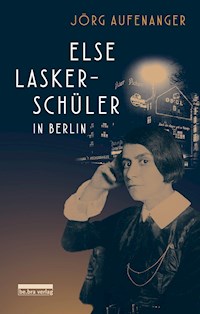12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Transit
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Kleist war fünfundzwanzig Jahre alt, als er Mitte Januar 1803 auf Einladung Wielands in dessen Gutshaus in Oßmannstedt einzog, um dort nach einem hektischen Aufenthalt in der Schweiz Ruhe zu nden und weiter an seinem Drama "Robert Guiskard" zu schreiben. Wieland, der damals einussreichste Dichter in der deutschen Literaturszene, hatte Gefallen an dem "jungen Mann von seltenem Genie" gefunden, bestärkte ihn in seinem radikal neuen dramatischen Stil, ließ sich die frisch entworfenen Szenen vortragen - und musste mit ansehen, wie Kleist immer wieder das eben Geschriebene vernichtet. Als dann noch Luise, die mehr als zehn Jahre jüngere Tochter Wielands, ins Spiel kommt, steigert sich die Schaffenskrise zu einer Lebenskrise: Obwohl Kleist die schwärmerische Liebe Luises erwidert, ist er hin- und hergerissen zwischen Euphorie und Angst, zwischen Respekt vor Wieland und der Furcht, seinen Ansprüchen nicht zu genügen, und vor allem zwischen dem Glück des Augenblicks und dem Druck, in dieser Welt endlich seinen Platz als Dichter und Mensch zu nden. Kleist ieht, ohne Abschied zu nehmen. An seine Schwester Ulrike schreibt er: "Ich musste fort, und kann dir nicht sagen, warum? Ich habe das Haus mit Tränen verlassen, wo ich mehr Liebe gefunden habe, als die ganze Welt zusammen aufbringen kann."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 122
Ähnliche
© 2010 by : Transit Buchverlag Postfach 121111 | 10605 Berlin
www.transit-verlag.de
Umschlaggestaltung, unter Verwendung
der Abbildungen: Unbekannte Kopie der
Originalminiatur des Peter Friedel (1801),
zw. 1831 und 1837, und einer Miniatur
der Louise Wieland, Kleist-Museum,
Frankfurt/Oder,
und Layout: Gudrun Fröba
eISBN: 978-3-887-47262-7
Jörg Aufenanger
»Alles, was süß ist, lockt mich.«
VIERZIG TAGE IM LEBEN DES HEINRICH VON KLEIST
INHALT
I
Ankunft
Vierzig Tage
Christoph Martin Wieland und Heinrich von Kleist
Der Kosmopolit am Schreibtisch
II
Zuvor: Unterwegs, doch wohin?
Warum Paris?
Schweiz: Landmann und Dichter
Weimar
III
Oßmannstedt
Gefahrvolle Zeit
IV
Danach
Wieder unterwegs
Wieder Paris
Anhang
Über den Autor
I
ANKUNFT
Ein eisiger Wintertag ist es, als er aus dem Gasthof in Weimar tritt. Einen Koffer mit seiner ganzen Habe in der Hand, stapft er durch die Gassen der Stadt, wendet sich nach Osten, leicht hügelig ist die Chausee hinaus, bis er schließlich das weite Feld erreicht. Zwei Stunden etwa hat er zu gehen, er kennt den Weg ja nun. Die Ilm, die sich durch das Tal schlängelt, führt ihn und so folgt er ihr, passiert Tieffurt, wo die Herzogin Anna Amalia ihren Sommerwohnsitz hat. Eine freie Strecke zwischen Feldern und kahlen Äckern liegt vor ihm, und selbst die Flussauen besitzen im Winter keine Anmut. Vorbei an der Untermühle geht er auf das Dorf Kromsdorf zu, auch für das dortige Schloss hat er kein Auge. Er durchläuft den Flecken Denstedt, strebt seinem Ziel entgegen: Oßmannstedt.
Dort nennt Christoph Martin Wieland ein Gut sein eigen. Schon in den letzten Wochen hat der Weg ihn einige Male zu ihm geführt. Voller Erwartung ist der Mann von fünfundzwanzig; denn in Oßmannstedt wird er für einige Zeit als Gast des Dichters und seiner Familie bleiben können. Bleiben! Das kennt er schon lange nicht mehr. Hat er es je gekannt? Seit Jahren ist er unterwegs, ein Mann ohne festen Wohnsitz, ohne Bibliothek, ohne ein Heim, ohne eine Frau.
»Ich habe die Feiertage in Oßmannstedt zugebracht, und mich nun (trotz einer sehr hübschen Tochter Wielands) entschlossen, ganz hinauszuziehen«, hat er einige Tage zuvor aus Weimar an seine Halbschwester Ulrike geschrieben. Trotz einer sehr hübschen Tochter? Oder doch wegen? »Ungewöhnlich hoffnungsreich« sei er, hat er in dem Brief hinzugefügt. Was erwartet er? Schon bei seinen ersten sporadischen Besuchen im November hat er diese Tochter Louise ins Auge gefasst, und auch sie scheint unter seinem Blick Gefallen an ihm gefunden zu haben, ihm zugeneigt zu sein. Aber auch ein Unbehagen, ja eine gewisse Furcht beschleicht ihn. Wie vor jeder Frau? Der er gern nah sein möchte und die er doch wie seine ehemalige Verlobte Wilhelmine von Zenge auf Abstand hält. Louise wird er nun tagtäglich nahe sein, in demselben Haus wie sie, unter demselben Dach.
Brief Kleists an seine Schwester Ulrike, Oßmannstedt, Januar 1803
»Ungewöhnlich hoffnungsreich?« Wo er schon so viele Hoffnungen in den letzten Jahren hat schwinden sehen? Doch nun hegt er noch eine weitere Hoffnung, denn in demselben Brief an seine Schwester hat er geradezu beschwörend geschrieben, er begebe sich an den Platz, »an welchem sich mein Schicksal endlich, unausbleiblich, und wahrscheinlich glücklich entscheiden wird.« Das aber soll nicht von der Tochter, sondern von dem Vater Wieland beschlossen werden. So hofft er. Und spürt sowohl den Druck, der auf ihm lastet, als auch die Vorfreude auf ein Glück, das er bisher nicht kennt. »Endlich, unausbleiblich und wahrscheinlich glücklich«, soll sich nun sein Los zum Guten fügen.
Die Ilm, die sich neben seinem Pfad entlang windet, hat sich an manchen Stellen tief in die Landschaft eingegraben, vor allem dort, wo der Fluss zu einer neuen Rundung ansetzt. Nun ist er am südlichen Ende des Gutsparks angelangt, steigt die Böschung hoch, passiert die Gräber zweier Frauen und sieht das Wielandsche Gutshaus schon vor sich liegen, nur noch wenige hundert Meter hat er zu gehen, – beschleunigt oder verzögert er den Schritt? Der Hahn auf dem baldachinähnlichen Turm der Dorfkirche blinkt ihm zu, er fasst Mut und erreicht schließlich den Ort, wo er sich zu Weihnachten wohl und geborgen gefühlt hat. Wie lange wird er hier verweilen können, nach der Hast, die sein Leben ohne Rast in den letzten beiden Jahren geprägt hat?
Er betritt den Innenhof des Guts, steuert auf das Wohnhaus zu und wird herzlich empfangen, von Wieland und seinen Töchtern Amalie, Caroline und eben Louise. Er ist angekommen. Erleichtert. Hat er doch am Morgen den schäbigen Gasthof in Weimar endlich verlassen und die Rechnung bezahlen können, nachdem Ulrike ihm Geld gesandt hat. Man habe ihm ein Zimmer eingeräumt, hatte er ihr schon vor Weihnachten nach seinen ersten Besuchen im November gemeldet. Er steigt die knarrenden Stufen in den ersten Stock hoch und nimmt dieses Zimmer, das mit Blick hinaus in den Park über dem Gartensaal liegt, in Besitz. Wie lange? Weiß er es, ahnt er es, dass auch dieser Aufenthalt nur von kurzer Dauer sein wird, ein weiterer Zwischenhalt in seinem Leben?
VIERZIG TAGE
Die vierzig Tage zwischen Anfang Januar und Mitte Februar 1803, die Heinrich von Kleist in Oßmannstedt verbringen wird, sind zwar eine biografische Einzelheit in seinem Leben, doch sie weisen weit über diese Tage selbst hinaus, da sie den entscheidenden Wendepunkt zum Dichter hin darstellen. Zwar ist gerade sein erstes Schauspiel Die Familie Schroffenstein, ein Trauerspiel in fünf Aufzügen, anonym in der Schweiz in der »Geßnerischen Buchhandlung beim Schwanen« erschienen, wie das Zürcher Intelligenzblatt am 30. November vermeldet, als Buch aber hat Kleist sein Schauspiel noch nicht in der Hand, als er in Oßmannstedt eintrifft. Nur das Manuskript der Schroffenstein liegt in seinem Gepäck neben einigen Szenen eines weiteren Schauspiels, das er kürzlich erst begonnen hat und nun in der Abgeschiedenheit des Wielandschen Landguts und der Fürsorge, die ihm dort zu Teil wird, gedenkt weiter zu schreiben: Ein Trauerspiel über den Normannenherzog Robert Guiskard.
Die Tage von Oßmannstedt bündeln wie Licht in einem Brennglas Kleists Existenz in dieser Gegenwart, aber auch das unmittelbare Vorher und Nachher. Sie werfen ein scharfes Licht auf sein Leben und sein Dichten, sie können konstituierend sein, um beides zu verstehen. Hier wird sein Größenwahn, der immer gepaart ist mit Selbstzweifeln, die dann zusammen zum Wahnsinn neigen, sichtbar. Sowie die Unerbittlichkeit, mit der er gegen sich selbst dichtet. Zudem haben sowohl seine Sehnsucht nach Nähe und Geborgenheit wie auch die Unfähigkeit, diese anzunehmen und zu genießen, hier ihr Feld. Sein obsessives Streben nach Glück und das gleichzeitige Ahnen oder Wissen, es nicht erreichen zu können. Zu diesem möglichen Glück gehören auch, er hat es so oft in den Briefen an seine ehemalige Verlobte Wilhelmine von Zenge beschworen, eine Frau, ein Haus und ein Garten. Und lockt dieses Glück nicht hier in diesem Haus mit dem großen Park und der jungen Louise?
Warum aber muss er immer wieder fliehen, warum legt er es auch darauf an, sich vertreiben zu lassen? Trotz einer Liebe? Trotz einer Freundschaft? Trotz eines Wohlbefindens? Immer wieder trotz! Auch aus Oßmannstedt wird er sich nach ungefähr vierzig Tagen und Nächten entfernen und wieder einmal weder wissen warum noch wohin er sich dann wenden soll.
Als Kleist bei Wieland eintrifft, ist er fünfundzwanzig Jahre alt. Acht Jahre hat er noch zu leben, ist also schon weit über die Lebensmitte hinaus. Das wissen wir, hat er es vielleicht geahnt? Kurz zuvor, als er in der Schweiz verweilte, hat er gegenüber der Schwester von einem baldigen möglichen Tod schon gesprochen.
Zu diesen vierzig Tagen in O. gehört auch das Davor und das Danach, denn die Tage bei Wieland haben sich lange vorbereitet, und die Tage bis zur erneuten Flucht über die Schweiz, Italien nach Paris und der Rückkehr in preußische Dienste sind eine unmittelbare Folge.
CHRISTOPH MARTIN WIELAND UND HEINRICH VON KLEIST
Wie kam es zu der Begegnung dieser beiden Männer, die immerhin vierundvierzig Lebensjahre voneinander trennt? Kleist hatte schon in pubertären Jahren Wieland als seinen Mentor angesehen, nachdem er dessen Schrift Sympathien im Sommer 1793 gelesen hatte, die indes schon fast vierzig Jahre zuvor entstanden war.
»Das war die üppigste Sekunde ... meines Lebens«, hatte er im Rückblick auf seine frühe Jugend im Juli 1801 aus Paris an Adolphine von Werdeck nach Potsdam berichtet: »Sechzehn Jahre, der Frühling, die Rheinhöhen, der erste Freund, den ich soeben gefunden hatte, und ein Lehrer wie Wieland, dessen Sympathien ich damals las – War die Anlage nicht günstig, einen großen Eindruck tief zu begünstigen?« Ein Faden der Sympathie war zu dem berühmten Dichter also gesponnen. Mit dem Freund war der drei Jahre jüngere Johann Jakob Otto August Rühle von Lilienstern gemeint. Sie lebten gemeinsam in der Garnison von Potsdam, in die Kleist als Vierzehnjähriger sofort nach der Konfirmation eingezogen war. 1798, kurz bevor er Abschied vom preußischen Militär nehmen sollte, hatten die Freunde eine vermeintlich heimliche Harzreise unternommen, auf der sie als Musikanten, Kleist als Klarinettist, durch das Bergland zogen. Fünf Jahre zuvor war Kleist mit der Truppe nach Mainz marschiert, hatte in Biberich Kantonierungsquartier genommen, hatte mit Der höhere Frieden ein erstes Gedicht verfasst, den Rhein bewundert und Wielands Schrift gelesen. Diesem ersten Freund, Rühle von Lilienstern, widmete Kleist auch das in ebendiesem Jahr der Harzreise verfasste Traktat Aufsatz, den sicheren Weg, das Glück zu finden und ungestört – Auch unter den größten Drangsalen des Lebens – ihn zu genießen. In ihm tauchen neben den Anleihen bei Goethes Wilhelm Meister, Schillers Don Carlos und dessen Schrift Die Schaubühne als moralische Anstalt oder Homers Ilias nahezu wörtliche Übereinstimmungen mit jener Schrift Wielands zu den Sympathien auf.
Johann Jakob Otto August Rühle von Lilienstern (1780-1847)
»Glücklich zu sein, das ist ja der erste aller unsrer Wünsche, der laut und lebendig aus jeder Ader und jeder Nerve unsers Wesens spricht, der uns durch den ganzen Lauf unseres Lebens begleitet, der schon dunkel in dem ersten kindischen Gedanken unsrer Seele lag und den wir endlich als Greise mit in die Gruft nehmen werden. Und wo, mein Freund«, im ganzen Traktat spricht Kleist immer wieder seinen Freund Lilienstern wie in einem Brief oder einem Disput an, »kann dieser Wunsch erfüllt werden, wo kann das Glück besser sich gründen, als da, ... wo die Welt mit ihren unermesslichen Reizungen im Kleinen sich wiederholt? ... wo es auch nur einzig genossen und entbehrt wird. Im Innern! ... Kein Tyrann kann es uns rauben, kein Bösewicht kann es stören.«
Aber woher kommt das Glück, wie erlangt man es? Glück sei Belohnung der Tugend, sei sowohl Aufmunterung zur Tugend als auch die Tugend selbst, die den Weg zum Glück weise. »Ja mein Freund, die Tugend macht nur allein glücklich.« Sie mache gar den Tugendhaften selbst im Unglück glücklich und bewahre den Menschen vor der Verzweiflung. Auch eine Versicherung Kleists gegen seine drohende Verzweiflung? Und daher auch die obsessive, verzweifelte Beschwörung des Glückes? Die er auch in den Briefen an seine Verlobte Wilhelmine von Zenge wenig später wiederholen wird.
Und Kleist wäre nicht Kleist, wenn sich nicht auch in diese so idealistische Vorstellung von Glück mittels Tugend Skepsis einmischte. Geschickt aber schiebt er Lilienstern den Gegenpart des Zweiflers zu. »Und nun, mein Freund, noch ein paar Worte über ein Übel, welches ich mit Missvergnügen als Keim in Ihrer Seele zu entdecken glaube. Ohne, wie es scheint, gegründete, vielleicht ihnen selbst unerklärbare Ursachen, ohne besonders üble Erfahrungen, ja vielleicht selbst ohne die Bekanntschaft eines einzigen durchaus bösen Menschen, scheint es, als ob Sie die Menschen hassen und scheuen.«
In gespielter Empörung fährt Kleist fort: »Menschenhass? Ein Hass über ein ganzes Menschengeschlecht! O Gott! Ist es möglich, dass ein Menschenherz weit genug für soviel Hass ist!« Fragt dann: »Gibt es denn nichts Liebenswürdiges unter den Menschen mehr? Und gibt es denn keine Tugenden mehr?« Antwortet paraphrasierend mit Wieland: »Ach und wenn sich auch im ganzen Umkreis der Erde nur ein einziger Tugendhafter fände, dieser einzige wiegt ja eine ganze Hölle von Bösewichtern auf.«
Bei Wieland selbst heißt es in den Sympathien so: »Gibt es keine tugendhaften Menschen auf der Welt? ... Ein einziger Tugendhafter kommt gegen eine ganze Hölle von Bösewichtern in Betrachtung.«
Auch an seine in Frankfurt an der Oder lebende Verlobte Wilhelmine von Zenge war er schon einige Monate vor dem Brief an Adolphine von Werdeck in einem Schreiben vom 22. März 1801 auf Wieland zu sprechen gekommen: »Ich hatte schon als Knabe (mich dünkt am Rhein, durch eine Schrift von Wieland) mir den Gedanken angeeignet, dass die Vervollkommnung der Zweck der Schöpfung wäre... Aus diesen Gedanken bildete sich so nach und nach eine eigne Religion.«
In ein Albumblatt für eine Potsdamer Freundin, wohl für die zwei Jahre ältere Luise von Linckersdorf, Tochter des Generalmajors in der Garnison, die er in einem Brief an seine Verlobte zwei Jahre später als ihm einst sehr teuer beschreibt und zwar in einem Ton, der sie eifersüchtig machen müsste, hatte er ebenfalls ein Zitat Wielands eingeschrieben, das er in dessen Schrift Gesicht von einer Welt unschuldiger Menschen gefunden hatte, die wie Die Sympathien schon vierzig Jahre zuvor entstanden war. »Geschöpfe, die den Wert ihres Daseins empfinden, die ins Vergangene froh zurückblicken, das Gegenwärtige genießen, und in der Zukunft Himmel über Himmel in unbegrenzter Aussicht entdecken; Menschen, die sich mit allgemeiner Freundschaft lieben, deren Glück durch das Glück ihrer Nebengeschöpfe vervielfacht wird, die in der Vollkommenheit unaufhörlich wachsen, – o wie selig sind sie!« Das ist ja nicht nur die kaum kryptische Liebeserklärung des zwanzigjährigen Kleist an die zweiundzwanzigjährige Luise, sondern drückt auch seinen innigsten Wunsch nach einem Glück mit einem »Nebengeschöpf« aus. Die Idee eines immerwährenden Strebens nach Vollkommenheit, die Wieland in Kleist geweckt hat, wird in den Jahren vor 1800 zu seinem absoluten, quasireligiösem Ziel, dem er alles eine Zeit lang unterzuordnen scheint.
Jedenfalls, Wieland hatte in Kleist eine Initiation ausgelöst und die Spur zu einer frühen Lebensmaxime gelegt, die dieser wie manisch verfolgen wird, bis ein Erlebnis diese abrupt in Frage stellen und den Idealismus der Jugend zerstören wird.
In jenem Brief an Adolphine von Werdeck von Ende Juli 1801 hatte er nach dem Verlust des Ideals rückblickend die Jugend »die üppigste Zeit des Lebens« genannt und es so begründet: »Weil kein Ziel so hoch und so fern ist, das sie sich nicht einst zu erreichen getraute. Vor ihr liegt eine Unendlichkeit – Noch ist nichts bestimmt, und alles möglich – Noch spielt die Hand, mutwillig zögernd, mit den Losen in der Urne des Schicksals, welche auch das große enthält – warum sollte sie es nicht fassen können?«
Doch inzwischen sind Jahre vergangen auf dem einst vermuteten sicheren Pfad zum Glück, den ihm Wielands Sympathien