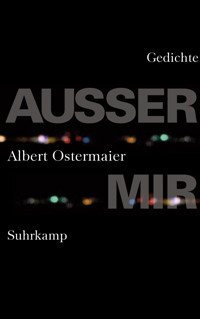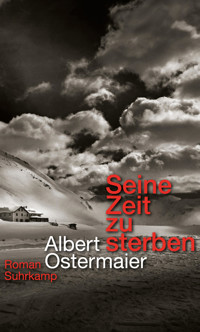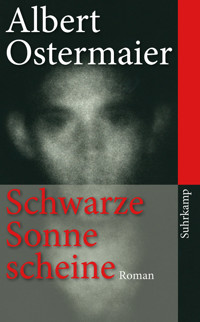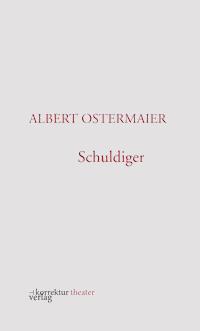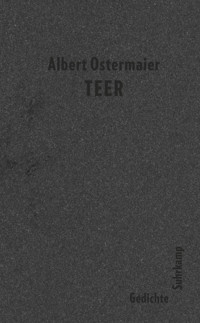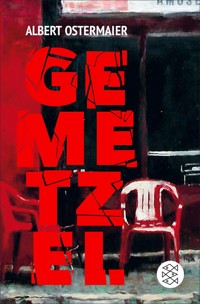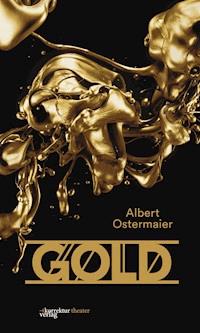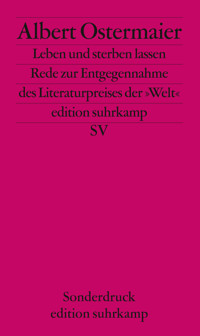19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alexander Verlag Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erstmalig erläutert Albert Ostermaier detailliert sein Selbstverständnis als Dramatiker, den Einfluss u. a. von Büchner und Achternbusch, Shakespeare und Brecht, Andrea Breth und Martin Kušej auf sein Verhältnis zum Theater und zum Drama. Am Beispiel seiner aktuellen Nibelungenbearbeitungen Gemetzel und Gold gibt er Einblick in seine Werkstatt und öffnet in einem Gespräch über das Theater weitere Perspektiven auf sein Werk und seinen Begriff vom Theater. Das Buch basiert auf drei öffentliche Vorträge, die Albert Ostermaier Anfang 2015 als Inhaber der 4. Saarbrücker Poetikdozentur für Dramatik gehalten hat. Mit der 2012 erstmals vergebenen Poetikdozentur für Dramatikerinnen und Dramatiker waren vor ihm bereits Rimini Protokoll, Roland Schimmelpfennig und Kathrin Röggla geehrt worden. Die Buchreihe im Alexander Verlag Berlin wird im Frühjahr 2017 mit Falk Richter fortgesetzt. "Er macht sich zum Esel, der Autor. Zum ›wohlbekannten, alten Esel‹, bevor er schließlich zur Schnecke gemacht wird oder auf den Hund kommt, er wiehert: ich will, ich will, will alle Rollen spielen, will der König dieser seltsamen Tiere des Theaters sein. (...) Der Autor, bevor er sich zum Esel macht und machen lässt, ist ein Weber wie Zettel in Shakespeares Sommernachtstraum: Er webt seine Erzählfäden und Stoffe, aus denen seine Träume und Traumata sind." Albert Ostermaier
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Albert Ostermaier, Von der Rolle …
Albert Ostermaier, geb. 1967 in München, wo er heute als freier Schriftsteller lebt, veröffentlichte 1995 seinen ersten Gedichtband Herz Vers Sagen, der mit dem Lyrikpreis des PEN Liechtenstein ausgezeichnet wurde. Im selben Jahr erfolgte die Uraufführung seines ersten Stückes Zwischen zwei Feuern.Tollertopographie im Marstall des Bayerischen Staatsschauspiels München. Seither gilt Ostermaier als einer der wichtigsten Gegenwartsdramatiker deutscher Sprache. Es folgten Uraufführungen u. a. am Nationaltheater Mannheim, am Schauspiel Hannover, am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, am Bayerischen Staatsschauspiel und am Wiener Burgtheater. Viele namhafte Regisseure inszenieren seine Stücke, darunter Andrea Breth, Lars Ole Walburg und Martin Kušej. 2015 wurden Gemetzel (bei den Nibelungen-Festspielen in Worms) und Mois non plus, ein Stück über Serge Gainsbourg, uraufgeführt, im Juli 2016 eröffnete Ostermaier die Nibelungen-Festspiele mit dem Stück Gold. Der Film der Nibelungen unter der Regie von Nuran David Calis.
Neben den Theaterstücken und zahlreichen Lyrikbänden – zuletzt Flügelwechsel und Ausser mir (2014) – publizierte er 2008 seinen ersten Roman Zephyr, gefolgt von Schwarze Sonne scheine (2011), Seine Zeit zu sterben (2013) und Lenz im Libanon (2015).
Ostermaier wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, u. a. dem Kleist-Preis, dem Bertolt-Brecht-Preis und 2011 mit dem Welt-Literaturpreis für sein literarisches Gesamtwerk. Er ist Torwart der deutschen Autorennationalmannschaft, Kurator bei der DFB-Kulturstiftung und seit 2015 Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Albert Ostermaier hat verschiedene Gastprofessuren und Poetikdozenturen übernommen, zudem arbeitet er als künstlerischer Leiter verschiedener Festivals: Zuletzt kuratierte er das forum:autoren beim Literaturfest München im November 2015.
Johannes Birgfeld, geb. 1971, ist nach Lehrtätigkeiten in Bamberg, Sewanee (TN/USA) und Oxford Oberstudienrat i. H. an der Universität des Saarlandes für Neuere deutsche Literaturwissenschaft und Initiator der Saarbrücker Poetikdozentur für Dramatik. Forschungen zur deutschsprachigen Literatur vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
Albert Ostermaier
Von der Rolle
oder: Über die Dramatik des Verzettelns
Saarbrücker Poetikdozentur für Dramatik Herausgegeben von Johannes Birgfeld
Alexander Verlag Berlin
Gedruckt mit finanzieller Unterstützung der Fachrichtung Germanistik an der Universität des Saarlandes.
Originalausgabe© by Alexander Verlag Berlin, 2016Alexander Wewerka, Fredericiastr. 8, 14050 Berlinwww.alexander-verlag.com | [email protected] Rechte vorbehalten.
Satz und Layout: Johannes Birgfeld/Antje Wewerka Umschlaggestaltung: Antje Wewerka Umschlagfoto Albert Ostermaier: Marcus Schlaf Schlusslektorat: Christin Heinrichs-Lauer ISBN 978-3-89581-438-9 (eBook)
Erste VorlesungVerzettelt oder: Der Autor als Esel der Mimesis
Zweite Vorlesung Kirschgeist oder: Theater dem Tod
Dritte VorlesungIch, Dionysos, oder: Sprache Rausch Gewalt
Anmerkungen zu den Vorlesungen
Aus der WerkstattZu Gemetzel und Gold
EpilogGespräch mit Albert Ostermaier über Theater
Nachwort
Erste Vorlesung
VERZETTELT ODER: DER AUTOR ALS ESEL DER MIMESIS
I-A, I-A, ich auch, ich auch, I-A, macht der Autor, ich, der Autor, er ist, I-A, ein mimetisches Maultier, er macht sich zum Esel, der Autor. Zum ›wohlbekannten, alten Esel‹, bevor er schließlich zur Schnecke gemacht wird oder auf den Hund kommt, er wiehert: Ich will, ich will, will alle Rollen spielen, will der König dieser seltsamen Tiere des Theaters sein. Aber wenn die Katastrophe kommt? Und mit ihr die sogenannte Notwendigkeit des Opfers? Wen schlachten sie dann? Wer muss zuerst daran glauben? Schon Kleist weiß es, wenn er Über die allmählige Verfertigung der Gedanken beim Reden – und das Gleiche gilt für das Schreiben – nachdenkt: Es ist der Esel, der »blutdürstige« unter den Tieren, der Kräuterkannibale, der sich den Löwen, den Füchsen, den Wölfen als Gottesopfer zum »[Z]erreißen« vorwerfen lassen muss.1
Der Autor, bevor er sich zum Esel macht und machen lässt, ist ein Weber wie Zettel in Shakespeares Sommernachtstraum:2 Er webt seine Erzählfäden und Stoffe, aus denen seine Träume und Traumata sind. Er ist, bevor er den Zauberwald (heute heißt er wohl OBI) betritt oder den Wald des Grauens, ein Handwerker, der bei seinen Zeilen, Leisten oder Webstühlen bleibt, der mit den Brettern vor seinem Kopf und den Brettern hinter der Stirn die Bühnen baut, die ihm die Welt bedeuten sollen, und dafür Geschichten webt aus gerissenen Fäden, aus verlorenen Fäden, aus Fadenscheinigem und scheinbar Fadem, fade-out, fade-in. Hier steht er, unser Zettel, und steht auf meinem Zettel, von dem ich ablese, statt Flugzeuge daraus zu falten.
Schon bei seinem ersten Auftritt spricht Zettel von einer Liste.3 Autoren lieben Listen. Die Liste ist die List des Autors, er zählt auf, und er zählt auf den Zuschauer, der ihn durchschaut, wenn er auf die Bühne blickt und nichts mehr blickt, als in einen Spiegel, der der Spiegel des Autors ist. Und wenn Autor und Zuschauer sich den Spiegel vorhalten und nichts vorenthalten, entsteht jene Unendlichkeit, die die besten Szenen macht. Natürlich ist alles List, ist Trug im Spiel, natürlich müssen die Spiegel am Ende zerbrechen, damit wir in den Scherben unserer Seele oder unseres Lebens stehen, natürlich müssen wir uns an ihren Kanten und Splittern verletzen, natürlich schärfen die Scherben mit ihren Spiegelungen unsere Sinne, müssen wir uns aus all den Brechungen, Verletzungen, Spiegelungen ein neues Spiegelbild, einen neuen Blutspiegel zusammensetzen, der die Brüche nicht leugnet, sondern zeigt.
Doch zurück zu Zettel und dem Sommer, in dem alle davon träumen, den gleichen Traum zu träumen.
Es beginnt mit einer Eselei. Anlässlich der Hochzeit, der Vermählung der Amazonenkönigin Hippolyta mit Theseus, dem Herrscher dieses fiktiven Athens, wird ein Preis, eine Rente, für die beste theatralische Darbietung ausgeschrieben. Der Autor muss in Vorleistung gehen: ein Stückauftrag, der keiner ist, sondern nur ein Versprechen auf die Zukunft, ein dramatischer Future, eine Phantasieblase. Es ist ein seltsames Athen, von dem da die Rede ist. Es sieht aus wie ein Idyll, ein aufgeklärter Herrscher, Hochzeitsvorbereitungen, Helligkeit, Lustbarkeiten, junge Welt, Sonnenschein, ein Flirren und Flüstern, frohe Tage, neuer Mond, gespannt wie ein Silberbogen, leuchtender Himmel, Wolken wie Ungeheuer, ein unsichtbarer Sturm, der sich anbahnt hinter allem, ein Wüstenwind, der kommen wird mit rotem Staub. Wie glückliche Menschen wirken alle im ersten Moment, eine Komödie, ein Sommer, ein Traum, aber auch, wenngleich mondbeschienen, die Nacht. Es ist ein Trugbild, ein Bild voller Fehler und Unschärfen, eine nature morte: Wer stehen bleibt, ist tot. Die wahre Natur des Menschen, seine dunkle Seite lauert im lautesten Lachen. Und der Tod, er ist schon da, das Kontrastmittel. »Den Gram verweise hin zu Leichenzügen«, befiehlt Theseus4 und beschwört sie dadurch herauf, die Schatten, die bleichen Gäste. Und selbst um seine Geliebte, die Amazone, hat er mit dem Schwert gebuhlt, sprich, er hat sie bezwungen unter der Klinge. Die heitere Stimmung der Hochzeit ist, noch bevor sie ganz ausgelassen ist, in Gefahr: Mit dem Auftritt des Egeus gerät alles ins Wanken, sofort ein falscher Ton, Fehlfarben, Störung, Bedrohung, Shining. Da tritt ein Vater auf, der vor dem König seine Tochter Hermia anklagt, weil sie nicht den Demetrius (dem wiederum Helena verfallen ist) heiraten will, den Ehemann also, den ihr Vater für sie vorgesehen hat, sondern den lüsternen Lysander liebt. Die Tochter, das eigen Fleisch und Blut, das Eigentum, dessen Fleisch man bluten oder dem man den eigenwilligen Kopf kürzen lässt, wenn es nicht gehorcht, und die mehr auf das eigene Herz als auf die Stimme und den Willen des Vaters hört, der kein Ohr für die Tochter und schon gar nicht die Liebe hat, nein, nicht Gehör, Gehorsam ist die Devise und der Gedanke des Vaters, Gehorsam, bis dass der Tod euch scheidet, so oder so. Egeus beharrt auf Vollzug, auf das Gesetz, dass wenn die Tochter dem Vater sich widersetzt, Tod oder Kloster, sprich Entgeschlechtlichung steht, Nonnen statt Wonnen also (wobei wir natürlich wissen, wie es in Klöstern zugeht, damals wie heute).
Warum schildere ich das alles, wo ich doch über Zettel als den Inbegriff und Personifizierungen des Autors und Dramatikers reden wollte? Nun, der Autor lebt nicht im luftleeren Raum, sonst müsste er ersticken. Der Konflikt ist sein Sauerstoff, das Unsichtbare, was er sehen will, das Unerhörte, auf was er hört, das Unausgesprochene, was er aussprechen muss. Er lebt zwischen den Zeilen und jagt auf sie wie auf Horizonte zu, die sich immer wieder gerade dann entfernen, wenn man sich ihnen so nahe fühlt. Er reiht Buchstaben zu Worten und Worte zu Sätzen, er stellt seine Liste auf eine Zeile, und seine List ist, sie Horizont zu nennen, und der Leser soll ihn lesen und dort auflesen, was der Autor hingeträumt hat.
Natürlich ist Zettel nicht der Autor in Shakespeares Stück. Es gibt da schon einen Autor, ein Alter-Autor, er heißt Squenz und ist die Konsequenz dessen, was ich über den Autor erzählen will.
Squenz hat jenes Werk gemacht, das die Handwerkertruppe sich zusammenschustern soll, denn eine Illusion zu bauen, macht gehörig Arbeit, und man kommt dabei ins Schwitzen und Grübeln, bekommt Schwielen und Brandblasen, nicht nur an den Händen, sondern auch in den Werken.
Squenz ist nicht der Spiegel des Dramatikers, er ist als Dramatiker der Spiegel eines Dilettanten, eines, der sein Bestes gibt, das aber nie genug sein kann, der etwas von seinem Handwerk versteht, aber nicht vom Schreiben. Er erinnert mich an einen Comic im New Yorker: Zwei Männer auf einer Cocktailparty, sagt der eine zum anderen: »Ach, Sie sind Schriftsteller. Ich wäre auch Schriftsteller, hätte ich die Zeit dazu.« Squenz hat sich die Zeit genommen und sein Stück gezimmert. Zimmermänner reisen in ihren Lehrjahren ja durchs Land oder sogar durch die Welt, sie lernen das Fremde kennen und lernen sich in der Fremde kennen, fremde Stile, fremde Techniken, anderen Sitten und Sittsamkeiten. Sie stehen auf Dächern und blicken ins Weite, sie wissen etwas von Architektonik und Statik, sie langen zu, sie schlagen ab, sie hobeln, sie wissen, wie man mit einer Axt umgeht und einer Säge, sie sind im Gegensatz zu den lyrischen Schreinern eher für das Prosaische, aber wissen, wie man etwas zusammensteckt, sie bauen ein Dach über dem Kopf, wissen, wo der Hammer hängt, und nageln fest, was festzunageln ist. Sie tragen schwarz. Alles gar nicht so falsch und weit hergeholt für einen Dramatiker. Kein Schneider, der sieben auf einen Streich nimmt, kein Kesselflicker, kein Bälgenflicker.5
Der Zimmermann hat den Baum der Erkenntnis gefällt, zersägt und aus den Brettern und Astlöchern eine Bühne im Winkelmaß gebaut, vielleicht sogar ein Theater, denn im Wald gibt es viele Bäume. Aber dann geht’s an die Worte, und die sind aus einem anderen Holz geschnitzt. Ein Meterstab ist noch kein Stabreim, die Worte gehen nicht so leicht auf den Leim, wenn sie kleben, kleben sie einem eine, man bleibt hängen und der Schauspieler hat einen Hänger, er fällt aus der Rolle wie der Zimmerer vom Dach fällt. Der Autor hat sich den Zimmermann ausgesucht, weil er sympathisch ist, weil er für Solidität steht, Bodenhaftung. Weil schon Josef ein Zimmerer war, auch wenn es bei ihm nur für eine Nebenrolle reicht. Mein Vater hat auch Zimmerer gelernt, bevor er Architekt wurde. Ich habe im Sägewerk und in der Zimmerei mein Geld für die erste E-Gitarre verdient und mir manchen schönen Spreißel eingezogen. Ich habe dort viele fehlende Gliedmaßen gesehen und Bierflaschen holen müssen für den Schaum vorm Mund und die Geschichten in den Pausen, wenn die Sonne sticht und die Bäume kein Ende nehmen wollen.
Hätte ich einen Handwerker aussuchen sollen für den Dramatiker, ich hätte auch den Zimmermann gewählt. Er ist kein Narr, aber zuverlässig, er weiß seinen Mann selbst in den höchsten Höhen und im Vollrausch zu stehen. Jeder begegnet ihm mit Respekt und das war das größte Lob, das es aus dem Mund eines Handwerkers gab. Der Schuster bleibt bei seinen Leisten, aber der Zimmermann Squenz möchte mehr leisten und ist doch ein Minderleister in dramatischen Dingen und ein unfreiwilliger Komiker in der Wahl seiner Worte. Er weiß, welches Holz für was taugt, was hält, was bricht, was sich biegt und was sich biegen lässt, was splittert und was hart ist, was harzt, was den Wurm hat. Für den Dramatiker hat jeder Satz einen Wurm, einen Wurmfortsatz nach dem anderen. Und so disqualifiziert er sich gleich zu Beginn, indem er sein Stück eine »höchst klägliche Komödie« nennt, in dem nicht nur Pyramus und Thisbe einen »höchst grausame[n] Tod« sterben, sondern auch die Literatur.6 Ja, wenn es nicht Absicht wäre. Und was für eine Kunst ist es, schlechter zu schreiben, als man selber schon schlecht schreibt.
Aber wir wollen von Squenz zu unserem wahren Autorspiegelbild zurückfinden, zu Zettel. Warum ist Zettel der V-Mann des Autors? Weil er ein Esel ist. I-A, I-A, I-A. Zettel kann es gar nicht erwarten zu erfahren, was er spielen soll, die Spannung wird bis zum Bersten hinausgezogen mit umständlichen Fragen und Verfahren, wahrscheinlich hat Zettel selbst Angst, er könnte fehlbesetzt werden, sprich, er könnte nicht entsprechend seiner Kunst und seinem Können besetzt werden.
So wartet er dann, was auf dem Zettel steht, was Zettel spielen soll. Und, wie könnte es anders sein: Pyramus, den tragischen Helden, der den tragischen Heldentod spielt wie ein Tenor, eine todsichere Rolle, Empathie, Sympathie, Katharsis. Aber Zettel zögert: »Was ist Pyramus. Ein Liebhaber oder ein Tyrann?«7 Sind Liebhaber keine Tyrannen, möchte man einwerfen, und können denn Tyrannen kein Liebhaber sein – siehe Theseus? Zettel prüft die Rolle, Zettel, der Weber, prüft den Stoff, was er hergibt, wie belastbar er ist, ob er ihn kleidet und ob er darin glänzen kann:
Das wird einige Tränen kosten bei einer wahrhaftigen Vorstellung. Wenn ich’s mache, laßt die Zuhörer nach ihren Augen sehn! Ich will Sturm erregen, ich will einigermaßen lamentieren. Nun zu den übrigen; – eigentlich habe ich doch das beste Genie zu einem Tyrannen; ich könnte einen Herkles kostbarlich spielen, oder eine Rolle, wo man alles kurz und klein schlagen muß. [...] Das ging prächtig. [...] Dies ist Herklessens Natur, eines Tyrannen Natur; ein Liebhaber ist schon mehr lamentabel.8
Natürlich würde Zettel lieber einen Tyrannen spielen! Warum? Weil der Autor lieber einen Tyrannen schreiben würde. Zettel ist nicht nur ein Esel, er ist auch ein Chamäleon. Der Autor ist ein Verwandlungstier, ein Maultiermutant, ein Metamorphosensüchtiger, der sich in alle Figuren und Tiere und Gegenstände, ja selbst in Landschaften, selbst in Jahreszeiten und das Wetter verwandeln möchte und verwandelt. Wie Zettel will er alles. Alles spielen, alles schreiben, alles gleichzeitig, sein Ziel ist die permanente Revolution, die permanente Häutung, Über- und Fortschreibung. Auf seinem Zettel, auf dem der Autor seine Zeilen zieht, ist er die Welt, bedeutet er die Welt, verwandelt er die Welt und sich selbst, er wechselt die Identitäten, die Haltungen, das Alter, die Sexualität, die Geschlechter, das Geschlecht. Zettel, als er sieht, dass Flaut sich ziert, die Thisbe zu spielen, wie es auf der Besetzungsliste, dem Zettel in der Hand des Autors, steht, springt er sofort ein und sieht seine Chance auf das Außergewöhnliche, die grenz- und vor allem körpergrenz- und geschlechtsüberschreitende Chance:
Wenn ich das Gesicht verstecken darf, so gebt mir Thisbe auch. Ich will mit ’ner terribel feinen Stimme reden: »Thisne, Thisne! – Ach Pyramus, mein Liebster schön! [...]«9
Der Autor ist ein Morphist und Morpheus. Wenn er als Mann eine Frau schreibt, dann schreibt er als Frau, dann schreibt es in ihm als Frau, dann verdichten sich alle femininen Anteile in ihm als Frauenperspektive, alle Erfahrungen, alle Sätze, als Erinnerungsfetzen, alle Frauen, die sein Leben geprägt haben, die Mutter, Großmutter, erste Lieben, die eigene Frau, die Begehrten, die Ersehnten, die Beobachteten, die Belauschten, die Filmfrauen, die Theaterfrauen, die Frauen auf der Straße, die Frauen in den Büchern. Alles wirbelt im Unterbewussten, alles wird aufgesogen und verkörpert sich zu einer Rolle, die der Autor einnimmt, aus der er mit den Fingern auf den Tasten spricht, und vielleicht bewegt er auch synchron seine Lippen dabei, verändert die Körperhaltung, die Chromosomen. Hätte ich einen Spiegel statt einem Screen, könnte ich es sehen. Aber will ich das? Das Eigen-Ich spielt keine Rolle, das Ich auf dem Zettel spielt die Rolle. Und es ist auf einer anderen Ebene auch ein Selbstgespräch, eine Parallelaktion. Oft kann man das, was da aus einem auftaucht und auftaut, das, was da plötzlich schwarz auf weiß steht oder dann vom Textkörper zum Schauspielerinnenkörper wird, oft kann man das nicht im eigenen Leben verorten. Es lässt sich nicht herleiten, ist im Heiner Müller’schen Sinne klüger als der Autor,10 irritiert, ist auf den ersten Blick biographisch nicht begründbar. Und selbst wenn man sich nicht erklären kann, was da aus einem spricht, woher es kommt, so kann es einem doch auch auf einer anderen Ebene eine ganz persönliche Szene machen, eine Szene hinter der Szene, hinter den Schreib- und Theaterkulissen. Durch die Entkörperung aus dem eigenen Körper, durch die Übertragung auf den Text und den Schauspieler, sage ich mir Dinge, die ich mir sonst nie gesagt hätte, erfahre ich, was ich verdrängt habe, was ich ersehnt habe, was ich ersehne, was mich wütend macht, was mich verzweifeln lässt. Ich erfahre im Schreiben eine Intensität von Leben und Erleben, von bei-mir-sein, von bei-mir-außer-mir-sein, von außer-mir-bei-mirsein, von bei-mir-bei-sich-sein, von Unmittelbarkeit und Radikalität, erfahre mich in einer Unbedingtheit, die ich im Leben, im Alltag nicht einlösen kann, der ich nachrenne, nachhechle, nachtrauere. Außerhalb des Textes bin ich ein Schatten meiner selbst, ein Schatten meines Textes, zweidimensional, während der Zettel nicht nur drei, sondern auch eine vierte Dimension hat. Im Schreiben riskiere ich alles, auch mein Leben, so pathetisch das klingt. Es ist eine Sucht und eine Flucht, ein Suchtort und Fluchtort, ich bin in einem Film, in dem ich alle Rollen spiele, in dem ich alles ganz realistisch sehe, obwohl ich während des Schreibens nur auf Buchstaben starre, die sich aneinanderreihen, ich bin beim Schreiben schizoid, polyphon, mehrspurig, ein mix und remix. Das ist so atemberaubend, was kann da mithalten? Wenig. Das ist auch eine Gefahr und Gefährdung.
Doch der zwanghafte Zettel wartet schon und wollte doch gerade die Thisbe spielen, was er nicht darf, was mich aber doch noch zu einer Abweichung verführt. Für Shakespeare war dieses Spiel mit Geschlechtern natürlich noch aufregender, denn er hatte eine zusätzliche Ebene, mit der er spielen konnte: Alle Rollen mussten von Männern gespielt werden, womit unendliche Doppelungen und Interpretationen und Triple-Identitäten möglich sind. Das macht ja Shakespeare so aufregend und dialektisch, dass er immer das eine und das andere ist und meint, dass man ihn nie auf den Punkt, sondern nur auf den Doppelpunkt bringen kann. Dieses Crossdressing und Gendercrossing macht beim Schreiben eine subtile Freude. So habe ich mich in Monologen aus weiblicher Perspektive versucht – nicht nur im Gedicht, wie etwa in dem folgenden in einer Verneigung vor Shakespeare, dessen Dramatischstes für mich seine Sonette sind:
viola
ich bin nicht was ich bin und will der weltnicht ausgeliefert sein als die die ich wärewäre ich ich wer mich vor die frage stelltob ich kein mann sein will dass ich erkläreich sei ein mann das sei ganz ausser fragesind es nicht männerkleider die ich tragedoch mit jeder weitren lüge die ich wagemit der ich mich vor mir als er einklagejedem wort das mich als frau verkenntund meine züge gesten männlich nenntwächst die angst dass ich bald bin werich scheinen will nicht sie sondern derdem der bart nicht auf der lippe wächstund zwischen den lippen kein geschlechtdas die scham bedeckt bis man entdeckter ist kein er wie sie eine sie die verstecktauch er zu sein ist denn die natur gerechtwenn sie unsere körper so unterscheidetahnt sie nicht wie er ohne sie in mir leidet11
sondern auch in Monodramen Nach den Klippen12 und dem ganz auf den Redestrom der Nighttalkerin Parthenope konzentrierten Stück Radio Noir,13 das so beginnt:
talk to mesprecht zu mir ich kann euchsehen dort draussen in dernacht wie ihr eure unschuldigenengelsmundgesichter mit dreckbeschmiert & verloren an dengleisen steht seh euch auf denzehenspitzen euer müdes lebenbalancieren & euer herz euchin die tiefe ziehen spring dochspring senk den schweren kopfauf deine brust & du wirst fliegenauf den schienen, wenn die räderdeine augen durch die schächteschleifen & dein blut rast durchdie adern der stadt & dein hirnversprüht sein glück & deineträume fahren dir endlich spürstdus aus der haut hinaus unter diebrücken an den ghettotürmen vorbeivon denen die menschen mit offenenarmen dir entgegenfallen & ihrefenster offen & einsam zurücklassen im toxischen wind dersie aus den angeln hebt & seinen