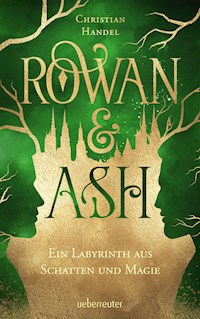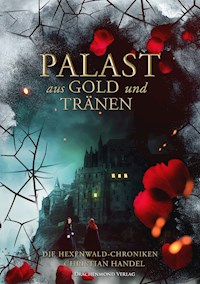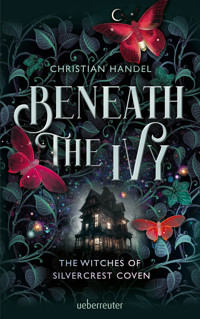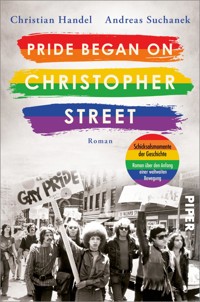8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Wünsche erfüllt ein Dschinn. Drei Prüfungen müssen Helden in Märchen bestehen. Zum dritten Mal laden wir euch ein in das magische Reich der Hexen und Lampengeister. Durch klirrendkalte Winternächte wirbeln Schneefrauen, auf Sommerweiden treiben Windsbräute ihr gefährliches Spiel und tief unter dem Meeresspiegel verbergen sich ganze Königreiche. Taucht ein in schillernde Welten voller Wunder und magischer Gefahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Von Fuchsgeistern und Wunderlampen
Eine märchenhafte Anthologie
Hrsg. Christian Handel
Copyright © 2018 by
Lektorat: Alexandra Fuchs / Stephan R. Bellem / Christian Handel
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout: Michelle N. Weber
Umschlagdesign: Alexander Kopainski
alexanderkopainski.de
Umschlagbildmaterial: Shutterstock und Jonas Jödicke (JoJoesArt): »Where Light and Dark Meet« & »Golden Moon«
Illustrationen: So Lil’ art
»Ansell & Greta« und »Giftschwestern«
übersetzt von Nina Bellem
ISBN 978-3-95991-801-5
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Vorwort
I. Märchen aus dem Morgenland
Das unglückliche Ende
Das schwarze Buch
Das alte Lied der Dünen
Die Zauberstute
II. Märchen aus dem Reich der Mitte
Pfirsichblüten im Schnee
Ein Kästchen voller Leben
III. Märchen aus dem Abendland
Ansell und Greta
Ins Blaue hinein
Krieg den Tauben
Der Elfenprinz
Schicksalsfäden
Die Windsbraut
Das Auge des Hähers
Sieben Schwestern
Im letzten Licht
Giftschwestern
Die Wunschkarte
Bücher von Hrsg. Christian Handel
Vorwort
Die »Drei« ist im Märchen eine mächtige Zahl. Drei Wünsche erfüllt ein Dschinn. Drei Tropfen Blut beschützen das Leben einer Prinzessin. Und zum dritten Mal laden wir euch mit einer Anthologie ein in die geheimnisvollen Welten, die hinter Dornenhecken und Zauberspiegeln verborgen liegen.
In den beiden vorhergehenden Ausgaben konzentrierten wir uns vor allem auf Adaptionen bekannter Geschichten. Wenn das Schlagwort Märchen fällt, denken viele von uns zuerst an Aschenputtel, Schneewittchen, Hänsel und Gretel und Dornröschen; vielleicht auch an Die kleine Seejungfrau und Das hässliche Entlein oder an Rotkäppchen und den Gestiefelten Kater. Die Beliebtheit der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, der Werke von Hans Christian Andersen und – in Deutschland schon weniger bekannt – von Charles Perrault formten nachhaltig unsere Vorstellung dieser Literaturgattung.
Dabei gab und gibt es Märchen überall. Sowohl die alten Ägypter als auch Chinesen erzählten sich schon vor über tausend Jahren Geschichten, deren Motive stark an Aschenputtel erinnern. Bei ihnen hieß die Heldin allerdings Rhodopis bzw. Yeh-hsien. Bereits Mitte des dritten Jahrhunderts sollen Teile der morgenländischen Sammlung Tausendundeine Nacht entstanden sein: spannende, oft auch erotische Erzählungen voller Wunder und Gefahren, eingebettet in eine dramatische Rahmenhandlung. An diesem erzählerischen Kniff orientierte sich im 17. Jahrhundert der Italiener Giambattista Basile mit seiner eigenen Märchensammlung Il Pentamerone. In ihr finden sich neben einigen ziemlich abgedrehten Geschichten auch ältere Varianten von beliebten Märchen wie etwa Rapunzel oder König Drosselbart. Märchen wurden eben schon immer neu erzählt und neu erfunden.
Eine Rahmenhandlung findet ihr in Von Fuchsgeistern und Wunderlampen zwar nicht, aber auch wir wagen dieses Jahr einen mutigeren Blick über den Tellerrand. Wir durchqueren Wüsten und entdecken mit dem Strandräuber Urashima ein verborgenes Königreich.
Deshalb habe ich diese dritte Märchenanthologie auch in drei Teile geteilt: Märchen aus dem Morgenland, Märchen aus dem Reich der Mitte und Märchen aus dem Abendland. Denn so sehr es uns Spaß gemacht hat, uns mit Lampengeistern und Schneefrauen zu beschäftigen, konnten wir uns dem Lockruf hiesiger Waldhexen und Elfenprinzen nicht erwehren.
Wir hoffen, ihr habt viel Freude an unseren Geschichten – egal, wer sie erzählt und egal, wohin sie euch entführen.
Es war einmal …
Christian Handel, Sommer 2018
Teil I
Märchen aus dem Morgenland
Das unglückliche Ende
Akram El-Bahay
Akram El-Bahay
Akram El-Bahay, der zu gleichen Teilen ägyptische wie deutsche Wurzeln hat, lebt und arbeitet als Autor und Journalist am Rhein. In seinen Geschichten entführt er seine Leser in schillernde Welten, die – wie er selbst sagt – »nach Wasserpfeifen schmecken und fremden Gewürzen duften«.
Für seinen Roman Flammenwüste wurde er 2015 mit dem Literaturpreis Seraph für das beste Fantasy-Debüt des Jahres ausgezeichnet. Wenn ihr orientalische Märchenabenteuer mögt (und Drachen), solltet ihr unbedingt einen Blick auf dieses Buch werfen.
Anfang des Jahres erschien sein Buch Wortwächter für Leser ab elf Jahren und vor ein paar Wochen mit Bücherkönig ein neuer Band seiner Fantasy-Saga Die Bibliothek der flüsternden Schatten.
Während ich von Akrams Büchern schwärme, schwärmt er unter anderem von den Romanen von J. R. R. Tolkien und Cornelia Funke. Märchen faszinieren ihn, weil sie »ja nur vordergründig die Geschichte(n) von Prinzessinnen, Hexen oder verwunschenen Königreichen erzählen. Dahinter steckt in der Regel eine zweite Geschichte, die viel über die Zeit und Menschen erzählt, die in ihr gelebt haben.«
Auch wenn sein Beitrag Das (un)glückliche Ende titelt, möchte ich mit ihr diese Anthologie eröffnen. Denn Akram reist ganz tief mit uns hinein in den verwunschenen Orient und verrät, wie die berühmte Märchensammlung Tausendundeine Nacht tatsächlich entstanden ist.
www.facebook.com/AkramElBahay
Das unglückliche Ende
Die Leute erzählen sich, oh glücklicher König … So beginnen sie alle, die Märchen, die ihre Zuhörer mitnehmen an fremde Orte und in vergangene Zeiten. Auf Abenteuer, die Ruhm oder Tod bedeuten können. Doch seid auf der Hut, mein König, wenn diese Worte aus dem falschen Mund kommen, können sie klebrig sein wie die Fäden eines Spinnennetzes. Euch einweben und nicht mehr freilassen.« Der alte Erzähler strich sich sein Gewand glatt und wartete auf ein Zeichen des Königs, fortzufahren.
Der Monarch zögerte für einen Moment, so als ob er sich nicht sicher war, ob er es wagen sollte, sich auf einen Weg zu begeben, der allein aus Worten bestand. Doch dann bedeutete er dem Mann vor sich mit einem Wink, weiterzuerzählen.
Der Alte nickte. Er warf einen kurzen Blick durch den Thronsaal. Marmorsäulen, ein Boden aus Alabaster und ein Goldmuster, das sich wie die Triebe einer Pflanze über die Wände schlang. Dieser Ort schien selbst einer seiner Geschichten entsprungen zu sein. Von draußen drang die Morgensonne hell durch die hohen Fenster und in ihrem Licht leuchteten die vor aufgeregter Neugier erröteten Wangen des Königs hell.
»Nun, auch meine Geschichte beginnt mit diesen Worten. Ihr braucht indes keine Angst zu haben, dass ich Euch verzaubere. Anders als es denen widerfahren ist, von denen meine Worte berichten.« Er räusperte sich, ehe er fortfuhr. »Die Leute erzählen sich, oh glücklicher König, dass es einst einen Herrscher wie Euch gab. König Schahriyâr war sein Name. Er gebot über eine Insel, die sich zwischen dem Reich des Kaisers von China und dem Land Indien erstreckte. Eines Tages erfuhr er, dass seine Frau ihm während eines Jagdausflugs untreu gewesen war. Blind vor Wut ließ er sie hinrichten und beschloss, dass er sich fortan jeden Tag mit einer neuen Frau vermählen und diese nach der Hochzeitsnacht töten lassen würde. So sollte er nie wieder von seiner Frau betrogen werden können. Die Angst unter den Töchtern der Stadt war fortan groß, von ihm zur Frau genommen zu werden. Die Tochter seines Wesirs aber, eine ebenso schöne wie kluge und mutige Frau namens Scheherazade, bat ihren Vater, den blutrünstigen König heiraten zu dürfen, um ihn von seiner Mordlust zu heilen. Sie wollte ihn mit der Macht der Märchen bekehren. Ihr Vater stimmte schweren Herzens zu, und so begann sie in der ersten Nacht mit ihrem königlichen Gemahl mit einem ihrer spannenden und wundervollen Märchen. Sie hielt erst kurz vor dem Morgengrauen in der Geschichte inne. Ihre Schwester Dinharazade, die vor dem Bett der Frischvermählten saß, bat sie darum, das Märchen fortzuführen. Und siehe da: Der König war gefangen in ihren Worten und wollte mehr hören. Er schenkte ihr das Leben für jeweils einen weiteren Tag, damit sie in ihrer Geschichte fortfahren konnte. So erzählte und erzählte sie, Nacht für Nacht, und jedes Mal brachte es der König nicht übers Herz, sie zu töten, ehe er nicht mehr von ihren spannenden Geschichten gehört hätte. Zuletzt wurde er durch die Macht ihrer Worte geheilt von seiner Gier nach dem Tod. Er schenkte Scheherazade das Leben. Sie gebar ihm drei Kinder und alle lebten glücklich bis zum letzten ihrer Tage.« Der Erzähler verzog die Mundwinkel zu einem geheimnisvollen Lächeln.
»Jaja«, murmelte der König ungeduldig. »Die Geschichten aus tausendundeiner Nacht. Jeder kennt sie. Selbst mein Kindermädchen hat sie mir vorgetragen. Hast du nichts Neueres?«
Der Alte nickte. »Sie sind alt, diese Märchen aus tausendundeiner Nacht. Würdet Ihr mir glauben, dass ich es war, der sie erstmals unter die Leute gebracht hat? Diyab Hanna, der große Erzähler. Nun, mein Herrscher, ich habe immer nur das glückliche Ende der List Scheherazades erzählt. Ich denke jedoch, dass die Zeit für die Wahrheit gekommen ist. Wenn Ihr mutig genug seid, mein König, will ich Euch das andere Ende vortragen. Das unglückliche Ende. Dunkel wie die Nacht über Eurem Palast. Und voll von dem heißen Wunsch nach Rache. Heißer als das schrecklichste Feuer.«
Der Wink kam diesmal sofort und der Alte fuhr fort: »Dann will ich sie Euch erzählen, die wahre Geschichte über König Schahriyâr, seine verlorene Frau Scheherazade und deren Schwester Dinharazade. Und über einen Erzähler, der, wie es der Zufall will, meinen Namen trägt. Doch seid auf der Hut, mein König. Denn diese Erzählung ist so unglücklich, wie es nur der Tod sein kann.« Der Alte räusperte sich und begann seine Geschichte.
Die Geschichte der Ifritin und ihrer Jägerin
Die Leute erzählen sich, oh glücklicher König, dass es einst eine Stadt gab, die sich so anmutig in einem Tal ausbreitete, als hätte die Wüste ihr eigens eine Bühne bereiten wollen. Die Kämme der Hügel, die sie im Osten, Westen und Norden säumten, waren zu schroff, um sie zu erklimmen, und boten den weiß getünchten Häusern Schutz vor den Angriffen umherstreifender Beduinen. Weit reckten sich die Türme des Palastes empor, der im Herzen der Stadt lag. Seine Kuppel war aus Silber und funkelte der Sonne wie ein auf die Erde gefallener Mond entgegen. In glücklicheren Tagen war die Stadt so häufig von Handelskarawanen besucht worden, dass, wer immer diesen Ort finden wollte, nur den Spuren der Kamele zu folgen brauchte. In den Tagen, während derer unsere Geschichte spielt, war die Stadt jedoch zu einem verfluchten Ort geworden. Seit vielen Jahren hatte niemand mehr gewagt, auch nur in ihre Nähe zu kommen. Nicht, seitdem die ersten Ghoulas in diesem Land gesehen worden waren. Man sagte, die Leichenfresserinnen würden jedem auflauern, der es betrat.
Der Mann und die Frau, die sich der Stadt mit ihrem Kamel von Süden her genähert hatten, waren die Ersten, die seit langer Zeit einen Fuß auf diesen Boden setzten. Der Mann war noch nicht ganz dreißig und blickte sich mit einer Mischung aus Abscheu und Interesse um, wie es meist Menschen taten, die die Welt nur aus Büchern kannten und feststellten, dass das Reisen viel mühseliger war als das Lesen. Er strich sich das Haar aus der Stirn, das dunkel wie das Gefieder eines Raben war. Erschöpft lehnte er sich gegen den gemauerten, mannshohen Rand eines der vielen Löcher, die sich wie die Glieder einer fast endlosen Schlange durch die Wüste wanden. Die Zugänge zum Qanat, dem Bewässerungssystem der Stadt.
»Du wusstest doch von den Ghoulas«, sagte die Frau und band sich ihre schwarzen Locken zu einem Zopf zusammen. »Warum bist du also verängstigt?«
Der Mann nickte langsam, während er seine Hände betrachtete, an denen Spuren des dunklen Blutes klebten. Man konnte meinen, die nun tote Leichenfresserin, die ihn vor kaum einer Stunde hatte verspeisen wollen, hätte eine Markierung auf seiner Haut hinterlassen wollen. Die Frau selbst trug Blutspritzer auf ihren Stiefeln, ihrer Hose und ihrem Hemd.
»Ja, ich weiß über Ghoulas Bescheid«, murmelte er. »Aber sie gehören in Geschichten.« Er sah sie an und runzelte die Stirn. »Ich bin ein Erzähler. Ich glaube nicht an den Unsinn von der verwunschenen Stadt. Sondern an die Märchen. Allein sie besitzen eine tiefere Wahrheit. Aber sie sind dennoch nicht echt.« Sein Blick fiel erneut auf seine Finger. »Sie sollten zumindest nicht echt sein.«
Dinharazade, die Frau, die ihn mit der Aussicht auf einige der unglaublichsten Geschichten und einhundert Dirham hatte überreden können, sie zur verwunschenen Stadt zu begleiten, lächelte mitleidig. »Du kennst all diese Wesen und glaubst, keines von ihnen wäre echt? Alle nur Auswüchse der Vorstellungskraft von Erzählern, deren Knochen längst blank gefressen sind? Die Ghoula, der wir den Kopf abgeschlagen haben, gehörte zu den Wachen. Sie sorgen dafür, dass sie nicht gestört wird.«
Der Erzähler griff nach einer der Trinkflaschen, die an der Satteltasche ihres Kamels hingen, und nahm einen tiefen Schluck.
»Sie?«, fragte er. »Ich verstehe nicht. Du hast mir gesagt, du suchst deine Schwester und brauchst meine Hilfe. Und ich begreife erst recht nicht, wie genau ich dabei helfen soll, jemanden zu finden. Sicher gibt es Abenteurer, die sich besser für solch eine Angelegenheit eignen.« Er wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Doch meinen Lohn will ich in jedem Fall«, schob er rasch hinterher. »Eine Sammlung der schönsten Geschichten, die es je gegeben hat.«
»Du wirst sie bekommen, Diyab Hanna«, sagte Dinharazade.
»Bloß Diyab«, erwiderte der Mann. »Ich bin es nicht gewohnt, dass man mich bei meinem vollen Namen anspricht. Nur an die ganzen Namen der Großen meiner Zunft erinnert man sich. Aber wenn du Wort hältst, werde ich vielleicht bald dazugehören. Diyab Hanna, der Erzähler. Der größte aller Erzähler. Doch ich frage mich, von wem du sprichst. Wer ist sie?«
Dinharazade biss sich auf die Lippe, als wollte sie die Worte daran hindern, zwischen ihnen hindurchzuschlüpfen. »Das dort ist die verwunschene Stadt«, sagte sie stattdessen.
Der Erzähler erbleichte. »Das ist sie? Ich dachte, sie wäre …«
»… nur ein Märchen«, beendete Dinharazade den Satz und griff nach den Zügeln des Kamels. »Wie die Ghoulas.« Sie lächelte bitter. »Ich hatte gehofft, wir würden keiner von ihnen über den Weg laufen. Der Schleichweg durch die Dünen ist schwer zu finden, wenn man nicht weiß, dass er existiert. Nun, die Leichenfresserin war noch ein Kind und leichtsinnig. Sie sind nicht oft allein unterwegs.«
»Woher kennst du eigentlich diesen Pfad?« Diyab rieb sich die Hände, um das Blut abzuwischen.
Dinharazade sah auf seine Finger und wusste, dass es vergeblich sein würde. Ghoulablut klebte wie Pech. »Ich habe ihn vor vielen Jahren zusammen mit meiner Schwester entdeckt.« Sie bemerkte den fragenden Blick des Erzählers aus den Augenwinkeln. »Die verwunschene Stadt war mein Zuhause. Ich war die Tochter des Wesirs. Aber das ist lange her.«
»Und was bist du heute?«, fragte der Erzähler verwundert.
Dinharazade hielt den Blick starr auf die Mauer der Stadt gerichtet, die so weiß wie die Jasminblüte war. »Ich bin eine Ifritenjägerin.«
»Ifriten?« Diyab sah sich um, als erwartete er jeden Moment, dass einer der Rachegeister sich vor ihnen aus der Luft schälen und sie mit seinem Feuer verbrennen würde. Nun, offenbar fing er an, seine Märchen zu glauben. Kluger Erzähler.
»Keine Angst«, erwiderte Dinharazade. Sie konnte ihm die Furcht allzu deutlich vom Gesicht ablesen. Himmel, was hatte sie sich da für einen Bücherwurm eingefangen? Sie zog kurz einen gläsernen Anhänger unter ihrem Hemd hervor, den sie an einer Kette um den Hals trug. Er war geformt wie ein Tropfen und in ihm schimmerte ein Licht golden wie die Sonne. »Eine Dschinnträne«, erklärte sie dem Mann. »Du hast von ihnen gehört?«
»In Märchen«, wisperte Diyab und betrachtete den Anhänger verzückt. »Aber ich hätte nie zu träumen gewagt …«
»Der Dschinn, von dessen Augenwinkel sie hinabfiel, starb durch die Magie eines Ifriten«, erklärte Dinharazade und ließ den Anhänger wieder unter ihrem Hemd verschwinden. »Im Augenblick seines Todes wurde sie hart wie Stein. Die Träne färbt sich rot, sobald einer dieser Rachegeister in der Nähe ist. Du siehst, es ist keiner hier.«
»Ifriten«, sagte Diyab halb zu sich selbst. Dann sah er Dinharazade in die Augen. »Unglaublich. Doch wenn du einen von ihnen jagst und deine Schwester retten willst, so vermute ich, dass der Ifrit in dieser Stadt haust. Hält er deine Schwester gefangen?«
Dinharazade verzog die Lippen zu einem freudlosen Lächeln. »Richtig und falsch, kleiner Erzähler. Ich will meine Schwester Scheherazade retten. All die Jahre habe ich dafür gelebt, um zu lernen, wie man Ifriten bekämpft und besiegt. Ihre Seele von dem Fluch löst, der sie an diese Welt bindet. Sie sind Geister, die in rauchlosem Feuer geboren werden. Menschen, die in den Flammen ihr Ende finden und denjenigen Rache schwören, die ihnen dies angetan haben. Kahle Geschöpfe mit Körpern aus schwarzem Rauch, aus denen Flammen schlagen. Mit Augen so rot wie die Abendsonne und Mäulern, die alles verschlingen können.« Dinharazade blickte den Erzähler an, der sprachlos an ihren Lippen hing, so wie es sonst seine Zuhörer taten. »Doch der Ifrit hinter diesen Mauern hält meine Schwester nicht gefangen.« Sie atmete tief durch, als bräuchte sie Kraft, um die nächsten Worte über die Lippen zu bringen. »Er ist meine Schwester.«
Das Kamel war bei Weitem nicht so störrisch wie der Erzähler. Dinharazade band das Tier an einen Pflock, den sie zwischen zwei der Zugänge zum Qanat in den Boden getrieben hatte. Von der Stadt aus sollte das Kamel nicht auffallen. Und wenn sie schnell genug waren, würden auch die Ghoulas nicht auf das Tier aufmerksam werden. Diyab hingegen beschwerte sich in einem fort, seit Dinharazade ein Seil aus der Satteltasche geholt, es am nächsten gemauerten Zugang befestigt und dem Erzähler eröffnet hatte, dass sie nach unten klettern mussten. Ihr Hinweis, dass die Ghoulas das Blut an seinen Fingern wittern konnten und er am sichersten in Dinharazades Nähe war, überzeugte ihn schließlich, ihr zu folgen. Obwohl der Weg hinab nicht allzu tief war, rutschte er zweimal fast ab und seine ängstlichen Schreie gebaren zahllose Echos in dem schmalen Gang, der sich unter der Erde erstreckte. Nichts regte sich, als sie unten ankamen. Für einen Moment lauschte Dinharazade in die Stille. Von irgendwoher hörte sie das Geräusch von Tropfen, die sich an den Innenwänden des Qanat fingen, hinabfielen und sich in der Mitte des unterirdischen Ganges zu einem schmalen Wasserlauf zusammenfanden.
Dinharazade zog eine faustgroße goldene Kugel aus einer Gürteltasche. Kaum hatte sie ihren Atem über die Kugel gehaucht, wuchs ein Licht in deren Inneren heran, das die Dunkelheit vertrieb.
»Noch so ein Zauberding?«, fragte Diyab.
»Das Herz eines Phoenix«, erwiderte Dinharazade. »Es spendet Licht und Mut. Wir können beides gebrauchen.« Sie ging voraus, das leuchtende Phoenixherz in der Hand, und versuchte nicht nur mit den Augen, sondern auch mit den Ohren zu sehen. In den Jahren, die sie Ifriten jagte, war sie nicht nur Rachegeistern begegnet. Allzu oft teilten sich die im Feuer geborenen Wesen ihre Verstecke mit Geschöpfen, die tief in den Schatten hausten. Einige von ihnen verschmolzen so gekonnt mit ihrer Umgebung, dass sie besser zu hören als zu sehen waren.
Diyab aber machte Dinharazades Bemühungen, nach ihren Feinden zu lauschen, zunichte. »Wie ist …«, begann er.
»… meine Schwester eine Ifritin geworden?« Dinharazade seufzte leise, während sich die Schatten vor ihnen widerwillig im Schein des Phoenixherzens teilten. »Sie hat den blutrünstigen König namens Schahriyâr bekehren wollen. Jeden Tag heiratete er eine neue Frau, um sie nach der ersten Nacht zu töten. Meine Schwester wollte ihn mit ihren Geschichten von seiner Mordlust kurieren. Kein Mensch kannte so viele wunderschöne Erzählungen wie sie. Und sie alle hatte Scheherazade in ein Buch geschrieben, aus dem sie für ihr Leben gern vorlas. Doch nach der ersten Nacht ließ er auch sie töten. Ich war dabei, als sie ihre Geschichte erzählte. Vergeblich bat ich sie, in der nächsten Nacht fortzufahren. Der König indes wollte nichts mehr hören. Er war grausamer zu ihr als zu den anderen. Denn er hatte ihren Plan durchschaut und sich einen besonders qualvollen Tod für sie überlegt. Bei lebendigem Leib ließ er sie verbrennen. Ich …«, sie stockte, als säßen ihr die Worte wie Splitter in der Kehle, »war dabei. Ich bin gezwungen worden zuzusehen, wie sie starb. Wie sie ihn verfluchte. Wie sie sich selbst verwünschte.« Das Herz des Phoenix in ihrer Hand zitterte, als fürchtete es sich vor der dunklen Erzählung, und sein Licht tanzte wild in der Finsternis.
»Sie hat sich zu einer Ifritin verflucht, nicht wahr?«, wisperte der Erzähler. »Es ist unverzeihlich, dies zu tun. Man sagt, nur wer in Flammen steht und so voller Wut ist, dass die eigene Seele brennt, vermag sie vom Tod zu lösen und an diesen Fluch zu binden. Wie kann man so sehr hassen?«
»Sie ist im Stich gelassen worden!« Dinharazade verfluchte sich für den Ausbruch. Sie war viel zu laut für den heimlichen Weg, den sie gewählt hatten. Rasch senkte sie ihre Stimme. »Sie hat alle um sich retten wollen. Doch keiner kam, sie zu retten. So musste sie sterben. Die Ifritin aber übertrifft denjenigen in seiner Grausamkeit, dessen Todesurteil sie empfangen hat.«
»Oh, kümmere dich nicht um die Herrin. Dein eigener Tod ist viel näher.« Die Ghoula erschien so plötzlich vor ihnen, dass Diyab erschrocken aufkeuchte.
Gleich wie viele Leichenfresserinnen Dinharazade auch bereits gesehen hatte, sie war immer wieder aufs Neue angewidert. Das Geschöpf war lang, dünn und mager wie eine Straßenkatze. Der nackte Körper wurde von weißer Haut umspannt und über dem totenähnlichen Schädel rankten sich strähnige schwarze Haare wie dünne Schlangen. Bis zur Hüfte sahen alle Ghoulas wie missgestaltete Frauen aus. Doch ihre langen, dünnen Beine endeten in Eselshufen. Die Augen steckten ihr weißen Kieseln gleich im Kopf. Dinharazade hörte sie schnüffeln wie ein Hund, der eine Fährte aufgenommen hatte.
»Es verirren sich nicht oft Besucher hierher«, kicherte die Ghoula und strich sich mit ihren bleichen Fingern über den Bauch. Wieder schnüffelte sie, dann richtete sie ihren Blick auf Diyab. Als sie die dunklen Flecken auf seinen Händen erkannte, leuchteten ihre Augen vor Hass hell auf.
»Bei allen Geschichten«, entfuhr es Diyab. »Das verfluchte Blut hat sie angelockt.« Er rieb sich über die Haut. »Und wir enden im Bauch einer Leichenfresserin.«
Die Ghoula kam näher, langsam wie eine Katze, die es darauf abgesehen hat, mit einer Maus zu spielen.
Dinharazade trat einen Schritt zur Seite, damit die Leichenfresserin freie Sicht auf Diyab hatte. »Sei vorsichtig«, sagte sie drohend. »Das Blut der anderen klebt nicht zufällig an seinen Händen. Er ist ein großer Krieger. Man nennt ihn den Ghoulaschlächter, da wo wir herkommen.«
»So?«, knurrte die Leichenfresserin und ihre Augen leuchteten heller auf.
»Er zerreißt sie mit bloßen Händen«, wisperte Dinharazade und trat noch einen Schritt zur Seite. Aus den Augenwinkeln sah sie Schatten, die sich ihnen lautlos näherten. Damit hatte sie gerechnet. Ghoulas jagten meist im Rudel und teilten sich die Beute. Es waren fünf. Zu viele, um sie einzeln zu töten. Dinharazade musste etwas anderes versuchen. »Er freut sich darauf, eure ganze Sippe auszurotten. Nur dafür hat er mich begleitet.«
»Hat er das?« Die Ghoula ging in die Knie und spannte die Muskeln ihrer sehnigen Beine an. Die Katze machte sich bereit zum Sprung.
»Hat er das?«, wiederholte Diyab fassungslos die Frage. Er sah zu Dinharazade.
»Er wird eher sterben, als dich leben zu lassen«, hauchte sie der Leichenfresserin entgegen, während ihre Finger an ihren Gürtel fuhren und sich um den Griff des Schwertes schlossen, das daran hing.
»Dann wird er sterben«, kreischte die Ghoula wild und sprang.
Diyab riss die Arme vor die Augen.
Dinharazade zog währenddessen das Schwert aus ihrem Gürtel und ließ es durch die Luft tanzen. Die Klinge trennte den Kopf der Ghoula so sauber ab, dass er durch die Höhle flog und vor die Schatten fiel, die sich am Rand des Phoenixlichtes zusammenkauerten. In Diyabs Schrei mischte sich das Kreischen der anderen Ghoulas. Plötzlich war ein Geklapper wie von Pferdehufen zu hören, das sich bald in der Ferne verlor. Dann wurde es totenstill.
Diyab fuhr sich übers Gesicht und betrachtete entgeistert den abgetrennten Kopf. Im Licht des Phoenixauges sah er fast ebenso bleich wie der zu Boden gefallene, reglose Torso der Leichenfresserin aus. »Ghoulaschlächter?« Er brachte das Wort mit einer Mischung aus Ekel und Angst über die Lippen.
»Ich musste sie ablenken. Und du siehst sehr gefährlich aus.« Dinharazade wusste nicht, ob der Erzähler den Scherz für bare Münze nahm.
»Wo sind die anderen? Da waren noch mehr, oder?«, fragte er und sah sich um.
Dinharazade steckte die Klinge in die Scheide an ihrem Gürtel. »Sosehr sie Leichen lieben, Ghoulas ertragen es nicht, den Tod der eigenen Art mit anzusehen.« Sie bückte sich, nahm den blutenden Kopf in die Hand und warf ihn Diyab zu, der ihn entgeistert auffing.
»Was …?«
»Wenn du ihn trägst, kommen sie nicht zurück, Ghoulaschlächter.« Sie lächelte, als der Erzähler den Kopf erst einen Moment voll Abscheu anstarrte und ihn dann vor sich hielt wie einen Schild. »Komm«, sagte Dinharazade. »Es ist nicht mehr weit.«
Sie folgten dem Weg, bis er an einer Steinwand endete. Eine eiserne Tür war kunstvoll in sie eingelassen, und der Wasserlauf zu ihren Füßen wurde kurz vor ihr von einer Metallplatte verschlossen. Diyab versuchte vergeblich, die Tür zu öffnen. »Offenbar abgeschlossen«, meinte er. »Hast du etwas, das uns hier helfen kann? Einen magischen Schlüssel vielleicht?«
Dinharazade schenkte ihm ein freudloses Lächeln. »Keinen magischen, aber einen aus Eisen. Der König wollte sich noch am Todestag meiner Schwester mit mir vermählen. Er hat mich bei ihrer Hinrichtung zusehen lassen, damit ich wusste, was auf mich zukommen würde. Bevor er jedoch die Ehe vollziehen konnte, kehrte Scheherazade in ihrer neuen Gestalt zurück.« Dinharazade zog einen rostigen Schlüssel aus einer Tasche ihrer Hose hervor. »Die Wachen des Königs lieferten ihr einen ebenso erbitterten wie sinnlosen Kampf. Mein Vater ergriff die Gelegenheit und brachte mich durch diese Tür aus dem Palast. Ich habe den Schlüssel, mit dem ich sie verschließen musste, damit man mir nicht folgen konnte, nie abgelegt.« Sie steckte ihn ins Schloss und drehte ihn um. »Und heute kehre ich zurück. Um meine Schwester zu erlösen und die Stadt zu befreien.«
Hinter der Tür lag ein Gang in tiefer Stille und Finsternis. Der Wasserlauf erschien wieder unter seiner eisernen Abdeckung und verschwand nach wenigen Schritten an einer Weggabelung in einem schmalen Gang zu ihrer Linken. Dinharazade wandte sich nach rechts. Die Luft roch abgestanden. Das Phoenixauge verdrängte die Schatten, die den Gang füllten. Nach einer Biegung drang heller Lichtschein zu ihnen. Zahllose Lampen brannten nicht weit entfernt in einem großen Raum, in den sich der Gang öffnete. Dinharazade blieb so unvermittelt stehen, dass der Erzähler gegen sie stieß.
»Was ist?«, zischte er aufgeregt und sah von Dinharazade zu dem Licht. »Sind dort Menschen?« Er kniff die Augen zusammen. »Vielleicht ist die Macht deiner Schwester gebrochen.«
Dinharazade schüttelte den Kopf. Niemand konnte die Macht eines Ifriten brechen. Ein Rachegeist konnte nur überlistet und eingesperrt oder getötet werden. Doch sie bezweifelte, dass einer der Einwohner ihrer Heimatstadt dazu in der Lage gewesen war.
Ihre linke Hand fand den Dolch an ihrem Gürtel von allein. Lediglich ein halbes Dutzend Bannsprüche existierten, die einen Menschen, der töricht genug war, einen Rachegeist zu jagen, vor dem sicheren Tod schützen konnten. Die Klinge, die im Schein der Lampen leuchtete, trug sie alle auf der silbernen Haut. Jeder einzelne hatte Dinharazade ein Jahr voller Gefahren und Entbehrungen gekostet. Sie alle waren die Anstrengung wert gewesen.
Dinharazade legte das Phoenixauge ab, bedeutete Diyab, ihr zu folgen und ging vorsichtig auf das Licht zu. Kurz zog sie die Dschinnträne hervor. Sie leuchtete blutrot.
Heimlichkeit machte keinen Sinn. Scheherazade war hier. Und sie wusste, dass jemand kam. Vielleicht sogar, wer kam. Neben sich hörte sie Diyab schlucken. Aus den Augenwinkeln sah sie ihn den abgetrennten Ghoulakopf wie einen Schild in die Höhe halten. Mit einem schnellen Schritt trat Dinharazade in den Lichtschein. Und sah sich verwundert um. Dort hätte eigentlich ein langer Gang sein sollen, der zu den Kellerräumen des Palastes führte. Der König hatte dort seinen Wein und die Lebensmittel lagern lassen, die man besser in der Kühle der Erde aufbewahrte. Vor ihr aber erstreckte sich ein opulent geschmückter, blind endender Flur, der zu beiden Seiten zahllose Türen aufwies. Wie viele waren es?
»Vierzig, wenn ich richtig gezählt habe«, hörte sie Diyab neben sich wispern. Es schien, als hätte er ihr die Frage von der Stirn abgelesen. »Durch welche müssen wir?«
Dinharazade antwortete nicht. Wo war Scheherazade? Sie zog eine Flasche aus schwarzem Kristall aus einer weiteren Tasche an ihrem Gürtel hervor. Das Glas, aus dem sie gemacht war, gab es nur an einer Stelle in der Wüste. Man erzählte sich, es sei die Schale eines gigantischen Eies. Den Rockvogel, der angeblich vor Jahrhunderten aus ihm geschlüpft war, hatte Dinharazade nie zu Gesicht bekommen. Neugierig, wie er wohl aussehen würde, hatte sie sich stets gewünscht, ihn aufzuspüren. Wenigstens hatte sie einen Teil des Eies. Die Flaschen, die man aus seiner Schale gefertigt hatte, waren die einzig sicheren Gefängnisse für Geister. Sie ging zu einer der Türen und strich mit den Fingern über den hölzernen Rahmen. Sie sahen alle völlig gleich aus. Schmucklos. Aus dunklem Zedernholz. Selbst der Messingknauf schien immer derselbe. Der Flur, zwischen dessen Wänden sie sich befanden, war völlig leer. Verflucht, wo war Scheherazade? Dinharazade wandte sich zu Diyab um und … erstarrte.
Hinter dem Erzähler stand ein Kind. Das dunkelhaarige Mädchen blickte sie aus schreckgeweiteten Augen an. Verflucht, wo kam es denn her? Das Mädchen konnte kaum zehn Jahre alt sein.
Diyab fuhr herum und stolperte von dem Mädchen fort, als gehörte es zu den Leichenfresserinnen. Es blickte Dinharazade und den Erzähler aus Augen an, die zu alt wirkten für ein so junges Gesicht. Die zu viel gesehen hatten. »Bitte nicht, edle Herrin«, wimmerte das Kind und machte einige Schritte weg von ihnen, während es auf den Dolch starrte. Rasch ließ Dinharazade die Waffe hinter ihrem Rücken verschwinden. Ein Kind. Also gab es noch Lebende in der Stadt. Sie trat auf das Mädchen zu und kniete sich zu ihm. »Wer bist du?«, fragte sie und strich dem Kind tröstend übers Gesicht. Sie selbst hatte einmal ganz ähnlich ausgesehen. Große, dunkle Augen in einem Gesicht, das die Sonne mit einem Schimmer von Kakao gefärbt hatte.
»Namika«, wisperte das Mädchen.
»Bist du weggelaufen?« Dinharazade hatte das Gefühl, das Kind zu kennen.
Namika nickte. Dann sah sie auf das, was Diyab in der Hand hielt, und ihr Blick verfinsterte sich.
»Hab keine Angst«, beruhigte Dinharazade sie. »Die Ghoula ist tot.«
Diyab neigte den Kopf ein wenig zur Seite. »Wir müssen weiter.«
Dinharazade wandte sich Namika zu. »Ja, wir suchen die Ifritin. Du weißt, von wem ich spreche?«
Namika nickte zögerlich. »Sie hält alle gefangen. Ich habe mich schon einmal befreien können. Doch sie fing mich und hat gedroht, dass sie mich beim nächsten Versuch töten wird.« Namika blickte Dinharazade flehentlich an. »Bitte, ich will nie wieder zu ihr.«
»Das musst du nicht«, versuchte Dinharazade sie zu beruhigen. »Dieser Ort ist verzaubert. Bist du durch eine dieser Türen geflohen?« Auf das Nicken des Mädchens hin bat Dinharazade es, auf den Eingang zu weisen, durch den es gekommen war. Das Mädchen trat vor die erste Tür auf der rechten Seite und legte die Hand auf den Messingknauf. Dinharazade aber hielt Namika am Arm fest und schob sie sanft fort. »Es ist besser, man stellt sich nicht unbewaffnet einer Ifritin entgegen«, sagte sie und hob den silbernen Dolch.
Das Mädchen warf einen ängstlichen Blick auf die Waffe und trat zur Seite.
Dinharazade überlegte einen Moment lang, Namika anzuweisen, auf dem Flur zu bleiben. Sie wusste indes nicht, wo ihre Schwester war und wollte nicht das Risiko eingehen, dass Namika Scheherazade oder einer ihrer leichenfressenden Dienerinnen begegnete, falls diese es entgegen aller Erwartung wagten, hierherzukommen.
Sie atmete tief durch. Und stieß die Tür auf.
Dinharazade blickte auf einen Marktplatz, der so festlich geschmückt war, als würde der Geburtstag des Königs gefeiert. Sie kannte diesen Platz, auch wenn er sich eigentlich irgendwo über ihnen an der Oberfläche im Zentrum der Stadt befinden musste. Hier wirkte ein Ifritenzauber. Wie lange hatte sie diesen Platz nicht mehr gesehen? Zu viele Jahre. Und doch war alles vertraut. Die Häuser, die ihn säumten. Die Stände, die bunte Tücher statt Dächer trugen. Und die Gerüche, die Dinharazade in die Nase zogen. In Öl gebackene Kichererbsenbälle, der Duft von frischem Fladenbrot, das Aroma gewürzten Kaffees. Sie schloss die Augen und sog die Erinnerungen an ein Leben, das sie verloren hatte, tief ein. Unwillkürlich machte sie ein paar Schritte auf den Platz. Alles fühlte sich echt an. Sie wollte wieder zurückgehen, doch ehe sie sichs versah, war sie von Menschen umringt, die ihr im Weg standen. Dinharazade hatte Mühe, sie aus dem Weg zu drängen. Dann endlich erkannte sie Diyab. Er stand auf dem Platz. Die Tür aber war weg. Und Namika ebenfalls. »Wo …?«, begann sie, und der Erzähler deutete bereits in die Menge.
»Jemand hat sie hineingezogen«, erklärte er unglücklich. »Ich bin hinterher, und dann ist die Tür verschwunden und ich habe das Mädchen aus den Augen verloren.«
Dinharazade fluchte. Dieser Ort duftete nicht nur verführerisch nach schönen Erinnerungen, sondern trug auch den Gestank einer Falle in sich. Verdammt, sie selbst hatte die Tür geöffnet und damit zugelassen, dass ihre Schwester das Mädchen in die Finger bekam. Also war es ihre Aufgabe, die Kleine zu retten.
»Es geht los«, raunte sie Diyab zu. Ihr Schwert würde ihr hier nicht helfen. Sie legte es ab. Dies war die Welt einer Ifritin. Und nur der Dolch konnte sie töten. Dinharazade sah sich um. Und nun? Finde das Mädchen und dann deine Schwester, sagte sie sich.
Zusammen mit Diyab machte sie sich auf die Suche. Sie wusste nicht, welchen Weg sie einschlagen sollten. Aufs Geratewohl liefen sie an dem Stand eines Kesselmachers vorbei, passierten einen Obsthändler, der seine Früchte zu waghalsigen Pyramiden aufgeschichtet hatte, und fielen fast über die Säcke eines Gewürzverkäufers. Doch sie fanden keine Spur von Namika. Ebenso wenig entdeckten sie einen Hinweis auf die Ifritin. Dinharazade blieb stehen und sah sich ratlos um, als Diyab zum Ende des Platzes deutete. »Da ist sie!«, rief er.
Tatsächlich! Dinharazade erkannte Namika. Ein Mann, der wie der König gekleidet war, hielt sie an der Hand. Er wiederum stand vor einem kleinen Mann, der die Zügel eines gewaltigen Vogels hielt. Dinharazade glaubte ihren Augen nicht zu trauen. Es war der Rockvogel. Er sah genauso aus wie auf den Bildern in den Büchern, die sie als Kind so geliebt hatte. Seine Federn schimmerten im Licht der Mittagssonne mal golden, mal silbern. Sein Leib ähnelte dem eines Adlers, der Schnabel erinnerte Dinharazade jedoch an einen Geier. Majestätisch warf er den Kopf in die Höhe und stieß einen hellen Schrei aus. Die Menschen auf dem Marktplatz scharten sich um den Vogel und ihren König. In dem Gedränge verlor Dinharazade das Mädchen aus den Augen. Im nächsten Moment entdeckte sie es wieder. Der König setzte Namika gerade auf den Rücken des Vogels. Was machte er da? Wieso lief Namika nicht weg? Weil sie vermutlich unter dem Bann der Ifritin steht, gab sich Dinharazade selbst die Antwort. So wie alle hier. Kaum war der König zurückgetreten, riss sich das Tier los und schlug wild mit den Flügeln.
»Nein«, schrie Dinharazade. Sie hörte sich selbst kaum, da sich die erschreckten Rufe der Menschen über den Marktplatz erhoben.
Namika klammerte sich in Todesangst an den silber-goldenen Federn des Vogels fest, während das Tier mit ihr in den Himmel stieg.
Dinharazade fuhr zu dem Erzähler herum, der wie erstarrt dem Rockvogel nachsah. »Tu etwas«, rief sie ihm zu.
Diyab sah sie an, als habe sie den Verstand verloren. »Ich? Was kann ich tun?«
»Es ist eine Geschichte. Verstehst du? Der Zauber meiner Schwester. Ich habe ihre Stimme gehört an jenem Tag, an dem ich geflohen bin. Die Leute erzählen sich, oh glücklicher König. Sie hat König Schahriyâr und alle Menschen in dieser Stadt in eine Geschichte eingewoben. Das alles ist ein erzähltes Gefängnis.«
»Eine Geschichte?« Diyab blickte sich verwundert um. »Wozu sperrt eine Ifritin diese Menschen in eine Erzählung ein?«
»Weil sie leben will«, erwiderte Dinharazade. »Wenn ich recht habe, braucht sie die Menschen, denen sie ihre Geschichten erzählt. Mit jeder Sekunde, die sie ihren verzauberten Worten lauschen, verlieren sie mehr von ihrem Leben. Bis nichts mehr davon übrig ist. Dann wird Scheherazade vermutlich weiterziehen. Eine neue Stadt finden, deren König sie eine Geschichte erzählen kann.«
Die Erkenntnis zeichnete sich langsam auf Diyabs Gesicht ab. »Das heißt, auch wir …«
Dinharazade nickte. »… stecken in einem ihrer Märchen. Vermutlich seit wir den Platz betreten haben. Aber wir sind noch bei Verstand. Und du kannst sie besiegen. Denn du bist ein Erzähler. Und in dieser Welt sind Worte Magie. Begreifst du das?«
»Deshalb hast du mich mitgenommen? Weil du einen Erzähler für diese Ifritengeschichte gebraucht hast? Ich weiß nicht, ob ich dazu imstande bin.« Er atmete tief durch. Dann reckte er sich und starrte zu dem Vogel empor, der fast die Wolken erreicht hatte. »Gut, ich versuche es«, meinte er wenig überzeugt. »Die Leute erzählen sich, oh … nun sie erzählen sich, dass an dem Tag, an dem der Rockvogel ein Mädchen entführte, ein Mann in die Stadt kam, dem ein Pferd aus Eisen folgte. Es wirkte wie ein lebendes Geschöpf, doch es war allein durch die Kunstfertigkeit seines Besitzers entstanden. Auf seinem Rücken befanden sich zwei«, Diyab suchte einen Moment nach den rechten Worten, »Wirbel, ja. Drehte man den linken, so erhob sich das Pferd, und drehte man den rechten, so landete es.«
Er hatte kaum geendet, als das Klappern von Hufen zu hören war. Die aufgebrachte Menge stob auseinander wie ein Schwarm Vögel, in den man einen Stein geworfen hatte, und ein prächtiges Pferd erschien. Es sah aus, wie Diyab es beschrieben hatte. Dinharazade betrachtete es fasziniert. Auf dem Rücken trug es die beiden Wirbel. Das Zaumzeug, an dem ein Mann es führte, war silbern und der Sattel aus einem Leder, das ebenso grau wie das Metallpferd war. Der Mann ließ es los, leichtfüßig trabte es zu dem Erzähler und blieb vor ihm stehen.
Diyab starrte das Pferd an wie eine Traumgestalt. »Unglaublich«, wisperte er. »Hier werden Geschichten wirklich wahr.«
»Sieht so aus«, meinte Dinharazade. Sie steckte den Dolch ein und schwang sich auf den Rücken des Pferdes, während sich sein Besitzer tief verbeugte.
Der Erzähler sagte nichts, setzte sich lediglich hinter sie und Dinharazade drehte den linken Wirbel. Sogleich stieß sich das Pferd mit allen vier Beinen ab und stieg so schnell in die Höhe, dass Dinharazade für einen Moment flau im Magen wurde. Die Menschen unter ihnen wurden schnell kleiner und nach wenigen Augenblicken schienen sie wie Ameisen. Plötzlich schoben sich Wolken unter das fliegende Pferd und verdeckten die Welt. Dinharazade sah nur noch den Himmel. Es gab nichts anderes. Wie ein Vogel flog das Pferd durch die Luft. »Wie lenkt man es?«, rief sie Diyab zu.
»Du musst ihm das Ziel ins Ohr flüstern.« Diyab wirkte geradezu euphorisch. Vermutlich war es der Stolz über seine wahr gewordenen Worte.
Dinharazade beugte sich vorsichtig vor. »Bring uns zu Namika«, wisperte sie dem Eisenpferd ins Ohr. Kaum hatte sie die Worte ausgesprochen, machte das Pferd kehrt und schoss in die Tiefe. Dinharazade klammerte sich an den eisernen Hals, während sie Diyabs Hände an ihren Hüften spürte. Die Wolkendecke brach auf. Unter ihnen lag nicht mehr der Marktplatz, sondern zu Dinharazades Verwunderung das Meer. Vermutlich eine neue Ifritengeschichte. Wellen bäumten sich wütend auf. Dinharazade hielt Ausschau nach dem gewaltigen Vogel. »Wohin fliegt er?«, rief sie.
»Dorthin, schätze ich«, antwortete Diyab, der eine Hand von ihr löste und auf eine Stelle im Meer deutete.
Dinharazade blickte in die Richtung, in die er wies, und erkannte einen einzelnen Berg, der sich trotzig aus dem Wasser erhob. Die Schaumkronen der Wellen tanzten um ihn herum und er war gesäumt von den Wracks zahlloser Schiffe. Im ersten Moment schien er winzig. Das Pferd aber schoss so schnell auf ihn zu, dass er rasch in die Höhe wuchs.
»Langsamer«, wies Dinharazade das Pferd an, doch es gehorchte nicht.
Der Berg wurde vor ihren Augen immer größer. Schon konnte Dinharazade die Höhlen erkennen, die seinen steinernen Leib wie dunkle Flecken musterten. Einen Augenblick später erkannte sie auf seiner Spitze ein gewaltiges Vogelnest. Und in ihm … Dinharazade stockte der Atem. Dort lag Namika. Sie rührte sich nicht. War sie tot? Und wo war Scheherazade?
»Du musst an dem Wirbel drehen«, schrie ihr Diyab von hinten zu. Er deutete auf den rechten. Sie drehte ihn, ohne dass das Pferd reagierte. Wieso wurde es nicht langsamer? Dinharazade versuchte es noch einmal. Vergeblich. Wütend schlug sie auf den Eisenleib. Sie würden wie die Schiffe enden, die erlegten Tieren gleich dem Berg zu Füßen lagen. Hatten sie versucht, dort zu ankern? Nein! Dinharazade verstand. Die Schiffe trugen nicht nur Holz, sondern auch Eisen am Leib. »Der Berg ist ein verfluchter Magnet. Erzähle etwas anderes«, rief sie Diyab zu. »Schnell, oder wir werden zerschmettert.«
»Etwas erzählen?« Diyab schwieg einen Moment. »Mir ist zu Ohren gekommen … Nein. Die Leute erzählen sich, oh glücklicher König, ach verdammt, dass es …« Seine nächsten Worte gingen im Rauschen des Windes unter. Das Pferd schoss schnell wie ein Pfeil auf den Berg zu. Es war nur noch eine Frage von Augenblicken, bis sie sterben würden. Dinharazade hörte den Erzähler etwas Unverständliches murmeln. Dann, kurz bevor das Eisenpferd gegen den Berg schlug, packte er Dinharazade an den Schultern und riss sie mit sich vom Pferd.
Dinharazade schrie, während sie hinabstürzten. Sie würden sterben. Sie … Dinharazade spürte, wie sie mit dem Rücken auf etwas Weichem landete. Ein Scheppern erfüllte die Luft, als das Eisenpferd gegen die Bergflanke prallte. Unwillkürlich warf sich Dinharazade auf die Seite. Und fand sich zu ihrer Verblüffung auf einem Teppich wieder. Das Knüpfwerk segelte friedlich in der Luft. Dinharazade gelang es mit Mühe, ihr wild schlagendes Herz zu beruhigen. »Ein Teppich?«
»Er ist nicht aus Eisen, oder?«, erwiderte Diyab, der ebenfalls auf dem Teppich gelandet war und sie überheblich angrinste.
»Nein.« Dinharazade erwiderte das Lächeln schwer atmend. »Sag ihm, dass er uns zu dem Nest bringen soll.«
Sie hörte Diyab ein paar Worte sagen, und der Teppich stieg sanft in die Höhe. Dinharazade zog den silbernen Dolch aus der Halterung an ihrem Gürtel. »Namika sitzt dort im Nest des Rockvogels. Wir retten sie und dann machen wir all dem ein Ende.«
»Soso«, hörte sie eine Stimme dröhnen. Sie schien von überall her zu kommen und war so durchdringend, dass Dinharazade glaubte, sie tief im Inneren zu fühlen. »Ihr wollt all dem ein Ende machen. Das glaube ich aber nicht.«
Der Teppich blieb auf einmal in der Luft stehen, als würde er festgehalten. Dinharazade fuhr herum. Und blickte einem gewaltigen Dschinn ins Antlitz. Seine Füße wurden vom Meer bedeckt, doch sein Kopf reichte bis fast hinauf zur Bergspitze. Er war bis auf einen schmalen Zopf an seinem Hinterkopf kahl und sein muskulöser Körper steckte in langen Hosen. Verflucht, wo kam der her? Natürlich aus den Geschichten deiner Schwester, gab sie sich selbst die Antwort.
»Und wieso glaubst du das nicht?« Diyab wirkte ungewohnt kühn. Da war eine Abenteuerlust in ihm erwacht, die sich nur zeigte, wenn man dem Tod um Haaresbreite entkommen war. Offenbar hatte die Erleichterung, noch zu leben, etwas in ihm geweckt, das Dinharazade nicht erwartet hatte. Mut.
»Weil ich euch zerschmettern werde«, donnerte der Dschinn.
»Zerschmettern?« Diyab lachte, und Dinharazade war sich nicht mehr sicher, ob er wirklich mutig oder nicht eher verrückt war. »Du kannst dir nicht mal etwas Passendes zum Anziehen herbeizaubern. Wie willst du da eine Ifritenjägerin und ihren Erzähler besiegen? Du bist nicht mächtiger als einer der Betrüger, die auf den Marktplätzen ihre Zauberkunststücke vorführen.«
»Wag nicht, mich zu beleidigen«, brüllte der Dschinn zornig.
Oh, sie waren eitle Wesen. Dinharazade hatte im Lauf der Jahre wenigstens fünf von ihnen gesehen, alle von der eigenen Macht berauscht.
»Ich werde dir beweisen, dass ich das mächtigste Geschöpf der Welt bin.«
»Ach, wirklich?«, höhnte Diyab. »Du ahmst mit deiner armseligen Gestalt uns Menschen nach. Ganz so, als würdest du dich nicht trauen, dir ein eigenes Äußeres zu schenken. Sicher bringst du es nicht einmal fertig, dir … sagen wir … eine Haut aus Eisen zu machen.«
Der Dschinn war außer sich, und Dinharazade fürchtete, er würde sie beide auf der Stelle mit seinen gewaltigen Händen zerdrücken wie Fliegen. Doch er fühlte sich herausgefordert, und dabei vergaßen Dschinnen alles. Dinharazade wusste das aus eigener Erfahrung. Und Diyab aus seinen Märchen offenbar auch.
Der Dschinn schnippte mit den Fingern und ihm wuchs noch im selben Moment eine eiserne Haut. Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen, da wurde er auch schon gegen den Berg geschmettert und zerbrach.
Dinharazade blickte Diyab verblüfft an. Es schien ihr, als würde sie neben einem anderen Mann sitzen. Wo nur war der tollpatschige Erzähler hin?
»Es ist eine Geschichte, oder?«, fragte er übermütig. »Und damit kenne ich mich aus.«
Der Teppich stieg, nun, da der Dschinn besiegt war, weiter in die Höhe. Von dem Rockvogel war keine Spur zu erkennen. Ein wenig bedauerte es Dinharazade. Sie hätte ihn allzu gerne noch einmal gesehen.
Ehe sie sein Nest erreichten, zogen mit einem Mal Wolken auf und legten sich um die Spitze des Berges. Der Teppich stieß durch den Dunst hindurch. Und siehe da: Statt der Bergspitze erstreckte sich vor ihnen eine gewaltige, verlassene Stadt, die ganz und gar aus Bronze gemacht schien. Das Meer war fort und ebenso der Berg. Sie flogen plötzlich kaum eine Handbreit über dem Boden. Wieder eine neue Ifritengeschichte.
»Nun, du bist nicht der Einzige, der erzählen kann«, murmelte Dinharazade. Der Teppich landete auf einen Befehl von Diyab hin direkt vor dem Palast der Bronzestadt. Dinharazade und er stiegen ab. Zwölf breite Stufen führten durch ein gewaltiges Tor in den Palast hinein. Doch niemand kam ihnen entgegen. Ebenso wenig sahen sie Menschen auf den Straßen. Sie waren allein. Dinharazade zog ihre Dschinnträne hervor. Sie schimmerte blutrot. Nein, sie hatte sich geirrt. Allein waren sie nicht.
Ihre Schritte hallten laut auf dem Marmorboden, als sie durch das Palasttor gingen. In der Eingangshalle brannten Feuer in wenigstens einem Dutzend Metallschalen. Doch weder waren Diener noch Wachen zu sehen. Die Halle führte auf ein weiteres Tor zu, dessen goldene Flügel von selbst nach innen aufschwangen, kaum dass Dinharazade die Hand daran legte.
Der Thronsaal war zu groß für den Palast. Zu groß, um überhaupt Wände auszumachen. Aber er war nicht leer, wie Dinharazade erwartet hatte. Sie waren alle da. Dinharazade erkannte einige von ihnen. Gesichter, die sie lange nicht gesehen hatte. Flüchtige Bekannte und Freunde, lange entbehrt. Sie schluckte. War ihr Vater unter ihnen? Unter all den Einwohnern ihrer Heimatstadt? Sie sah ihn nicht. Und es war keine Zeit, ihn zu suchen. Die Menschen schienen mit offenen Augen zu schlafen. Sie standen steif und stumm da und bildeten ein Spalier, an dessen Ende ein gewaltiger Thron stand. Er war so schwarz wie ein Stück Nacht. Auf ihm saß eine hünenhafte Gestalt, aus deren ebenso schwarzem Leib Flammen loderten. Oh, sie sah aus, wie die Geschichten Ifriten beschrieben. Schwarze, kahle Wesen. Hünenhaft mit blutroten Augen und einem riesigen Maul. Für einen Moment fürchtete Dinharazade, dass ihr die Beine versagen würden. Da war sie. Diesen Moment hatte sich Dinharazade in so vielen Nächten ausgemalt. Doch es gab keine Worte, die ihre Gefühle in diesem Augenblick beschreiben konnten.
Zu Scheherazades Füßen lag auf einem Steinblock eine reglose Gestalt. Und daneben hockte Namika. Dinharazades Herz machte einen Sprung.
»Ihr seht euch nicht besonders ähnlich.« Diyab schluckte tapfer die Angst hinunter, die er sicher im Herzen fühlte, und versuchte sich an einem aufmunternden Lächeln, das ihm jedoch nicht recht gelingen wollte. »Ich gehe recht in der Annahme, dass dies deine Schwester ist? Doch wer sind all die anderen?«
»Die Menschen, die in ihren Zauber verwoben sind«, erwiderte Dinharazade. Dann ging sie mit ihm auf ihre Schwester zu.
Dinharazades Blick wechselte zwischen der Ifritin, dem Mädchen und den Menschen in dem Thronsaal hin und her. Nur ihre Schritte waren zu hören. Immer weiter suchte sie ihren Vater. Vergeblich.
»Er ist tot.« Die Worte klangen wie das Schnipp-Schnapp einer Schere, die durch Luft schnitt. Die Ifritin erhob sich und reckte ihre gigantische Gestalt. Die Flammen tanzten ausgelassen auf ihrem Leib.
Dinharazade hielt die Tränen zurück. Nicht jetzt.
»Ich habe immer gewusst, dass du eines Tages kommen würdest«, sagte die Ifritin mit schneidender Stimme. »Ich habe dich vermisst. Du und ich hatten doch einen Plan. Du solltest den König überreden, mir aufzutragen, meine Geschichten Nacht für Nacht weiterzuerzählen.« Scheherazades Blick fiel auf die Gestalt, die auf dem Steinblock lag. Ein Mann, das Gesicht so bleich und abgemagert, dass es einem Totenschädel ähnelte. Die Ifritin hatte ihm offenbar fast alles Leben gestohlen. Auf dem Kopf trug er eine Krone und zu seinen Füßen lag ein Buch.
Dinharazade erkannte es. In ihm standen die Geschichten, die ihre Schwester gesammelt hatte. Auch Namika hielt den Blick fest auf das Buch gerichtet, während ihre Lippen zuckten, als würde sie sich Mut zusprechen.
»Mein Gatte.« Die Stimme gab Dinharazade das Gefühl, in ihrem Inneren Schnitte zu hinterlassen. »Er hört mir so gerne zu. Sie alle tun das.«
»Gib sie frei«, sagte Dinharazade und richtete den Dolch auf ihre Schwester.
Zur Antwort knurrte die Ifritin wie eine Hyäne und beugte sich vor. Ihr Mund öffnete sich über die gesamte Breite ihres Gesichtes. Dinharazade sah das Feuer in ihrem Rachen lodern. Dann lösten sich die Flammen aus dem Mund und schossen auf Dinharazade zu. Im letzten Moment warf sie sich zur Seite. Die Flammen strichen ihr über die Haut und sengten ihr die Haare an. Ihre Schwester sprang von ihrem Thron auf und machte einen Schritt auf Dinharazade zu. Aus ihren Fingern lösten sich weitere Flammen. Sie tanzten ausgelassen auf der brennenden, verkohlten Haut der Ifritin. Scheherazade schien es nicht eilig zu haben, ihrer Schwester den Tod zu bringen. Sie ließ zu, dass Dinharazade aufstehen und hinter dem Steinblock Deckung finden konnte. Wo war Namika? Und wo war der Erzähler? Dinharazade beugte sich um den Steinblock herum, den silbernen Dolch in der Hand … und stolperte sofort zurück. Die Flammen krochen schnell um den Steinblock auf sie zu. Wie Schlangen wanden sie sich. Scheherazades Finger tanzten durch die Luft, als wäre sie eine Puppenspielerin. Vermutlich führten sie die Flammenbänder.
Nach wenigen Augenblicken hatten die Flammen Dinharazade eingeschlossen. Sie war in einem Kreis gefangen, der sich langsam enger zog. Ihr Versuch, über das Feuer zu springen, endete damit, dass eines der Flammenbänder vorstieß und sie wie eine Schlange in den Oberschenkel biss. Der Schmerz ließ Dinharazade fast ohnmächtig werden. Geschlagen sank sie auf die Knie.
»Das ist das Ende deiner Geschichte.« Scheherazades Stimme klang in diesem Moment mehr als zuvor wie aus einem Albtraum.
»Wenn du eine weitere Erzählung kennst, wäre das ein guter Moment.« Dinharazade konnte Diyab nicht sehen. Sie hoffte nur, dass er sie hörte.
»Ich habe lange darauf gewartet, mich an dir rächen zu können«, zischte Scheherazade.
»Hallo? Bist du noch da?« Dinharazade stemmte sich trotz der Schmerzen auf die Beine und versuchte, unter den Menschen den Erzähler auszumachen. War er geflohen? Offenbar. Mit einem Mal fühlte sich Dinharazade so einsam wie nie in ihrem Leben.
»Du wirst mein Schicksal teilen«, fuhr ihre Schwester ungerührt fort. »Du wirst brennen.« Langsam kam sie auf Dinharazade zu.
»Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Ifritin, die zahllose Menschen in ihre Geschichte gesperrt hatte, plötzlich alle Worte verlor.«
Diyab. Er war doch noch da. Plötzlich war es still. Dinharazade sah zu dem Schatten, der hinter der Ifritin erschien. Der Erzähler. Er hatte die Augen geschlossen und seine Lippen bewegten sich.
Er sprach, leiser nun, und Dinharazade verstand nicht mehr, was er sagte. Doch die Ifritin war wie erstarrt, und endlich entdeckte Dinharazade das Mädchen. Es war ganz in der Nähe der Ifritin bei dem Steinblock. »Komm«, rief sie ihr zu. Das Mädchen aber bewegte sich nicht. Und es sagte keinen Ton. Seine Augen aber glühten vor Hass. Noch nie hatte Dinharazade einen Menschen so hasserfüllt gesehen.
Dann verstand Dinharazade. War sie blind gewesen? Sie hatten die Ifritin nie hinter einer der vierzig Türen suchen müssen. Sie hatten sie bereits im Flur gefunden. Namika hatte sie tief in die Ifritengeschichte gelockt. Das brennende Geschöpf vor ihr war nur eine Täuschung.
Dinharazade humpelte auf Namika zu. Das Mädchen verschwamm hinter den Tränen, die Dinharazade plötzlich in die Augen schossen. »Ich schenke dir ein glückliches Ende, Schwester«, wisperte sie. Sie sah durch den Tränenschleier, wie die Gestalt des Mädchens wuchs und in Flammen aufging. Die Ifritin zeigte sich in ihrer wahren Gestalt. Sie hob die Hände, Flammen wuchsen ihr aus den Fingern. Doch Dinharazade hatte die silberne Klinge bereits geworfen. Sie traf genau ins Herz. Mit einem Schrei, der von einem Riesen hätte stammen können, zerbarst die Ifritin. Dann wurde es dunkel um Dinharazade.
Als sie erwachte, lag sie im Freien auf dem Platz, den sie hinter der Tür gefunden hatte. Dieser hier fühlte sich jedoch echt an. Es war kalt und über ihr zeigten sich bereits die Sterne am Nachthimmel. Dinharazade erhob sich blinzelnd. Neben ihr kniete Diyab und hinter ihm sah sie Menschen, die umherstolperten, als wären sie aus einem Traum erwacht. Sie hatten die Stadt gerettet.
»Du lebst«, wisperte er.
»Was ist mit meiner Schwester?« Dinharazades Stimme klang rau.
»Tot«, erklärte Diyab. »Ich hätte nie gedacht, dass sie das Mädchen war. Kaum war sie besiegt, verschwand alles. Der Thron, der ganze Palast …«, er stockte, und Dinharazade legte ihm die Hand auf den Arm. »Nur das hier konnte ich retten.« Er deutete auf ein Buch, das neben Dinharazade lag. Die Erzählungen ihrer Schwester. »Ich weiß nicht, wie wir alle hierhergekommen sind.«
»Die Geschichte meiner Schwester hat ein Ende gefunden«, sagte Dinharazade leise. Sie griff nach dem Buch. »Nimm es«, bat sie. »Es ist die versprochene Belohnung. Die schönsten Geschichten, die von einer Menschenzunge erzählt werden können.« Sie wollte Diyab das Buch reichen, doch dann zögerte sie. »Schwör mir jedoch eines. Ich will nicht, dass der Name meiner Schwester bekannt wird als der einer todbringenden Ifritin. Sie hat den Preis bezahlt, weil sie andere retten wollte.«
Diyab nickte. »Ich schenke ihr das, was du ihr geben wolltest. Ein glückliches Ende.« Er lächelte Dinharazade an und beugte sich so tief zu ihr herab, dass sie seinen Atem auf ihren Lippen spüren konnte. Nein, er war wirklich nicht mehr derselbe Mann wie zu Beginn ihres Abenteuers. Und sie war nicht dieselbe Frau. Dinharazade, die Ifritenjägerin, war mit ihrer Schwester gestorben. Wer würde sie nun sein? Es gab zahllose Möglichkeiten. Diyabs Kuss war ehrlich und tröstend und brachte ihr Herz so heftig zum Schlagen wie … noch nie zuvor. Sie erwiderte den Kuss, bis sie beide genug Liebe beieinander gefunden hatten. Dann gab sie ihm das Buch.
Er öffnete es vorsichtig und blätterte durch die Seiten. »So viele Geschichten«, murmelte er. »Genug für eintausend…«, er blickte hinauf zum Himmel, auf dem die Sterne wie Silbertropfen schwammen, »tausendundeine Nacht. Ich werde sie erzählen. Alle. Und niemand wird deine Schwester je vergessen. Denn Geschichten sind beständiger als die Zeit. Sie sind unsterblich.«
Das schwarze Buch
Ava Reed
Ava Reed
Ava Reed bezeichnet sich selbst als Buchverrückte. Sie ist eine leidenschaftliche Leserin, teilt ihre Liebe zu mitreißenden Geschichten auf Facebook, Instagram und der eigenen Website und schreibt seit einigen Jahren selbst emotionale, oft fantastische Romane. In vielen ihrer Geschichten geht es um Verlust, Liebe und Mut.
Sie wurde in Saarbrücken geboren, lebt aber mittlerweile in Frankfurt am Main, wo sie Lehramt studiert hat. Inzwischen konzentriert sie sich voll und ganz aufs Schreiben. Gerade ist Mondlichtkrieger erschienen. Damit setzt sie Mondprinzessin fort, ihr Fantasyjugendbuch, das 2016 auf den ersten Platz beim Lovelybooks Leserpreis 2016 in der Kategorie Fantasy & Science Fiction gewählt wurde.
Im kommenden Jahr erscheint nicht nur ihr nächstes Jugendbuch Alles. Nichts. Und ganz viel dazwischen, sondern auch der Auftakt ihrer neuen Fantasyreihe. Trotz dieses vollbepackten Kalenders hat sie es geschafft, für unsere diesjährige Anthologie etwas zu schreiben. Ich liebe Geschichten, die Aspekte eines Märchens aufgreifen und daraus eigene, neue Geschichten weben. Aber welchem orientalischen Märchen sich Ava in Das schwarze Buch widmet, verrate ich euch nicht. Das dürft ihr nun selbst entdecken.
www.instagram.com/avareed.books/
Das schwarze Buch
Es geschah in einer sternenklaren Nacht.
Eine Entscheidung ward getroffen, um zu retten,
was zu retten war, und zu bewahren, was zu bewahren galt.
Ein Fluch ward gesprochen, der die Zeit überdauerte.
Bis ein Fremder kommen würde, ihn zu brechen.
Abadi glaubte nicht an Magie. Aber er glaubte daran, dass Wunder geschehen konnten. Sein Vater Said erklärte ihm stets, dass es Menschen gab, die stärker mit dem Universum verbunden waren als andere. Dabei lehnte sich Said gerade so weit zu ihm, dass Abadi seinen Atem spürte und den Duft seiner Haut wahrnahm, die nach Rauch und Pergament roch. So weit, dass Said lediglich flüstern musste und Abadi augenblicklich eine Gänsehaut bekam.
Er kannte die Worte seines Vaters auswendig.
In dieser Welt und allen anderen unterscheiden wir uns nur durch zwei Dinge: unser Gehör und unser Herz. Höre zu, wenn es darauf ankommt, und sprich mit dem Herzen, wenn die Zeit gekommen ist.
Jedes Wort glich einem Versprechen, einer Prophezeiung, einem alten Zauber, und kroch durch Abadis Glieder, um schließlich in seiner Mitte zu verharren. Es kam ihm vor, als wären die Sätze für ihn bestimmt, als wären sie für ihn geschaffen worden. Als hüteten sie ein Geheimnis, von dem Abadi noch nichts wusste.
»Wo steckst du?« Said fluchte leise, aber bestimmt, während er nach seinem Sohn suchte, der sich wieder einmal in seinen Gemächern versteckte und in verschiedenen Schriften las. »Ich weiß längst, wo du bist«, sagte Said, als er die raue, lange Decke über seinem Holztisch hochhob und Abadi lesend darunter fand. »Was ich nicht weiß, ist, warum ich stets danach frage, wo es so offensichtlich ist.« Said wollte streng klingen, nahezu tadelnd, doch er schaffte es nicht. Er musste sich zu sehr bemühen, sein Lächeln nicht zu zeigen, und genauso wenig seinen Stolz. Abadi war bedeckt mit verschiedenen Papieren, wie eh und je, aber Said war sich sicher, dass er von allen Schriften nicht einmal die Hälfte lesen und entziffern konnte. Sie waren zu kompliziert für ihn. Neben Abadi brannte sich eine kleine Flamme ihren Weg den Docht entlang und spendete warmes Licht.
Said ging langsam auf die Knie, stützte sich mit den Armen auf ihnen ab, um Abadi besser ins Gesicht sehen zu können. »Der Sultan erwartet uns. Er und sein Sohn.«
»Ich möchte keine Zeit mit Raed verbringen, Vater.«
Dieses Thema war in den vergangenen Tagen oft aufgekommen und Said begann sich Sorgen zu machen.
»Raed ist dein Freund.«
»Er ist der Sohn des Sultans.«
»Und das schließt seine Freundschaft aus?«
»Er ist älter als ich.«
»Wenige Monde und das weißt du. Es wird Zeit, mir zu sagen, was dich wirklich beschäftigt«, forderte Said mit ruhiger Stimme und offenem Blick. Abadi presste die Lippen zusammen und man sah ihm an, dass er mit sich rang. Die letzten Male, als Said ihn gefragt hatte, war er stumm geblieben.
»Ich bin Abadi, Vater. Nur Abadi. Irgendwann wird er nicht mehr nur Raed sein.«
Die Worte sickerten in Saids Verstand und nun wurde ihm klar, was seinen Sohn belastete. »Hast du Angst vor dem Tag, an dem dein Freund Sultan wird?«
»Angst ist etwas für Feiglinge«, erwiderte Abadi trotzig. Said lächelte und hielt seinem Sohn die Hand hin. Ohne ein weiteres Wort löschte dieser die Flamme und ergriff die Hand seines Vaters, um sich beim Aufstehen helfen zu lassen.
Sie gingen zu ein paar großen, edel verzierten und bestickten Kissen, auf denen Abadi am liebsten saß, weil sie am gemütlichsten waren.
»Wo soll ich anfangen?«, fragte Said, während er seufzte und die Arme wie zuvor auf seinen Beinen ablegte. Er fixierte seinen Sohn, der seinen Blick jedoch gesenkt hielt.
»Ein Feigling ist man nicht, weil man Angst hat. Man ist es, weil man Mut nicht zulässt. Angst ist keine Schwäche. Sie kann uns zu Stärke verhelfen. Wir können an ihr wachsen oder zugrunde gehen. Die Entscheidung liegt bei uns.« Said legte seine Finger unter Abadis Kinn und zwang ihn, ihm ins Gesicht zu sehen. »Hast du das verstanden? Lass deine Ängste zu, dann kannst du gegen sie kämpfen.«
Abadi sah in die großen Augen seines Vaters, die den seinen so ähnelten, und nickte. Ja, er verstand, was Said ihm sagen wollte, und er spürte die Wahrheit der Worte in jeder Faser seines Körpers.
»Was Raed angeht …« Said zog seine Hand zurück und legte seinen Kopf schief, während er Abadi musterte. »Ein Freund ist ein Freund, wenn Seele und Seele zusammenpassen. Wenn du glaubst, du könntest Raed verlieren, muss es vielleicht so sein.«
»Das ist es nicht, Vater«, gestand Abadi.
»Was ist es dann?«
»Er wird Sultan sein und ich werde ich sein. Ich werde mich einem Freund beugen müssen.« Es kostete Abadi viel Kraft, seine wahren Gedanken auszusprechen. Er bemerkte, wie die Schamesröte in sein Gesicht kroch, wie es sich erhitzte, und spürte, wie sein Herzschlag lauter wurde, schneller.