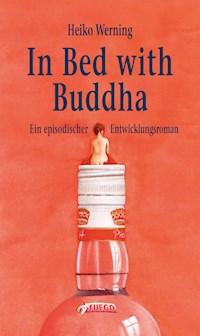18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Welt ist voller sonderbarer und fantastischer Kreaturen – noch ... Was man jetzt gegen das Artensterben tun muss! Die Zhous Scharnierschildkröte hat das Social Distancing erfunden: Wann immer ihr etwas nicht behagt, geht sie in den Mini-Lockdown und kappt die Verbindungen zur Außenwelt. Der Tasmanische Beutelteufel ist der Wutbürger unter den Tieren, der stinkend, schreiend und mit roten Ohren durch die Gegend springt. Die Partula-Schnecke, benannt nach dem Trio der römischen Schicksalsgöttinnen, ist ein echter Albtraum aller Romantiker und von ElitePartner. Der Baumhummer, ein verunstalteter Südsee-Yeti mit schwankendem Gang und Rüstung, kann Klone erzeugen. So seltsam und unterschiedlich wie diese Tiere sind, teilen sie doch eine traurige Gemeinsamkeit: Ihr Überleben steht auf der Kippe! Städtebau, Abholzung von Wäldern oder Wilderei haben die Arten in eine prekäre Lage gebracht. Ein gallisches Dorf von engagierten Tierfreunden und –schützern rund um die Organisation Citizen Conservation sorgt durch ihren Einsatz in Zucht- und Auswilderungsprojekten dafür, dass das endgültige Aussterben verhindert werden kann. Heiko Werning, einer der Initiatoren von Citizen Conservation, und Ulrike Sterblich entwerfen in ihren kenntnisreichen wie unterhaltsamen Tierporträts ein faszinierendes Panoptikum dessen, was die Natur zu bieten hat und zeigen: Der Erhalt der Artenvielfalt ist eine entscheidende Menschheitsaufgabe!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Heiko Werning / Ulrike Sterblich
Von Okapi, Scharnierschildkröte und Schnilch
Ein prekäres Bestiarium
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Heiko Werning / Ulrike Sterblich
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Heiko Werning / Ulrike Sterblich
Heiko Werning ist Autor aus Leidenschaft, Reptilienforscher aus Berufung und Tierbeschützer aus Notwendigkeit. Er ist Autor mehrerer zoologischer Fachbücher, schreibt aber auch für Taz und Titanic. Seine Texte liest er regelmäßig bei den Berliner Lesebühnen Reformbühne Heim & Welt und Brauseboys vor. Seine Wedding-Geschichtensammlungen sind eine inoffizielle Chronik des Berliner Problembezirks. Er ist einer der Initiatoren von Citizen Conservation.
Ulrike Sterblich ist Politologin und Autorin aus Berlin. Ihre Diplomarbeit schrieb sie einst über ökologische Ethik, später wurde sie als Gastgeberin der Lesebühne Berlin Bunny Lectures bekannt. Sie veröffentlichte mehrere Bücher, zuletzt „The German Girl“ (Rowohlt), und arbeitet seit 2018 konzeptionell und redaktionell bei Citizen Conservation und Frogs & Friends mit. Sie hat keine Haustiere, aber wenn, dann hätte sie gern einen Schnilch.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Die Welt ist voller sonderbarer und fantastischer Kreaturen – noch ... Was man jetzt gegen das Artensterben tun muss!
Die Zhous Scharnierschildkröte hat das Social Distancing erfunden: Wann immer ihr etwas nicht behagt, geht sie in den Mini-Lockdown und kappt die Verbindungen zur Außenwelt. Der Tasmanische Beutelteufel ist der Wutbürger unter den Tieren, der stinkend, schreiend und mit roten Ohren durch die Gegend springt. Die Partula-Schnecke, benannt nach dem Trio der römischen Schicksalsgöttinnen, ist ein echter Albtraum aller Romantiker und von ElitePartner. Der Baumhummer, ein verunstalteter Südsee-Yeti mit schwankendem Gang und Rüstung, kann Klone erzeugen.
So seltsam und unterschiedlich wie diese Tiere sind, teilen sie doch eine traurige Gemeinsamkeit: Ihr Überleben steht auf der Kippe!
Städtebau, Abholzung von Wäldern oder Wilderei haben die Arten in eine prekäre Lage gebracht. Ein gallisches Dorf von engagierten Tierfreunden und –schützern rund um die Organisation Citizen Conservation sorgt durch ihren Einsatz in Zucht- und Auswilderungsprojekten dafür, dass das endgültige Aussterben verhindert werden kann.
Heiko Werning, einer der Initiatoren von Citizen Conservation, und Ulrike Sterblich entwerfen in ihren kenntnisreichen wie unterhaltsamen Tierporträts ein faszinierendes Panoptikum dessen, was die Natur zu bieten hat und zeigen: Der Erhalt der Artenvielfalt ist eine entscheidende Menschheitsaufgabe!
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Verlag Galiani Berlin
© 2022, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung und Illustrationen: Manja Hellpap und Lisa Neuhalfen, Berlin
Lektorat: Wolfgang Hörner
ISBN978-3-462-31028-3
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Der Beutelwolf – So etwas wie eine Einleitung in das Prekäre Bestiarium
Alfreds Prachtgurami
Der Amerikanische Totengräber
Der Anegada-Wirtelschwanzleguan
Das Aye-Aye
Der Bartgeier
Der Baumhummer
Die Bayerische Kurzohrmaus
Der Beo
Der Biber
Der Blutegel
Der Darwinfrosch
Die Deserta-Tarantel
Der Eisbär
Der Europäische Stör
Der Feldhamster
Der Feuersalamander
Das Goldene Löwenäffchen
Der Kalifornische Kondor
Die Mallorca-Geburtshelferkröte
Der Mangarahara-Buntbarsch
Der Milu
Der Europäische Nerz
Die Nimbakröte
Das Okapi
Das Pangolin
Das Panzernashorn
Die Partula-Schnecken
Der Pátzcuaro-Querzahnmolch
Das Philippinen-Krokodil
Der Pillendreher
Das Przewalski-Pferd
Die Round-Island-Boa
Der Schneeleopard
Der Schnilch
Der Schwarzfußiltis
Die Socorrotaube
Der Spix-Ara
Der Tasmanische Beutelteufel
Der Ur
Das Vancouver-Murmeltier
Der Vaquita
Der Viktoriasee-Buntbarsch
Das Visayas-Pustelschwein
Das Vulkankaninchen
Der Waldrapp
Der Wangi-Wangi-Brillenvogel
Der Wisent
Zhous Scharnierschildkröte
Anhang
Das Projekt Citizen Conservation
Dank
Autorenverzeichnis
Register und Schlagwortverzeichnis
Der Beutelwolf – So etwas wie eine Einleitung in das Prekäre Bestiarium
So könnte man es natürlich auch machen: Im Jahr 2017 war es einem Forschungsteam rund um Andrew J. Pask von der Universität Melbourne gelungen, das komplette Genom eines in Alkohol konservierten Beutelwolf-Embryos zu entschlüsseln. Die Grundlage dafür, um dieses Tier von den Toten aufzuerwecken. Also, nicht den Embryo persönlich. Sondern seine Art. Mithilfe der DNA, die nun nur noch geklont, in die entkernte Eizelle einer nahe verwandten Art eingepflanzt, geboren, in irgendeinen künstlichen Beutel gepackt und dann großgezogen werden müsste. Einziger Nachteil: Kein Mensch weiß, ob das jemals gelingen wird.
Der Beutelwolf, auch bekannt als Tasmanischer Tiger, ist im 20. Jahrhundert ausgestorben. Wobei Ausgestorben eigentlich kein besonders treffender Terminus ist. Aussterben kann schon mal vorkommen. Wenn ein Komet auf die Erde trifft, beispielsweise. Weshalb bekanntlich vor 65 Millionen Jahren ein großer Teil der Dinosaurier ausgestorben ist (dass eine kleine Gruppe gefiederter Saurier dem Massen-Exitus entkommen ist und deren Nachkommen uns heute mit Gesang, Eiern und zugekoteten Stadtplätzen erfreuen, ist inzwischen ja hinlänglich bekannt). Es hat eine Weile gedauert, bis die Ökosysteme der Erde sich von diesem Schlag wieder einigermaßen erholt und eine neue blühende Artenvielfalt hervorgebracht haben, aber auch in dieser wird immer mal wieder ausgestorben. Alle paar Jahre scheidet einer von vielen Millionen Playern im großen Spiel des Lebens auf ganz natürliche Weise aus. Weil andere einfach besser waren als er und ihn nach und nach verdrängt haben. Das ist ein bisschen so, als wenn man beim Mensch, ärgere dich nicht so richtig Pech hat. Schwupps, ist man raus. Eine Art kann auch verschwinden, weil sie sich weiterentwickelt und die alte, weniger vorteilhafte Form dann mit der Zeit verschwindet. Das ist das natürliche Hintergrundrauschen der Evolution.
Der Beutelwolf aber ist nicht einfach so ausgestorben. Er wurde ausgerottet. Vom Menschen.
Als die Vorfahren der Aborigines vor etwa 50000 Jahren nach Australien kamen, waren Beutelwölfe dort noch weit verbreitet. Heute herrscht ja oft das Bild von edlen Ureinwohnern, die in Einklang mit der Natur, den Ahnen, den Mondphasen und ihren Totemtieren leben, aber die Wahrheit ist wohl eher, dass der Mensch schon immer eine Schneise der Verwüstung über den Planeten gezogen hat, wo immer er auftrat. Jedenfalls kam er nach Australien, brachte später auch seine Hunde mit, die dann als Dingos Karriere machen sollten, und schließlich war der Beutelwolf verschwunden. Man vermutet heute, dass die Dingos die Hauptursache dafür waren, denn diese wilden Hunde leben im Wesentlichen wie der Beutelwolf und machen im Ökosystem all die typischen Beutelwolf-Dinge – nur effektiver. Vor etwa 3000 Jahren gab es jedenfalls auf dem australischen Festland keine Beutelwölfe mehr, sehr wohl aber noch auf der bis dahin dingofreien Insel Tasmanien.
Dort hielt der Beutelwolf es noch ziemlich lange aus. Als die ersten Briten Anfang des 19. Jahrhunderts auf Tasmanien anlandeten, war dieser Raubbeutler noch weit verbreitet und häufig. Die Europäer machten sich an die Arbeit und rotteten zunächst die menschlichen tasmanischen Ureinwohner aus. Als das 1865 vollbracht war, lebten immer noch Beutelwölfe auf der Insel. Allerdings war auch ihr Bestand schon stark reduziert, denn die Siedler hatten Schafe mitgebracht und waren nun der festen Überzeugung, die Beutelwölfe würden diese in einem fort reißen und somit gewaltige wirtschaftliche Schäden anrichten. Kommt einem ziemlich bekannt vor, diese Geschichte, seit Wölfe auch wieder durch Deutschland ziehen und uns inzwischen an die zweitausend Schafe jährlich mopsen, sodass nur noch 1998000 der zum Schlachten gezüchteten Wolltiere für uns übrigbleiben. Was bereits zu wütenden Forderungen führt, der Wolf müsse schleunigst wieder abgeschossen werden.
Der Beutelwolf sieht unserem Wolf ziemlich ähnlich. Abgesehen von seinem Hinterteil, das gestreift ist wie ein Tiger (und das ihm seinen Alternativnamen eingebracht hat). Ansonsten ginge so ein Beutelwolf optisch problemlos als neue, stylische Hunderasse durch. Jedenfalls solange man nicht sieht, wie er sich vermehrt. Denn der Beutelwolf war, man ahnt es bei dem Namen schon, ein waschechtes Beuteltier, also deutlich näher mit dem Känguru oder dem putzigen Koalabären (der ja auch kein Bär ist) verwandt als mit dem Wolf. Seine bis zu vier Jungen waren bei der Geburt nackt und winzig und mussten erst einmal drei Monate im unter dem Bauch befindlichen Beutel der Mutter Milch säugen und heranwachsen.
Die in vielen anderen Aspekten ausgeprägte Ähnlichkeit zum Wolf ist ein schönes Beispiel dafür, wie ganz unterschiedliche Tiere bei ähnlichen Umweltbedingungen dieselben Anpassungsstrategien und manchmal sogar dasselbe Aussehen entwickeln. Beim Beutelwolf war diese Ähnlichkeit allerdings evolutiv am Ende eindeutig ein Nachteil. Denn er sah zwar aus wie ein Wolf, ernährte sich aber bevorzugt von Geflügel und diversen Kleinsäugern. Seine Beißkraft reichte gar nicht aus, um Schafe zu töten. Die von den Siedlern beklagten Risse gingen wohl auf verwilderte Hunde zurück, was sie aber nicht daran hinderte, dem vermeintlichen Übeltäter Beutelwolf unerbittlich nachzustellen. Die tasmanische Regierung setzte 1830 sogar ein Kopfgeld aus: Ein Pfund gab es pro erlegtem Thylacine, wie die Tiere in ihrer Heimat heißen, zehn Schillinge für einen Welpen.
Hundert Jahre später war es vorbei. 1930 erschoss der Farmer Wilf Batty den letzten verbürgten, freilebenden Beutelwolf und posierte noch stolz mit ihm auf einem Foto. Einige weitere Exemplare lebten noch vereinzelt in Zoos. Dort starb das letzte Tier, Benjamin, in der Nacht vom 6. auf den 7. September 1936, in Hobart, der Hauptstadt Tasmaniens. Genau 59 Tage, nachdem die tasmanische Regierung sich durchgerungen hatte, die Art unter Schutz zu stellen.
In den folgenden Jahrzehnten wurde der Beutelwolf zu einer Art Nessie des australischen Buschlands. Immer wieder gab es mehr oder weniger glaubwürdige Sichtungen des zunehmend mystischen Tiers, die alle eines gemeinsam hatten: Sie konnten nie sicher bestätigt werden. Bis heute sucht eine unbeirrte Community nach dem verschollenen Thylacine, lässt Kotproben analysieren, stellt Kamerafallen auf, wertet unscharfe Fotos von irgendwas aus und schafft es immer mal wieder in die Zeitungen mit angeblichen Wiederentdeckungsmeldungen.
Das Schicksal des Beutelwolfs berührt die Menschen, wohl weil er ein charismatisches, tatsächlich einzigartiges Tier war, dessen brutale Ausrottung anders als bei vielen Schicksalsgenossen sehr anschaulich verlief – und gut sichtbare Spuren hinterließ. Es gibt sogar noch Filmaufnahmen der Tiere. 2021 veröffentlichte das National Film and Sound Archive of Australia einen kolorierten Filmschnipsel von Benjamin, dem Letzten seiner Art, wie er durch seinen Käfig im Zoo streift. Das lässt uns sehr direkt fühlen, was wir verloren haben. Und ahnen, dass wir es hätten verhindern können – nein: müssen. Die heutigen Überlegungen, den Beutelwolf durch Klonen mit immensem Aufwand wieder auferstehen zu lassen, zeugen von einem andauernden schlechten Gewissen.
Leider ist der Beutelwolf kein Einzelfall. Der Mensch war wohl schon beteiligt am Exitus von prähistorischen Tieren wie dem Mammut, aber mit dem Beginn der Neuzeit stieg die Zahl seiner Opfer beständig. Prominente Beispiele dieser Epoche sind der Dodo, der Riesenalk oder die Stellersche Seekuh. Mit dem Beginn der Industrialisierung und dem Wachstum der Weltbevölkerung wurden es immer mehr. Was Exponentialkurven bedeuten, haben wir während der Corona-Krise ja gelernt. Im Fall des Artensterbens prognostizierte der Weltbiodiversitätsrat der Vereinten Nationen (IPBES) 2019, dass rund eine Million Arten (Pflanzen jetzt immer mitgemeint) in den »kommenden Jahrzehnten« von der Ausrottung bedroht sind. Längst schon ist der Begriff des sechsten Massenaussterbens wissenschaftlich akzeptiert. Wir sind also bereits mittendrin in einer der großen Aussterbewellen der Erdgeschichte; bei der davor hat es die Dinosaurier erwischt (nach vier Vorgänger-Ereignissen, die noch eher weniger blockbustertaugliche Einzeller, Würmer, Kerb-, Krebs- und Krabbeltiere betroffen hatten). Allerdings sind diesmal weder Kometeneinschläge noch Vulkanausbrüche verantwortlich, sondern der Mensch. Dumm nur für uns: Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass wir dann auch bald dran sind, denn der Zusammenbruch der Ökosysteme würde auch unser Schicksal besiegeln. Weshalb die Biodiversitätskrise neben der Klimakrise als größte Bedrohung der Menschheit gilt.
Es gibt aber noch andere Gründe, warum wir uns bemühen sollten, so viele Arten wie möglich vor dem finalen Verschwinden zu bewahren. Etwa, weil wir keinen Schimmer haben, welcher Nutzen sich für uns noch hinter der schrumpeligsten braunen Kröte oder der blindesten Höhlenassel verbergen könnte. Wer hätte vor 200 Jahren gedacht, dass ein eher eklig wirkender Pinselschimmelpilz uns einmal einen Penicillin genannten Stoff schenken und Abermillionen von Leben retten würde? Die Ausrottung von Arten zu verhindern, gebietet also bereits die reine ökonomische Vernunft, wenn man schon sonst kein Gefühl für ihren Wert hat.
Viele Menschen aber haben genau dieses Wertegefühl durchaus, aus religiösen oder ethischen Gründen oder einfach nur so. Wie eben beim Beutelwolf. Sie spüren, dass diese Tiere schlicht nicht für immer verschwinden sollten. Weil wir sie sehen, weil wir sie unter uns wissen wollen. Wer wäre nicht entzückt, heute noch irgendwo, und sei es ausschließlich im Zoo, einen Dodo betrachten zu können? Gut, zugegeben, beim Tyrannosaurus gibt es geteilte Meinungen.
Darüber, dass die massenhafte Ausrottung von Arten verhindert werden sollte, herrscht weitgehend Einigkeit. Nur leider folgt daraus bislang nicht viel. Jedenfalls nicht viel Wirksames. Eine Spezies nach der anderen verschwindet, im immer höheren Tempo – Exponentialkurven eben. Die durch den Menschen verursachte Aussterberate liegt, je nach Modell und betrachteter Organismengruppe, um den Faktor 100 bis 10000 über dem »evolutiven Grundrauschen«. Seit dem Jahr 1600 wurden um die 500 Tier- und 700 Pflanzenarten wissenschaftlich als ausgerottet registriert, und die dürften nur den bedeutend kleineren Teil der tatsächlichen Opfer ausmachen, denn bei vielen weniger auffälligen Arten (denken Sie nur mal an Milben, Käfer und Moose) haben wir bislang nicht einmal von ihrer Existenz erfahren, geschweige denn davon, dass diese Existenz durch unser Wirken schon wieder beendet wurde.
Für viele Arten besteht die einzige Hoffnung auf Überleben derzeit darin, dass sie in menschlicher Obhut durch gezielte Zuchtprogramme erhalten werden. Aus dem einfachen Grund, dass es unmöglich sein wird, die Ausrottung in der Natur noch zu verhindern, selbst wenn umgehend strikte Maßnahmen eingeleitet würden – wonach es unglücklicherweise bislang zudem nicht einmal ansatzweise aussieht. Noch geht die Abholzung von Wäldern, das Trockenlegen von Mooren, die Ausbreitung der Wüsten nicht nur ungebremst, sondern sich in hohem Tempo beschleunigend weiter. Umweltgifte, eingeschleppte Invasoren und Krankheiten fordern zunehmend Opfer. Der Klimawandel schreitet immer schneller voran und wird in den nächsten Jahrzehnten abertausende von Arten vernichten, und wir können in der Natur nichts mehr dagegen tun. Selbst wenn wir sofort auf Klimaneutralität umschalten würden – was wir leider nicht tun werden –, wäre der »Bremsweg« viel zu lang, um ihre klimabedingte Ausrottung noch zu verhindern. 2016 machte die Bramble-Cay-Mosaikschwanzratte den Anfang. Das kleine Nagetier lebte ausschließlich auf der nur wenige hundert Meter messenden Insel Bramble Cay vor der australischen Küste im Norden des Great Barrier Reefs. Durch den Anstieg des Meeresspiegels in der Torres-Straße und eine verstärkte Zyklon-Aktivität ist ihr Lebensraum zerstört worden. Die kleine Ratte gilt damit als erstes Säugetier, das vom menschgemachten Klimawandel ausgerottet wurde. Es wird nicht das letzte bleiben. Was uns da noch bevorsteht, lässt ein Blick vor die Küste von Bramble Cay ahnen. Der Weltklimarat schätzt, dass bereits bei einer Erderwärmung von 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit 70 bis 90 Prozent der tropischen Korallenriffe absterben werden. Und niemand glaubt noch, dass es gelingen könnte, die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu begrenzen. Was das allein für die als artenreichster Lebensraum der Welt geltenden Korallenriffe bedeutet, kann man sich leicht ausmalen.
Haben wir also schon verloren? Nein! Um beim Beispiel der Korallenriffe zu bleiben: Forscher basteln an vielversprechenden Ansätzen zum Aufbau künstlicher Riffe und der Aufzucht von wärmetoleranteren Korallenarten, mit deren Hilfe man neue Riff-Lebensräume schaffen könnte. Eine Voraussetzung dafür wäre natürlich, die globale Temperaturerhöhung noch auf einem möglichst niedrigen Wert zu stoppen. Tja, und dann wäre es halt schön, wenn es noch Tiere gäbe, die man dort ansiedeln könnte.
Genau hier aber liegt das Problem. Viele Arten werden ausgerottet sein, ehe eine Rettung in der Natur möglich sein wird. Das lässt sich gar nicht mehr verhindern, egal wie engagiert wir jetzt plötzlich Natur- und Klimaschutz da draußen, also in situ, betreiben würden. Weil natürliche Prozesse nicht von heute auf morgen umkehrbar sind, und weil bei vielen Arten die Zahl der Individuen bereits so stark reduziert ist, dass die Population unter natürlichen Bedingungen keine Chance mehr hat, sich zu erholen – sie sind »funktional ausgestorben«. Zumindest in freier Natur.
Die einzige Rettung für viele Arten wird deshalb darin bestehen, ihnen Asyl in menschlicher Obhut zu gewähren, also ex situ. Solange, bis sie draußen wieder eine Chance haben. Dafür benötigen wir Zoos. Und weil die Ausrottungsraten so schnell ansteigen, bräuchten wir viel mehr Tierhaltungskapazitäten, um wenigstens einen Teil, eine Auswahl besonders bedeutsamer Arten noch zu retten. Anders als beim Beutelwolf vor hundert Jahren haben wir heute in vielen Fällen das Wissen und die Möglichkeiten, bedrohte Tierarten ex situ dauerhaft zu erhalten. Und zwar so zu erhalten, dass man sie in fünfzig, hundert oder zweihundert Jahren in den dann hoffentlich restaurierten und wieder funktionierenden Lebensräumen neu oder zur Unterstützung noch lebender Restbestände ansiedeln könnte. Beispiele dafür gibt es inzwischen viele. Wir stellen in diesem Buch eine ganze Reihe davon mitsamt ihren teils unglaublichen, abenteuerlichen, traurigen, lustigen oder skurrilen Geschichten vor.
Bei anderen Arten dagegen sind noch viele Fragen offen. Wir wissen schlicht noch nicht genug über sie. Dieses für ihre Erhaltung sowohl in situ als auch ex situ unbedingt notwendige Wissen zu sammeln, ist eine weitere Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Und zwar rechtzeitig. Auch darüber sprechen wir in diesem Buch.
Woran es im Moment vor allem mangelt, sind Kapazitäten, um viel mehr Arten einen sicheren Unterschlupf bieten zu können. Die bestehenden Zoos sind diesbezüglich längst überlastet. Sie bräuchten erheblich mehr Ressourcen: mehr Geld, mehr Platz, mehr Personal. Wir würden uns sehr wünschen, dass die Mittel dafür von staatlicher Seite zur Verfügung gestellt werden. Aber seien wir ehrlich: Danach sieht es im Moment nicht gerade aus. Jedenfalls nicht in dem Umfang, der erforderlich wäre.
Aber Zoos sind nicht die Einzigen, die sich mit Tieren auskennen. Eine Vielzahl von privaten Enthusiasten beschäftigt sich hingebungsvoll mit der Haltung und Zucht zahlreicher Tierarten. Naturgemäß eher weniger mit Elefanten und Giraffen, sondern dafür mit kleinen Fröschen, Fischen und Finken. Oder Geckos, Asseln und Spinnen. Wo die Liebe eben so hinfällt.
Das Projekt Citizen Conservation wurde vom Berliner Verein Frogs & Friends, einer Art PR-Agentur für Amphibien, dem Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) sowie der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) gegründet. Es verfolgt das Ziel, möglichst viele Erhaltungszuchten in menschlicher Obhut aufzubauen, indem die Kapazitäten, das Wissen und die Instrumente von Zoos und Privathaltern zusammengeführt werden. Denn gerade was kleinere, unscheinbarere oder weniger populäre Arten angeht, verfügen private Tierhalter über einen unschätzbar wertvollen Wissensfundus, jahrzehntelange Praxis und vor allem: sehr viel Zeit und Engagement. Der moderne Artenschutz kann es sich nicht erlauben, auf diese Ressourcen zu verzichten, will er dem galoppierenden Sterben etwas entgegensetzen. Bislang fehlt es aber an jeder Koordination und Anleitung dieser über das ganze Land verstreuten, privaten Tierhalterinnen. Das will Citizen Conservation ändern. Um Institutionen wie Zoos, Museen und andere Einrichtungen mit sachkundigen privaten Enthusiastinnen und Engagierten zusammenzubringen, damit sie gemeinsam einen mess- und zählbaren Anteil im Kampf gegen das Artensterben leisten.
Citizen Conservation wurde 2018 gegründet. 2020 wollten wir das Projekt durch eine Kampagne in den Zoos einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen. Dann kam ein Virus dazwischen, das dazu führte, dass eine breitere Öffentlichkeit in Zoos keinen Einlass mehr fand. Daher sind wir auf die Idee gekommen, kleine Geschichten über wundersame Tiere zu schreiben, die alle eines gemeinsam haben: Sie drohen, in den nächsten Jahren auszusterben, wenn sie nicht durch ein beherztes Ex-situ-Zuchtprogramm gerettet werden. Oder sie wurden bereits durch die Haltung in menschlicher Obhut gerettet und können heute daher wieder in freier Natur umherstreifen oder -fliegen (und ein paar Sonderfälle haben wir auch vorgestellt). Wir haben eine Reihe von Musikerinnen, Schriftstellern, Schauspielerinnen und Kabarettisten gebeten, unsere Texte einzulesen – und uns sehr darüber gefreut, dass sie unserer Bitte entsprochen haben, obwohl wir keinerlei Honorar anbieten konnten. So entstand der Kreaturen-Podcast, den wir 2020 und 2021 in zwei Staffeln à zwölf Folgen kostenfrei auf allen relevanten Internetplattformen angeboten haben. Diese Texte sowie die der beiden nächsten Staffeln, die ab 2022 veröffentlicht werden, sind in diesem Buch in überarbeiteter Form versammelt. Zum Nachlesen und Staunen, zum Mitbangen und Freuen. Die Autorenhonorare fließen vollständig an Citizen Conservation, und besonders schön ist es, dass der Verlag Galiani Berlin noch mal einen halben Euro pro verkauftem Buch obendrauf legt. Also: Macht das Prekäre Bestiarium zum Bestseller! Auf dass viele weitere wundersame Tiere vor dem Verschwinden bewahrt werden!
Die Kenntnis, dass viele Tierarten nur durch Ex-situ-Erhaltungszucht gerettet werden konnten, ist nicht weit verbreitet. Die Erkenntnis, dass sie für noch viel mehr Arten die einzige Überlebenschance darstellt, noch viel weniger. Stattdessen wird gefragt, was es denn nütze, wenn eine Art nicht mehr in der Natur, sondern nur noch hinter Glas lebe? Wir antworten darauf stets, dass es darum geht, Optionen für die Zukunft zu erhalten. Die Option etwa, später einmal Arten in wiederhergestellten oder gesicherten Lebensräumen neu anzusiedeln. Ob das möglich sein wird, muss sich zeigen. Ist die Art erst einmal verschwunden, gibt es diese Option jedenfalls nicht mehr. Und ob das Zusammenklonen einst ausgestorbener Arten wirklich eine Alternative sein wird, ist mindestens ungewiss.
Zum anderen erzählen diese Tiere uns ihre Geschichten. Geschichten, wie wir sie nun aufgeschrieben haben. Geschichten, die zeigen, was für eine fast unglaubliche Vielfalt möglicher Lebensformen und -weisen es auf der Welt gibt; und Geschichten, die letztlich davon berichten, dass wir nicht allein sind auf der Welt – und dass wir vor allem auch gar nicht allein sein könnten. Die Biodiversität ist so etwas wie das Immunsystem des Planeten. Ohne seinen Schutz können auch wir nicht überleben. Um es zu schützen, müssen wir uns grundlegend ändern. Man könnte auch sagen: Einzelne Arten können durch Haltung gerettet werden, der Mensch aber nur durch eine neue Haltung.
Und schließlich ist der Erhalt einer Art auch als reiner Selbstzweck sinnvoll und lohnend. Wäre die Welt nicht einfach ein kleines bisschen besser, wenn wir die Möglichkeit hätten, wenigstens im Zoo auch heute noch den Beutelwolf sehen zu können? Also, wir jedenfalls finden: Doch, doch!
Alfreds Prachtgurami
Ach, dieses Macho-Gehabe! Da kann man gendern, was das Zeug hält, Sternchen oder Binnen-Is setzen, wie man mag, oder, so wie wir in diesem Buch, mal das generische Maskulinum mit dem generischen Femininum lustig hin und her wechseln lassen, und dann pfeift halt doch wieder der nächste Typ hemmungslos einer vorbeigehenden Frau hinterher und macht auf dicke Hose. Der Mensch neigt trotz tausender Jahre Zivilisationsgeschichte immer noch zum Gockelhaften, um nicht zu sagen: zum Prachtguramihaften.
Bei Alfreds Prachtgurami jedenfalls wird noch gänzlich vom Feminismus unverdorben geworben, gebalzt und geposed. Mit Saisonbeginn suchen sich die Männchen der mit etwa 3,5 Zentimetern Länge winzigen Fischlein eine möglichst schicke Bleibe, also beispielsweise eine Höhle, die durch Falllaub gebildet wird, oder einen Hohlraum unter einer Wurzel. Wären sie Menschen, stellten sie sich jetzt wohl breitbeinig vor ihren Angeberschuppen. Weil sie aber Fische sind, machen sie es eben breitflossig. Dabei hilft ihnen eine anatomische Besonderheit. Ihre Rücken- und Afterflossen sind auffällig lang, weisen ungewöhnlich viele Knochenstrahlen auf und können bei Erregung aufgespreizt werden. So ein Fischkerl ist dann ganz Flosse. Es entsteht der Eindruck, als würde sein Körper vollständig von einem breiten Flossensaum umlaufen, die Gestalt wandelt sich vom länglichen Fischlein zu einem Fisch wie ein Schrank. Zumindest wenn man, wie das Weibchen es tut, von der Seite guckt. Gleichzeitig fährt das Männchen bei seiner Färbung die Kontraste hoch, als hätte jemand bei Photoshop den Regler ganz nach rechts gezogen. Plötzlich zeigt es breite, gelblich weiße und bläuliche Längsstreifen, die sich scharf vom tiefschwarzen Grund abheben. Irisierende Elemente sorgen für eine atmosphärisch stimmige Lightshow, und um den Flossensaum zieht sich eine hellbläuliche Linie, um die spektakulären Ausmaße der Superflosse (immerhin mehrere Millimeter!) zu betonen. Um noch eins draufzusetzen, erscheint plötzlich ein senkrechter schwarzer Balken im Auge. »Sexy Eyes« nennen Fischfachleute dieses Phänomen allen Ernstes. Nun ja, im Grunde können wir das Analogon dazu in Form von Sonnenbrillen in jedem Hiphop-Video bestaunen.
Ebenfalls ähnlich wie im Hiphop fängt das Männchen jetzt an, seltsame Zuckungen vorzuführen. Es neigt den Kopf um mehr als 45 Grad nach unten und zittert mit dem ganzen Körper. Dabei geht es natürlich wie immer darum, die Bitch zu sich nach Hause zu locken. Über alles Weitere wollen wir hier mal diskret hinweggehen, denn was in den eigenen vier Höhlenwänden passiert, ist ja letztlich Privatsache. Wir sagen nur so viel: Umschlingungen! Scheinpaarungen! Laichstarre! Senkeier! Schaumnest! Den Rest überlassen wir Ihrer Fantasie. Am Ende kleben dann jedenfalls befruchtete Eier an der Wand. Im Grunde also alles wie beim Menschen.
Aber jetzt kommt es zu einer überraschenden Wendung. »Danach« verlässt das Weibchen die Höhle, den Macker und die Brut. Das Männchen kümmert sich von nun an aufopferungsvoll um die Eier, fächert ihnen beständig frisches Wasser zu und betüddelt anschließend auch noch die Babys. Wir müssen unser Urteil zum Rollenverständnis bei Fisch und Mensch vielleicht noch einmal überdenken.
Diese ganzen faszinierenden Verhaltensabläufe kann man im Aquarium gut beobachten. Wie es aussieht, allerdings wohl auch nur noch dort. Denn in freier Natur scheint Alfreds Prachtgurami seit ein paar Jahren ausgerottet zu sein. 2005 wurde er überhaupt erstmals wissenschaftlich beschrieben, Fundort war ein einziger Bachabschnitt im Torfmoorwald Westmalaysias. Ein womöglich letzter Nachweis gelang dort 2016, doch als Fischfreunde später zurückkehrten, fanden sie statt eines Schwarzwasser-Urwaldbaches nur noch einen zugeschlammten Wasserlauf inmitten von Palmölplantagen.
Prachtguramis bilden eine Gruppe von etwa 20 hochspezialisierten Arten, die sich an die extremen Bedingungen in Torfmoorwäldern angepasst haben. Wie bei uns entstehen auch in Südostasien Moore in wassergesättigter Umgebung, in der mehr pflanzliches Material anfällt als abgebaut werden kann. Anders als bei uns werden sie in Südostasien von Wald bestanden. Dessen reichliche Pflanzenreste bilden das Torf, und weil halt immer mehr dazukommt, wächst das Moor beständig in die Höhe – bis zu 20 Meter hohe Torfschichten sind möglich. Das halb verrottete organische Material bildet Huminsäuren, die für ein stark saures Milieu sorgen, was Mikroorganismen hemmt und somit dafür sorgt, dass Laub und Äste noch langsamer abgebaut werden. Torfmoorwälder speichern wie ein gigantischer Schwamm Wasser und organisches Material, also Kohlenstoff. Und die Prachtguramis, die dort leben, schwimmen im Grunde in Säure herum.
Unglücklichweise aber gedeihen dort, wo Torfmoorwälder wachsen, auch Ölpalmplantagen besonders gut. Der internationale Markt für Palmöl ist in den vergangenen Jahrzehnten geradezu explodiert. Praktisch überall findet es Verwendung, von Biodiesel über Waschmittel bis zu Margarine und Nutella. Um Platz für neue Ölpalmplantagen zu schaffen, werden großflächig Torfmoorwälder gerodet und entwässert. Das ist zum einen natürlich für die zahlreichen Arten ein Problem, die in diesen Wäldern leben – unter ihnen als echter Promi der Orang-Utan. Zum anderen schadet diese Entwicklung dem globalen Klima, denn trockene Torfböden zählen weltweit zu den Hauptquellen für Treibhausgase, während nasse Torfböden der Atmosphäre Treibhausgabe entziehen. Torfbrände, die in trockengelegten Mooren schnell katastrophale Ausmaße annehmen, bedrohen überdies Leib und Leben der Menschen in Südostasien und führen zu Destabilisierung und Massenflucht aus ganzen Landstrichen.
Mit der Abholzung ändern sich natürlich auch die Bedingungen in den Bächen: Besonnung, Wasserchemie, Strömungsverhältnisse – nichts ist mehr so, wie es war. Alfreds Prachtgurami aber hat sich nun einmal an die speziellen Umweltbedingungen angepasst, die sein guter, alter Torfmoorwaldbach ihm über Jahrtausende geboten hat. Nun ist er verschwunden.
Aber noch nicht endgültig. Denn Aquarienfreunde haben ein Herz auch für die kleinsten Fischlein. So sind in den letzten Jahren immer mal wieder Prachtguramis über den Zierfischhandel exportiert oder von Hobby-Enthusiasten selbst gefangen und mitgebracht worden. Zum großen Durchbruch als Aquarienstars haben sie es nie gebracht, dafür sind ihre Anforderungen an die Wasserwerte zu speziell. Dennoch gelingt engagierten Spezialisten ihre Nachzucht regelmäßig. Als klar wurde, wie dramatisch sich die Lage für die meisten der etwa 20 Prachtgurami-Arten entwickelt, haben diese sich unter dem Namen The Parosphromenus Project zusammengetan. Das kann sich zwar niemand merken oder auch nur aussprechen, ehrt dafür aber den wissenschaftlichen Namen der Gattung. Die Fischfreaks von The Parosphromenus Project