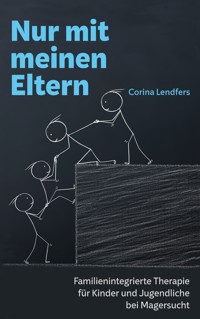4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Fremde Länder, idyllische Ankerbuchten, rauschende Segelfahrten, Freiheit und ganz viel Genuss - davon träumen Corina und Michael, als sie 2013 mit ihren fünf Kindern zwischen zwei und neun Jahren auf eine alte Stahlyacht nach Portugal ziehen. Stattdessen erwarten sie eine veraltete Elektrik, undichte Luken, marodes Holz und Löcher im Rumpf. Doch die beiden lassen sich nicht unterkriegen und lernen, dass es Perfektion beim Segelschiff nicht gibt und wie man auch im größten Chaos den Moment genießen kann. Von Portugal segeln sie los über Madeira zu den Kanaren, meistern ihren ersten Hochseetörn als Familie und erkennen, dass auf Langfahrt die Höhen höher und die Tiefen tiefer sind als im gewöhnlichen Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Einzug auf der
PINUT
Leinen los nach Madeira
Ein Loch kommt selten allein
Unterhosen und Vulkane
Im Kampf gegen Rollenzwänge
Atlantikfieber
Unser kleines Paradies
Die Kunst des Angelns
Das Boot als Feind
Kanarischer Frühling
Wiedersehen im Paradies
Über-Lebenskünstler
Facetten der Einsamkeit
Die Krux mit den Batterien
Philosophie und Esskastanien
Lausalarm
Stürmische Festtage
Verliebt in eine Insel
Ärger mit dem Ruder
Mit dem Südwind nach Norden
Schlauchboot-Tücken
Ein ungemütlicher Nachbar
Abschied
Freundschaften auf Langfahrt
Glossar
Über die Autorin
Vorwort
Ein Segelboot, fünf Kinder, jede Menge Optimismus und Abenteuerlust – das sind die Zutaten, mit denen Michael und ich 2013 die Schweiz verlassen haben. Nicht, weil wir notorisch unzufrieden gewesen wären mit unserem Leben, weil wir unter gesellschaftlichen Zwängen gelitten hätten oder besonders systemkritisch gewesen wären. Wir haben uns wohl gefühlt in unserem Zuhause in den Schweizer Bergen, mit unserer Arbeit als Mutter, Kulturmanagerin und Teilzeitlehrerin resp. als Chorleiter, Dirigent und Rhetorik-/Auftrittscoach. Jonas war 2, Ursina 4 ½, Rahel 6, Seraina 8 und Saskia 9 Jahre alt.
Wir sind aufgebrochen, weil wir einerseits mehr Zeit gemeinsam mit uns und den Kindern verbringen wollten, und weil uns andererseits das Leben in gewisser Weise zu bequem geworden ist. Schon immer hat uns das Neue gereizt, die Abenteuerlust gekitzelt und das Fremde fasziniert.
In resp. mit den Bergen sind wir aufgewachsen, sie sind uns vertraut. Das Meer ist es, das uns lockt. So haben wir uns 2009 entschieden segeln zu lernen, ein Boot zu kaufen und für unbestimmte Zeit auf den Weltmeeren unterwegs zu sein. Ausschlaggebend ist der Gedanke gewesen, unser Zuhause immer dabei zu haben und trotzdem reisen zu können.
Wir haben unheimlich viel gelernt: übers Schiff, übers Segeln, über andere Kulturen, übers Meer, über den Wind und vor allem über uns selbst. Michael meinte einmal: „Die Höhen sind höher und die Tiefen tiefer als im normalen Leben.“
Davon möchte ich in diesem Buch erzählen. Von Euphorie und Rückschlägen, von Löchern im Rumpf und Kinderbanden, vom Bordunterricht, von Traumbuchten, der Einsamkeit, der Liebe und vom unendlichen Blau des Meeres.
Unsere Reise ist nicht zu Ende. Wir wollen segelnd die Welt erkunden, solange es uns möglich ist. Wir wollen sie weitergeben, die Geschichten, die das Leben schreibt. Und Mut machen, den eigenen Traum zu leben.
Corina Lendferswww.segel-vision.com
Einzug auf der PINUT
Portugal, Juli 2013
„Das Tor steht offen.“ Erleichtert atme ich auf. Es ist kurz vor 18.00 Uhr. Die Hitze flimmert über dem Asphalt.
Einige Sekunden lang schließe ich die Augen, meine Fingerspitzen beginnen zu kribbeln. Dann stürmt mein Blick voraus, streift die vielen aufgebockten Yachten, durchforstet den Wald an Masten und bleibt beglückt an den einzigen schwarzen hängen.
„Wir sind da, wir sind da!“
„Da ist sie!“
„Papa, halt an!“ Aufgeregt rufen die Kinder durcheinander.
Längst haben sie sich abgeschnallt und hüpfen wie eine Horde Flöhe auf ihren Sitzen herum. Der Motor verstummt. Die Schiebetür unseres Kleinbusses fliegt auf.
„Da ist sie, unsere PINUT!“
„Wo ist die Leiter?“
„Mama, weißt du den Code noch?“
Ich lasse mich von Rahel aus dem Auto ziehen und strecke mich. Tief atme ich die Meeresluft ein, die ich so sehr vermisst habe. Sie riecht nach Salz, Seegras und Fisch, ist warm und erfrischend zugleich.
Mein Herz hüpft wie die Kinder. Ich schaue zu Michael hinüber und sehe ein Lächeln auf seinem Gesicht. Gemächlich schreitet er das Schiff von hinten nach vorn und auf der anderen Seite von vorn nach hinten ab. Hin und wieder berührt er eine Stelle, wischt Staub weg, hängt das Landstromkabel über einen Pfosten. Er drückt aufs Schlauchboot unter dem Schiff.
Ich lasse meinen Blick hinauf zur Mastspitze gleiten. Schön sieht sie aus, unsere PINUT. Weiß mit den roten Zierstreifen, den beiden kurzen Masten und der festen Sprayhood. Und groß. Aufgebockt auf dem Trockenen, beide Seiten abgestützt durch orangefarbene Stahlstützen und zusätzlich nach unten fixiert mit breiten Spanngurten. Weit ragt der Bugspriet über den Rumpf hinaus.
Die PINUT ist ein holländischer Knickspanter aus dem Jahr 1976. Damit ist sie älter als ich. Wir haben sie aus zweiter Hand gekauft von einem älteren Paar, das dreizehn Jahre lange darauf gewohnt und das Schiff für eine Weltumsegelung ausgerüstet hat, zu der es nie gekommen ist.
Rahel zieht an meinem T-Shirt und hüpft von einem Bein aufs andere. „Mama, können wir endlich hinauf?“
„Klar!“ Wir gehen zur Leiter, die mit einem Zahlenschloss an eine Stahlstütze gekettet ist. Wie lautet der Code? Irgendwas mit 4, 6 und 1, versuche ich mich zu erinnern. Fünf Monate ist es her, seit ich das letzte Mal hier war. Nach dem dritten Versuch klappt es, ich kann die Kette lösen. Ich stelle die Leiter an die Bordwand und fixiere sie oben an einer Relingstütze. „Ihr könnt kommen!“
„Auf zum Sturm!“, ruft Michael.
Ich überlasse das Innere des Schiffs den Kindern und laufe übers Deck. Hier oben hat man einen guten Blick über die anderen Schiffe. Das große Areal der Werft ist durch Mauern, Zäune und ein elektrisches Eingangstor von der Außenwelt abgeschottet. Die Yachten stehen in Reihen nebeneinander, der Platz ist sauber. Ich zähle rund 70 Schiffe. Die Abendsonne spiegelt sich im Wasser der angrenzenden Lagune und taucht die Skyline von Faro in ein weiches, rötliches Licht.
Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir die PINUT gekauft. Sie ist unser erstes Schiff und das einzige, das wir uns physisch angeschaut haben. Wir wollten eine Stahlyacht mit zwei Masten, Mittelcockpit, U-förmiger Küche und 12m Länge, groß genug für uns und die Kinder und klein genug, um sie im Notfall alleine segeln zu können. Die PINUT erfüllt diese zentralen Kriterien.
„Mama, schau her!“ Ursina klettert zu mir aufs Vordeck und streckt mir ein Stofftier entgegen. „Oo ist noch da! Er hat gut auf unser Schiff aufgepasst!“ Zärtlich streicht sie dem kleinen Marienkäfer über die rote Kapuze. Wir haben ihn letzten Sommer zurückgelassen. Er sollte hier die Stellung halten.
„Hat er seine Arbeit gut gemacht?“, frage ich Ursina.
Die Kleine nickt und ruft: „Ja, alles ist noch da. Und jetzt gehen wir Schiffe schauen!“ Geschickt klettert sie über die hohe Leiter hinunter aufs Dock. Für ihre fast fünf Jahre ist sie eher klein, eifert ihren drei älteren Schwester aber in allem nach und lässt sich von ihnen selten etwas sagen. Jetzt ruft sie ihre Geschwister zusammen. Kurz darauf schallen Kinderstimmen über die Zementfläche.
Michael umfasst mich von hinten. Ich lehne meinen Kopf an seine Schulter und atme tief ein. „Es ist schön, wieder hier zu sein.“ Seine Stimme klingt tief und entspannt. Trotz der langen Autofahrt von der Schweiz hierher.
Ja, es ist schön. Und diesmal bleibe ich hier. Diesmal gibt es kein Abschiednehmen vom Schiff, keinen schmerzlichen letzten Blick aus dem Flugzeug, kein sehnsuchtsvolles Warten auf den nächsten Urlaub. Diesmal bleibe ich.
„Papa, Horst ist da!“ Mehrstimmig erreicht uns der Ruf im Bauch des Schiffs, wo wir die Rucksäcke der Kinder auf die Kojen verteilen.
„Horst!“
Wir blicken uns an und klettern an Deck. Der kleine, leicht gebeugte Mann aus Salzburg mit den grauen Haaren und durchdringenden Augen ist von den Kindern umringt. Grüßend hebt er die Hand.
„Horst! Gibt’s dich auch noch?“ Michael klopft ihm freundschaftlich auf die Schulter. Wir haben ihn letztes Jahr bei unserem ersten Probewohnen auf der PINUT kennengelernt.
„Na klar! Schön, dass ihr wieder da seid! Es war so ruhig ohne euch.“ Schmunzelnd blickt er auf die Kinder. „Aber groß sind sie geworden, die Kinder!“
„Klar!“ Saskia strahlt. „Hast du Schokomilch für uns?“
Horst lacht. „Nein, ich hab' ja nicht gewusst, dass ihr heute kommt. Aber gleich morgen geh' ich einkaufen.“
„Darf ich mitkommen?“
Saskias Wangen sind gerötet, die langen, dunkelblonden Haare liegen ein wenig zerzaust von der Fahrt auf ihren Schultern, ihre grünen Augen blitzen. Dem Charme meiner neunjährigen Tochter zu widerstehen fällt offensichtlich auch Horst schwer. „Warum nicht?“
„Viel hat sich nicht verändert in den letzten Monaten“, stelle ich mit Blick auf die umliegenden Schiffe fest.
„Nein. Einige Boote sind rausgefahren, einige reingekommen, aber viele sind geblieben.“ Horst fährt sich mit der Hand durchs Haar. „Kommt rüber, wenn ihr Lust habt.“
„Danke, Horst. Wir werden erst mal unsere Pyjamas suchen.“ Die Sonne ist untergegangen und mein Magen knurrt.
In meine Begeisterung, wieder hier zu sein, mischt sich Vorfreude aufs Segeln. Gelernt haben wir das Segelhandwerk auf einem kleinen Schweizer See. Lange Jahre der Vorbereitung auf unsere Reise liegen hinter uns, nun ist der Atlantik zum Greifen nah.
In diesem Moment ahne ich nicht, dass es nochmals ein ganzes Jahr dauern wird, bis die PINUT durch den schmalen Kanal im Sumpfgebiet vor Faro und Olhao ins offene Meer gleiten wird mit Kurs Madeira.
Leinen los nach Madeira
Faro-Madeira, August 2014
„Ich schlag‘ vor, wir setzen das Großsegel, bevor wir aus der Lagune von Faro draußen sind.“ Michael wirft einen Blick auf die Seekarte.
Ich nicke. „Einverstanden.“
Er geht ans Großfall, ich löse die Bändel, die das Segel zusammenhalten.
„Klar?“ Michael zwinkert mir zu.
„Klar.“
Die PINUT steht im Wind, das Segel nimmt die ersten Meter. Plötzlich stockt es.
„Stopp, Michael, die Schnur zwischen den Maststufen und den Wanten ist im Weg!“
Res kneift die Augen zusammen, legt den Kopf in den Nacken. Der Schweizer Skipper begleitet uns auf unserem ersten Hochseetörn. Von Portugal nach Madeira sind es rund 520 Seemeilen. Mit einem Etmal von geschätzten 100 Meilen sollten wir nach fünf Tagen und Nächten an unserem Ziel, der kleinen Marina Quinta do Lorde im Südosten der Insel eintreffen.
Michael lässt das Segel wieder herunter. „Ich steig‘ rauf.“ Stufe um Stufe erklimmt er den schwankenden Mast, während die Sicherungsleine langsam durch meine Hand gleitet. Ich lehne den Kopf zurück, beobachte ihn. Er ist fit, das intensive Lauftraining, das er leidenschaftlich ausübt, zahlt sich aus. Mit Leichtigkeit steigt er in die Höhe. Seine langen, schwarzen Haare flattern im Wind.
„Belegen!“, erreicht mich sein Ruf von oben.
Ich fixiere das Fall an der Klampe.
Die Sonnenstrahlen tanzen auf der bewegten Wasseroberfläche wie Milliarden kleiner Kristalle. Ein rotes Fischerboot schießt an uns vorbei. Seine Heckwelle schaukelt die PINUT kräftig.
„Was war das?“, ruft Michael erschrocken.
Ich beobachte, wie er die dünne Schnur, die verhindern soll, dass sich das Fall an den Maststufen verheddert, losknotet. Dann lehnt er sich nach vorne, schlingt das Schnurende um die Want, hält sich rasch wieder am Mast fest. Er schaukelt zwischen den Wolken.
„Ich komm‘ runter!“
Ich öffne die Tauklemme und gebe Leine.
Als Michael bei mir ankommt, ist er blass. Sein Atem geht heftig. Er lehnt sich an die Reling und reicht mir den Schäkel mit dem Fall. Ich befestige ihn am Segel.
„Wollen wir hissen?“ Mein fragender Blick registriert kleine Schweißperlen auf seiner Stirn.
„Gib mir ein paar Minuten.“ Er schließt die Augen. Eine Bö jagt Wassertropfen vor sich her. Die PINUT neigt sich leicht zur Seite. Ich stecke eine Haarsträhne hinter mein Haarband. In der Ausfahrt aus der Lagune von Faro erscheint eine Segelyacht.
„Res, Gegenverkehr!“, rufe ich in Richtung Cockpit.
Res hebt die Hand und legt Ruder nach Steuerbord.
„Gut, Corina, ich bin soweit.“ Michael nimmt das Fall erneut in die Hand. Nach wenigen Augenblicken steht das Segel. Michael lässt sich auf eine Cockpitbank fallen. „Uff, nie wieder! Nie wieder steig‘ ich den Mast rauf, wenn wir auf See sind.“
Ich lege meine Hand auf sein Knie. „Tut mir leid, das war mein Fehler. Ich hab‘ die Schnur falsch geführt.“ Zerknirscht betrachte ich sein blasses Gesicht.
Er versucht ein Lächeln. „Schon gut.“
Kaum haben wir die Lagune verlassen, werden die Wellen höher und länger.
Unsicher blickt mich Rahel an. „Mama, bleibt das jetzt so?“
Res antwortet für mich. „Ja. Das ist die typische Atlantikdünung. Lang und gemütlich.“ Der hochgewachsene Mann mit grauem Haar und fröhlichem Blick hat den Atlantik bereits mehrere Male überquert. Er muss wissen, wovon er spricht. Ich betrachte die Seekarte und den Kompasskurs. Mit einem Blick über meine Schulter meint er: „Ich schlag‘ vor, noch auf diesem Kurs weiterzufahren, bis wir die Fischzucht hinter uns gelassen haben. Danach können wir auf Kurs Madeira gehen.“
„Einverstanden. Komm, Jonas, du brauchst ein Gstältli, es schaukelt zu stark.“ Ich krame im Schapp mit den Rettungswesten und hole die Sicherheitsgurte hervor. Auf der Luvbank sitzend stemme ich einen Fuß gegen die Wand des Niedergangs und ziehe Jonas auf meinen Schoss. Seine blonden Haare kitzeln meinen Hals. Es ist nicht einfach, die kleinen Arme bei diesem Hin- und Hergeschaukel in die Schwimmweste zu zwängen, während er erfolglos versucht, sich irgendwo festzuhalten. Mit seinen drei Jahren sind selbst die geringen Distanzen im Cockpit für ihn groß.
Während ich die Kinder mit Sicherheitsgurten versorge, behält Res den Kurs im Auge. „Hey, wir haben die ersten zehn Seemeilen bereits geschafft.“ Er strahlt uns an.
„Na toll. Zehn Seemeilen von über 500.“ Michaels Stimme klingt nicht halb so begeistert. „Ich glaub‘, ich leg‘ mich ein wenig hin.“ Langsam steigt er hinunter in die Achterkajüte.
Mit leichter Besorgnis bemerke ich ein mulmiges Gefühl in der Magengegend. Ich bin noch nie seekrank gewesen und möchte daran auch nichts ändern.
„Mama, mir ist schlecht!“ Ursina sitzt zusammengesunken in der Ecke des Cockpits.
„Wart, ich bring‘ dir einen Eimer.“
Wo sind nur die Eimer? Ach ja, die haben wir aus dem Weg geräumt, festgezurrt unter der Treppe des Niedergangs. Das heißt, dass ich mich jetzt in den Bauch des Schiffs begeben werde. Ich atme tief ein und steige langsam in den Salon hinunter. In den Eimern steht eine angebrochene Fünf-Liter-Wasserflasche. Die muss raus. Mit einer Hand halte ich mich am Kartentisch fest, um von den Wellen nicht durchs Schiff geworfen zu werden, mit der anderen versuche ich, den Griff der Flasche zu fassen. Es gelingt. Nur: Wohin damit? Ich stelle sie kurzerhand ins Waschbecken.
Ich halte inne. Es fühlt sich seltsam an, hier unten zu sein. An sich hat sich ja nichts verändert, seit wir das Trockendock in Faro verlassen haben. Außer vielleicht, dass alles aufgeräumt ist. Und dennoch fühlt es sich ganz anders an. Vor den Fenstern rauschen die Wellen vorbei, oft blicken wir direkt durch die Fenster ins Wasser. Genießen kann ich das noch nicht. Wie lange es wohl dauern wird, bis ich mich ans Segeln gewöhnt habe? Daran, dass ich keinen Schritt machen kann, ohne mich irgendwo festzuhalten? An all die klappernden, knarrenden Geräusche?
„Hier, Ursina. Falls du erbrechen musst, spuck bitte hier rein.“
Ich stehe im Niedergang und strecke Ursina den Eimer entgegen. Sie nimmt ihn langsam. Angestrengt stemme ich mich ins Cockpit und setze mich zwischen Rahel und Seraina. Jonas schläft bei Saskia in der Hundekoje. Ursina würgt. Seraina hält sich die Ohren zu.
„Mama, wohin mit dem Eimer?“ Ursinas Stimme klingt doppelt so fit wie vorhin.
Tja, wohin? „Klemm' ihn zwischen Cockpitwand und Reling, da kann er nicht umfallen.“
„Mama, ich brauch‘ auch einen Eimer!“, keucht Rahel.
Ich halte ihr den zweiten hin und stehe rasch auf. Konzentriert starre ich auf die Seekarte.
„Wann gibt‘s was zu essen?“ Ungläubig drehe ich mich zu Ursina um. Die blonden Haarsträhnen kleben zwar noch verschwitzt auf ihrer Stirn, aber ihre Augen blicken bereits wieder fröhlich.
„Jetzt gibt‘s erst mal nichts, dein Magen ist ja noch ganz durcheinander.“
„Mir geht‘s aber wieder gut“, protestiert die Fünfeinhalb-jährige lautstark.
„Schluss, jetzt gibt‘s nichts.“ Ich wende mich wieder der Seekarte zu.
„Mama, mir ist schlecht!“
Oh nein! Jonas klettert verschlafen ins Cockpit. Noch bevor ich mich umdrehe, hält ihm Res einen Eimer hin.
„Das kann ja heiter werden“, murmle ich.
Res stupst mich in die Seite und zwinkert mir zu. „Das wird schon!“
Im Moment sieht es nicht danach aus. Die Eimer drehen ihre Runde durchs Cockpit. Ich bekomme den Geruch nicht mehr aus der Nase. Als es dämmert stehe ich auf.
„Kommt, Kinder, ich bring‘ euch ins Bett.“
„Schaltest du die Positionslichter bitte gleich ein?“, fragt Res.
Ich nicke und verschwinde mit Jonas im Vorschiff. Ich kämpfe mit meinem Magen und verzichte bei den Kindern auf Zähneputzen und Schlafanzug. Mechanisch decke ich sie zu, streiche ihnen über die Haare und flüchte ins Cockpit. Ich versuche, die salzige Seeluft in meinen Körper fließen zu lassen und zu entspannen. Es gelingt mir nicht. Bevor die Übelkeit Überhand nimmt, verabschiede ich mich mit einem knappen „Ich leg‘ mich kurz hin!“ von Res und sinke auf meine Koje.
Wo sind nur diese Tabletten? In der Regel schwöre ich auf die Homöopathie, aber im Fall Seekrankheit hat sie erbärmlich versagt. Ich finde die kleine Kartonpackung, drücke eins der unscheinbaren Tablettchen heraus, halbiere es und spüle es mit einem Schluck Wasser hinunter. Nur noch schlafen...
Ich taste nach meinem Handy. Halb zehn. Michael schläft neben mir. Ich kann Res nicht die ganze Nachtwache allein machen lassen. Dumm, dass wir unser Ölzeug nicht vorher aus seiner Versenkung geholt haben. Eigentlich habe ich gedacht, beim Segeln im Hochsommer würde ich es nicht brauchen. Weit gefehlt. Die Nächte sind kühl. So stecken unsere warmen Jacken und Hosen zusammen mit der Reservebettwäsche in einem Kompressionssack im Schrank. Hinter den Handtüchern, den Taucherbrillen und den Badesachen. Nun landet alles teils auf dem Bett, teils davor, da die Wellen keine Rücksicht auf meine Ausräumarbeit nehmen. Ich bekomme den Plastiksack zu fassen und zerre ihn hervor. Im Licht der Stirnlampe identifiziere ich meine Hose und meine Jacke. Michaels Kleidung lege ich neben seinen Kopf, den Rest der Ware stopfe ich zurück in den Schrank. Rasch, die Tür zu – und erst auf Madeira wieder öffnen!
Als ich im Cockpit erscheine, ist mir schon wieder übel. Ich setze mich auf einen Kugelfender auf dem Achterdeck und klammere mich an die Reling. Die kühle Nachtluft füllt meine Lunge, ich schließe die Augen. Die Wellen heben die PINUT in die Höhe, um sie kurz darauf wieder abzusetzen.
Es gelingt mir, die Bewegung des Schiffs aufzunehmen. Ich öffne die Augen und lasse meinen Blick über die Wasseroberfläche gleiten. Der Mond scheint hell, die Sterne sind nicht zu sehen. Silbern schimmert das Meer. Das Rauschen der Wellen durchdringt mich. Ich habe das Gefühl, dass sich meine Grenzen auflösen, dass ich eins werde mit dem Schiff und dem Meer. Immer wieder füllt sich meine Lunge, der Sauerstoff schießt durch meinen Körper und belebt die letzte Zelle.
Endlich verschwindet die Übelkeit.
Ich steige ins Cockpit, wo Res auf der Bank ausgestreckt döst. Als ich mich ihm gegenüber setze, schreckt er auf. Er gähnt, streckt sich.
„Ich kann übernehmen.“
Dankbar nickt er. „Wie lange?“
„Drei Stunden?“
„Gut. Wir sind auf Kurs, haben Halbwind mit 20 Knoten. Weck mich, wenn was Ungewöhnliches ist.“
Ich nicke. „Schlaf gut!“
Mit einem Polster im Rücken kuschle ich mich auf die Cockpitbank. Gleichmäßig rollen die Wellen von hinten auf uns zu, unter der PINUT hindurch. Mein Blick schweift erneut über die milchig schimmernde Wasseroberfläche. Sogar beim hellen Mondlicht wäre es bei diesem Wellengang unmöglich, einen treibenden Container rechtzeitig zu sichten. Es braucht schon unheimlich viel Vertrauen, sich auf diese Unwägbarkeiten einzulassen, geht es mir durch den Kopf. Angst hab‘ ich keine. Ich fühle mich sicher in unserer Zwölf-Meter-Stahlyacht. Sie würde auch eine Containerbegegnung wegstecken, daran glaube ich fest. Was anderes bleibt mir, ehrlich gesagt, auch nicht übrig.
Am nächsten Mittag sind alle im Cockpit versammelt.
„Wie hoch sind die Wellen, Res?“ Neugierig blickt ihn Rahel an. Die kurzen Haare stehen ungekämmt in alle Richtungen, ihre hellen Augen mit den braunen Punkten wandern zwischen Res und den Wellenbergen hin und her. Ab und zu erwischt uns eine Welle von der Seite, klatscht an die Bordwand, läuft übers Vordeck und spritzt ins Cockpit.
Res legt die Stirn in Falten, fährt sich mit der Hand durch die grauen Haare. „Vier bis fünf Meter sind das schon.“ „Am schönsten find‘ ich es, wenn wir oben auf einem Berg sind und wieder hinunterdüsen!“ Rahel strahlt über das ganze Gesicht und scheint die Fahrt zu genießen.
„Hast du gesehen, Corina, dass die Salonluke undicht ist? Jedes Mal, wenn eine Welle übers Deck spült, tropft es aufs Bett.“ Ich spüre Res‘ forschenden Blick auf mir.
„Bei uns in der Kinderkajüte auch“, fügt Seraina hinzu.
„Nein. Hab‘ ich nicht gesehen. Bei Regen waren die Luken dicht.“ Ich rümpfe die Nase. Die Luken sind alt, und ich habe die Stahlrahmen entrostet und stellenweise verspachtelt.
„Regen belastet die Luken weit weniger als die Wellen.“ Res zuckt die Schultern.
„Okay, also eine neue Baustelle.“ Irgendwie macht mir das gerade nicht so viel aus. Die feuchte Bettstelle ist zwar nicht besonders angenehm, aber die Dauer des Törns absehbar. Auf Madeira werde ich mich um neue Dichtungen kümmern.
„Hat jemand Hunger?“ Fragend blicke ich in die Runde.
„Mama, bitte sag nichts vom Essen!“ Gequält blickt mich Seraina an. Auch Rahel und Ursina schütteln die Köpfe. Saskia hat sich in der Hundekoje eingeigelt, kein Geräusch ist zu hören.
„Nein, Mama, mir ist schlecht.“ Jonas zieht eine bemitleidenswerte Grimasse.
Ich kann mir ein Grinsen nicht verkneifen. Meine sonst so quirlige Mannschaft, die eigentlich immer hungrig ist, hängt wie narkotisiert in den Seilen oder quetscht sich auf die Leebank, den einzigen Ort, an dem man sitzen kann, ohne einen Muskelkrampf vom Festhalten zu bekommen. Mir aber knurrt der Magen.
„Ich werd‘ trotzdem was kochen, vielleicht mögt ihr ja dann doch mitessen.“
Res nickt. „Find‘ ich eine gute Idee. Vor lauter Kotzen werden alle sonst zu schwach.“ Er hat eine erfrischende Art, den Nagel auf den Kopf zu treffen.
Ich verschwinde in der Versenkung. In allen Schränkchen und Fächern klappert und poltert es, Wasser rauscht an den Fenstern vorbei. Die Topfhalterungen am Gasherd sind bereits vormontiert. Geplant ist ein Linseneintopf. Dazu brauche ich Linsen, Zwiebeln und Knoblauch aus dem Vorratsgang, Karotten und Würstchen aus der Kühlbox, Kartoffeln aus der Kartoffelkiste in der Bilge. Und den Kochtopf, versteht sich. Der steht hinter dem Dampfkochtopf im Küchenschrank.
Ich stemme mich gegen den Herd, öffne vorsichtig den Schrank. Alles bleibt drin. Allerdings wünsche ich mir mindestens eine Hand mehr, als ich versuche, den passenden Kochtopf herauszuholen. Eine hohe Welle trifft das Boot von Backbord, ich schleudere gegen die Küchenschublade, fliege zurück und remple die Ecke des Gasherds. Ich schwitze, als der Topf endlich auf seinem Platz steht. Zwiebelbrett und Messer sind griffbereit, aber die Zwiebel ist sehr ungeduldig. Während ich in der Kühlbox hänge, um Karotten und Würstchen zu angeln, höre ich sie durch den Salon in Richtung Vorschiff rollen. Derweil kämpfe ich mich zu den Karotten vor. Vier Packungen Salatkäsewürfel klemme ich unter den Arm, schiebe zwei Quarktöpfe zur Seite und bekomme die Karotten zu fassen. Mangels Alternative lasse ich sie ins Waschbecken plumpsen, gefolgt von zwei Packungen Nürnberger Rostbratwürstchen. Rasch stecke ich die Käsewürfel zurück in die Box, schließe den Deckel.
Die Zubereitung des Eintopfs erweist sich als nicht weniger anstrengend. Munter kullern Karotten- und Wursträdchen durch die Küche, ins Waschbecken, auf den Salonboden.
„Hallo, kann mir mal einer helfen, bitte?“, rufe ich in Richtung Cockpit.
Rahels Kopf erscheint im Niedergang. „Ja, was ist?“
„Ach, Rahel, kannst du bitte die Würstchen auf dem Boden einsammeln?“
Rahel grinst breit und klettert die Treppe herunter. Flink sammelt sie die Wursträdchen ein, legt sie in eine Schüssel. „Hier.“
Ich wische mir den Schweiß von der Stirn. Der Duft des Linseneintopfs lockt immer mehr Crewmitglieder in den Niedergang.
„Mh, das riecht gut! Ich hab‘ zwar keinen Hunger, aber es riecht ausgezeichnet!“ Seraina zieht eine Augenbraue in die Höhe.
Mit sichtlichem Appetit lassen sich ausnahmslos alle den Eintopf schmecken – wenn auch in deutlich kleineren Mengen als üblich.
„Mama, schnell, komm hoch, hier sind Delfine!“
Ursinas aufgeregter Schrei weckt mich aus einem unruhigen Schlaf. Ich strecke die steifen Glieder. Habe ich überhaupt geschlafen? Ist dieses leise knarrende Geräusch bei der Autopilotpumpe normal? Was scheppert da unregelmäßig am Heck? Wird der Strom ausreichen, bis wir auf Madeira sind?
„Mama, komm, es sind ganz viele!“
Ich setzte mich auf und gähne. Die frische Meeresluft verscheucht Müdigkeit und beklemmende Gedanken. Ich klettere aufs Vordeck – und staune mit meiner Familie. Eine Gruppe Delfine schwimmt neben der PINUT, taucht geschickt unter dem Bug durch, schießt neben uns her. Ein Delfin scheint uns begrüßen zu wollen, denn unermüdlich springt er neben dem Schiff in die Höhe. Sein grauweißes Schuppenkleid glänzt in der Nachmittagssonne.
„Schaut mal, die spielen mit dem Schiff Fangen!“
„Wow, sind die schnell!“
„Hoffentlich schlagen sie sich nicht den Kopf an!“
„Papa, schau mal, da ist ein ganz kleiner dabei! Der ist ja herzig!“
Hell wirbeln die Kinderstimmen durcheinander. Ich halte mich an der Reling fest. Die Tiere sind schön. Wenn sie auftauchen sieht es aus, als würden sie lächeln. Und sie sind unheimlich schnell. Wir durchpflügen die Wellen bereits mit 5,2 Knoten, eine gute Geschwindigkeit für unsere schwere, alte Dame, die Delfine überholen uns jedoch mit Leichtigkeit, fallen ab, um uns dann erneut hinter sich zu lassen.
„Schade, jetzt schwimmen sie weg.“ Jonas‘ Stimme klingt enttäuscht, aber seine Augen leuchten, als er den Tieren nachblickt. Eine letzte Schwanzflosse taucht auf, dann haben die Wellen sie wieder verschluckt.
Berauscht von dem Erlebnis treffen wir uns alle im Cockpit. Seraina holt sogleich einen Hefter mit Papier und beginnt, die Delfine zu zeichnen. Rahel lehnt sich an ihre Schulter, schaut ihr zu. Nach kurzer Zeit legt Seraina den Bleistift zur Seite und lehnt den Kopf in den Nacken.
„Das geht nicht, mir ist schon wieder übel.“
Sie schließt die Augen und ich beobachte, wie die Farbe ganz langsam aus ihrem Gesicht weicht. Rahel verharrt schweigend neben ihr, ergreift ihre Hand und streichelt sie.
Einige Stunden später bin ich allein im Cockpit. Die Sonne ist untergegangen, der Mond steht voll und hell am Himmel. Ich ziehe den Reißverschluss meiner Jacke bis zur Nase hinauf, wickle mich in eine Decke. Wir haben perfekten Wind für unsere Überfahrt. Zuverlässig schiebt er uns mit 20 bis 25 Knoten immer weiter südwestlich. Allerdings wäre mir ein wenig mehr Halbwindkurs lieber. Angestrengt blicke ich auf die Nadel der Windanzeige. Sie pendelt zwischen 120° und 150° von Backbord. In Böen schlägt sie beängstigend weit zur 180°-Marke aus. Soll ich eine leichte Kurskorrektur vornehmen, um den Windwinkel auf sicher zu haben und keine Patenthalse zu riskieren? Ach was, denke ich, so bleibe ich wenigstens wach, wenn ich den Wind im Auge behalten muss. Jetzt wäre ein Windpilot nützlich. Er würde das Schiff in einem definierten Windwinkel steuern und nicht, wie unser elektrischer Autopilot, auf einen Kompasskurs ausgerichtet.
Neben mir leuchten helle Streifen im Wasser auf. Leuchtplankton. Die Mikroorganismen erfahren durch die Wellen, die unser Schiff erzeugt, eine Reibung und reagieren mit kurzem Aufleuchten. Sie werden auch „Glühwürmchen des Meeres“ genannt. Fasziniert beobachte ich das Lichter-spiel in der Dunkelheit des Atlantiks.
Eine besonders kräftige Bö reißt mich aus meiner gemütlich-schläfrigen Nachtbetrachtung. Ich stütze mich auf die Ellbogen, fixiere erneut die Windanzeige. Die Nadel pendelt nun hartnäckig um 150°. Ich luve um 5° an und hoffe, dass der Wind nicht mitdreht.
„Alles klar, mein Liebling?“ Michael steht hinter mir und blickt mir über die Schulter.
Ich drehe den Kopf. Er wirkt verschlafen, seine Augen sind zu schmalen Schlitzen zusammengezogen. „Ja. Wir kommen gut voran, zwischendurch laufen wir mit über sechs Knoten.“ Eine Bö erfasst uns und beschleunigt die PINUT auf 6,2 Knoten, als ob sie meine Aussage bestätigen wollte. „Allerdings kommt der Wind ein bisschen sehr von hinten. Ich hab‘ den Kurs um 5° nach Steuerbord korrigiert.“
Michael nickt. Er blickt sich um. „Gibt’s noch Kaffee?“
Ich schüttle den Kopf. „Nein. Aber vom Linseneintopf ist noch ein Rest da.“
Im fahlen Mondlicht sehe ich ihn lächeln. „Sehr gut. Den nehm‘ ich auch. Magst du noch kurz hierbleiben, bis ich mich mit Proviant eingedeckt hab‘?“
„Klar.“
Wenig später kuschle ich mich in meine Bettdecke. Ich liebe das Schaukeln vor allem, wenn ich im Bett liege. Meine Füße stoßen an die Wassermelone, die zwischen Wand und Matratze eingeklemmt ist. Wir werden sie übermorgen aufschneiden. Dann haben wir den dritten Tag auf See hinter uns, und die Übelkeit sollte bei allen vorbei sein.
Ein lauter Knall reißt mich aus einem tiefen Schlaf. Das Schiff neigt sich nach Steuerbord, ich rutsche quer über die Matratze auf Jonas zu.
„Was war das?“ Erschrocken setzt sich Seraina neben mir auf. Verschlafen reibt sie sich die Augen.
„Keine Ahnung“, murmle ich, taste nach meinem Ölzeug und steige ins Cockpit.
Res erscheint auf der anderen Seite aus dem Niedergang beim Salon.
„Was ist passiert?“
Michael steht am Steuerrad und versucht angestrengt, die PINUT wieder auf Kurs zu bringen. „Eine Bö hat das Heck weggedrückt. Das war eine glatte Patenthalse.“ Verbissen starrt er auf die Windanzeige.
Wir hatten am Nachmittag zu Groß und Genua auch das Besansegel gesetzt. Jetzt flattern alle drei Segel heftig im Wind und veranstalten einen Krach, der uns die Verständigung erschwert.
„Ich denke, wir halsen nochmal, um wieder auf Kurs zu kommen!“, schreit Michael und fällt langsam ab.
Res ergreift die Großschot, ich krieche aufs Achterdeck und angle nach der Besanschot. Mit den Beinen halte ich mich am Besanmast fest, die Hände fest um die Leine geklammert. Als der Baum kommt, hole ich sie so rasch wie möglich dicht. Der Baum bleibt mittschiffs stehen.
„Ich möchte das Besansegel bergen!“, rufe ich nach vorne.
„Gut, ich bleib‘ auf Vorwind!“ Michael hält den Daumen in die Höhe. Mit Res‘ Hilfe berge ich das Besansegel. Es ist in der Mitte quer auseinandergerissen. Die dünnen Bändsel schneiden sich in meine Finger ein, während ich sie um das Segel zurre. In der Hast habe ich vergessen, Handschuhe anzuziehen.
„Besan ist geborgen, du kannst auf Kurs gehen.“
Res steht neben Michael, ich halte die Großschot. Langsam luvt die PINUT an, der Lärm im Groß lässt nach. Ich gebe Leine, bis das Segel maximal gefiert ist. Erleichtert lasse ich mich auf die Cockpitbank fallen.
„Was haltet ihr davon, wenn wir unseren Kurs so korrigieren, dass wir den Wind von etwa 100° bis 120° Steuerbord haben? Wir segeln dann zwar nicht mehr direkt Richtung Madeira, haben aber den Wind ein wenig stabiler.“ Fragend blickt Michael von Res zu mir.
Res nickt. „Ist mir auch lieber. Eine Wende müssen wir sowieso fahren, und zeitlich sind wir gut unterwegs.“
Michael grinst. „Eine Wende. Die eine Wende. Irgendwie ist es schon fast ein wenig skurril: In der Segelausbildung sind wir pro Trainingseinheit mindestens 30 Wenden und 20 Halsen gefahren auf unserem kleinen Bergsee. Jetzt, auf hoher See mit einer Distanz von über 500 Seemeilen, fahren wir genau eine einzige Wende!“
Ich lache. „Ja, du hast Recht. Wenn wir so weitermachen, verlernen wir die Manöver wieder.“
Res zuckt die Schultern. „Das ist die Krux an der Theorie. Sie sieht immer anders aus als die Praxis. Was meint ihr, wie rasch ihr die Kartenberechnungen vergessen haben werdet? Wenn ihr sie nicht konsequent bei jedem Törn trainiert, ist das Wissen bald wieder weg.“
Ich seufze. „Das ist ja das Traurige. Für die Prüfung hab‘ ich soviel Zeit investiert, um das Ganze zu lernen, und jetzt übernimmt die Software die ganzen Berechnungen und das GPS die Positionsbestimmung.“
Michael kratzt sich am Kopf. „Andererseits wird mir allein bei der Vorstellung übel, mich unten am Kartentisch bei dieser Welle über eine Seekarte beugen zu müssen und Positionen einzuzeichnen oder Kurse zu berechnen.“
„Oh, nein danke!“ Unwillkürlich schüttle ich mich. Da lobe ich mir doch auch die moderne Technik.“
„Land in Sicht! Land in Sicht!“ Michaels Ruf lockt die Crew ins Cockpit.
„Wo? Wo, Papa?“ Ursinas Augen suchen den Horizont ab.
„Da, ich seh’s! Dort, direkt vor uns!“ Aufgeregt deutet Rahel auf eine Erhebung, die undeutlich am Horizont erscheint. „Ist das Madeira?“
Ich schüttle den Kopf. „Nein, das ist Porto Santo, eine flache Insel vor Madeira.“
„Gehen wir dorthin?“
„Nein. Wir wären im Dunkeln dort. Ich möchte lieber bei Tag ankommen. Nächtliches Einlaufen in eine Marina heben wir uns für später auf.“ Ich zwinkere Rahel zu.
„Och, schade. Wie lange dauert es denn noch bis Madeira?“
„Wahrscheinlich werden wir morgen vor Mittag dort sein.“
Leider. Ich genieße das Hochseesegeln und würde liebend gern noch tagelang weitersegeln.
Seraina scheint es ähnlich zu gehen. Sie legt den Kopf schief und meint: „Eigentlich ist das doof. Da haben wir uns endlich ans Schaukeln gewöhnt und es ist uns nicht mehr übel, und schon sind wir da. Können wir nicht noch weitersegeln?“
Ein wenig wehmütig betrachte ich die Küste von Madeira, die wir am folgenden Morgen anlaufen. Der Wind lässt auch in der Einfahrt der Marina nicht nach. Wir sind froh über die Hilfe der Marineros am Steg. Der Schwell ist beachtlich.
„Vielleicht können wir so unsere Seebeine behalten und müssen beim nächsten Törn nicht wieder von vorn beginnen?“, hofft Seraina.
Res schüttelt grinsend den Kopf. Für ihn endet die Reise hier. Er wird morgen in die Schweiz zurückfliegen. Die Kinder stürmen vom Schiff. Bald höre ich sie rufen: „Kommt her, hier sind so viele Katzen!“
Es wäre warm genug für kurze Hosen. Meine unzähligen blauen Flecken umhülle ich jedoch lieber mit knöchellangem Jeansstoff. An den spitzigen Kanten des Kochherds müssen wir zweifellos noch arbeiten.
Michael umfasst mich von hinten, dreht mich um. Seine Augen blitzen. „Hey, wir haben es geschafft! Wir sind auf Madeira!“
Er küsst mich. Ich lache und schließe die Augen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Meine Gedanken schweifen zurück nach Faro. Ein Jahr voller Rückschläge, Zweifel, voller Arbeit und Einsamkeit liegt hinter uns. Jedem Schiff, welches das Dock verlassen hat, haben wir wehmütig nachgeschaut, denn unser Aufgabenberg ist mit jedem Monat gewachsen anstatt geschrumpft. Am Anfang war es am schwersten zu ertragen, weil wir nicht mit den vielen Reparaturen gerechnet haben, sondern davon ausgegangen sind, wenige Wochen nach unserem Einzug auf dem Schiff lossegeln zu können. Doch dann sind die Löcher gekommen.
Ein Loch kommt selten allein
Portugal, August 2013
„Michael, kommst du bitte mal?“ Meine Stimme klingt offenbar erschrockener als mir lieb ist, denn Michael ist nach wenigen Augenblicken bei mir. „Wir haben ein Loch.“
Er nimmt mir den Schraubenzieher aus der Hand und kniet neben der PINUT nieder. Behutsam fährt er über die Stelle am Rumpf, die ich soeben bearbeitet habe. Die Spitze des Schraubenziehers verschwindet im Inneren des Schiffs.
Die Umgebung um mich herum verschwimmt, ich nehme nur noch das bleistiftdicke Loch mit dem Schraubenzieher wahr. Das Blut pulsiert schmerzhaft in meinen Ohren. Ein dicker Kloß bildet sich in meinem Hals. Die klebrige Hitze des portugiesischen Sommers lastet plötzlich schwer auf meinen Schultern und treibt mir Schweißperlen auf die Stirn.
Michael klopft den Stahl um das Loch herum ab. Farbe blättert ab und fällt zu Boden. Er steht auf. Ich schlinge die Arme um seinen Hals und drücke meinen Kopf an seine Schulter. Tief aus meinem Innern steigt ein Schluchzen auf. Tränen vermischen sich mit Schweißtropfen. Michael hält mich fest, ich spüre seine streichelnde Hand auf meinem Rücken.
„Was hat Mama?“ Saskias Stimme dringt von weit her an mein Ohr.
„Sie ist traurig.Wir haben ein Loch im Schiff.“
„Wo?“
„Dort unten.“
Ich höre Saskias hastige Schritte auf der Leiter und kurz darauf ihren aufgeregten Ruf: „Kinder, wir haben ein Loch im Schiff!“
Ich hebe meinen Kopf und atme tief ein.
„Kaffee?“
Ich nicke und klettere hinter Michael die Leiter hinauf. Benommen lasse ich mich auf die Cockpitbank fallen. Rahel setzt sich neben mich. Ich lege den Arm um sie und ziehe sie an mich.
„Was machen wir jetzt?“ Sie blickt mich unsicher fragend an.
„Wir fragen Bernie, ob er es schweißen kann.“ Meine Stimme klingt nicht so fest, wie ich es gern hätte.
„Zum Glück ist Bernie hier! Der hilft uns sicher.“
Ich bin auch froh um die Anwesenheit des großen Briten mit dem schlohweißen Haar. Er gilt als ausgezeichneter Schweißer. Etwa zeitgleich mit uns hat er sich im Internet eine Stahlyacht gekauft, die sich nach und nach als lackierter Rosthaufen entpuppt hat. So schneidet er nun Stück um Stück seines Bootes heraus und schweißt es neu zusammen.
Der Duft frisch gemahlenen Kaffees schleicht sich in meine Nase. Ich öffne den Mund und schiebe den verspannten Unterkiefer langsam hin und her. Der Kaffeekocher klappert, dann höre ich das Klicken des Feuerzeugs.
Kurz darauf erscheint Michael im Niedergang. Er setzt sich zu mir. Rahel verdrückt sich.
„So schlimm find‘ ich das nicht. Das ist ja der große Vorteil eines Stahlschiffs: Alles kann geschweißt werden.“ Aufmunternd lächelt er mich an. Er wirkt nachdenklich, aber ruhig.
Mein Blick gleitet übers Deck und fixiert Michaels dunkle Augen. „Ich habe Angst, dass das nicht das einzige Loch ist.“
Er nickt langsam. Sein Lächeln verschwindet. „Klar.“
„Andererseits hat Gwilym keine kritischen Stellen am Unterwasserschiff gefunden“, erinnere ich mich an die Begutachtung des britischen Experten im Frühling. Wir haben die Yacht vor einem Jahr gekauft und eine Ultraschallmessung der Stahldicke machen lassen.
„Außer den rostigen Stellen, die sichtbar sind. Die müssen wir uns genau anschauen. Zudem konnte er ja nicht alles ausmessen, sondern hat sich auf Stichproben beschränkt.“ Michael verschwindet wieder im Bauch des Schiffs. Der Kaffee sprudelt und duftet intensiv.
Kräftiges Poltern am Schiffsrumpf lässt mich aufstehen.
„Hallo, Wolfgang.“
„Habt ihr das Ladegerät besorgt?“
„Nein, Michael fährt morgen nach Ayamonte.“
„Und habt ihr was von den Kabeln gehört?“ Seine hervorstehenden, großen Augen blicken forschend in mein Gesicht. Ich verneine erneut. „Wenn sie bis übermorgen nicht hier sind, müssen wir sie woanders auftreiben. Mein Ersatzteil soll ich Ende Woche bekommen. Solange kann ich euch noch helfen, danach muss ich mich um mein eigenes Schiff kümmern.“
„Alles klar, Wolfgang, wir kümmern uns drum.“ Der grauhaarige Deutsche hebt die Hand zum Gruß und verschwindet hinter dem Nachbarschiff.
Ich trinke einen Schluck Milchkaffee und spüre der Wärme nach, die sich im Magen ausbreitet. „Mh, ausgezeichnet.“ Michael zaubert zwei Kokosplätzchen aus seiner Hosentasche und reicht mir eins.
„Danke, perfekt!“
Er blickt mich aufmerksam an. „Geht’s wieder?“ Der zärtliche Klang seiner Stimme bringt mich aus der mühsam zurückgewonnenen Fassung.