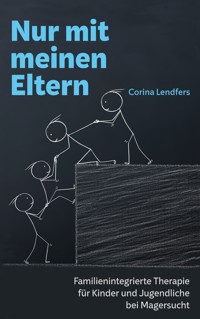Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Seit zweieinhalb Jahren leben die Schweizer Michael und Corina mit ihren fünf Kindern und Bordhündin Guia bereits auf ihrem Stahlschiff. Von den Kanaren brechen sie nun auf zu den kapverdischen Inseln, stellen sich der Herausforderung der Atlantiküberquerung und landen in Südamerika. In Französisch-Guyana geraten sie in einen Generalstreik, tauchen in Surinam in den Regenwald ein und bringen schließlich in der Karibik auf ihrem Boot ihr sechstes Kind zur Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kanaren-Kapverden, Juli 16: Kapverden, wir kommen!
Trinidad, September 17: Die Pinut hängt in den Seilen
Sal, Juli 16: Geburtstagsfeier auf Kapverdisch
Trinidad, September 17: Schweißen, Schleifen, Streichen
Sal-Sao Vicente, August 16: Zu zehnt hart am Wind
Trinidad, Oktober 17: (Schul)Unterricht auf Reisen
Santo Antao, September 16: Bergdörfer und Gefängnisse
Trinidad, Dezember 17: Traumstrände und Dschungel
Santa Lucia, September 16: Anlanden will gelernt sein
Trinidad, Dezember 17: Oh, du karibische Weihnachtszeit
Sal, Dezember 16: Schimmel à discrétion
Trinidad, Dezember 17: Abenteuer im Parkhaus
Atlantiküberquerung, 14.2.-4.3.17: Allein mit dem Ozean
Trinidad, Dezember 17: Lagerfeuer am Wasserfall
Französisch-Guyana, April 17: Generalstreik im Dschungel
Trinidad, Januar 18: Der Countdown läuft
Surinam, Mai 17: Multikulti im Regenwald
Trinidad, Januar 18: Unsichtbare Monsterkräfte
Surinam, Juni 17: Grenz-Erfahrung
Trinidad, Januar 18: Im Geburtshaus
Surinam-Tobago, August 17: Flautenbaden
Trinidad, Januar 18: Eine Entscheidung
Tobago, August 17: Beamtendünkel und Delfine
Trinidad, Januar 18: Ein Crewmitglied wird geboren
Glossar
Vorschau
Über die Autorin
Vorwort
2013 haben wir die Schweiz verlassen, um einen anderen Lebensstil zu finden – einen, der besser auf die Bedürfnisse unserer großen Familie abgestimmt ist. Seit fünf Jahren leben wir nun auf unserer Segelyacht PINUT. Wir, das sind Corina und Michael mit Saskia (Jg. 2004), Seraina (Jg. 2005), Rahel (Jg. 2007), Ursina (Jg. 2008), Jonas (Jg. 2011) und Andri (Jg. 2018) mit unserer Spanischen Wasserhündin Guia und den beiden südamerikanischen Reisfinken Ricki und Lilli.
Gestartet sind wir in Portugal. Unser Reisetempo ist gemächlich, wir haben viel Zeit in den verschiedenen Ländern verbracht. Zwischenzeitlich haben wir Europa verlassen, auf den kapverdischen Inseln vor Afrika gelebt, den Atlantik überquert, die Regenzeit in Südamerika kennengelernt und ein Baby in der Karibik geboren.
Und noch immer sind wir nicht reisemüde! Auch nach Flauten und kräftigen Winden nicht, nach Generalstreik in Französisch-Guyana und Ärger mit Beamten in der Karibik, nach Schimmel im Schiff und Bananenmatsch an Deck – wir wünschen euch unterhaltsame Lesestunden!
Corina LendfersMai 2018, Trinidad, Karibik
www.segel-vision.com
Kanaren-‐Kapverden, Juli 16
Kapverden, wir kommen!
„Direkt vor einem Törn frage ich mich immer, warum wir uns das alles antun.“ Ich stehe Ute gegenüber und seufze laut auf.
Sie grinst mich an und streicht sich eine lange, braune Haarsträhne aus dem Gesicht, die ihr der Wind hartnäckig über die Schulter bläst. „Weil wir eine tolle Zeit auf den Kapverden verbringen wollen!“
„Hoffen wir's!“ Die Nervosität kribbelt in meinen Fingerspitzen, und mein Magen rumort, obwohl ich noch immer auf dem Steg in der kleinen Marina La Restinga auf El Hierro, der kleinsten und letzten Insel unserer Kanarenrunde, stehe. Die Sonne leuchtet am wolkenlosen Himmel, vor uns schaukeln die Masten der Segelyachten. Es riecht nach Fisch.
Wir sind startklar.
Ute zieht mich zu sich, und wir umarmen uns schweigend. Es ist der erste mehrtägige Törn, den Michael und ich alleine mit unseren fünf Kindern und Hündin Guia auf der PINUT zurücklegen. Bisher haben wir für längere Schläge professionelle Skipper oder Freunde mitgenommen. Nun bin ich froh, dass wir die Reise zu den Kapverden gemeinsam mit der FELBA zurücklegen werden. Ute und Valentin, die beiden Wiener Ärzte, sind unsere lieben Freunde und treuen Begleiter, die seit drei Jahren unseren Weg immer wieder kreuzen und mit denen wir viele schöne Erlebnisse teilen.
Die FELBA bezeichnen wir als "große Schwester der PINUT". Sie ist ebenfalls eine Stahlketsch, nur noch schwerer, tiefer, breiter und schwerfälliger als unser Boot. Eigentlich wäre sie besser für uns geeignet, da sie über zwei Achterkajüten verfügt. In der PINUT wohnen zwei Kinder in der Vorschiffkajüte, eins in der Hundekoje mittschiffs, zwei in einer neugeschaffenen Kajüte, die wir aus dem Vorratsgang gebaut haben, und Michael und ich teilen uns die Achterkajüte. Alles auf zwölf Metern Länge und max. 3,6m Breite. Noch geht es, aber allmählich wird es eng. Leider wächst das Schiff nicht mit den Kindern mit.
„Mama, wann starten wir?“ Saskia sitzt am Ende des Stegs, eine Fotokamera in der Hand. Eine Handvoll Möwen tront auf der imposanten Hafenmauer, erhebt sich in regelmäßigen Abständen in die Lüfte, um sich laut kreischend auf die Fische im Hafenbecken niederzulassen. Ein ideales Fotomotiv.
„Sobald der Wind ein wenig nachlässt und uns nicht mehr an den Steg drückt.“
„Okay.“ Sie steht auf und klettert an Deck der PINUT. Für unsere zwölfjährige Älteste ist die Seglerei ein notwendiges Übel, das sie eisern in ihrer Koje, mit Kopfhörern im Ohr und dem e-Reader in der Hand, hinter sich bringt.
„Mama, Ute, können wir noch ein Foto von allen machen, bevor wir ablegen?“ Seraina und Rahel kommen auf den Steg gerannt. Ihre Wangen glühen vor Aufregung.
„Warum nicht? Der Wind ist sowieso noch zu stark.“
Wir holen Saskia und treffen kurz darauf auf den Rest unserer Crews. Ursina balanciert auf der Mauer der kleinen Hafenpromenade. Ihr blondes Haar leuchtet in der Sonne. Als wir vor drei Jahren in unser Abenteuer gestartet sind, war sie knapp fünf Jahre alt.
Jonas sitzt bei Horst auf dem Schoß. Schon damals, auf dem Trockendock in Faro, wo wir Horst kennengelernt haben, ist er als Zweijähriger Knirps gerne bei ihm auf seinem Schiff gewesen und hat sich mit Schokomilch füttern lassen. Inzwischen hat Horst hat sein eigenes Schiff verkauft und begleitet gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Gudrun die FELBA auf diesem Törn.
Ebenfalls mit dabei sind unsere beiden kanarischen Hunde, unsere Guia, Spanische Wasserhündin aus Gran Canaria, und Churro, der kleine schwarze Mischling aus La Palma, der bei Ute und Valentin sein neues Zuhause gefunden hat. Insgesamt sind wir sechs Erwachsene, fünf Kinder und zwei Hunde auf zwei Stahlyachten, die sich an diesem 2. Juli 2016 auf den rund 700sm langen Weg zu den Kapverdischen Inseln vor Senegal machen.
„Wenn das so weitergeht, sind wir in einer Woche schon auf den Kapverden!“ Ich sitze im Cockpit, lasse mir die Sonne aufs Gesicht scheinen und freue mich über fast sechs Knoten Fahrt. Der Start ist geglückt, bereits die ersten Stunden sind Segeln vom Feinsten. Die FELBA befindet sich steuerbord von uns, noch steht der Funkkontakt.
Leider geht es nicht so weiter. Bereits nach sechs Stunden schläft der Wind ein.
„Tja, die Prognose trifft exakt zu.“ Michael zieht die Augenbrauen in die Höhe. Das schwarz gelockte Haar hat er zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden.
„Sieht ganz so aus. Schade.“ Ich betrachte die flatternde Genua. „Und gedreht hat der Wind auch. Wir haben ihn nun genau von achtern.“
„Vorsicht, der Baum!“ Blitzschnell holt Michael die Großschot dicht und verhindert eine Patenthalse. „So geht das nicht, wir müssen abfallen.“
„In welche Richtung?“ Ich rümpfe die Nase. Wenn die Windrichtung so bleibt, werden wir im Zickzackkurs zu den Kapverden segeln müssen. Wir hatten eigentlich auf etwas mehr Ostwind gehofft.
„Ich schlage vor, dass wir erst mehr West machen, damit wir nicht zu nah an der Landnase von Nouhadibou vorbei segeln. Dort ist windmäßig ziemlich was los.“
„Wir sind zwar noch lange nicht dort, aber du hast Recht. Also Kurskorrektur um 30°.“ Ich drücke auf den Plusknopf der Autopilotanzeige, und der Bug richtet sich weiter nach Westen. Sofort steht die Genua wieder, das Schlagen des Segels hört auf.
„Das wird wieder so ein Schaukelkurs werden“, seufzt Rahel. Die Wellen kommen von steuerbord achtern und wiegen die PINUT hin und her.
„Ja, leider.“ Ich mag Segelkurse mit eindeutiger Krängung lieber.
„Das Groß steht schlecht. Vielleicht sollten wir es ganz fieren und eine Pulltalje legen.“
„Ja. Dann lass uns den Baum aber nach steuerbord nehmen und den Schmetterling machen.“
„Einverstanden, meine Skipperin!“ Michael lacht, drückt mir einen Kuss auf die Lippen und verschwindet auf dem Vordeck.
Nach dem Segelmanöver machen wir zwar immerhin 3,5 Knoten Fahrt, das Schaukeln ist aber anstrengend. Erschöpft lasse ich mich auf die Cockpitbank fallen. Michael verschwindet in der Küche, und kurz darauf ziehen duftende Kaffeeschwaden durchs Schiff.
Noch bevor die Sonne hinter einem Wolkenstreifen im Meer versinkt, haben wir die FELBA aus den Augen verloren.
„Eigentlich erstaunlich“, sagt Michael nachdenklich, den Blick auf den Horizont gerichtet, „unsere Schiffe verfügen über ähnliche Segeleigenschaften, und trotzdem sind wir schon nach wenigen Stunden so weit voneinander entfernt, dass wir uns nicht mehr sehen können.“
„Haben wir sie noch auf dem Funk?“ Ich kuschle mich in meine Vliesjacke und kraule Jonas' Kopf, der auf meinem Bauch liegt. Meine anfängliche Nervosität ist auf El Hierro zurückgeblieben.
„Werden wir gleich sehen.“ Michael ergreift das Handfunkgerät. „FELBA, FELBA, FELBA, this is PINUT, PINUT, PINUT, over.“
Stille fängt uns ein, durchbrochen vom regelmäßigen Rauschen der Wellen.
„FELBA, FELBA, FELBA, this is PINUT, PINUT, PINUT, over.“
„PINUT, this is FELBA. Wo seid's denn?“
„Hallo, Valentin! Naja, irgendwo aufm Wasser...“
„Wir haben den Motor angeschmissen. Ich mag keine Flauten, dieses ewige Hin- und Hergeschaukle ist nicht mein Ding.“
„Dann seid ihr vor uns, wir trödeln unter Segeln vor uns hin. Mit der Crew ist alles in Ordnung?“
„Klar. Horst will die Nachtwachen machen, da legen wir uns demnächst aufs Ohr.“
„Alles klar. Lass uns morgen früh wieder versuchen zu funken.“
„Machen wir! Gute Nacht!“
Michael grinst mich an. „Das dachte ich mir schon, dass Valentin nicht lange fackelt, sondern motort.“
„Na danke, den Krach brauch ich nicht, schon gar nicht nachts!“ Ich schüttle mich, lege den Kopf in den Nacken und suche zwischen den Wolken nach Sternen. Noch ist es nach Sonnenuntergang empfindlich kalt, aber schon bald werden wir das Ölzeug zuhinterst in den Schränken verstauen können.
Die erste Nachtfahrt auf jedem Törn ist immer ein wenig besonders. Ich schäle mich aus meiner Wolldecke und lasse meinen Blick übers Cockpitdach nach vorne gleiten.
So ganz entspannt bin ich noch nicht. Zwar habe ich keine nennenswerte Angst vor der Kollision mit einem Container oder Wal, das Risiko schätze ich als gering ein und zudem sitzen wir ja auf einem starken Stahlschiff. Vielmehr ist es die Dunkelheit, die mich verunsichert, das Versagen der Augen. Der Himmel ist schwarz, von Wolken überzogen, nur ganz schwach zeichnet sich der Horizont ein wenig heller vom Meer ab. Um mich herum rauschen die Wellen, und neben mir glitzert Leuchtplankton. Die Luft riecht feucht und salzig.
Ich freue mich auf die Kapverden. Zwar weiß ich, dass auch dort der Tourismus inzwischen Einzug gehalten hat und dass vor allem die beiden Wüsteninseln Sal und Boavista mit ihren hellen Sandstränden bei Urlaubern aus Europa immer beliebter werden. Aber dennoch. Wir segeln nach Afrika!
Wir haben uns lange Zeit gelassen mit diesem Schritt. Ein Jahr haben wir in Portugal verbracht, anderthalb weitere auf den Kanaren. Ursprünglich ist unser Plan gewesen, zwei Jahre nach dem Start bereits in der Karibik zu sein. Aber die Kanaren hatten für uns so viele Vorteile. Die Flüge in die Schweiz sind kurz und günstig, was Michael zugute gekommen ist, da er in den ersten beiden Jahren unserer Reise aus beruflichen Gründen mehrmals jährlich in die Schweiz hat fliegen müssen.
Zudem ist das kanarische Klima schlichtweg perfekt, gleichmäßige 24°C das ganze Jahr über auf den südwestlichen Inselteilen, kaum Regen und eine angenehme Luftfeuchtigkeit, nicht zu hoch, aber auch nicht zu trocken. Es gibt keine gefährlichen Infektionskrankheiten und keine lästigen Stechmücken. Wir haben uns wohlgefühlt, auch gesundheitlich.
Ich stehe lange im Cockpit, halte mich am Cockpitdach fest und verliere mich in der Dunkelheit. Obwohl ich müde bin, sind meine Sinne geschärft. Der Wind ist noch mehr eingeschlafen und unsere Reisegeschwindigkeit ist auf 2.5 Knoten gefallen. Die Genua haben wir geborgen, da sie überhaupt nicht mehr stehen wollte. Der Block der Großschot schlägt immer wieder klappernd aufs Achterdeck, wenn das Segel unruhig flattert, wie um Langeweile zu vertreiben. Wir werden wohl doch noch motoren müssen.
Kaum hat mich dieser Gedanke gestreift, taucht Michael aus dem Niedergang auf. Er steckt in seiner Ölzeugjacke und wirkt noch ein wenig verschlafen. Nach einem Blick auf die Geschwindigkeitsanzeige raunt er: „Bald stehen wir. Lass uns den Motor starten, bevor wir rückwärts fahren.“
Ich seufze, beginnt doch nun meine Freiwache und ich hätte gerne ein wenig geschlafen. Wenn aber der Motor läuft, ist es in unserer Kajüte zu lauf dafür. Trotzdem nicke ich.
Wir holen Besan- und Großsegel mittig, denn bergen möchten wir sie nicht. Sollte der Wind wider Erwarten doch noch zurückkommen, so müssten wir fürs Setzen des Großsegels aufs Vordeck, und das möchten wir nachts wenn möglich vermeiden. Mithilfe des Motors machen wir immerhin 4 Knoten, aber an Schlaf ist nun nicht zu denken. Macht nichts. Es geht mir gut. Ich lege mich auf die Cockpitbank und ich genieße die gemeinsame Wache mit Michael.
Während der nächsten beiden Tage pendelt die Windstärke zwischen 10 und 15 Knoten und wir zwischen dümpeln und motoren. Funkkontakt mit der FELBA haben wir keinen mehr.
„Die sind sicher schon bald auf Sal!“, witzelt Michael. Dann verfinstert sich seine Miene. „Jetzt bräuchten wir unseren Parasailor. Das wäre genau das richtige Segel für diesen Kurs und so wenig Wind!“
Ich höre den Frust in seiner Stimme und kann ihn nicht einmal trösten. Denn er hat Recht. Der Parasailor, unser nagelneues Leichtwindsegel, befindet sich gerade irgendwo auf dem Weg zwischen El Hierro und Deutschland. Michael hat es von seinem letzten Schweiz-Aufenthalt mitgebracht, und wir haben es auf dem Weg von La Gomera nach El Hierro testen wollen. Anfangs ist es majestätisch gestanden, aber dann sind wir in die Düse zwischen den Inseln geraten. Innerhalb von 10 Minuten hat der Wind von 15 auf über 30 Knoten zugelegt, und wir, absolute Anfänger im Parasailorsegeln, haben keine Ahnung gehabt, wie wir das Riesentuch wieder herunter bekommen sollten. Michael ist auf dem Vordeck gesessen und hat versucht, den Trichter mit dem Bergeschlauch herunterzuzerren, während ich – völlig falsch, aber das habe ich erst später bei der Problemanalyse erfahren – mit aller Kraft die vier Leinen, mit denen das Segel getrimmt wird, dicht holen wollte. Schließlich haben wir das Segel bergen können – aber erst, nachdem es in der Mitte auseinandergerissen und der Trichter gebrochen ist. So haben wir es mit viel Herzschmerz auf El Hierro in zwei große Kartonschachteln verpackt und zurückgeschickt.
An Michaels zusammengekniffenen Augen erkenne ich, dass sich auch vor seinem inneren Auge die Szene wieder abspielt. Teures Lehrgeld. Mein Zeigefinger fährt über die tiefen Furchen zwischen den Augenbrauen. „Magst du einen Kaffee?“
„Gerne.“ Sein Lächeln gelingt nur halb.
„Mama, ich glaub', unseren Bananen ist übel!“ Seraina hangelt sich von ihrem Sonnenplatz auf dem Achterdeck den Wanten entlang in Richtung Cockpit und bleibt am Besanmast stehen.
Alarmiert schiebe ich mich in die Höhe und steige zu ihr aufs Deck. Der Wind zerzaust ihr blondes Haar, und ihre Wangen sind gerötet vom Mittagsschlaf in der Sonne. Es riecht ungewöhnlich süßlich hier oben.
„Hier, die Bananen direkt beim Mast sind schon ganz schwarz.“
„Oh weh!“ Erschrocken ziehe ich das alte Bettlaken zur Seite, das die Bananenstaude der Sonne schützt. Wir haben die sehr große Staude von den Mitarbeitern des Trockendocks in Tazacorte auf La Palma zum Abschied geschenkt bekommen und sie an den Besanbaum gehängt. Zwar haben wir sie nach links und rechts mit Leinen fixiert, aber durch ihr hohes Gewicht schaukelt sie trotzdem hin und her und stößt mit jeder Welle an den Mast. Von den vordersten Bananen ist nur noch Matsch übrig.
„Wir müssen die Staude weiter nach hinten binden.“ Ich suche nach einer Leine und binde sie am unteren Ende der Staude fest, um sie zu stabilisieren. Aber sie ist zu schwer.
„Dann klemmen wir doch einfach ein Polster zwischen den Mast und die Bananen, dann ist es weich, wenn sie dranschlagen“, überlegt Seraina.
„Das können wir versuchen.“
Wenig später ist der untere Teil des Mastes in Schaumstoff gehüllt. Zwar schlägt die Staude noch immer dagegen, aber vielleicht können wir so die Früchte retten. Ich pflücke alle zermatschten und bereits weichen Bananen und trage sie ins Cockpit.
„Wer mag eine Banane?“
„Ich!“
„Ich auch!“
„Ach, gib mir doch auch eine.“ Michael streckt mir grinsend die Hand hin. Alles, was nicht aufgegessen wird, wird zu einem Smoothie verarbeitet.
Am vierten Tag frischt der Wind auf. Endlich! Zwar müssen wir weiterhin halsen, da er noch immer zu sehr aus Norden kommt, aber nun machen wir wieder Fahrt. Wir setzen die Genua und rauschen mit guten 5 Knoten dahin.
„Ich hoffe bloß, dass der Wind nicht zu sehr zunimmt. Gemäß Prognose sollte es vor Nouakchott ziemlich blasen.“ Michael runzelt die Stirn.
Ich werfe einen Blick auf die Seekarte. In rund zwei Tagen sollten wir das Kap in einer Distanz von etwa 200 Seemeilen umfahren. „Wir werden sehen. Immerhin können wir jetzt endlich segeln!“
Zufrieden lehne ich mich zurück, lasse meinen Blick über die Schaumkrönchen um uns herum schweifen und schaue einer Gruppe fliegender Fische zu, die in hohem Tempo aus den Wellen schießt, um gleich darauf wieder unterzutauchen. So liebe ich das Segeln. Wenn der Wind leise in den Wanten singt, das Schaukeln gleichmäßig wird und das Rauschen der Heckwelle von guter Geschwindigkeit erzählt. Ich lasse mir die Sonne aufs Gesicht scheinen und schließe die Augen. Jonas schläft im Salon, Seraina sitzt auf einem Fender auf dem Achterdeck, Rahel und Ursina schauen Donald Duck-Bücher an und Saskia hat sich in ihrer Kajüte eingeigelt.
Michael zieht das Satellitentelefon aus der Winschkurbeltasche und richtet die Antenne aus. „Vielleicht klappt es ja sogar mit dem Empfang. Der Himmel wäre nun ja frei.“
„Mmh.“ Mir ist das egal. Ich brauche keine Verbindung zur Außenwelt. Jetzt nicht, auf diesem Törn nicht. Ich bin glücklich, mich nur auf unsere Familie, auf meine eigenen Gedanken, aufs Segeln und aufs Boot konzentrieren zu können. Alles andere – Berichterstattung nach Hause, Austausch mit der FELBA, Neuigkeiten von Freunden – kann bis zu unserer Ankunft auf den Kapverden warten.
„Morgen hat Jonas Geburtstag. Ich schlage vor, dass wir ein Geburtstagsfrühstück mit Butterzopf machen und nachmittags eine Feier mit Kuchen und Geschenken.“
„Das klingt gut! Ich bekomm' jetzt schon Hunger auf Butterzopf!“ Dann runzelt er die Stirn. „Aber meinst du, du kannst bei dem Geschaukel backen?“
„Ich denke schon. Das Wägen wird eine Lotterie werden, weil die digitale Wage bei Wellengang nicht funktioniert, aber irgendwie krieg' ich das schon hin.“ Ich erinnere mich an den Törn von Madeira nach Lanzarote, als wir alle Heißhunger auf Süßes, aber keinerlei Kekse oder Schokolade mehr an Bord hatten. Obwohl ich zu Beginn unserer Reise unter Deck noch an Seekrankheit gelitten hatte, habe ich mich damals im Salon verkeilt und aus lauter Verzweiflung einen Baumnusskuchen gebacken. Inzwischen, zwei Jahre später, habe ich nur noch in den ersten paar Stunden nach dem Ablegen ein mulmiges Gefühl im Magen und ein Stechen im Kopf, aber mit jeder zurückgelegten Seemeile fühle ich mich besser. So anstrengend wie damals wird es also diesmal beim Backen nicht werden.
„Jonas, welchen Geburtstagskuchen wünschst du dir?“
Der kleine Kerl versucht vergeblich, Ursina zum Legospielen zu bewegen und traktiert sie mit einem Farbstift. Beim Wort Kuchen horcht er auf.
„Was? Kuchen?“
„Klar, du hast doch morgen Geburtstag!“
Ein Strahlen erhellt das kleine Gesicht. „Ursina, hast du gehört, ich hab' morgen Geburtstag! He, Ursina, hörst du mich?“
Ursina grunzt unwillig und hält sich ihr Comic vors Gesicht.
„Also, welchen Kuchen möchtest du, Jonas?“
„Hm. Schoggi will ich nicht. Haben wir Sauerkirschen?“
Ich schüttle den Kopf.
„Und Ananas?“
„Schon, aber die ist noch nicht reif.“
„Dann eben einen mit Erdbeeren.“
„Erdbeeren haben wir auch keine.“
„Och, was haben wir dann?“
„Äpfel, Orangen, Bananen, Rosinen, getrocknete Aprikosen und Datteln, Nüsse...“
„Das will ich alles nicht.“
„Okay, dann überleg's dir. Bis morgen früh hast du noch Zeit.“
Der Duft nach gedünsteten Zwiebeln steigt in meine Nase. Michael ist in der Küche verschwunden und kümmert sich ums Abendessen. Linseneintopf mit Würstchen, noch immer unser bewährtes Hochseeessen.
Mein Blick schweift über die Wasseroberfläche. Ich habe den Eindruck, dass die Wellen ein wenig höher geworden sind. Die Geschwindigkeitsanzeige klettert auf über sieben Knoten, wenn die PINUT auf einer Welle hinunter surft. Seraina und Rahel haben auf zwei Kugelfendern auf dem Achterdeck Platz genommen. Sie halten die Leinen wie Zügel, beobachten die Wellen und treiben ihre Fenderpferde bei jeder Welle an, die von schräg hinten auf die PINUT zurollt.
„Springt bloß nicht über Bord bei den Wellen!“ Ich lache ihnen zu und freue mich über ihr ausgelassenes Spiel. Mit ihren Lifelines eingepickt in die Reling kann ihnen nichts passieren.
Zwei Stunden später liege ich auf der Cockpitbank und betrachte den Sternenhimmel über mir. Millionen kleiner und kleinster Lichtpunkte übersäen den schwarzen Nachthimmel. Ich erkenne den großen und den kleinen Bären, die Milchstraße und die Kassiopeia. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Vollmond aufgeht.
Alle fünfzehn Minuten klingelt mein Handywecker und erinnert mich daran, einen Rundumblick zu machen. Ich stehe auf, starre in die Dunkelheit und sehe nichts. Es ist einfach zu dunkel. Vom Heck her ertönt das reibende Geräusch von Gummi auf Metall. Ich beleuchte mit der Stirnlampe unser Dinghi und erkenne, dass es an den Davits bei jeder Welle hin- und herschaukelt. Eine Leine muss sich losgeruckelt haben. Ich prüfe die Leinen, ziehe sie über die Winsch nach und bin zufrieden. Jetzt hält es wieder.
Auf dem Rückweg ins Cockpit komme ich an der Bananenstaude vorbei. Der intensive Geruch nach überreifen Bananen irritiert meine Nase. Ich ziehe das Bettlaken zur Seite und beleuchte die Staude.
„Iiiihh!“ Angewidert rümpfe ich die Nase.
„Was ist los?“ Verschlafen erscheint Michael im Niedergang.
„Wir müssen die Staude abhängen. Mindestens die Hälfte der Bananen ist Matsch.“
„Oh.“ Er verschwindet wieder in der Achterkajüte.
Eine große Welle erwischt die PINUT auf steuerbord, sie neigt sich stark zur Seite und wirft mich grob gegen den Relingsdraht.
„Autsch! Wieder ein blauer Fleck mehr“, grummle ich und verkeile mich zwischen Besanmast und Guias Hundebox.
„Brauchst du Hilfe?“ In seine Ölzeugjacke eingepackt steht Michael im Cockpit.
„Ich weiß noch nicht. Wohin sollen wir mit der Staude? Wir können sie so nicht hängen lassen bei diesen Wellen. Sie schlägt viel zu sehr herum, da nützt auch das Polster dazwischen nichts mehr.“
Meine Augen suchen das Achterdeck nach einem geeigneten Platz ab.
„Ins Schiff reinholen?“ Michaels Stimme klingt zweifelnd.
„Wohin genau? Drinnen haben wir noch weniger Platz als draußen.“
„In den Backskisten ist auch alles voll.“
„Und im Dinghi können wir sie nicht fixieren“, überlege ich. Zudem lagern wir dort unsere vollen Abfallsäcke, also auch keine gute Idee.
„Und wenn wir sie in Guias Hundebox legen?“ Michael fröstelt und zieht den Reißverschluss seiner Jacke zum Kinn.
„Ja, warum nicht? Guia ist sowieso auf See nie in der Box, sondern nur im Cockpit.“ Ich knie vor die Hundebox, fixiere das Türgitter mit einer Schnur an der Reling und hole das Hundekissen heraus.
„Lass das doch drin.“
„Du meinst, damit die Bananen weicher liegen?“ Ich muss grinsen.
„Naja, dann rutschen sie nicht herum.“
„Stimmt. Kannst du die Leine lösen und mir die Staude heruntergeben?“
Michael macht sich am Besanbaum zu schaffen und versucht, möglichst nicht in Berührung mit dem arg zugerichteten vorderen Teil der Staude zu kommen.
„Warte. Ich nehm' erst alle verdrückten Bananen ab, die müssen wir sowieso möglichst bald verwerten.“
„Hier.“ Rahel steht grinsend mit einer großen Schüssel neben mir.
„Danke.“ Die Schüssel füllt sich rasch. „Bringst du mir bitte ein zweite?“
Nach der dritten ruft Rahel: „Mehr haben wir nicht!“
„Passt, der Rest fliegt über Bord!“ Die ganz schlimm zugerichteten Bananen werden zu Fischfutter. Dennoch stehen am Schluss drei große, volle Schüsseln im Cockpit. Ich klebe überall, aber die Staude hat ihren sicheren Platz in der Hundebox gefunden. Immerhin.
„Ich weiß, welchen Kuchen Jonas morgen bekommt!“ ruft Michael plötzlich.
„Ich auch! Bananenkuchen!“
Wir prusten alle drei los.
„Und zum Frühstück gibt’s Bananenmilchshake.“ Michael fährt sich mit der Zunge über die Lippen.
„Und Bananenbrot“, ulke ich.
„Hört auf, ich kann jetzt schon keine Bananen mehr riechen!“ Rahel rümpft die Nase.
„Hilfst du mir trotzdem, Plätze für die Schüsseln zu finden?“
Sie nickt und verschwindet mit einem Teil der Früchte im Schiffsbauch.
Das Backen am nächsten Morgen gelingt und auch die Girlande bleibt flatternd am Cockpitdach hängen, obwohl die See rauer geworden ist und der Wind zugenommen hat.
Jonas fühlt sich wie ein kleiner König. „Ich will immer auf dem Meer Geburtstag feiern, das ist das Allerbeste! Da kann man den ganzen Tag feiern!“ Glücklich steckt er sich ein Stück Bananenkuchen mit Schokostückchen in den Mund.
Trinidad, September 17
Die PINUT hängt in den Seilen
An Jonas' Geburtstag erinnere ich mich, als ich anderthalb Jahre später auf Trinidad Ballone bei der Roti-Hütte aufhänge, diesmal für Seraina. Sie wird zwölf und wollte unbedingt, dass die PINUT an ihrem Geburtstag noch schwimmt. Denn wir sind hierher nach Trinidad gekommen, um das Schiff aus dem Wasser zu holen. Das Unterwasserschiff braucht neues Antifouling, für den Wassermacher wollen wir einen eigenen Borddurchlass bohren und unser Zweitanker soll endlich seinen Platz am Bug neben dem CQR bekommen. Für all diese Arbeiten braucht die PINUT festen Boden unter dem Kiel, und Chaguaramas auf Trinidad gilt als einer der besten Plätze in der Karibik für Schiffsarbeiten. Es liegt außerhalb des Hurrikangürtels und bietet eine gute Bootsinfrastruktur zu vernünftigen Preisen.
Aber noch schwimmt unser Schiff, und alle freuen sich auf den Ananaskuchen und die Maniokmuffins, die wir für Serainas Geburtstag gebacken haben.
„Ui, das sieht schön aus!“ Strahlend steht meine zweitälteste Tochter vor der überdachten Terrasse der Roti-Hütte. Die Girlande schaukelt zwischen zwei Pfeilern, und unzählige Ballone hüpfen im Wind auf und ab. Die Roti-Hütte ist ein kleines Häuschen auf dem Trockendock von Power-Boats, in dem mittags Roti, eine Art gefüllter Teigfladen, sowie andere Gerichte aus Fleisch, Reis, Kartoffeln und Gemüse verkauft werden. Am späteren Nachmittag ist das Restaurant geschlossen und wir haben die Terrasse für uns. Auf den langen Holztischen stehen bereits Fruchtsäfte, Wasser, Papierteller, Wassermelone und die Backwaren.
„Fehlen nur noch unsere Gäste.“ Suchend blickt sich Seraina um. Ihr blondes Haar fällt ihr leicht über die Schultern, sie trägt ein buntes Sommerkleid in kräftigen Farben. „Da kommen sie!“
Mein Blick folgt ihrem ausgestreckten Arm. Gleich von zwei Seiten kommen unsere Gäste auf die kleine Hütte zu. Ich freue mich sehr, unseren langjährigen Freund Walter, den pensionierten Schweizer Pfarrer von der Segelyacht PAPILLON II, wiederzusehen. Wir haben uns 2013 in Faro auf dem Trockendock kennengelernt und viele Stunden bei Käse, Wein und philosophischen Gesprächen verbracht. Walter ist auf dem Weg nach Kolumbien.
„Alles Gute zum Geburtstag, Seraina!“ Er schüttelt ihr die Hand.
„Mama, schau mal, Muffins!“ Mit vor Freude geröteten Wangen stürzt sich ein kleiner Blondschopf auf den Teller mit den süßen Törtchen.
„Halt, Liam, du darfst noch nichts nehmen! Wir warten, bis alle da sind.“ Gerade noch rechtzeitig gelingt es Alice, die Hand des vierjährigen Wirbelwindes davon abzuhalten, sich ein Muffin zu schnappen.
„Hallo, Alice.“ Ich umarme die zierliche Frau mit dem braunen, langen Haar. Erst gestern, direkt nach unserer Ankunft auf Trinidad, sind wir uns im Laden des Trockendocks zum ersten Mal begegnet, und heute wissen wir bereits, dass aus diesem einen Zusammentreffen eine Freundschaft entstehen wird. So ist es uns bisher oft passiert auf unserer Reise: Jede neue Begegnung wird sofort beurteilt, und je nachdem, wie diese Beurteilung ausfällt, trifft man sich rasch wieder oder eben nicht. Denn meist ist die Zeit, die man zusammen verbringen kann, knapp, da jedes Boot seine eigenen, individuellen Reisepläne hat. Darum gilt es, keine Zeit zu verlieren, sondern sie gemeinsam zu nutzen. Innerhalb weniger Stunden weiß man dann auch schon das Wichtigste aus dem Leben des anderen, kennt seine Pläne und Ziele und verabredet sich für Ausflüge und Unternehmungen. Das geht, weil es im Langfahrtseglerleben keinen täglichen Job gibt, der ruft, kein Handy, das klingelt und keine Termine, die einzuhalten sind. Oder zumindest fast keine. Auf dem Trockendock ist die Situation ein klein wenig anders, weil jeder so rasch wie möglich mit seinem Boot wieder ins Wasser will.
„Wann habt ihr euren Krantermin?“ Walter blickt uns fragend an.
„Morgen früh um acht.“ Michael streckt sich.
„Kinder, morgen früh um acht kommt die PINUT aus dem Wasser!“
„Wisst ihr schon, wohin sie euch stellen?“
„Nein, Alice. Wir würden gerne so weit wie möglich vom Wasser weg, da die Luftfeuchtigkeit dann nicht ganz so hoch ist. Wir müssen Schweiß- und Streicharbeiten machen.“
„Viele Plätze hat es nicht mehr. Jetzt kommen viele Yachten von den nördlicheren Karibikinseln hierher, um am Schiff zu arbeiten, damit sie im Dezember nach der Hurrikanzeit wieder parat sind.“ Walter hat zweimal die Welt umsegelt und kennt sich aus.
Am nächsten Morgen um acht ist weit und breit kein Kran in Sicht. Auch um neun nicht. Wir erfahren, dass gestern Abend ein Motorboot in der Auswasserstelle festgemacht hat. Das muss nun zuerst aus dem Wasser gehoben werden.
Nach dem Mittagessen ist es endlich soweit. Michael steuert die PINUT in Richtung Auswasserstelle. Ich fahre gemeinsam mit Rahel im Dinghi nebenher. Der Wind, der nachts komplett eingeschlafen gewesen ist, hat wieder aufgefrischt und stellt für unseren schwer zu manövrierenden Langkieler eine zusätzliche Herausforderung dar. Die PINUT zieht rückwärts immer nach rechts, und nun verstärkt der Wind diese Tendenz noch. Ich werde mit dem Dinghi versuchen, das Heck zu stoßen, sollte es zu nahe an die Betonwand gedrückt werden.
Das Unterfangen ist gar nicht so einfach. Am meisten Nerven kostet aber nicht der Wind, sondern die Rufe der Schaulustigen, die meinen, besser zu wissen, was zu tun ist.
„Mehr nach rechts!“
„Schneller!“
„Vorsicht, mehr links halten!“
„Halt, nicht so schnell!“
Zum Glück bleibt Michael in solchen Situationen gelassen. Er kennt das Verhalten der PINUT, lässt ihr Zeit, testet aus, welchen Einfluss der Wind hat, und nimmt drei Anläufe, bis er das Schiff so stehen hat, dass er mit meiner Hilfe rückwärts in die Box hineinkommt. Ich bin mir sicher, dass er die Rufe der Umstehenden gar nicht wahrgenommen hat.
Kaum haben wir an den riesigen Pollern festgemacht, fährt der Kran heran. Breite Gurten werden unter dem Bauch des Schiffes durchgezogen. Dann ruckelt es ein wenig, Michael schaltet den Motor aus und springt über die Reling, nachdem er mir die Leiter gereicht hat. Kaum steht er neben mir auf dem Steg, wird die PINUT auch schon in die Höhe gehoben. Zentimeter um Zentimeter steigt sie aus dem Wasser empor.
„Ui, ist die PINUT groß!“ Staunend steht Jonas neben mir. Das letzte Mal, als wir das Schiff auf dem Trockenen stehen hatten, war er viereinhalb, und offensichtlich kann er sich nicht mehr daran erinnern.
„Achtung, weg vom Steg!“ Ein Dockarbeiter in blauem Overall fuchtelt mit den Armen in der Luft herum. Wir gehen zur Seite und der Kran setzt sich in Bewegung.
Ich finde es jedes Mal beeindruckend, wenn unser 22 Tonnen schweres Schiff mit scheinbarer Leichtigkeit in den Seilen hängt. Leicht schwingend fährt sie über die holprige Straße quer übers ganze Dock, bis sie ganz hinten, weit weg vom Wasser in der Nähe der Autostraße, sanft auf ihrem neuen Standplatz abgesetzt wird.
„Wir haben euch extra einen Platz direkt neben den Toiletten und Duschen gegeben, wegen der Kinder“, erläutert Michael, der Kranführer, seine Wahl.
„Danke, das ist super!“ Ich habe rasch erkannt, dass die meisten Yachten um uns herum unbewohnt sind, und dafür bin ich dankbar. Denn es gibt nichts Anstrengenderes, als die Kinder laufend dazu anhalten zu müssen ruhig zu sein, nicht herumzurennen und nichts liegen zu lassen. Das ist bei fünf Kindern im Alter zwischen sechs und dreizehn Jahren ein Ding der Unmöglichkeit – vor allem auf dem Trockendock, das in Kinderaugen doch nichts anderes ist als ein riesengroßer Spielplatz. Für die Kinder beginnt eine Zeit voller Entdeckungen, Freiheit und Selbstbestimmtheit
Auch für uns ist das Schiffsleben an Land mit mehr Freiraum verbunden. Selbst wenn die Arbeitsliste immer länger wird, als anfänglich erwartet, wenn uns der Schmutz auf und im Schiff viel Gelassenheit abverlangt und wir abends immer vollkommen erschöpft in die Kojen fallen, so ist die Zeit auf dem Trockenen regelmäßig eine willkommene Abwechslung zum engen Zusammenleben auf See. Die PINUT jetzt auf ihrem Kiel stehen zu sehen ist ein bisschen so wie der Landfall nach einem längeren Segeltörn. Ich erinnere mich an unsere Ankunft auf Sal nach neun Tagen auf See.
Sal, Juli 16
Geburtstagsfeier auf Kapverdisch
„Land in Sicht!"
Michaels Ruf weckt mich. Verschlafen krieche ich aus der Koje und reibe mir die Augen. Die Sonne muss dicht über dem Horizont stehen, allerdings verbirgt sie sich hinter hellbraunem Dunst. Ein ungewohnter Geruch liegt in der Luft. Nicht mehr der Salzgeruch des Meeres, es riecht anders. Nach Blüten und Fisch. Dann entdecke ich einen Hügel in der Ferne. Und weiter steuerbord noch einen.
„Ist das Sal?“ Ich kneife die Augen zusammen und versuche eine Verbindung zwischen den beiden Hügeln zu erkennen.
Michael nickt. „Ja. Viel sieht man von hier aus nicht. Die Insel ist bis auf diese beiden größeren Erhöhungen flach und wüstenhaft.“
Die Inselgruppe der Kapverden, bestehend aus nördlichen (Barlovento) und südlichen Inseln (Sotavento) ist evolutionsgeschichtlich im selben Zug mit den Kanaren, Madeira und den Azoren aus Vulkanen entstanden. Im späten 15. Jahrhundert kamen die Portugiesen und stationierten eine Handvoll Familien mit Sklaven aus dem nahen Senegal auf Sao Antao. So vermischte sich die afrikanische mit der europäischen Kultur und brachte eine kreolische Kultur mit kapverdischer Identität hervor. Heute sind neun der 15 Inseln bewohnt. Die Amtssprache ist Portugiesisch, auf den Straßen wird Kreolisch gesprochen. Bezahlen kann man in kapverdischen Escudos oder in Euro.
Als wir in die weite Bucht von Palmeira auf Sal einlaufen, bin ich nicht unglücklich darüber, dass dieser Törn zu Ende geht. Seit neun Tagen sind wir nun auf See, acht Nächte lang haben Michael und ich uns mit den Nachtwachen abgewechselt und tagsüber gekocht, abgewaschen und die Kinder betreut. Wir sind beide kräftemäßig an der Grenze. Für die Atlantiküberquerung werden wir wohl einen weiteren Erwachsenen mitnehmen, um zu genügend Schlaf zu kommen.
Über UKW-Funk erfahren wir, dass die FELBA bereits vor Anker liegt. In der Bucht tummeln sich etwa fünfzehn Yachten und unzählige Fischerboote.
„Uff, das wird eng.“ Mir bricht der Schweiß aus allen Poren. Ich mag enge Ankerplätze gar nicht, mangelt es uns doch bisher an ausreichender Ankererfahrung.
Langsam steuert Michael an der FELBA vorbei. Ute und Valentin stehen an der Reling und fuchteln wild mit den Armen.
„Ich glaube, sie meinen, wir sollen dort drüben hin“, versuche ich ihre Gebärden zu deuten.
Zwischen einer Yacht und zwei Fischerbooten im Päckchen lassen wir den Anker fallen. Michael gibt Kette, ich beobachte unsere nächste Umgebung.
„Der Anker hält.“ Sein Fuß steht auf der Kette, den Blick hat er ans Ufer gerichtet. Ich peile über die Reling und gebe ihm Recht. Die PINUT steht. Allerdings sind wir dicht an die andere Yacht geraten. Zu dicht.
„Lass uns nochmals ankerauf gehen. Das ist sicher ein leichter Kurzkieler, der schwoit anders als wir. Nicht, dass wir das Schiffchen noch zertrümmern!“ Ich grinse ihn an und er nickt.
„Aber wohin dann?“
„Weiter hinein würde ich nicht gehen, dort ist es zu voll und das Wasser sieht auch nicht besonders sauber aus für den Wassermacher.“
„Stimmt. Also hinter die FELBA.“
Michael hilft unserem CQR-Anker übers Wasserstag hinauf, während ich die PINUT zügig in Richtung Ausgang steuere. Während ich um einige Yachten kurve, um den besten Platz zu orten, fährt ein langes, hölzernes Fischerboot auf uns zu. Ein schwarzer Mann in einem roten Shirt winkt uns zu und zeigt auf eine Mooring.
„Wir sollen daran festmachen!“ schreie ich zu Michael nach vorne. Ich sehe, dass er zögert. Auch ich bin mir nicht sicher. Was, wenn der Einheimische Kohle wittert und uns die Mooring für teures Geld verkaufen will? Aber da sehe ich, wie Michael nach dem Bootshaken greift und mir zunickt. Langsam halte ich auf die Mooring zu.
„Olá, bom día!“ Der Mann im Boot streckt uns die Hand hin. In einer Mischung aus Portugiesisch, Kreolisch und Spanisch erzählt er uns, dass er Jaír Ramos heißt und hier im Hafen der „Junge“ für alles ist. Wir können für wenig Geld an der Mooring bleiben, und falls wir Taxiservice, Wasser oder sonst was brauchen, sollen wir ihm anrufen. Er drückt Michael einen Zettel mit einer Telefonnummer in die Hand und verschwindet wieder.
„Auch nicht schlecht.“ Ich drehe den Zündschlüssel und wische mir den Schweiß von der Stirn. Jetzt sind wir also in Afrika.
„Ankerbierchen?“ Michael zwinkert mir zu.
„Aber klar!“
Jaír stellt sich als sehr nützlich, wenn auch nicht besonders zuverlässig heraus. Er ist ein stämmiger, freundlicher Mann Mitte Vierzig, dessen wertvollstes Accessoire sein Handy ist. Ein altes mit Tasten, das zudem nicht immer funktioniert, wie er uns mehrmals mitteilt und wie wir später noch erleben werden.
Er chauffiert uns an Land und hilft uns beim Einklarieren. Zum ersten Mal auf unserer Reise müssen wir bei der Immigration und beim Zoll vorsprechen. Allerdings scheint beides nicht besonders dringend zu sein. Der Immigrationsbeamte ist gerade nicht da, wir sollen morgen wiederkommen. Immerhin müssen wir nicht zum Flughafen für den ganzen Papierkram, wie es noch vor einigen Jahren üblich war, bevor das Büro hier eröffnet wurde.
Die ersten Schritte auf schwarzafrikanischem Boden fühlen sich seltsam an. Um uns herum dunkelhäutige Menschen, die uns unverhohlen betrachten. Die Kinder drücken sich an Michael und mich. Ich übe mich in Gelassenheit, aber so ganz gelingt es mir nicht. Es ist für mich das erste Mal, dass ich als Weiße in einem Land mit überwiegend schwarzer Bevölkerung unterwegs bin, und ich fühle mich zugegebenermaßen unsicher. Ich kann nicht genau festmachen, was mich verunsichert, und bin einfach froh, dass uns Jaír begleitet.
Er macht mit uns eine Ortsführung und zeigt uns ein kleines Lokal, in dem wir die Nationalspeise Katchupa bestellen. Katchupa ist ein äußerst schmackhaftes Gericht aus weißem Mais, Gemüse und entweder Ei, Fleisch oder Fisch, je nach Verfügbarkeit. Wir genießen das Essen an kleinen Plastiktischen auf Plastikstühlen auf der Straße gemeinsam mit Ute, Valentin, Horst und Gudrun. In den Hauseingang nebenan drücken sich zwei Jungen, die uns aufmerksam beäugen. Gegenüber sitzt eine junge Frau mit einem Baby im Arm auf der Türschwelle und scherzt mit einem Mann.