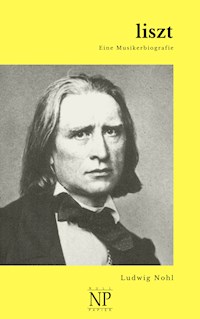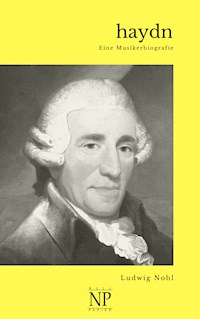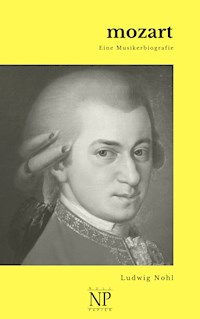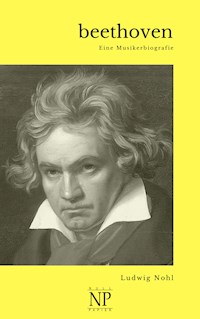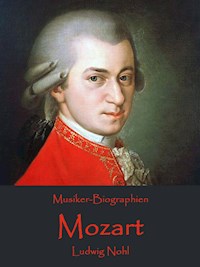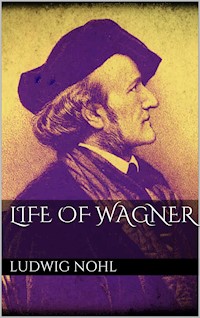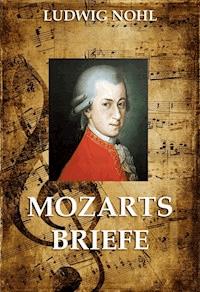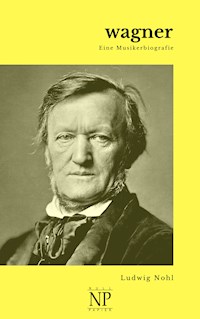
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Musikerbiografien
- Sprache: Deutsch
Ludwig Nohl erweist sich in dieser fesselnden Biographie als aufmerksamer Chronist der schillernden Persönlichkeit Richard Wagners. Er beleuchtet dessen radikale Erneuerung der Opernform, die Kraft und Wucht seiner "Musikdramen" und die unkonventionellen Lebenswege, die Wagner beschritt. So entsteht ein differenziertes Bild jenes Mannes, der mit "Der Ring des Nibelungen" und "Tristan und Isolde" die Musikgeschichte bis heute prägt. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ludwig Nohl
Wagner
Eine Musikerbiografie
Ludwig Nohl
Wagner
Eine Musikerbiografie
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2025Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: , 3. Auflage, ISBN 978-3-962817-39-8
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Spruch
Vorwort
1. Die erste Jugendzeit.
2. Sturm und Drang.
3. Revolution in Leben und Kunst.
4. Die Verbannung.
5. München.
6. »Bayreuth«.
7. Der »Parsifal«.
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Musikerbiografien
Beethoven - Eine Musikerbiografie
Weber - Eine Musikerbiografie
Haydn - Eine Musikerbiografie
Liszt - Eine Musikerbiografie
Mozart - Eine Musikerbiografie
Spohr - Eine Musikerbiografie
Wagner - Eine Musikerbiografie
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Spruch
»Auf, ihr Brüder, ehrt die Lieder! Sie sind gleich den guten Taten. Wer kann besser als der Dichter Dem verirrten Freunde raten?«
Goethe.
Vorwort
Schon unsere Meister Haydn, Mozart, Beethoven hatten ihre Kunst über ihre Vorgänger dadurch erweitert, dass sie sich stets mehr den Bewegungen des Lebens anschlossen. Und wiederum mit ihrem Schaffen selbst gaben sie diesem Leben ihrer Nation und der Menschheit vertiefteren Gehalt, der sogar zuletzt wieder an das Höchste anknüpfte, was wir besitzen, die Religion. Dieser Spur folgte nun kein Künstler mit mehr durchdringender Kraft als Richard Wagner, und er konnte dies, weil bei gleicher geistigen Begabung einerseits die Grundlage seiner Bildung breiter und tiefer war als bei unseren elastischen Meistern, andererseits die Bewegung unseres Lebens gerade während seiner langen Schaffenszeit immer kräftiger und mannigfaltiger wurde, weil die Ideen unserer Dichter und Denker mehr und mehr zur Tat und Wahrheit in unserem Dasein gediehen. Wagners Entwicklung ist eine ebenso sicher ruhig fortschreitende wie diejenige jener drei Klassiker, und alle Kämpfe, so heftig sie manchmal auch waren, klärten ihm selbst nur den Weg zu jenem hohen Ziele, an dem wir selbst heute mit ihm stehen und eine freie Entfaltung aller unserer Kräfte vor uns sehen. Dieses Ziel heißt die Umfassung alles Kunstvermögens zu dem großen Gesamtkunstwerke des musikalischen Dramas, in dem sich die Allbewegung unseres menschlichen Daseins bis zu ihrer höchsten Entfaltung im Ideale darstellt. Und da dieses musikalische Drama geschichtlich auf der Oper beruht, so sind die Meister, die sich naturgemäß mit R. Wagner zu einem zweiten Dreigestirn unserer Kunst einen, der Begründer der deutschen Oper, C. M. von Weber, und der Reformator der alten Oper, Christof Wilibald Gluck. Daher wird uns die Darstellung der Entwicklung unseres jüngsten Meisters ebensowohl aus jene älteren hinweisen wie die Erkenntnis von dem, was er selbst uns ist, von selbst ergeben.
1. Die erste Jugendzeit.
(1813–1831)
»Ich beschloss Musiker zu werden.«
Wagner.
*
Richard Wilhelm Wagner ist am 22. Mai 1813 in Leipzig geboren. Sein Vater leitete damals die Polizeiverwaltung, die durch die endlosen Truppenbewegungen der französischen Kriege von besonderer Bedeutung war. Derselbe erlag denn auch bald darauf der Epidemie, welche unter den durchziehenden Armeen ausgebrochen war. Die Mutter, eine Frau von feinerem geistigen Wesen, heiratete darauf den hochbegabten Schauspieler Ludwig Geyer, welcher ein vertrauter Freund des Hauses gewesen war, und zog mit ihm nach Dresden, wo er am Hoftheater angestellt und sehr angesehen war. Hier hat denn Wagner seine Kindheit und erste Jugend verlebt. Neben der großen patriotischen Erhebung waren künstlerische Eindrücke das erste, was ihn tiefer anregte. Schon der Vater hatte an den theatralischen Liebhabereien des damaligen Leipzig regen Anteil genommen und jetzt gehörte die Familie ja ganz der praktischen Kunst an. Ein Bruder Albert und die Schwester Rosalie gingen später zum Theater über, und zwei andere Schwestern pflegten eifrig des Klavierspieles. Richard selbst befriedigte die kinderhafte Neigung zum Komödiespielen nur auf dem Zimmer und sein Klavierspiel beschränkte sich auf das Nachklimpern von Melodien, die ihm ins Ohr gefallen waren. So hörte ihn der Vater in der Krankheit, die auch ihn bald darauf befiel, das Liedchen »Üb’ immer Treu und Redlichkeit« und den damals ganz neuen »Jungfernkranz« aus dem Freischütz spielen und der Knabe wieder hörte ihn ganz leise die Mutter fragen: »Sollte er vielleicht Talent zur Musik haben?« Er hatte ihn früher zum Maler bestimmt, da er selbst ein ebenso guter Porträtmaler wie Schauspieler war. Jetzt starb er, ehe der Knabe sieben Jahre alt war, und hinterließ demselben nur die Mitteilung der Mutter, er habe etwas aus ihm machen wollen. Wagner erinnerte sich bei der ersten Skizzierung seines Lebens, die er im Jahre 1842 schrieb, dass er auf diesen Ausspruch des Vaters sich lange etwas eingebildet habe, und jedenfalls war es ihm ein Antrieb zum Höheren.
Seine Neigung ging aber zunächst nicht auf die Kunst, er wollte vielmehr studieren und kam so auf die berühmte Kreuzschule. Musik ward nur so nebenbei betrieben. Zwar ein Hauslehrer musste ihm auch Klavierstunden geben, allein wie beim Zeichnen widerte ihn hier das Erlernen des Technischen bald an und er zog vor, nach dem Gehöre zu spielen, wobei er sich die Ouvertüre zum Freischütz einstudierte. Der Lehrer hörte dies und meinte, es werde nichts aus ihm werden. Fingersatz und Läufe erlernte er dabei freilich nicht, aber eine aus der eigensten Empfindung stammende Betonung, wie sie kaum je ein Künstler besessen hat. Die Ouvertüre zur Zauberflöte lernte er schon damals lieben, der Don Juan dagegen blieb ihm noch unzugänglich.
Allein alles dies war nur große Nebensache. Griechisch, Lateinisch, Mythologie und alte Geschichte fesselten den regen Geist des Knaben und zwar so sehr, dass sein Lehrer ihm mit Ernst das Studium der Philologie zuwies. Wie er die Musik nachspielte, versuchte er jetzt die Dichtung nachzuahmen. Ein Gedicht auf einen gestorbenen Mitschüler erhielt sogar den Preis, jedoch musste viel Schwulst daraus entfernt werden. Der Überschwang der Fantasie und Empfindung kündigte sich auch hier in früher Jugend an. Nun wollte er, elf Jahre alt, Dichter werden! Ein sächsischer Poet Apel bildete die griechischen Trauerspiele nach, warum sollte nicht er dasselbe können? Die ersten zwölf Bücher der Odyssee hatte er schon übersetzt und Romeos Monolog sogar metrisch nachgebildet, nachdem er, bloß um Shakespeare genau kennen zu lernen, für sich auch Englisch erlernt hatte. So beherrschte er früh die Sprache, die »für uns dichtet und denkt«, und Shakespeare blieb sein nächstes Vorbild. Ein großes Trauerspiel, ungefähr aus Hamlet und Lear zusammengesetzt, ward jetzt entworfen, und wenn darin allein zweiundvierzig Menschen starben und er sich wegen Mangels an Personen am Schlusse genötigt sah, deren Geister wiederkommen zu lassen, so erkennen wir auch hier nur das Übermaß der angeborenen Kraft.
Ein Gutes hatte dieser ungeheuerliche Dichtungsversuch: er führte ihn zur Musik, und an ihrem dämonischen Ernste lernte er selbst erst den Ernst der Kunst begreifen, die ihm im Gegensatz zu seiner Wissenschaft bis dahin noch so wenig als ernst galt, dass ihm unter anderen: der Don Juan wegen seines italienischen Textes läppisch und das »geschminkte Komödiantentum« widerlich erschienen war. Er hatte in der gleichen Zeit den Freischütz kennen gelernt und wenn er Weber an ihrem Hause vorbeigehen sah, betrachtete er ihn stets mit heiliger Scheu. Die Weisen, die seinem Jugendempfinden schon durch die patriotische Erregung jener ersten Tage unseres wiedererstehenden Vaterlandes nahe standen, bezauberten ihn und erfüllten ihn mit schwärmerischem Ernste. »Nicht Kaiser und nicht König, aber so dastehen und dirigieren!« rief es in ihm, als er Weber mit seinem Freischütz die Gemüter an jene Melodien bannen sah. Jetzt kam er mit der Familie nach Leipzig zurück. Hatte er über seinem großen Trauerspiel, das ihn volle zwei Jahre beschäftigte, die Studien versäumt? Man versetzte ihn auf der Nicolaischule nach Tertia zurück und er verlor darüber alle Freude am Lernen. Dazu trat jetzt zum ersten Male auch der volle Geist der Musik in seinen Anschauungskreis: er hörte in den Gewandhauskonzerten Beethovens Symphonien. »Ihr Eindruck auf mich war allgewaltig«, sagt er von dieser tiefen Seelenerfahrung seines 15. Lebensjahres, die umso eindringlicher war, als er vernahm, dass der große Meister das Jahr zuvor in der traurigsten Weltabgeschiedenheit gestorben sei. »Ich weiß nicht, wozu man mich eigentlich bestimmt hatte«, lässt er noch nach Jahren in seiner Novelle »Eine Pilgerfahrt zu Beethoven« einen jungen Musiker sagen, »nur entsinne ich mich, dass ich eines Abends eine Beethovensche Symphonie hörte, dass ich darauf Fieber bekam, krank wurde, und als ich wieder genesen, Musiker geworden war.«
In der Schule war er faul und lüderlich geworden, nur sein Trauerspiel lag ihm noch am Herzen, aber dieser Beethoven bestimmte ihn jetzt auch leidenschaftlich zur Musik. Ja das Anhören der Egmont-Musik begeisterte ihn so, dass er um alles in der Welt sein Trauerspiel nicht anders als mit einer solchen Musik »vom Stapel laufen lassen« wollte. Sie zu schreiben traute er sich ohne Bedenken zu, hielt es aber doch für gut, sich zuvor über einige Regeln dieser Kunst aufzuklären. Um dies im Fluge zu tun, lieh er sich auf acht Tage eine leichtfassliche Generalbasslehre. Das Studium trug wohl nicht so schnelle Früchte wie er gehofft, aber die Schwierigkeiten reizten seinen lebhaften und energischen Geist. »Ich beschloss Musiker zu werden«, erzählt er.
So hatten sich seines Innern in früher Jugend zwei mächtige Gewalten unseres modernen Daseins bemächtigt, die allgemeine Geistesbildung und die Musik. Es siegte zunächst die letztere, aber in der Form, die jene ebenfalls einschließt, in der Darstellung einer poetischen Idee, wie sie zuerst völlig Beethovens Symphonie zum Ausdruck gebracht hatte. Hören wir also, wie diese etwas eigenmächtig wollende Art den stürmischen jungen Geist auf die eigentliche Bahn seiner Entwicklung gebracht hat.
Derweilen war sein »großes Trauerspiel« von der Familie entdeckt worden. Sie geriet in große Betrübnis, weil damit die Vernachlässigung der Schulstudien ans Licht kam. Dass er sich bereits zur Musik innerlich berufen fühlte, verschwieg er unter solchen Umstanden freilich, blieb aber heimlich den Kompositionsversuchen treu. Bezeichnenderweise ließ ihn dabei niemals der dichterische Nachahmungstrieb los, ordnete sich jedoch dem musikalischen unter, ja ward nur zur Befriedigung des letzteren herbeigezogen, so sehr beherrschte ihn noch das Besondere der Musikkomposition. Beethovens Pastoralsymphonie zum Beispiel bestimmte ihn einmal zu einem Schäferspiele, das in seiner dramatischen Anlage wieder durch Goethes Singspiel »Die Laune des Verliebten« angeregt war, und er schrieb dabei Musik und Verse zugleich, sodass die Handlung und die Situationen ganz aus dem Musik- und Versemachen hervorgingen. Ebenso aber reizten ihn die vorhandenen Formen der Musik zur Nachahmung, es entstanden damals auch eine Sonate, ein Streichquartett und eine Arie.
Diese Werke mögen wohl der Formbildung nach ohne Tadel, werden aber ebenso ohne eigenartigen Gehalt gewesen sein. Sein Geist war noch in anderen Dingen umfangen als in dem wirklichen Poesiewesen der Musik. Gleichwohl glaubte er sich unter dem Schutze solcher Leistungen auch bei der Familie als Musiker melden zu können. Doch nahm diese solche Kompositionsversuche umso mehr nur als eine flüchtige Leidenschaft wie andere, als er ja nicht einmal ein Instrument in genügender Weise spielte, um sich auch als praktischen Musiker sicher und fest zu betätigen. Dazu trat jetzt eine seltsame Gärung und Verwirrung in den jungen Sinn, der schon so mancherlei Bedeutendes und fast alles zu gleicher Zeit in sich aufgenommen hatte. Die damals herrschenden Romantiker, besonders der mystische Th. A. Hofsmann, der selbst Dichter und Musiker zugleich war und neben den schönsten poetischen Auslegungen der Werke Glucks, Mozarts, Beethovens die ausschweifendsten Fantasien über Musik geschrieben hat, wirrten ihm die poetischen Ideen und die musikalischen Ausdrucksmittel in der tollsten Weise durcheinander. Es war für den kaum sechzehnjährigen Jüngling Gefahr um den gesunden Verstand zu kommen. »Am Tage, im Halbschlafe, hatte ich Visionen, in denen mir Grundton, Terz und Quinte leibhaftig erschienen und mir ihre wichtige Bedeutung offenbarten; was ich darüber aufschrieb, starrte von Unsinn«, sagt er selbst.
Da war es denn hohe Zeit, dass Setzung der gärenden Elemente und Klärung eintrat. In der Tat wurde ihm jetzt diese musikalische Sprache, deren Halbverständnis ihn zu solchen Gesichten und Fantasien brachte, auf ihren wahren Bestand, auf ihre gegebenen Gesetze und Regeln zurückgeführt. Ein tüchtiger Musiker, der spätere Altenburger Organist Müller, ließ ihm die seltsamen Gestalten und Gewalten seiner überreizten Einbildung zu einfachen musikalischen Intervallen und Akkorden verschweben und brachte so eine feste Grundlage der Erkenntnis auch in diese musikalischen Begeisterungen und Fantasien. Doch war der Unterricht noch im Praktischen erfolglos. Der junge Brausekopf und Schwärmer blieb in diesem Studium unordentlich und nachlässig. Seine geistige Anschauung und Erregung ging schon zu weit, um sich leicht auf das ruhige Erlernen einer trockenen Technik zurückbannen zu lassen, und war doch noch nicht eigenartig mächtig genug, um zu solcher notwendigen Aneignung der Mittel auch in der Kunst sich selbst zusammenzufassen.
Eine der großen Ouvertüren für Orchester, die er, statt erst die Musik als selbstständige Sprache zu erlernen, damals zu schreiben vorzog, nennt er selbst den »Culminationspunkt seiner Unsinnigkeiten«. Und doch war etwas in dieser Komposition in Bdur, was bei ihrer Aufführung im Leipziger Gewandhause einem ausgebildeten Musiker wie dem späteren Berliner Oberhofkapellmeister Heinrich Dorn, seinem damaligen Freunde, Achtung abnötigte: es war dies dasjenige, was Wagner von sich und seiner geistigen Bildung her auch in der Musik suchte und gab, die poetische Idee, die einer Komposition den sicheren Wurf eines innerlich und organisch Gestalteten gibt. So konnte er den jungen Autor, dessen Werk allerdings von Seiten des Publikums statt günstiger Aufnahme Unwillen und Heiterkeit gefunden hatte, aufrichtig mit der Zukunft trösten.
Zunächst versetzte auch ihn die hereinbrechende französische Julirevolution von 1830 in die größte Erregung und er wollte sogar eine politische Ouvertüre schreiben. Ebenso lenkten die fantastischen Ausschweifungen der Universität, die er derweilen beschritten hatte, um sich durch das Studium allgemein geistiger Fächer allseitig für den Beruf als Musiker auszubilden, seinen Sinn noch eine Weile von dem Ernste desselben ab. Dann aber ließ ihn zu seinem und der Kunst Heile die Vorsehung einen Mann finden, der seinem nach solchem Sturme umso heftiger erwachenden Drange nach Ordnung und Regel in seinem Musikstudium ebenso ernst wie freundlich entgegenkam: Theodor Weinlig, seit 1823 Cantor der Leipziger Thomasschule, also im Geist und Können des großen Sebastian Bach aufgewachsen. Dieser besaß die Eigenschaft des guten Lehrers, gleichsam spielend in die Geheimnisse seiner Sache einzuführen. In weniger als einem Jahre wusste der junge Studiosus die schwierigsten Aufgaben des Kontrapunktes mit Sicherheit und Leichtigkeit zu lösen und ward als zur wirklichen Selbstständigkeit in seiner Kunst erzogen von seinem Lehrer entlassen. »Frau Charlotte Weinlig, der Witwe seines unvergesslichen Lehrers«, lautet denn auch die Widmung seines »Liebesmales der Apostel«, der einzigen oratorienmäßigen Arbeit, die Wagner geschaffen hat. Aus jener Zeit rühren auch eine Sonate und eine Polonaise her, die fern jedem Schwulst einfach natürlichen musikalischen Satz haben. Mehr aber gilt es uns, dass Wagner damals auch Mozart innig erkennen und lieben lernte, es war dies die Bahn, auf welcher er später über Beethoven hinaus den mächtigen Leipziger Cantor finden sollte, der durch seine Kunst die Tiefen unseres wahren Lebens ebenso für immer erschlossen wie geheiligt hat.
Zunächst war es jetzt Beethoven, dessen Kunst sich ihm auf der sicheren Grundlage eigenen Könnens auch sicher erschloss und der ihn dann völlig zum Komponisten machte. »Ich zweifle, dass es zu irgendwelcher Zeit einen jungen Tonsetzer gegeben hat, der mit Beethovens Werken vertrauter gewesen wäre, als der damals achtzehnjährige Wagner«, sagt H. Dorn von jener Zeit. Und er selbst erzählt in seinem »Deutschen Musiker in Paris«: »Ich kannte keine Lust mehr, als mich so ganz in die Tiefe dieses Genius zu versenken, bis ich mir einbildete, ein Teil desselben geworden zu sein.« Er schrieb sich des Meisters Ouvertüren ab und ebenso die Neunte Symphonie, die ihn ebenso in tobendes Schluchzen wie in höchste Schwärmerei versetzte. Ebenso erkannte er jetzt völlig Mozart, zumal die Jupitersymphonie. »Er hat den vaterländischen Geist mit seiner Reinheit des Gefühls und Keuschheit der Eingebung als das heilige Erbteil betrachtet, mit dem der Deutsche, wo er auch sei und in welcher Sprache er auch rede, gewiss ist, die angestammte Größe und Hoheit zu bewahren«, urteilt er wenig Jahre später in Paris über Mozart. »Klarheit und Kraft war mein Bestreben«, sagt er von dieser Jugendepoche, und eine Ouvertüre und eine Symphonie bekundeten bald, dass er die Vorbilder wirklich erfasst hatte. Zwanzig Jahre eigener Fruchtbarkeit in dieser hohen Schule der Kunst und er sollte auch deren eigenes letztes Vorbild, den großen Sebastian Bach, innig erkennen lernen und auf diesem tiefsten Grunde der Musik das erhabene Gebäude einer deutschen Kunst errichten, die unseren Geist in all seinen Fähigkeiten und Idealen umfasst und uns endlich auch ein vollständiges Nationaldrama begründet hat.
Die Schulung war vorüber: jetzt geschah, mit nichts bewaffnet als mit seinem Wollen und Können, kühnen und sicheren Schwunges der Sprung ins Leben. Wollen und Können sollten sich an seinen Kämpfen und Leiden ebenso erproben wie stählen. Mit den ersten dauernden Eroberungen derselben finden wir ihn wieder.
2. Sturm und Drang.
(1832–1841)
»Der Gott, der mir im Busen wohnt. Er kann nach außen nichts bewegen!«
Goethe.
*
Man weiß aus Beethovens Leben, was damals Wien für die Musik bedeutete. Im Sommer 1832 machte sich Wagner zum Besuche dorthin auf, fand sich aber stark enttäuscht: »Zampa«1 und Strauß’sche Potpourris daraus umtönten ihn aller Orten. Er sollte die Kaiserstadt erst spät und als ruhmgekrönter Meister wiedersehen. Die Vorortschaft in Musik und Oper war an Paris übergegangen. In Prag dagegen führte das Konservatorium seine Symphonie auf. Doch konnte er auch hier erfahren, wie wenig das Reich seines Beethoven bereits begonnen hatte.
In Leipzig brachte man dann im Winter ebenfalls die Symphonie. »Es ist eine kecke dreiste Energie der Gedanken, ein stürmischer kühner Schritt und doch eine so jungfräuliche Naivetät in der Empfängnis der Grundmotive, dass ich große Hoffnungen auf den Verfasser setze«, schrieb H. Laube, den Wagner kurz zuvor kennen gelernt, und wir ersehen auch hier die Sturmbewegung der Zeit, die von da an für uns nicht mehr ins Stehen kam und uns heute die Einheit der Nation und der Kunst geschaffen hat. Burschenschafter, St. Simonist, Weltverbesserer, dies war nach des jungen Künstlers Sinn. Das »Junge Europa«, in dem Laube die freien Gedanken des neuen Jahrhunderts, Liebesrausch und jede Art Lebensgenuss predigte, spukte ihm in allen Gliedern, und Heines Schriften wie vor allem der wollüstig weiche Ardinghello von Heinse erhöhten dieses erregte Sinnendasein.
Einstweilen war jedoch die bessere Natur noch siegreich in ihm, Beethoven und Weber blieben seine guten Genien. Er komponierte 1833 nach ihrem Vorbilde eine Oper »Die Feen«, und der Text zeigt die durch Ernst geweihte Grundrichtung seines Wesens. Eine Fee liebt einen Sterblichen, kann aber selbst die Menschlichkeit nur unter der Bedingung gewinnen, dass der Geliebte sie, möge sie sich auch noch so böse und grausam zeigen, nicht ungläubig verstoße. Sie verwandelt sich nun in einen Stein und wird durch des Geliebten sehnenden Gesang entzaubert. Dieser selbst aber wird, gleich jenem unbedingten Glauben an den geliebten Gegenstand ein bedeutsamer Zug der idealen Auffassung Wagners vom Wesen der Liebe, dann ebenfalls in die unsterbliche Wonne der Feenwelt ausgenommen. Zur Aufführung ist das Werk nie gekommen. Bellini, Adam und Genossen beherrschten die Bühne auch in Deutschland. Nun kam zu dieser Enttäuschung der ungemeine Erfolg, den die für Wagner so hochbedeutsam gewordene große Schröder-Devrient sogar und gerade in diesen leichten Opern, vor allein als Romeo hatte. Dann das prickelnde Element dieser Franzosen und Italiener, gegen welche die damals beginnende deutsche Kapellmeistermusik quälend langweilig erschien, er selbst, der Einundzwanzigjährige zu jeder Art Tat und Genuss bereit, – warum sollte nicht er, der sich so sehr nach Erfolg sehnte, ebenfalls diese Bahn beschreiten? Beethoven erschien ihm als der Schlussstein einer großen Epoche, jetzt musste etwas Neues, anderes kommen. Die Frucht dieses Siedens und Überkochens war »Das Liebesverbot oder die Novize von Palermo«, die erste Oper von ihm, die zur Aufführung gelangte.