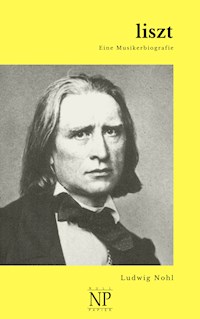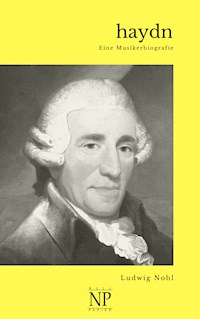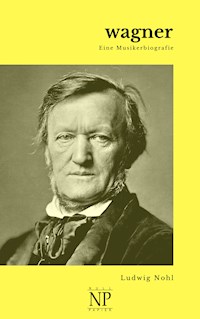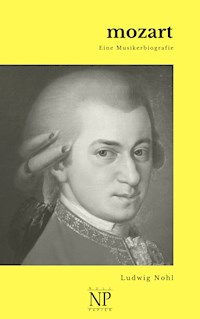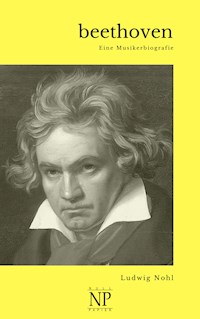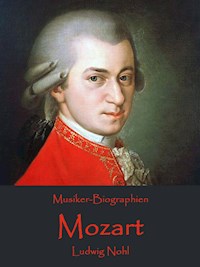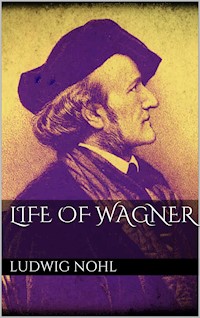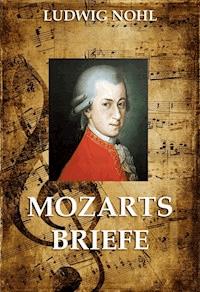Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Musikerbiografien
- Sprache: Deutsch
Diese Biographie beleuchtet einen Komponisten, dessen Werke den Übergang von der Klassik zur Romantik eindrucksvoll markieren. Nohl fängt die poetische Klangwelt von Carl Maria von Weber ein und zeigt, wie dessen Opern – allen voran "Der Freischütz" – das deutsche Musiktheater nachhaltig veränderten. Mit spürbarer Leidenschaft erzählt Nohl von Webers beruflichen Triumphen und privaten Rückschlägen und macht so den Menschen hinter dem Komponisten greifbar. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ludwig Nohl
Weber
Eine Musikerbiografie
Ludwig Nohl
Weber
Eine Musikerbiografie
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2025Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: , 3. Auflage, ISBN 978-3-962817-24-4
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Spruch
Einleitung
1. Die Jugendzeit.
2. Auf den Wogen des Lebens.
3. Die Wanderjahre.
4. Kampf und Sieg.
5. Der Freischütz.
6. Euryanthe.
7. Oberon.
8. Tod und Bestattung.
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Musikerbiografien
Beethoven - Eine Musikerbiografie
Weber - Eine Musikerbiografie
Haydn - Eine Musikerbiografie
Liszt - Eine Musikerbiografie
Mozart - Eine Musikerbiografie
Spohr - Eine Musikerbiografie
Wagner - Eine Musikerbiografie
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Spruch
»Wie Gott will!«
Weber
Einleitung
»O mein herrliches deutsches Vaterland, wie muss ich dich lieben, wie muss ich für dich schwärmen, wäre es nur, weil auf deinem Boden der Freischütz entstand! Wie muss ich das deutsche Volk lieben, das den Freischütz liebt, das noch heute an die Wunder der naivsten Sage glaubt, das noch heute, im Mannesalter, die süßen geheimnisvollen Schauer empfindet, die in seiner Jugend ihm das Herz durchbebten! Ach du liebenswürdige deutsche Träumerei! Du Schwärmerei vom Walde, vom Abend, von den Sternen, vom Monde, von der Dorfturmglocke, wenn es Sieben schlägt! Wie ist der glücklich, der euch versteht, der mit euch glauben, fühlen, träumen und schwärmen kann! Wie ist mir wohl, dass ich ein Deutscher bin!«
So schrieb im Jahre 1841 von Paris aus Richard Wagner, als dort Webers weltbekanntes Werk zum ersten Male vollständig aufgeführt wurde, in die geliebte Heimat. Und was war es, was ihn bei diesem deutschen Werke gerade in der kalten Fremde so bis zu Tränen rührte? Er selbst sagt von der Sage, die den Untergrund dieser herrlichen Tondichtung mit ihren wehmütig beseligenden Stimmungen bildet, Folgendes:
»Die Sage vom Freischützen scheint das Gedicht jener böhmischen Wälder selbst zu sein, deren düster feierlicher Anblick uns sofort begreifen lässt, dass der vereinzelt hier lebende Mensch sich einer dämonischen Naturmacht wenn nicht verfallen, doch unlösbar unterworfen glaubte. Und hierin liegt gerade der besondere deutsche Charakter dieser und ähnlicher Sagen begründet: dieser ist von der umgebenden Natur so stark vorgezeichnet, dass ihr die Bildung der dämonischen Vorstellung zuzuschreiben ist, welche bei anderen, von dem gleichen Natureinfluss losgelösten Völkern mehr der Beschaffenheit der Gesellschaft und der sie beherrschenden religiösen Ansichten entspringt. Wenngleich grauenhaft, gestaltet sich diese Vorstellung hier nicht eigentlich grausam: die Wehmut bricht durch den Schauer hindurch, und die Klage um das verlorene Paradies des Naturlebens weiß den Schrecken über die Rache der verlassenen Mutter zu mildern. Dies ist eben deutsche Art. Überall sonst sehen wir den Teufel unter die Menschen sich begeben, Hexen und Zauberer von sich besessen machen, sie dann willkürlich dem Scheiterhaufen übergeben oder vom Tode retten; selbst als Familienvater sehen wir ihn erscheinen und mit bedenklicher Zärtlichkeit seinen Sohn beschützen. Doch selbst der roheste Bauer glaubt dem heut zu Tage nicht mehr, weil diese Begebenheiten zu platt in das alltägliche Leben gesetzt sind, in welchem sie doch ganz gewiss nicht mehr vorkommen. Hingegen ist glücklicherweise der geheimnisvolle Verkehr des menschlichen Herzens mit der ihn umgebenden eigenartigen Natur noch nicht aufgehoben. Denn in ihrem beredten Schweigen spricht diese heute noch zu jenem ganz so wie vor tausend Jahren, und das, was es ihm in altersgrauer Zeit erzählte, versteht er heute noch so gut wie damals. So wird diese Natursage das ewig unerschöpfliche Element des Dichters für den Verkehr mit seinem Volke.«
Der dieses besondere Heimatsgut uns Deutschen auch in der Kunst der Töne völlig schenkte und damit den Grund einer deutschen Oper ausbaute, die in dem Schatten des heute herangewachsenen mächtigen Lebensbaumes unser ganzes tiefere Dasein hegt, war also Carl Maria von Weber. Ihm sei diese weitere biografische Skizze gewidmet.
1. Die Jugendzeit.
(1786-1804)
C. M. von Weber, wie er sich zu unterzeichnen pflegte, entstammte einer geadelten niederösterreichischen Familie und sein Sinn blieb zeitlebens Kaiser und Reich von damals als der eigentlichen Vertretung von Deutsch und Heimatlichkeit mit lebhaftem Empfinden zugewandt. Sein Vater hatte ein außerordentlich bewegtes Leben geführt, in dem aber eines stets wie ein Polarstern festgestanden war: einen musikalischen Genius zum Sohne zu haben. Die Liebe zur Kunst und zwar besonders zu Theater und Musik war nach altösterreichischer Art in der Familie ein zweites Stück Leben. Der Bruder dieses Franz Anton Weber war jener Mannheimer Souffleur und Kopist, dessen dritte Tochter in Wien Mozarts Frau wurde, und Franz Anton selbst ward, nachdem er zuerst Offizier, dann Beamter gewesen, hintereinander Theaterdirektor, Musikdirektor, Stadtmusikus und wieder Theaterdirektor, als welch letzterer er fast das ganze heilige römische Reich durchzog.
Sein Sohn Carl Maria ward im Jahre 1786 zu Eutin geboren, und zwar wie in der Familie als das wahrscheinlichste angenommen war, am 18. Dezember. Doch verließ der Vater schon im nächsten Frühjahr das Land der seeigen Buchenwälder, um eben von Norden nach Süden und umgekehrt die deutschen Lande als Theaterdirektor zu durchziehen. Die Mutter, Genofeva von Brenner aus Bayern, war eine sanfte stille leidende Frau. Auch der Sohn hatte von Geburt an ein Leiden am Schenkelknochen, das ihn in der ersten Jugend den Knabenspielen entzog und niemals im Leben das Gefühl voller Gesundheit genießen ließ. Infolge dessen lahmte er in späteren Jahren etwas auf dem rechten Fuße. Doch ward er so von Jugend an gewöhnt, den Quell der Frische und Heiterkeit in sich selbst und der inneren Anspannung zu suchen. Andrerseits erscheint als ein großer Vorteil für seine eigenartige Entwicklung die frühe Vertrautheit mit der Bühne. »Sohn des Theaterdirektors, Gespiele der Kinder der Schauspieler und Musiker, durch seine körperliche Schwäche an die Nähe der Eltern gebunden, war für ihn das Theater, das Orchester, die Bühne die Welt, die sonst dem Knaben Straße, Garten und Hof umschließen«, sagt sein Sohn, sein Biograf. Doch zeigte er anfangs nicht besondere musikalische Begabung. Sein Vater und ein älterer Stiefbruder Fridolin gaben ihm Musikunterricht. Letzterer schlug ihm im Zorn einmal den Violinbogen über die kleinen Hände und zwar mit den wegwerfenden Worten: »Carl, du kannst vielleicht alles werden, aber ein Musiker wirst du nimmermehr!« Der Übereifer des Vaters, der durchaus ein Wunderkind haben wollte, drängte die unbefangene Äußerung des angebornen Talentes wohl eher zurück. Denn als der Knabe einen vernünftigen Lehrer bekam, zeigte sich dieses sofort von selbst. »Den wahren festen Grund zur deutlichen charaktervollen Spielart auf dem Klaviere und gleiche Ausbildung beider Hände habe ich dem braven, strengen und eifrigen Heuschkel in Hildburghausen zu verdanken«, schreibt er später selbst. Dies war im Jahre 1796-97 gewesen.
Der Vater war ein gar fahrig abenteuernder und in späteren Jahren auch hochfahrender Herr, der es in seinen stets wechselnden Verhältnissen und oft sehr gewagten Unternehmungen mit den Mitteln seinen Zweck zu erreichen nicht immer so genau nahm. Aber eines stand ihm als unverrückbare Lebensaufgabe da, seinem Sohne diejenige Erziehung zu geben, die zu dem Berufe eines tüchtigen künstlerischen Schaffens notwendig ist. So brachte er ihn zunächst zu Haydns Bruder Michael nach Salzburg, der als sattelfester Kontrapunktiker bekannt war, und »Sechs Fughetten« hieß das erste Werk, das im zwölften Jahre des Knaben herauskam. Dann aber schlug bei dem Vater die begreifliche Vorstellung durch, dass für einen zukünftigen Opernkomponisten vor allem die Kenntnis der Verwendung der Mittel der Musik zu ausdrucksvoller Darstellung der unmittelbaren Empfindung erforderlich sei. Er führte ihn daher nach München, das seit 1778 durch Carl Theodor mit seiner Mannheimer Kapelle zu einer bedeutenden Stätte der Kunstpflege erhoben worden war. Lernte der Knabe hier bei einem ausgezeichneten Sänger der italienischen Schule, Wallishauser (Valesi), vor allem den Gesang beherrschen, sodass ihm dieser später ebenso natürlich war wie das praktische Verstehen aller Bühnenerfordernisse, so verhalf ein neuer verständiger Lehrer seinem natürlichen Talente, wie es zuerst Heuschkel erkannt und gepflegt hatte, zum Durchbruche. »Dem klaren stufenweis fortschreitenden sorgfältigen Unterrichte des Letzteren – es war der Klaviermeister Kalcher, – danke ich größtenteils die Herrschaft und Gewandtheit im Gebrauche der Kunstmittel, vorzüglich in Bezug auf den reinen vierstimmigen Satz, die dem Tondichter so natürlich werden müssen, soll er rein sich und seine Ideen auch dem Hörer wiedergeben können, wie dem Dichter Rechtschreibung und Silbenmaß«, sagt er selbst. Eine ganze Reihe von Kompositionen, Sonaten, Variationen, Lieder, eine große Messe und sogar eine Oper »Die Macht der Liebe und des Weines« entstanden in dieser Studienzeit von 1798-1800. Des Vaters Stolz wollte sie sogar der Welt mitteilen. Es fand sich jedoch zum Heil der ruhigen Fortentwicklung des Sohnes dafür kein Verleger.
Damals lernten die Webers den neuerfundenen Steindruck kennen, der uns heute die billige Edition Peters und damit eine Kenntnis der musikalischen Meisterwerke verschafft hat, wie sie so leicht bisher nur von Werken der Poesie und der bildenden Kunst zu gewinnen war. Der Vater war ganz begeistert von dieser Erfindung Sennefelders und träumte sich bei des Sohnes Talent goldene Berge. Dieser begann denn auch sogleich mit Eifer selbst zu lithografieren, was ihm bei seiner Handfertigkeit im Zeichnen leicht wurde, ja er wusste sogar bald auch die lithografische Presse selbst zu verbessern. Als nun gar ein sonderbarer Zufall, ein Brand, der sich auf einen einzelnen Schrank bei Kalcher beschränkte, seine zahlreichen Kompositionen zerstörte, meinte er nach der streng gläubigen Art, wie die fromme Mutter sie in ihn gelegt hatte, dies als einen Wink des Himmels betrachten und sich ganz der Lithografie widmen zu sollen. Ein Heft Variationen, freilich noch recht mangelhaft in der technischen Herstellung, erschien 1798, und nun wanderten die beiden Neuunternehmer nach der kleinen Bergwerksstadt Freiberg im Erzgebirge, wo die hohe Entwicklung jedes technischen Könnens ihnen die sichere Erfüllung ihrer Hoffnungen verhieß.
Ein ganzes Jahr hing der heranwachsende Knabe über diesen mechanischen Übungen. Dann brach die Liebe zur Kunst siegreich wieder durch. Ihr erstes größeres Erzeugnis war ein deutsches Singspiel »Das stumme Waldmädchen«. Weber selbst nannte es zwar später ein »höchst unreifes und nur hier und da nicht ganz von Erfindung leeres Produkt« und die Wirkung auf der Bühne erwies sich auch nicht als dauernd. Allein er war auf diese Weise doch seiner Kunst und vor allem der Bühne wiedergewonnen. Ja so kräftig hatte sogleich der erste Eindruck dieses wiedereroberten Besitzes gewirkt, dass er »verleitet von den Wunderanekdoten von großen Meistern« den zweiten Akt des Werkes in zehn Tagen niedergeschrieben hatte. Jetzt wollte er denn auch von der Lithografie nichts mehr wissen. Er bot im Dezember 1800 sein »Arcanum«1 der Wiener Kunst- und Musikhandlung von Artaria zum Kauf an und fügte zugleich als »Michel Haydnscher Zögling« das Angebot einer Anzahl von Kammermusiksachen hinzu, erhielt jedoch auf dieses erste Schreiben an einen Verleger gar nicht einmal Antwort. Ein heftiger Streit mit den Fachmusikern der Stadt, den seines Vaters eitles Renommieren mit des Sohnes Können entfacht hatte, verleidete dann beiden den Aufenthalt in Freiberg und sie zogen wieder aus, wie man sagen muss, Geschäfte in Kunst zu machen.
Abermals ein heiteres Singspiel, »Peter Schmoll und seine Nachbarn« war das Erzeugnis neuen Schaffens, er verlor die Spur seiner zum schönen Ziele führenden eigensten Lebensbahn nicht. Er hatte denn auch die Freude, in Salzburg, wo dieses Werk im Jahre 1801 entstand, von seinem alten Lehrer das Zeugnis zu empfangen, dass dasselbe »mannhaft und vollkommen nach den Regeln des Kontrapunkts bearbeitet, mit vielem Feuer und mit Delicatesse und dem Texte ganz angemessen komponiert sei«, und sah sich zudem »als dessen lieber Zögling der ganzen musikalischen gefühlvollen Welt zur besten Aufnahme empfohlen«. Das Werk selbst kam bald in Augsburg zur Bühnenaufführung, jedoch ohne jeglichen Erfolg. Dazwischen lag abermals eine Kunstreise. »1802 machte mein Vater eine musikalische Reise mit mir nach Leipzig, Hamburg, Holstein, wo ich mit dem größten Eifer theoretische Werke sammelte und studierte«, erzählt er selbst. »Unglücklicherweise stieß ein Doctor alle meine schönen Lehrgebäude mit den oft wiederkehrenden Fragen: Warum? über den Haufen und stürzte mich in ein Meer von Zweifeln, aus dem mich nur nach und nach das Schaffen eines eigenen, auf natürliche und philosophische Gründe gestützten Systems rettete, sodass ich das viele Herrliche, das die alten Meister befohlen und festgestellt hatten, nun auch in seinen Grundursachen zu erforschen und in mir zu einem abgeschlossenen Ganzen zu formen suchte.«
Der ihm zu diesem Resultate behilflich geworden ist, war der Abbe Vogler, bekannt aus Mozarts Briefen aus Mannheim. Ihn lernte er im Jahre 1803 in Wien kennen und diese Bekanntschaft ward entscheidend für sein Leben, für das überhaupt dieser Wiener Aufenthalt ein erster Abschnitt werden sollte.
Die stets neue Erfahrung, die der jetzt Sechzehnjährige auf dieser letzten Reise mit seinem Talente gemacht hatte, – Michael Haydn nennt ihn einen »ganz ausgezeichnet starken Klavierspieler dieser Zeit« und zudem sang er zur Guitarre hinreißend jene gemütvollen oder schalkhaften Lieder, die auch den Grundkern all seines dramatischen Schaffens bilden, – diese persönliche Erfahrung hatte ihm sein Talent wie seine Aufgabe stets mehr zum Bewusstsein gebracht. Eine kleine Begebenheit in seiner Vaterstadt Eutin, wo Vater und Sohn im Oktober 1802 für ein paar Wochen weilten und wo auch Bekanntschaft mit Johann Heinrich Voß geschlossen wurde, von dem Weber so manches Lied gewinnend heiter oder komisch komponiert hat, ist eben dafür bezeichnend. Er musizierte dort viel in dem Hause des Kanzleirates Stricker. Dabei verdross es ihn oft, dass der Sohn des Hauses mit seinem fertigen Maultrommelspiel wahre Triumphe feierte. Als derselbe aber einmal sogar auf zwei Maultrommeln spielte und dabei solchen Enthusiasmus erregte, dass selbst der Vater Weber ausrief: »Gott, Maria, wie schön!« weigerte sich Carl Maria auf das bestimmteste, selbst dort das Klavier wieder anzurühren. Das immer mehr erwachende Gefühl seiner Aufgabe aber war es, was ihn jetzt instinktmäßig nach Wien, dem Mittelpunkt der Musik, drängte, wo der Altmeister Joseph Haydn noch lebte und jede Art der Musik schönste Blüten trieb.
Über diesen Aufenthalt hat Weber selbst ausführliche Briefe geschrieben, die in der Biografie nicht enthalten, im Jahre 1842 im Wiener Modejournal und dann 1882 in dem Buche »Mosaik. Für musikalisch Gebildete« veröffentlicht worden sind. Gerichtet sind dieselben an einen musikalischen Freund in Salzburg, und sogleich der Eingang des ersten derselben zeigt uns Webers ganzes in Freundschaft seliges Herz. »O ich kann dir gar nicht sagen, wie abgeschieden und traurig ich hier lebe«, heißt es 1802 von Augsburg aus. »Hätte ich meine Musik nicht, ich müsste bald verzweifeln. Und noch dazu keine Seele zu haben, die so mit mir empfindet, das schmerzt, besonders, wenn ich dann an die leider so kurzen selig verlebten Tage mit dir denke.« Es geschieht das allmähliche Erwachen in ihm, und hiermit Hand in Hand geht ein stets größeren Umfang nehmendes geistige Interesse, zumal im Dienste seiner Kunst. Schon jetzt ist von einer musikalischen Zeitung, von einem Musiklexikon, von einer Musikgeschichte Wiens die Rede. Wie denn auch die äußere Hebung seiner Kunst und ihrer Jünger zeitlebens sein eifriges Bestreben blieb! »Bruder! meine Brust ist so voll, dass ich unmöglich mehr schreiben kann«, heißt es unmittelbar vor der Abreise nach Wien, wo er die Erfüllung aller Wünsche erhoffte.