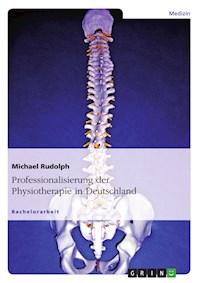14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
«Wenn die Kinder nach der Grundschule nicht das kleine Einmaleins oder nicht richtig lesen können, ist was komplett falsch gelaufen.» Aber genau das, sagt Michael Rudolph, sei allzu oft traurige Realität. Der erfahrene Schulleiter hat in wenigen Jahren die Berliner Bergius-Schule, die einen üblen Ruf hatte, zu einer begehrten Unterrichtsstätte gewandelt – mit klaren Regeln für ein diszipliniertes Lernen. Für ihn sind auch Tugenden wie Pünktlichkeit und höflicher Umgang entscheidend, um wieder Ruhe und Verlässlichkeit in den Schulalltag zu bringen In diesem Buch beschreibt Rudolph zusammen mit seiner Koautorin Susanne Leinemann, wie man eine schulische Umgebung schaffen kann, egal wo, in der Lernen das wichtigste Ziel ist. Das zahlt sich aus – selbst digitaler Fernunterricht gelingt so besser. Es braucht Mut, so die Botschaft, Mut, den Auftrag der Schule ernst zu nehmen. Schule ist kein Selbstzweck, im Gegenteil. Sie liefert die Basis, damit Schüler später gut in der Arbeitswelt ankommen können. Aufstieg durch Bildung ist aktueller denn je, doch nur wer am Ende wirklich etwas kann, hat gute Chancen. Verstrickt in pädagogische Grabenkämpfe und Bildungstheorien haben wir viel zu oft das Ziel aus den Augen verloren: Was soll Schule? Rudolph antwortet mit dem Mut zum Wesentlichen: Schule ist zum Lernen da!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Michael Rudolph • Susanne Leinemann
Wahnsinn Schule
Was sich dringend ändern muss
Über dieses Buch
«Wenn die Kinder nach der Grundschule nicht das kleine Einmaleins oder nicht richtig lesen können, ist was komplett falsch gelaufen.» Aber genau das, sagt Michael Rudolph, sei allzu oft traurige Realität. Der erfahrene Schulleiter hat in wenigen Jahren die Berliner Bergius-Schule, die einen üblen Ruf hatte, zu einer begehrten Unterrichtsstätte gewandelt – mit klaren Regeln für ein diszipliniertes Lernen. Für ihn sind auch Tugenden wie Pünktlichkeit und höflicher Umgang entscheidend, um wieder Ruhe und Verlässlichkeit in den Schulalltag zu bringen In diesem Buch beschreibt Rudolph zusammen mit seiner Koautorin Susanne Leinemann, wie man eine schulische Umgebung schaffen kann, egal wo, in der Lernen das wichtigste Ziel ist. Das zahlt sich aus – selbst digitaler Fernunterricht gelingt so besser.
Es braucht Mut, so die Botschaft, Mut, den Auftrag der Schule ernst zu nehmen. Schule ist kein Selbstzweck, im Gegenteil. Sie liefert die Basis, damit Schüler später gut in der Arbeitswelt ankommen können. Aufstieg durch Bildung ist aktueller denn je, doch nur wer am Ende wirklich etwas kann, hat gute Chancen. Verstrickt in pädagogische Grabenkämpfe und Bildungstheorien haben wir viel zu oft das Ziel aus den Augen verloren: Was soll Schule? Rudolph antwortet mit dem Mut zum Wesentlichen: Schule ist zum Lernen da!
Vita
Michael Rudolph, geboren 1953, ist seit vierzig Jahren im Berliner Schuldienst. Seit 2005 leitet er die Bergius-Schule in Berlin-Friedenau, die er von einer Problemschule zu einer begehrten Bildungseinrichtung geführt hat.
Susanne Leinemann schreibt für die «Berliner Morgenpost». Sie hat mehrere Bücher vorgelegt und wurde mit dem Henri-Nannen-Sonderpreis ausgezeichnet. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei schulpflichtigen Kindern in Berlin.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung hißmann, heilmann, hamburg
ISBN 978-3-644-00673-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Ein Schloss für Schüler
Mut zum Wesentlichen
Es fehlen die Grundlagen
Das breite Versagen der Schule
Das Theater mit der Schulinspektion
Von der Arbeiterbewegung lernen
Wo stehen wir jetzt?
Die Sache mit den Regeln
Ohne Erziehung geht es nicht
Schule muss machbar bleiben
Und wenn sich jemand nicht an die Regeln hält?
Nicht wegschauen!
Lehrjahre im Chaos
Lehrer im Reservat Kreuzberg
Unterricht an der «Restschule»
Die schleichende Desillusionierung der fortschrittlichen Lehrer
So geht es nicht weiter!
Das ewige Problem der «Brennpunktschulen»
Schule? Lohnt doch nicht
Handeln oder untergehen
Hilfe, der «Bolle» brennt!
Neue Lösungswege
Gewalt an der Schule
Wer wollen wir als Schule sein?
Als Team arbeiten
Schwarz-Rot-Gold im tiefsten Kreuzberg
Vielfalt braucht Gemeinsamkeit
Die Sache mit dem Kopftuch
Plötzlich heterogen?
«Alle Religionen seindt gleich und guth»
Wechselhafte Dominanzkultur
Was ist richtig?
Angezählt
Durchgreifen und ansprechbar bleiben
Der enge Kontakt zu den Eltern
Autorität sein, aber nicht autoritär
Theorie und Wirklichkeit
«Arbeiten? Ich werde YouTuber!»
Miteinander
Das Kastensystem der deutschen Bildung
Die Mischung macht’s
Kulturschock. Vom Gymnasium in eine andere Welt
Vom Segen der Stille
Lehren aus Corona: Hauptsache digital?
Die Grenzen der Schule
Die Schule ersetzt nicht die Eltern
Einfach vorleben!
Manchmal dauert es länger
Die Ganztagsschule soll alles retten
Schule – Lernort oder Lebensort?
Und wieder ein Anfang
Literatur
Ein Schloss für Schüler
Mut zum Wesentlichen
Die Sache mit den Regeln
Lehrjahre im Chaos
So geht es nicht weiter!
Vielfalt braucht Gemeinsamkeit
Was ist richtig?
Miteinander
Die Grenzen der Schule
Ein Schloss für Schüler
Ein Spätsommertag im August, die Schule steht heute leer. Nein, nicht wegen Corona, noch ist das Virus unbekannt. Heute haben sich alle Klassen zu einem ganz normalen Wandertag aufgemacht. Eben hat der Hausmeister die Schulglocke ausprobiert, irgendetwas hakte dort, eine Weile klingelte es mehrmals hintereinander. Nun ist Ruhe. Allerdings nur bis der Hausmeister das mechanische Grammophon aus dem Schulmuseum herausträgt und auf die Treppe des Schulportals stellt. Er legt eine Schellackplatte auf, kurbelt, und aus dem Trichter erklingt Tanzmusik der 20er Jahre. Inzwischen hat er sich einen Gartenstuhl hervorgezaubert, sitzt vor dem Eingang der Schule in der Sonne, hat die Augen geschlossen und genießt die schon leicht herbstliche Wärme. Um ihn herum blüht farbenstark der Oleander, der links und rechts vom Schuleingang gepflanzt ist.
Leute bleiben stehen, die gerade noch an diesem Wochentag über den Perelsplatz gehetzt sind. Spaziergänger, Einkäufer, Anwohner hier aus Friedenau, einem bürgerlichen Viertel im Südwesten Berlins. Sie genießen die Musik, betrachten vergnügt unseren tiefenentspannten Hausmeister, bewundern den Anblick des schönen und prächtigen Gebäudes aus der Kaiserzeit, das immer nur einen einzigen Zweck hatte: eine gute Schule für Schüler zu sein. Viele Sinnsprüche an der Fassade weisen auf das Bestreben hin. «Es fällt kein Meister vom Himmel», «Ohne Fleiß kein Preis» und «Wie die Saat, so die Ernte» stehen dort in Stein gemeißelt. Mancher Betrachter fragt an diesem Mittag nach, ob man mal einen Blick ins Innere werfen dürfe. Wir laden die Besucher herzlich in unser Schulschloss ein.
Denn ein Schloss für Bildung ist es; die Friedrich-Bergius-Schule so zu nennen ist kaum übertrieben. An den üppigen Säulen im Innenraum finden sich kleine Wappen für jedes Schulfach – der Erlenmeyerkolben für Chemie, eine Figur aus geometrischen Formen für Mathematik, eine Eule für Philosophie. Schön und prächtig ist das Treppenhaus, sind auch die breiten Flure, die aber plötzlich in Verruf gekommen sind. Kaiserzeitliche Flurschulen gelten dem heutigen Zeitgeist als gestrig, als steinerne Überreste einer vergangenen, dunklen pädagogischen Epoche der Schülerunterdrückung. «Die Flurschule des 19. Jahrhunderts wurde einst für den Paukunterricht des 19. Jahrhunderts gebaut. Pädagogik war passiver Nachvollzug staatlich vorgegebenen und verordneten Wissens», so verurteilt sie beispielsweise der Bildungsforscher Jörg Ramseger. Aber unsere Schüler lieben diese alte Schule mit ihrer prächtigen sandsteinfarbenen Fassade, den riesigen Fenstern und gerade auch den breiten Fluren, in denen sie nach jeder Schulstunde aneinander vorbeiströmen.
Womöglich bleiben einige Besucher vor der Wand mit den Bildern ehemaliger Schüler stehen. Egon Bahr, der SPD-Politiker und enge Vertraute Willy Brandts, ging hier zur Schule, auch Peter Lorenz, der Berliner CDU-Politiker, der 1975 von der «Bewegung 2. Juni» entführt und in einem Kreuzberger Keller festgehalten wurde. Das Porträt des Theaterkritikers Friedrich Luft hängt hier, auch das von Karl-Eduard von Schnitzler, später auch Sudel-Ede genannt, der jahrelang im «Schwarzen Kanal» des DDR-Fernsehens polemisch westdeutsche Fernsehausschnitte kommentierte. Sie alle und viele mehr gingen hier zur Schule, damals beherbergte das Gebäude noch das Friedenauer Gymnasium für Jungen.
Nach dem Krieg zog eine Realschule in das Gebäude. Die Schülerschaft veränderte sich mit den Jahrzehnten radikal. 2005 stand die Realschule vor dem Aus – zu viel Gewalt, kaum Anmeldungen, zu viele Schulabbrecher. Selbst die Lehrer trauten sich damals nicht mehr, ihre Autos in der Nähe der Schule zu parken. Zu groß war die Befürchtung, am Ende des Schultages einen abgetretenen Außenspiegel vorzufinden. Aus Angst vor den eigenen Schülern schlichen sie nach Schulschluss über Hintereingänge aus der Schule. Das große prächtige Schulportal war fest in der Hand aggressiver, ungebändigter Schüler, die mächtigen Säulen links und rechts waren mit Graffiti beschmiert. Der damalige Direktor wusste sich nicht anders zu helfen, als die Schmierereien mit weißer Wandfarbe zu übertünchen, die grell und alarmistisch vom ruhigen Sandstein abstach. Am nächsten Tag waren die Graffiti wieder da, wieder wurden Quast und weiße Farbe hervorgeholt. So ging es Schicht für Schicht. Niemand mehr aus Friedenau meldete freiwillig sein Kind hier an.
Das ist heute radikal anders. Unsere Schule hat inzwischen mehr Anmeldungen als Plätze, sie ist seit Jahren übernachgefragt. Unsere Schüler sind stolz, hier zu sein. Und wir, die Lehrer, sind stolz auf sie. Fast alle erreichen am Ende einen Abschluss, fast die Hälfte verlässt sogar nach der zehnten Klasse mit einer Gymnasialempfehlung in der Tasche unsere Schule und macht sich auf den Weg zum Abitur. Dabei fallen wir unter die Kategorie «Brennpunktschule» – viele unserer Schüler stammen aus Familien, in denen nicht viel Geld vorhanden ist, über siebzig Prozent sprechen zu Hause kaum oder gar kein Deutsch. Der Schulalltag ist für alle fordernd, für die Schüler, aber auch für die Lehrer, die Sozialpädagogen, die Sekretärin, den Hausmeister, auch die Putzfrauen. Wir alle ziehen an einem Strang, weil wir das Gleiche wollen: unseren Schülern genügend Wissen und ein gutes Sozialverhalten vermitteln, damit sie später wirkliche Chancen im Beruf haben, um so ein selbstbestimmtes Leben zu führen und am Ende verantwortungsvolle, meinungsstarke und kraftvolle Bürger zu werden.
In diesem Buch will ich zusammen mit meiner Co-Autorin Susanne Leinemann, deren frischer Blick von außen half, erzählen, wie wir in den letzten Jahren in der Schule gearbeitet haben. Dennoch soll hier nicht ein einziges pädagogisches Konzept propagiert werden, denn uns ist immer bewusst: Es geht auch ganz anders. Jede Schule ist eine andere. Eine Grundschule arbeitet unter anderen Voraussetzungen als ein Gymnasium, eine Hauptschule kämpft mit anderen Problemen als eine Gemeinschaftsschule. Es gibt kein Rezept für alle.
Und doch gibt es etwas, das uns eint. Verschiedene Schulen mögen verschiedene Wege gehen, aber alle Wege sollten ein gemeinsames Ziel haben: Wissen zu vermitteln und ein gutes Sozialverhalten zu entwickeln. Es geht um Leistung und um das Miteinander. Es gibt zwei Fragen, die sich jede Schule, jedes Kollegium immer wieder stellen muss, Jahr für Jahr: Haben meine Schüler genügend gelernt? Und handeln sie umsichtig? Das ist es, was für die Absolventen am Ende wirklich zählt. Was die Eltern umtreibt und was die Ausbilder, Professoren und Arbeitgeber später erwarten. Spätestens das Coronavirus und seine lebensgefährliche Ausbreitung hat uns gezeigt, wie schnell die Dinge existentiell werden können und wie sehr man sich dann in einer Gesellschaft aufeinander verlassen muss; wir brauchen die gut ausgebildeten jungen Erwachsenen dringend, ob als Supermarkt-Angestellte, Ärzte, Erzieher oder Feuerwehrleute, die in solchen Momenten mit Übersicht und Disziplin handeln – aus ihrem Können heraus. In der Pandemie wurde uns deutlich vor Augen geführt, wie stark man in einer Gesellschaft aufeinander angewiesen ist, wie wichtig es ist, dass alle wissen, was sie tun müssen. Die Basis dafür wird früh gelegt. Die Botschaft ist deshalb klar: Eine Schule, in der nicht gelernt wird, ist nutzlos.
Wir können es nicht verantworten, dass junge Menschen jahrelang in einer Schule herumsitzen und dann als Auszubildende im Elektrobereich nicht wissen, was das Ohm’sche Gesetz ist, oder als zukünftige Kaufleute mit dem Dreisatz völlig überfordert sind oder keinerlei Chancen auf eine Ausbildung als Maler und Lackierer haben, weil sie schon am Einstellungstest scheitern. Und Abiturienten in die Welt entlassen, denen grundlegende Fähigkeiten für das Studium fehlen, die schon beim Verfassen einfachster akademischer Texte scheitern. Wie viele Talente gehen der Gesellschaft verloren, weil die Schulen – nicht die Schüler – versagt haben, weil schlicht zu wenig gelernt wurde. Mir scheint, diese Frage ist in den letzten Jahren in Vergessenheit geraten. Zeit, sich wieder daran zu erinnern.
Mut zum Wesentlichen
Es gibt eine einfache Aufgabe, die zwei Drittel unserer neuen Schüler jedes Mal an ihre mathematischen Grenzen bringt. Mit jedem, der nach der Grundschule zu uns kommen will und der sich hier bewirbt, führe ich anfangs ein Gespräch, damit wir uns gegenseitig kennenlernen. Da stelle ich unsere Schule vor, unsere Ideen, versuche, mit der Schülerin oder dem Schüler ins Gespräch zu kommen. Ich schaue mir die Zeugnisse an und erkundige mich bei den begleitenden Eltern, der Mutter oder dem Vater, nach ihren Erwartungen an uns. Natürlich geht es auch um die Frage, wie war die Grundschulzeit, was wurde gelernt, wo gibt es noch etwas nachzuholen. Und häufig frage ich dann: «Kannst du mir sagen, was 3 × 9ist?»
Mir ist bewusst, wie aufgeregt viele Schüler in diesem Moment sind. Für die meisten ist dies der erste formalere Moment in ihrem Leben, das erste kleine Bewerbungsgespräch. Wir sitzen an einem langen alten Tisch in meinem Schulleiterzimmer mit der Fensterfront zum Perelsplatz, einem weitläufigen und im Sommer sehr grünen Platz, umgeben von Gründerzeithäusern. An der Rückseite meines Büros findet sich eine ausladende Bücherwand voller historischer Bände, mehr Bücher, als die meisten unserer Schüler jemals in einem Raum gesehen haben, außer in einer Bibliothek. Der Bundespräsident blickt uns im Porträt von der Wand an. Überall Schulakten und Papiere. Ein großes Schwarz-Weiß-Bild lehnt vor den Büchern, es zeigt den Widerstandskämpfer Friedrich Justus Perels, einen engen Freund Dietrich Bonhoeffers, 1937 heiter auf einem Wanderausflug mit Schülern. Auch Perels, der kurz vor Kriegsende von der SS erschossen wurde, war in der demokratischen Weimarer Zeit hier in diesem Gebäude zur Schule gegangen. Es ist eine freundliche, aber durchaus auch offizielle Atmosphäre. Das ist beabsichtigt, denn dies ist ein traditionsreiches Amtszimmer. Es atmet Geschichte.
Aber «3 × 9» ist keine schwere Frage. Man muss wissen, unsere Schulbewerber kommen aus der sechsten Klasse. In Berlin, das ist eine Besonderheit, dauert die Grundschule nicht vier, sondern sechs Jahre. Das ist keine Neuerung der letzten Jahre, sondern war eine Nachkriegsentscheidung – 1951 wurde es im Westberliner Schulgesetz so festgelegt. Ein Reformschritt, der in gewisser Weise seiner Zeit voraus war. Die Idee schon damals: Die Schülerinnen und Schüler sollten länger zusammen lernen, bevor sich ihre Bildungswege trennen. Man reagierte damit auch auf die Schulpolitik Ostberlins, wo alle ja noch länger gemeinsam lernten. Es sitzen vor mir also Elf- und Zwölfjährige, die sich nun mit einer einfachen Rechnung herumschlagen. Sollten sie nach der zehnten Klasse die Schule verlassen und eine Lehre beginnen, dann haben sie jetzt schon fast sechzig Prozent ihrer Schulzeit hinter sich.
«3 × 9», eigentlich müsste die Antwort prompt folgen. Bei einem Drittel unserer Anwärter klappt das auch. Aber für die anderen ist diese Aufgabe kaum zu lösen. Es wird geraten, getippt, behauptet, entschuldigt, geschwiegen, es werden die Finger zu Hilfe genommen, es wird an die Decke geschaut. Nach längerer Pause, mit viel Anstrengung und einigen Fehlversuchen kann meist ein weiteres Drittel eine korrekte Antwort geben: 27. Es gibt keine andere. Da kann man sich nicht rausdiskutieren. Vom letzten Drittel kommt nichts. Die haben wirklich überhaupt keine Ahnung, wie die Lösung lauten und wie sie zu ihr gelangen könnten.
Es fehlen die Grundlagen
Jetzt kann man natürlich mit dem Kopf schütteln und sich denken, der Mann übertreibt. So schlimm kann es nicht sein. Womöglich hat man selbst Kinder und erinnert sich vergnügt an lange Urlaubsfahrten im Auto, wo das Einmaleins wie ein Quizspiel geübt wurde. Denkt an Karteikarten, Computerlernspiele, kleine Belohnungen. Oder das Kind hatte tollen Unterricht in der Schule, das Einmaleins wurde immer wieder wiederholt, bis es saß. 3 × 9? Wer bitte soll das am Ende der sechsten Klasse nicht flott lösen können?
Die Antwort ist einfach: diejenigen, die es nicht genügend eingeübt haben. Das Einmaleins ist ja eine sehr alte Rechenmethode. Schon die Ägypter der Pyramidenzeit konnten multiplizieren. Wir haben also Tausende Jahre pädagogischer Erfahrung, wie man es lernt. Und offenbar wurde bislang nur eine einzige funktionierende Methode gefunden, nämlich: sich hinzusetzen und zu büffeln. Erst verstehen, dann üben und wiederholen, bis es sitzt. Denn das kleine Einmaleins ist eine mathematische Grundlage, ohne die kein Schüler an einer weiterführenden Schule auskommt. Es gehört zum mathematischen Alphabet, egal welcher Abschluss angestrebt wird, egal wie er im jeweiligen Bundesland heißt: Hauptschulabschluss, Berufsbildungsreife, MSA, Mittlere Reife, Abitur. Wer das kleine Einmaleins nicht beherrscht, gerät ins Hintertreffen. Und die wenigsten haben eine Familie zu Hause, in der so etwas in der Freizeit geübt wird. Offenbar hat auch nicht jeder einen Unterricht gehabt, in dem dieses Manko ausgeglichen wurde.
Es fehlt unseren Schülern an Grundlagen. Das liegt nicht an den Schülern, denn die sind nicht unbegabter oder gar dümmer als frühere Generationen. Es liegt an der Schule, wenn in vielen Bereichen, nicht nur in der Mathematik, bei ganz einfachen, aber fundamentalen Dingen versagt wird. Unsere neuen Siebtklässler, die zu uns kommen, wissen häufig kaum, wie man einen Hefter führt. Sie können nicht mit einem langen Lineal umgehen, haben Schwierigkeiten, einen rechten Winkel zu zeichnen, überhaupt sauber zu arbeiten. Sie haben nie gelernt, bei dem, was sie tun, sorgfältig zu sein. Einfache Aufgaben, wie ein Inhaltsverzeichnis anzulegen, überfordern sie. In dreißig Minuten bringen manche nur ein paar holprige Linien auf das Papier.
Es ist schwer, mitanzusehen, wie schnell einige beim Schreiben ermüden. Ein DIN-A4-Blatt soll mit Text gefüllt werden, mit jeder Zeile wird die Schrift mancher Schüler zittriger und gröber, so als hätten diese Jugendlichen einen Alterstremor. Dabei sind sie nur schlicht ungeübt im Schreiben, es fehlt ihnen die Feinmotorik. Was nicht weiter verwundert, denn viel zu häufig müssen Grundschüler in Arbeitsheften und auf Arbeitsblättern nur noch Lückentexte ausfüllen, also höchstens ein Wort, eine fehlende Endung oder wenige Silben schreiben. Ein Lückendiktat, bei dem nur Leerstellen gefüllt werden müssen, sei für «schwächere Schreiberinnen und Schreiber» besonders fair, heißt es in einer Empfehlung der Kultusministerkonferenz, weil «der Schreibaufwand begrenzt» sei. Oder man meidet das Schreiben gleich ganz und lässt einfach die richtige Antwort ankreuzen: A, B oder C. Niemand muss sich wundern, wenn dann in der siebten Klasse vielen unserer Schüler die Schreibpraxis fehlt. Das gilt übrigens genauso für das Lesen. Wer gut lesen will, muss anfangs üben, am besten täglich. Dann gelingt es später, auch längere, kompliziertere Wörter flüssig vorzulesen. Aber das wird zu selten getan.
Ob Sport, Erdkunde, Biologie, Chemie oder Englisch, überall fehlt die Basis. Es kommen Siebtklässler zu uns, die haben in Erdkunde niemals einen Atlas aufgeschlagen. Wenn sie Landkarten ausmalen sollen, sieht es so wild aus, als befänden wir uns in der Hochzeit des Expressionismus. Schüler tauchen auf, die im Naturwissenschaftsunterricht der fünften und sechsten Klasse nie von CO2 gehört haben, geschweige denn von Kohlenstoffverbindungen. Wir haben Zwölfjährige, die auch nach Jahren des Unterrichts keinen einfachen Satz in Englisch bilden können. In der Sportstunde haben die Sportlehrer aufgehört, eine Rolle vorwärts von den Schülern zu fordern – zu viele schaffen sie nicht mehr, von der Rolle rückwärts ganz zu schweigen. Biologie-Lehrblätter, die noch in den 90er Jahren in der Hauptschule bearbeitet wurden, wären heute bei uns selbst in der zehnten Klasse undenkbar: zu komplex. Und in unseren Werkstattkursen, in denen die Klasse an Bohrmaschinen und Kreissägen steht, um etwas herzustellen, haben die Pädagogen inzwischen Angst um die Gesundheit ihrer Schüler, weil ihre Feinmotorik zu schlecht ausgebildet ist und die Konzentration zu schnell nachlässt.
Nochmals: Den Schülern werfe ich das nicht vor, an ihnen liegt es nicht. Seit über vierzig Jahren arbeite ich als Lehrer, seit vielen Jahrzehnten auch als Schulleiter, und ich durfte in den vielen Jahren Tausende Schüler kennenlernen. Meiner Erfahrung nach gibt es heute wie damals kaum Schüler, die nicht das Zeug dazu haben, am Ende einen Schulabschluss zu schaffen. Aber sie können es nur schaffen, wenn bis zur zehnten Klasse zumindest die Grundlagen in den Kernfächern sitzen. Doch das tun sie oft nicht mehr. Die Folge ist: Wir weichen die Standards auf, senken das Niveau der Abschlussprüfungen. Auch das gilt für alle Schulformen, sogar für das Abitur.
Es ist wie mit der Handschrift. Wenn Schüler nicht flüssig schreiben können, wenn das Schriftbild katastrophal ist, dann empfiehlt die moderne Pädagogik: Reduzieren wir einfach die Schriftanteile im Alltag und in den Prüfungen, damit es die Schwächeren leichter haben. Der bessere Weg wäre aber zu sagen: Lasst uns mit den Schülern so lange üben, bis sie in der Lage sind, problemlos zu schreiben. Dafür müssten die Schüler aber bereit sein, zu lernen und sich anzustrengen. Und wir als Pädagogen müssten ihnen auch mal im Nacken sitzen und sie fordern. Damit sie auf längere Sicht erleben, wozu sie fähig sind. So wie es jetzt oft zugeht, lernen sie lediglich: Ich kann es einfach nicht.
Das breite Versagen der Schule
Es gibt genügend Untersuchungen, die nachweisen, dass unsere Schüler auch in normalen Schuljahren ohne pandemiebedingten Unterrichtsausfall in der Breite zu wenig lernen. Zuletzt bescheinigte der IQB-Bildungstrend von 2018 – IQB steht für «Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen» –, dass es um die mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen der Neuntklässler in diesem Land nicht gut steht. Getestet wurden bundesweit 44 941 Schüler dieses Jahrgangs durch alle Schulformen hindurch, per Zufallsprinzip ausgewählt. Die nur scheinbar gute Nachricht: Deutschlandweit erreichten durchschnittlich fast fünfundvierzig Prozent einen mathematischen Regelstandard oder besser. Regelstandard wird von der Kultusministerkonferenz (KMK) als das definiert, was an Leistung von Schülern zu diesem Zeitpunkt eigentlich zu erwarten sein sollte – unser Bildungsstandard also. Die Schüler müssen in diesem Moment der neunten Klasse noch nicht alles wissen, sie haben ja noch ein Jahr bis zum Mittleren Schulabschluss. Aber sie sollten schon eine bestimmte Zwischenetappe erreicht haben. Wer unter dem Regelstandard liegt, erfüllt lediglich den Mindeststandard oder dümpelt gar in der Kategorie «unter Mindeststandard». Und das ist die schlechte Nachricht. Denn im letzten Bildungstrend blieben also bundesweit fünfundfünfzig Prozent der getesteten Schüler unter dem Regelstandard, rund vierundzwanzig Prozent erreichten noch nicht mal den Mindeststandard.
Noch bedrückender: Das ist der Bundesdurchschnitt, eine Zahl, die nur bedingt die Realität in vielen Bundesländern widerspiegelt. Denn das Gefälle zwischen den Bundesländern ist groß. Während in Sachsen und Bayern über die Hälfte der Schüler mindestens den Regelstandard erreichte, gelang das in Bremen nur knapp neunundzwanzig Prozent der getesteten Schüler. Nicht viel besser war das Ergebnis im Saarland, in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Man muss sich das sehr klar verdeutlichen: Sechzig bis siebzig Prozent der Schüler schaffen es in diesen Bundesländern nicht, eine «durchschnittliche» Leistung zu erreichen, die zu diesem Zeitpunkt von ihnen erwartet werden kann. Denn der Mindeststandard ist lediglich, laut IQB, «ein definiertes Minimum an Kompetenzen». Wer also «unter Mindeststandard» – in Bremen vierzig Prozent, in Berlin vierunddreißig – bleibt, verfügt noch nicht mal über ein Minimum von Wissen. Da bleibt nicht viel.
Und es lohnt sich, noch genauer hinzuschauen. Denn die besseren Zahlen werden hauptsächlich von einem Schultyp gespeist: dem Gymnasium. Deren Ergebnisse aus dem Bildungstrend werden separat aufgeführt. Schaut man sich nun die gymnasialen Zahlen an, so haben plötzlich im Bundesdurchschnitt über achtzig Prozent der getesteten Schüler in Mathematik den Regelstandard, Regelstandard plus oder gar einen Optimalstandard erreicht. Interessanterweise gibt es auch hier eine unglaubliche Spanne zwischen den einzelnen Bundesländern. Während in Sachsen und Bayern über neunzig Prozent der getesteten Gymnasiasten im Mittel- und Spitzenfeld liegen, sind es in Bremen und Berlin lediglich rund sechsundsechzig Prozent. Die Studie spricht offen aus, dass sich auch für Deutschlands Gymnasien eine «ungünstige Entwicklung» abzeichne, sowohl in Mathematik als auch in den naturwissenschaftlichen Fächern Chemie, Physik und Biologie. Denn die Spitzenleistungen nähmen zunehmend ab. Aber insgesamt scheint der Bundesdurchschnitt von einundachtzig Prozent der gymnasialen Neuntklässler, die einigermaßen Ahnung von Mathe haben, beruhigend hoch.
Doch was heißt das für die restlichen weiterführenden Schulen, wenn die starken Zahlen eigentlich nur von einer Schulform zu kommen scheinen? Im vierhundertfünfzig Seiten starken IQB-Bericht des Bildungstrends sucht man vergeblich nach einer Tabelle, in der nur Ergebnisse weiterführender Schulen ohne die Gymnasiasten aufgelistet werden. Es gibt sie nicht. Das wird damit begründet, dass das Gymnasium die einzige Schulform sei, die in allen Bundesländern einheitlich existiere. Deshalb könne man dort problemlos deutschlandintern vergleichen. Tatsächlich findet man bei den anderen weiterführenden Schulen ein buntes Sammelsurium vor, jedes Bundesland hat da ein anderes Konzept. Von der traditionellen Haupt- und Realschule über die Werkrealschule, Sekundarschule oder Regionalschule bis hin zur Stadtteilschule und Oberschule. Aber trotzdem frage ich mich: Wo liegt das Problem, auch diese Zahlen zu errechnen? Vermutlich darin, dass die Ergebnisse für alle anderen weiterführenden Schulen, rechnet man einmal die Gymnasiasten heraus, so ernüchterten, dass die Zahlen öffentlich nur noch schwer vermittelbar wären.
In der letzten PISA-Studie von 2018, als Deutschland wieder im Ranking irgendwo im Mittelfeld der OECD-Staaten dümpelte, fanden sich im Bericht aufschlussreiche Balkendiagramme zu den Kompetenzstufen fünfzehnjähriger deutscher Schüler in Mathematik und Naturwissenschaften. Die sieben Balken der nicht gymnasialen Schularten sind dort hellblau, die sieben des Gymnasiums dunkelblau gekennzeichnet. Würde man die farblich zusammengehörigen Balken an der Spitze miteinander verbinden, so käme jeweils eine Parabel heraus – Aufstieg, Scheitelpunkt, Abfall. Allerdings liegen die beiden Parabeln verschoben voneinander, die Schnittmengen sind klein. Während das Gymnasium eindrücklich und fast ausschließlich den Bereich der sehr soliden und sehr starken Leistungen abdeckt, finden sich alle anderen Schultypen im Zentrum des schwachen und schwächeren Bereichs. Auch bei der Lesekompetenz erreichen die Gymnasialschüler im PISA-Test 2018 deutlich mehr Punkte als die Schüler nicht gymnasialer Schularten. «Die Differenz zwischen den beiden Gruppen in Höhe von 120 Punkten entspricht einem Lernunterschied von geschätzt drei Schuljahren», schreibt der Pädagoge Werner Klein, der beim Sekretariat der Kultusministerkonferenz die Abteilung Qualitätssicherung leitet. Knapp dreißig Prozent dieser Schüler bewegten sich an den weiterführenden Schulen lesend weiterhin auf Grundschulniveau. In diesem Land stimme etwas nicht mit der Bildungsgerechtigkeit, folgert Klein. Zu viele Schüler bleiben weit unter ihren Möglichkeiten.
Das lässt sich in den einzelnen Bundesländern auch ganz konkret mit Prozentzahlen unterlegen. So wurden 2015/16 Berliner Achtklässler mit VERA 8 – was wie ein weiblicher Vorname klingt, ist die Abkürzung für «Vergleichsarbeiten» – auf ihre, wie es heute gerne heißt, «Kompetenzen» getestet. Die Teilnahme an diesen Vergleichstests ist an allen öffentlichen Schulen der Stadt verpflichtend. In Berlin werden zwei Versionen dieser Testhefte ausgegeben: eine schwerere für die Gymnasien, eine leichtere für alle anderen weiterführenden Schulen, die ja vom überwiegenden Teil der Hauptstadtschüler besucht werden. Das Ergebnis bei der leichteren Version? In Mathematik erreichten damals achtundsechzig Prozent der getesteten Achtklässler nicht einmal die Mindestanforderungen, blieben also unter dem Mindeststandard. Seitdem werden die VERA-8-Ergebnisse in Berlin wohlweislich unter Verschluss gehalten. Allerdings legte eine Expertenkommission für Schulqualität, die zuletzt in der Hauptstadt eilig einberufen worden war, um das Bildungsniveau in Berlin irgendwie anzuheben, im Herbst 2020 offen, wie es genau mit diesen Schülern weiterging: «Bei der Prüfungsarbeit zum Mittleren Schulabschluss erreichten im Fach Mathematik in 2018 mehr als vierzig Prozent der Schülerinnen und Schüler der Integrierten Sekundarschulen und der Gemeinschaftsschulen nur die Note mangelhaft oder ungenügend.» Kein Wunder.
Auch in anderen Bundesländern sieht es an den weiterführenden Schulen – mit Ausnahme der Gymnasien – kaum besser aus. Als 2019 die baden-württembergischen Achtklässler von Haupt- und Werkrealschulen mit VERA 8 auf ihre mathematischen Kenntnisse geprüft wurden, lagen fast achtzig Prozent unter dem Regelstandard speziell für ihren Schultyp, knapp die Hälfte davon hatte dabei noch nicht einmal den Mindeststandard für einen Hauptschulabschluss geschafft; und auch an den klassischen Realschulen blieben noch sechsundsiebzig Prozent der Schüler unter dem Regelstandard, den man erreichen sollte für einen späteren Mittleren Schulabschluss. Die Gemeinschaftsschulen, an denen ja gemeinsam gelernt wird, gaben ebenfalls ein sehr durchwachsenes Bild ab –nur vierzehn Prozent schafften hier den Regelstandard oder mehr für einen Mittleren Schulabschluss. Nicht besser im Norden. Dreiundsechzig Prozent der Achtklässler in Hamburger Stadtteilschulen erreichten 2017 nicht den Mindeststandard in Mathematik, als es um das Ziel Mittlere Reife ging. In Schleswig-Holstein erbrachten die Ergebnisse der Vergleichsarbeit VERA 8 in 2019, dass an den weiterführenden Schulen ohne Gymnasium in Mathematik die Gruppe der «Risikoschüler oder potenziellen Risikoschüler» bei fast fünfzig Prozent liegt, wenn die einen «Ersten Allgemeinbildenden Abschluss» anstreben, sprich: den Hauptschulabschluss. Geht es dagegen um den Mittleren Schulabschluss, wächst die Gruppe der Schüler, die nicht den Regelstandard erreichen, auf neunundsiebzig Prozent an. Das heißt, nur rund zwanzig Prozent dieser Schüler lagen zu dem Zeitpunkt im grünen Bereich – ganz anders als an den Gymnasien dort oben im hohen Norden, wo trotz schwererer Aufgaben im Testheft fast achtzig Prozent den Regelstandard in Mathematik oder besser schafften. Und auch in Deutsch – im Lesen, Textverständnis oder Orthographie – sind die Werte für Schüler weiterführender, nicht-gymnasialer Schulen in den einzelnen Bundesländern ernüchternd.
«Wir wissen, dass eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Schülern die Bildungsstandards nicht erreicht», räumte Ilka Hoffmann, Hauptvorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, in einer VERA-kritischen Broschüre ein. Um aber gleich danach die verpflichtenden Vergleichstests für Kinder und Jugendliche zu verdammen, weil die doch wieder und wieder nur die gleiche Bildungsmisere belegten. Diese Tests, denen sie vorwirft, zu wenig auf die Vielfalt im Klassenzimmer einzugehen, trügen ja nichts zur Lösung bei. Unzählige Runden dieser Tests hätten nur «reines Beschreibungswissen» geliefert, würden von vielen Pädagogen nicht als «nützliche Unterstützung» gesehen, sondern als unangenehmes «Kontrollinstrument» empfunden. Und sie plädiert deshalb für eine freiwillige Teilnahme an den Vergleichsarbeiten. Tatsächlich führt Niedersachsen seit dem Schuljahr 2019/20 keine Vergleichsarbeiten mehr durch, mit dem Argument, man wolle Lehrerinnen und Lehrer von der Mehrarbeit entlasten. Dass danach in dem Schuljahr die Kultusministerkonferenz die VERA-Teilnahme im April für alle Bundesländer von «verbindlich» auf «freiwillig» setzte, hatte mit den Schulschließungen aufgrund der Corona-Pandemie zu tun – so ging Niedersachsens radikaler Schritt quasi unter, blieb fast unbemerkt. Doch es ist noch nicht zu Ende. Im Schuljahr 2020/21 steigen noch zwei weitere Länder teilweise oder ganz aus der Vergleichsarbeiten-Pflicht aus: Bremen und Brandenburg. Offizielles Argument auch hier: «Entlastung der Schulen». Nun gelte es erst mal, den verpassten Stoff aufzuholen. Das scheint wichtiger, als sich ein Bild vom Leistungsstand der Schüler im jeweiligen Bundesland zu machen.
Dabei entstanden diese ursprünglich verpflichtenden Tests als Reaktion auf den PISA-Schock um das Jahr 2000. Damals war der Aufschrei groß. Fast jeder vierte Fünfzehnjährige, so hatte die Studie festgestellt, könne in Deutschland nicht richtig lesen. Auch Mathematik sei schwierig, ein Viertel der Fünfzehnjährigen könne höchstens auf Grundschulniveau rechnen. Weiter hieß es, die «Leistungsstreuung» zwischen den sehr starken und sehr schwachen Schülern sei in Deutschland relativ groß. Die «mittlere Leistung», das Mittelfeld also, sei dagegen nur schwach besetzt. Ein Viertel der jugendlichen deutschen Schüler also eine Risikogruppe? Das durfte nicht sein.
Ein Fokus nach dem PISA-Schock lag also auf der Schulqualität. Vergleichsarbeiten für Dritt- und Achtklässler wurden nun verpflichtend eingeführt, um eine Art Frühwarnsystem im Klassenzimmer zu haben. Und dieses Frühwarnsystem schlägt seitdem lautstark an. Die Verantwortlichen dieser Vergleichsarbeiten schreiben über die Risikogruppe jener Schüler, die im Test noch nicht mal die Mindestanforderungen erreichen, ihnen fehlten «basale Kenntnisse». Konkret heißt das bei einem Drittklässler, dass sie oder er nicht die notwendigen Grundkenntnisse hat, «um den erfolgreichen Übergang von der Grundschule in eine weiterführende Schule zu bewältigen». Und den Achtklässlern? Fehlt, laut Institut für Schulqualität, das Rüstzeug, «um ein selbstbestimmtes und beruflich erfolgreiches Leben bestreiten zu können».
Machen wir uns nichts vor: Es ist schwer, diese Wissenslücken noch in der kurzen verbleibenden Zeit zu schließen, fast unmöglich. Wie sollen Schülerinnen und Schüler, denen offensichtlich die Basis fehlt, in ein, zwei Jahren lernen, was in den vorherigen drei oder acht Jahren versäumt wurde? Und das zusätzlich zu dem neuen Stoff! Es fehlt an den weiterführenden Schulen, wenn sie kein Gymnasium sind, innerhalb des Leistungsspektrums der Schüler ein stabiles, größeres Mittelfeld, das zumindest den Regelstandard erreicht. Aber nicht nur dort. Das Drama beginnt schon in den Grundschulen.
Wenn wie in Berlin zuletzt, 2019, knapp dreißig Prozent der Drittklässler in Lesen, Zuhören und Rechnen noch nicht mal die Mindestanforderungen packen und weitere gut fünfundzwanzig Prozent auch nicht den Regelstandard erreichen, sollte man denken, es bricht Panik aus. Denn über die Hälfte der Berliner Grundschüler liegt damit unter dem Regelstandard, statt Mittelfeld haben wir eine riesige Gruppe unterdurchschnittlich ausgebildeter Drittklässler – die Mehrheit der Schüler. Offenbar ist seit dem PISA-Schock nichts besser, im Gegenteil, die Schulqualität ist schlechter geworden. Um beim Bild des Frühwarnsystems zu bleiben: Wir haben Alarmstufe Rot.
Das Theater mit der Schulinspektion
So weit, so eindeutig. Jetzt aber wird es kompliziert – denn häufig scheint Leistung in der Pädagogik nur noch eine Nebenrolle zu spielen. Das mussten wir als Friedrich-Bergius-Schule selbst schmerzhaft erfahren. Bei uns steht sie eindeutig im Mittelpunkt, wir wollen, dass unsere Schüler in den vier Jahren bei uns etwas lernen. Es ist ja eine eher kurze Zeit, die wir haben. Bei vielen müssen wir in der siebten und auch achten Klasse Stoff nacharbeiten, den sie eigentlich schon aus der Grundschule kennen sollten. Das kostet Zeit und erfordert viel Konzentration.
Deshalb ist der Unterricht bei uns klar organisiert, die Lehrer leiten an, geben vor. Wenn es möglich ist, teilen wir unsere Klassen, damit die Lerngruppen kleiner werden und wir noch gezielter Schüler unterstützen können. Es gibt einfache Rituale bei uns, die helfen, eine gute Arbeitsatmosphäre herzustellen. So stehen am Beginn jeder Stunde alle Schüler auf, man begrüßt sich mit einem «Guten Morgen». Dadurch ist klar: Jetzt beginnt der Unterricht. Das Arbeitsmaterial, Hefte und Stifte, liegen schon vorbereitet auf dem Tisch. Eine Schülerin oder ein Schüler fasst anfangs das Gelernte der letzten Stunde kurz zusammen, dann geht es weiter im Stoff. Wir glauben an Übung und Wiederholung, sehen auch in Hausaufgaben einen Sinn. Einfach gesagt: Unser Unterricht ist bewusst traditionell.