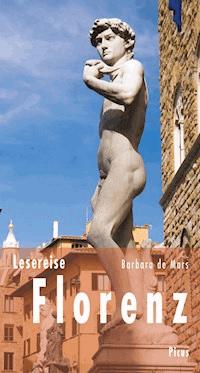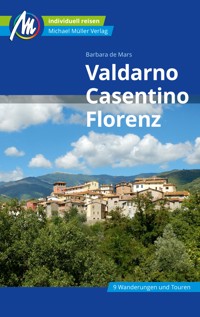Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zu Fuß durch die Toskana und bis nach Assisi in Umbrien, auf den Spuren und zu den Lebens- und Wirkorten großer Maler, von Giotto über Masaccio und Piero della Francesca, bis hin zu Leonardo da Vinci, Pontormo und Michelangelo Buonarroti. Mit einer Frage: Wie nahmen diese Maler ihre Umwelt wahr, warum bildeten sie die Welt so ab, wie sie es taten? Die Konstruktion von Welt, auch im Spiegel der Auseinandersetzung mit unserer heutigen Gesellschaft und ihren Werten. Eine Aufzeichnung dreier Jahre. Ein Ergehungsbericht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für A. und S.
Niente
Prolog
«Salvatico è quel che si salva»
Der Wilde wird sich retten
Leonardo da Vinci
„Niente“ (Nichts). So begannen Italiener gern ihre Rede, was mich immer irritierte. Wer nichts zu sagen hatte, mochte es gleich bleiben lassen. Aber nun war ich es, die vor dem leeren, weißen Blatt Papier saß. Hatte es irgendeinen Sinn, meine Wahrnehmungen niederzuschreiben? Verbarg dieses weiße Nichts etwas, das zum Vorschein kommen wollte, zwingend kommen musste?
Niente.
Zugegeben, anfangs hatte ich Angst. Vor dem Unsichtbaren, das im Kopf dröhnte, vor dem grauen Ungewissen, das auf der Haut stach wie tausend Nadeln. Angst vor Krankheit, Schmerzen und Tod. Davor, die ich liebte nicht schützen zu können und das Leid anderer mit ansehen zu müssen. Angst vor dem Unfassbaren, dem Ungesagten und am meisten Angst vor mir selbst und dass ich der Situation nicht gerecht wurde. Wie eine Wolke legte sie sich um meine Stirn, drückte die Gedanken nieder und machte sie eng und klein, bis mir die Luft wegblieb. Sie kam, als das Virus von China nach Norditalien schwappte. Plötzlich war die Gefahr nah und die Kamerabilder schienen echter als noch wenige Wochen zuvor. Nur die Bergkette des Apennins, der Wirbelsäule Italiens, lag noch zwischen dem Virus und mir. In diesem historischen Moment durchdrangen sich Raum und Gefühl. Es schien mir, wie Platon es im „Timaios“ ausdrückte, dass „Chora“ – der Ort und die Amme des Werdens – gerade eine neue Welt hervorbrachte. Und Italien entpuppte sich wieder einmal nicht als Rückgrat, sondern – um mit Churchill zu reden – als „weiche Wampe“ Europas. Doch ich muss noch weiter ausholen.
Die ersten Jahre des neuen Jahrtausends waren gleichförmig und unaufgeregt verflossen. Jeder kümmerte sich um das eigene Wohlergehen und auch ich hatte es eilig mit dem Fortkommen. Wobei in dem Wort bereits eine fahrlässige Verdrängung der Gegenwart lag, denn warum wollte ich sonst fort?
Vor der Terrasse meines Hauses verschwand die Wiese, als man begann, dort Reihenhäuser zu errichten. Die Nachbarn kauften sich keine Autos mehr, sondern mieteten sie. Zuerst waren sie gasbetrieben und in jüngerer Zeit dann bisweilen aus der Steckdose. Meiner Freunde Gesichter wurden reifer und die Falten gruben sich tiefer, bis sie aussahen wie getrocknete Pflaumen. Wenn ich in den Spiegel blickte, sah ich mich darin genauso. In Wahrheit gab es kein Fortkommen, ich trat auf der Stelle.
Nun, ein paar Signale, dass etwas grundsätzlich falsch lief, waren mir schon aufgefallen. Zunächst schienen es nur kleine Brüche im Spiegel, die das Bild unschön verzogen, aber kein neues entstehen ließen. Immer häufiger und in immer kürzeren Abständen biss sich die Erinnerung an den Brüchen fest. So lange, bis ich anfing Worte zu suchen für das, was meine Wahrnehmung dergestalt stolpern ließ. Das war zur Zeit der großen Krise 2008.
Die Kooperative, welche die Reihenhäuser vor meinem Haus baute, war pleite und die Arbeiten standen still. Im Dorf lieferten sich die Alten der Kommunistischen Partei und die Epigonen von Berlusconis „Forza Italia“ immer seltener hitzige Diskussionen. Man brauchte die Streithähne jetzt nicht einmal mehr räumlich zu trennen wie noch in den vergangenen dreißig Jahren. Die „Casa del Popolo“ an der Piazza gab auf und machte zu. Ihr konservatives Pendant ACLI, die Christliche Vereinigung der italienischen Arbeitnehmer gleich neben der tausend Jahre alten Pfarrkirche, baute seine Küche aus und wandelte sich zur Pizzeria. Die Gemeinde rief Wettbewerbe für ihre Bürger aus, im Frühling, wer das schönste Blumenbeet richtete und zu Weihnachten um den üppigsten Lichterschmuck im Vorgarten. Die Banalität der Wirklichkeit kotzte mich an. „Austerità“ nannte man den wirtschaftlichen Sparkurs nach der großen Finanzkrise. Die Europäische Union verordnete ihn dem Land, damit es seine Schulden abbaute. Aber verschlossen wie Austern wurden auch die Menschen. Nun behielt man die eigene Meinung besser für sich, denn an den politischen Entscheidungen der jeweiligen Regierung würde sich eh nichts ändern. Die Lage wurde mit jedem Jahr schlimmer und die Leute grauer.
Als ein Komiker aus Protest gegen die etablierten Parteien die Fünf-Sterne-Bewegung gründete, bäumten die Unzufriedenen sich ein letztes Mal auf, doch auch die Sterne verloschen am Himmel der ganz großen Interessen. Übrig blieb nur eine sprachlose Stille und am lautesten schwiegen die Medien. Etwas, das noch nicht benennbar war und doch alles ausbremste, lastete auf dem Land. Und es kam noch schlimmer.
Auf den Bahnsteigen standen die Menschen vereinzelt wie Pilze und starrten auf ihre Handys. Sie grüßten einander kaum mehr, redeten nicht mehr mit Fremden und nahmen wenig Anteil an ihrer Umwelt. Die Neugierde verblühte, was bei den Jugendlichen besonders ins Auge fiel. In Restaurants unterhielten sich die Familien am Tisch nicht mehr miteinander, sondern gierten nur noch nach Kontakt mit der äußeren Welt oder stellten die Kinder mit Spielen an den flachen Scheiben ruhig. Gegenwart setzt ein „Hic et Nunc“ voraus und genau dieser Moment, wenn sich das Jetzt am Hier rieb und einen eindringlichen Augenblick Gegenwart schöpfte, wurde zerstört, indem man sich ins Netz einspeiste. Das „Gegen-“ der Gegenwart war nun nicht mehr präsent, sondern im tauben Telefon oder sonstwo in den Wolken. Während die Gabel die Pasta drehte, schwiegen Paare und Familien einander an, denn der Sinn ihres Tuns war ausgelagert und sie nurmehr ein Abziehbild ihres eigenen Lebens. Platons Höhlengleichnis kam mir in den Sinn und ich empfand eine große Sehnsucht, auszubrechen und die Realität und das Leben zu schauen.
Es war auch eine Sehnsucht nach Erkenntnis. Dante Alighieri, der sich viel mit der italienischen Sprache beschäftigt hatte, erfand immer wieder neue Worte, die mit der Vorsilbe „in-“ begannen und bedeuteten, dass der Italiener sich in eine Angelegenheit hineinschmiss und -wühlte, sich mit ihr identifizierte. Der Deutsche hatte demgegenüber das „er-“ und erfuhr, erkundete und erlebte. Für mich war das eine Bewegung, die von außen bedächtig die Ränder abzirkelte und dann langsam ins Innere vordrang. Es waren zwei unterschiedliche Arten, sich auf die Welt einzulassen. Irgendwie gefiel die italienische mir besser.
Dann kam das Virus und anfangs hatte auch ich Angst. Der Januar war kalt und im Februar das Wetter oft herrlich. Nun schwiegen die Medien nicht mehr, sondern schrieben, hauptsächlich Zahlen, die täglich stiegen und mit ihnen kletterte die Angst. Es entstand das Phänomen der „öffentlichen Meinung“, die keinen Plural kannte. Mit ihr kam das erste englische Wort: „Lockdown“.
Was nun geschah, konnte ich nicht wirklich begreifen und vielleicht blieb es mir deshalb fremd und ich begann alles wie von außen zu betrachten, ganz so, als beträfe es mich nicht. Ich erinnerte mich an andere Anlässe von großer Tragweite, die ich ähnlich empfunden hatte. In der Kindheit die autofreien Sonntage und in der Jugend die erste Uhrumstellung auf die Sommerzeit. Willentlich politisch herbeigeführte Ereignisse, die die gesamte Gesellschaft betrafen und deren Konsequenzen nicht absehbar waren. Der Lockdown begann Anfang März.
Das Wetter war noch schöner und mittlerweile auch wärmer als im Februar und die Vögel begannen zu zwitschern und die Amseln überquerten liebestrunken und unbedacht die Straßen. „Social distancing“ war der zweite englische Ausdruck und die Menschen standen in Schlangen vor den Supermärkten und hielten einen Meter achtzig Abstand, setzten Masken auf und zogen Plastikhandschuhe über, um keine Keime einzufangen oder zu übertragen. Dann ereignete sich Bergamo und Bilder von Militärlastwagen, die Leichen transportierten, flimmerten über die Bildschirme. Von dem Moment an blieben die Leute zuhause und desinfizierten häufig die Hände. Ich besaß keinen Fernseher und nahm jene Bilder nur am Rande wahr. Anfangs hatte es mich wie in einem Sog zu den anderen Menschen gezogen, um es ihnen gleichzutun. Doch in den folgenden Wochen geschahen drei Dinge, die dafür sorgten, dass ich zu anderen Schlüssen kam als die meisten.
Das erste Ereignis geschah in jenen Wochen, als alle in Metaphern sprachen und schrieben, als seien sie im Krieg. Eines Tages begannen städtische Reinigungskräfte in weißen Ganzkörper-Schutzanzügen mit langstieligen Sprühvorrichtungen die Dorfstraßen zu desinfizieren. Der Anblick schien mir surreal und ich hielt ihr Tun für gänzlich aussichtslos. Das zweite Vorkommnis war an dem Tag, als ich wieder einmal allein für mich durch den Wald spazieren ging. Das war schon während des Lockdowns und dementsprechend hatten die Behörden streng untersagt, in die Natur zu gehen. Kein menschliches Geräusch drang an mein Ohr, kein Rauschen der Autobahn, kein Laubbläser und keine Motorsäge. Eine nie empfundene, tiefe Ruhe streckte sich über das Land. Vorwitzige Krokusse und spontane Veilchen begleiteten mich entlang des Wegs. Die eleganten Blüten der Obstbäume explodierten in weißen, rosa und roten Schattierungen und die Mimosen prusteten los in kräftigem Gelb. Als ich so für mich in der Stille ging, begriff ich, dass das Leben stärker war als alle Angst. Wenngleich ein Bekenntnis zum Leben auch schiefgehen konnte. Tatsächlich gab es im April noch einmal eine eisige Nacht und ließ die Blüten von Aprikosen und Oliven sowie die Reben erfrieren. In diesen Wochen des Lockdowns sah ich, wie im Grunde alles Sein ein Sprung ins Ungewisse war. Nur Vertrauen in die Natur und ins eigene Ich als ein Teil von ihr konnten den Graben überwinden, den die Angst vor dem Nicht-Sein gerissen hatte. Auf meinen verbotenen Spaziergängen erkannte ich das Wagnis, das in jedem Ding lag und den Mut als elementaren Wert. Erst jetzt begann ich langsam zu begreifen, wie zentral der Begriff der Verantwortung war. Das Wort selbst erzwang die Antwort, die in ihm steckte.
Den Ausschlag gab dann ein drittes Moment, und zwar, als ich ein Kleinkind im Kinderwagen sah. Reglos lag es da, vor dem Gesicht eine Maske, die beinahe noch seine Augen bedeckte. Nach allem, was ich wusste und empfand, galt mir das Leben am meisten zu schützen, welches sein gesamtes Potential noch unentfaltet in sich barg. Es war bereits bekannt, dass Kinder selten erkrankten und wenn, so doch kaum schwer. Trotzdem wurden sie im Laufe der Zeit immer unbedingter gezwungen, stundenlang Masken zu tragen und regelmäßig medizinische Eingriffe zuzulassen oder gar selbst anzustellen. Schnell lernten die Kleinen, ihren Kameraden genauso zu misstrauen wie dem eigenen Körper. Es wurde ihnen verboten, auf den Spielplatz zu gehen und sich mit anderen zu treffen. Anstatt ein Beispiel zu geben und das Risiko auf sich zu nehmen, argumentierten die Erwachsenen, die Kleinen könnten für den Tod der eigenen Großeltern verantwortlich sein. Hier war für mich die Linie überschritten. Den Kindern solche Schuldgefühle aufzubürden, war ich nicht bereit mitzumachen. Währenddessen ließ man trotz vieler Beteuerungen Schwache und Alte allein und viele starben einsam und ohne Würde und Beistand. So zogen die Wochen und Monate vorbei. Bereitwillig und pflichtbewusst kamen die Kinder den Forderungen der Erwachsenen nach, denen sie schließlich vertrauten, aber ihre Gesichter wurden immer trauriger. „Pandemie“ war wahrlich treffend für das, was passierte, denn „pan“ stand für „ganz“ und „demos“ hieß „Volk“ und obwohl das Wort an sich nichts von einer Krankheit in sich trug, schien mir das ganze Volk siech. Oder große Teile davon. Ein Sommer und ein Herbst vergingen und im Winter verkündeten Politik und Medien einen großen Erfolg, den sie „Impfung“ nannten. Statt von Krieg sprach man nun vom Gemeinwohl. Zu dessen Gunsten sollte jeder nicht nur auf Freiheiten verzichten, sondern auch auf seine körperliche Unversehrtheit. Aber die meisten atmeten erleichtert auf, denn endlich gab es ein konkretes Ziel, das „Herdenimmunität“ hieß. Zunächst wurde einmal gespritzt und dann noch einmal und man hoffte inständig, dass das Virus nun verschwände, doch diesen Gefallen tat es den Menschen nicht. Da ergriffen Politiker und Experten das Wort und die Medien echoten es in die Welt: Es läge an denen, die sich sträubten. Umgehend richtete sich die Wut der Herde gegen die schwarzen Schafe.
Es war das zweite Jahr im Zeichen der Pandemie. In den folgenden heißen Monaten versuchten die einfachen Leute taumelnd, ihr emotionales Gleichgewicht und finanzielles Auskommen wiederzuerlangen. Auf dem Höhepunkt des Sommers trat eine neue Verordnung des Notstandsregimes in Kraft. Ab sofort durften Lokale, Museen und Hotels nurmehr von denen betreten werden, die gespritzt oder getestet und als „gut“ zertifiziert waren. Gut hieß in diesem Fall „negativ“, obwohl letzteres bisher eigentlich etwas ablehnte oder verneinte. Ich wunderte mich, wie schnell ein Wortsinn sich in sein Gegenteil verkehrte und fragte mich gleichzeitig, ob dies auf Dauer bestehen konnte. „Green Pass“ war der dritte englische Begriff, der über das Land hereinbrach und hier erst beginnt die eigentliche Geschichte.
WEGE UND GEDANKEN
In den Spuren der Wanderschäfer. Vom Casentino-Tal bis ins Chianti (100 Km)
Giotto und die Realität. Von Vicchio nach Vaglia (27 Km)
Masaccios neue Perspektive. Von Cascia nach Loro Ciuffenna (20 Km)
Dogmen und Glück. Von Loro Ciuffenna nach Arezzo (23 Km)
Piero della Francesca und die mathematische Welt. Von Arezzo nach Castiglion Fiorentino (12 Km)
Der Garten Gottes. Das Chio-Tal (16 Km)
Die „Italienische Zeit“, Garibaldi und Hannibal. Von Castiglion Fiorentino an den Trasimener See (21 Km)
Der Zusammenfall der Gegensätze. Leonardo da Vinci und Pontormo. Pontorme, Vinci, Carmignano bis nach Poggio a Caiano (ein wenig gemogelt 37 Km)
Michelangelo und der geheime Weg. La Verna, Compito und Chiusi della Verna (15 Km)
Francesco oder „Worfle nicht bei jedem Wind“. Valfabbrica bis Assisi (15 Km)
Vorige Seiten: Der letzte Teil unserer viertägigen Wanderung führt uns durch eben abgeerntete, ausgedehnte Weinberge des Chianti-Gebiets, bevor wir schließlich das turmbewehrte Monteriggioni erreichen.
1. In den Spuren der Wanderschäfer
Vom Casentino-Tal bis ins Chianti (100 Km)
Die hochsommerliche Luft war mit Wärme aufgeladen und auch nachts kühlte es nur wenig ab. Ein fürs andere Jahr konnte ich mir nicht vorstellen, dass dieser Zustand sich je ändern, dass ein Winter überhaupt wieder möglich sein würde. Ich dachte, es müsste immer so weiter gehen, ohne Pullover, in leichten Schuhen und ohne einen Gedanken der Vorsorge. Aber dann kam unweigerlich der Tag Anfang bis Mitte August, an dem wie die Italiener sagten „der Sommer brach“. Ausgelöst durch ein starkes Gewitter senkten sich abrupt die Temperaturen. Die fortan einsetzende morgendliche und abendliche Frische erinnerte die Weinbauern daran, dass die Rebenernte bevorstand und die Kinder, dass die Schule bald wieder anfing. Eine Membran war geplatzt und etwas Neues drängte ins Bewusstsein. Ab dem 6. August musste man den grünen Pass vorzeigen.
Mit ihm versuchte nicht zum ersten Mal in der Pandemie die Technik im Leben der Bürger zu ankern. Bereits im Jahr zuvor hätte eine viele Millionen teure Anwendung namens „Immuni“ dafür sorgen sollen, dass das Telefon warnte, sobald man sich zeitlich und räumlich nah bei jemandem aufgehalten hatte, der anschließend positiv getestet wurde. (Wie kompliziert die Angelegenheit war, ließ sich schon an der verschachtelten Grammatik des letzten Satzes erkennen.) Zeit, Raum und Personen mussten definiert werden und eine einzige Information sollte zeitlich versetzt, aber in der Sache verlässlich, Alarm auslösen. Interessant war, dass sich alles um Informationen und nicht etwa einen realen Zustand drehte. Der Warnruf „Achtung positiv“ sagte nichts aus. Nicht, ob die andere Person tatsächlich ansteckend war, ob sie gehustet hatte, ob nicht vielleicht eine Fensterscheibe die Leute trennte. Noch waren die Daten rudimentär, aber würde es einmal möglich sein, mithilfe von Informationen, die in eine Form gepresst wurden, Wirklichkeit zu erfassen und abzubilden und daraus sinnvolle Handlungen abzuleiten? Darüber wollte ich noch nachdenken. Aufgrund seiner Unzuverlässigkeit war „Immuni“ jedenfalls erst mal vom Tisch.
Nicht jedoch der Pass, der ausschließlich denen grünes Licht für alte Freiheiten gab, die den Vorgaben der politischen Machthaber entsprachen. Wie alle Ausweise teilte er die Menschen in unterschiedliche Kategorien und wer in der einen war, konnte nicht in der anderen sein. Zwangsläufig bedeutete dies Diskriminierung, wobei im Lateinischen „discriminatio“ schon das Wort „crimen“ - wahlweise Vorwurf oder gleich Verbrechen - steckte. Indem sie den Pass vorzeigten, wurden alle Menschen über einen Kamm geschert, wodurch der Einzelne im Kollektiv aufging und nichts mehr zu melden hatte. Die Maschine nahm keine Rücksicht auf persönliche Befindlichkeiten. Man musste ihn zeigen, wenn man in Restaurants essen wollte, bei sportlichen und kulturellen Veranstaltungen, in Museen und allen kulturellen Einrichtungen, in Thermal- und Schwimmbädern, bei Volksfesten und Kongressen, in Glücksspielhallen und auch, wenn man sich auf Ausschreibungen für öffentliche Stellen bewarb. Freigeschaltet wurden alle, die gespritzt, genesen oder innerhalb der vergangenen 48 Stunden getestet waren. Bald schon wurde offensichtlich, dass das Instrument keine zuverlässige Auskunft über die Gesundheit des Trägers lieferte, denn auch grün Etikettierte konnten positiv und sogar krank sein. Damit fiel zwar der Grund für seine Einführung weg, der Pass aber blieb.
Trotzdem beschloss ich zunächst, mich wenig um ihn zu sorgen, schließlich war ich in Italien, wo der Staat nur sporadisch funktionierte. Die konfuse Bürokratie des Landes fand normalerweise für alle Probleme ein Schlupfloch und sei es eine Selbstauskunft. Bei letzterer nahm man die Verantwortung fürs eigene Handeln auf sich und entband das Gegenüber von ihr, was eigentlich sowieso selbstverständlich sein sollte. Den Italienern war ein zivilisiertes Miteinander wichtig: „Vivi e lascia vivere“ (leben und leben lassen), „Immuni“ hatte sich schließlich auch totgelaufen. So hoffte ich zunächst.
Während die Leute in die Ferien fuhren, sich an den Stränden aalten und unter gleißender Sonne Gamberi und Gelati aßen, versuchte ich auszublenden, dass mir tief innen mulmig zumute war. Nachts schlief ich schlecht, wachte oft auf und lauschte nach draußen, wann endlich das Rotkehlchen zu trillern begänne. Ich träumte wüst, wobei die Stimmungen, die mich im Traum durchwirkten, immer die Eigenschaften des Raums und seiner Gegenstände definierten. Träume waren wie Musik, eine Tonart gab die Farbe vor, die dann den ganzen Traum über anhielt. Stimmungen unterschieden sich insofern von Gefühlen, als sie weder auf ein Ziel gerichtet waren noch willentlich beeinflusst werden konnten. Sie waren einfach da. So jedenfalls kam es mir vor, ähnlich wie ich es bei Heidegger gelesen hatte, während Platon sie noch als bloße Meinung abwertete. Was war nun richtig? In jenen Tagen stellte ich vieles in Frage.
Dann rief eines Tages der Brummbär an. Er war um die Fünfzig, klein und drahtig. Ein dunkler Vollbart rahmte sein viereckiges Gesicht ein. Im Alltag bestritt er eher schlecht als recht seinen Unterhalt als ausführendes Rädchen in einer Provinzbehörde. Dieses Leben war ihm verhasst, besonders die Enge der Stadt mit ihren vielen Menschen und deren vielfältigen Bedürfnissen. Nach Möglichkeit flüchtete er deshalb in die Natur, die er besser verstand und in der er sich wohler fühlte. Des Öfteren haderte er mit den Menschen und seinem Schicksal und brummelte vor sich hin, deshalb nannte ich ihn so. Nachdem er einen Schein als „Guida ambientale escursionistico“ (Ausflugsumweltführer, ja die Italiener können auch Wörter zusammenkleben) gemacht hatte, war er endlich offiziell befähigt und berechtigt, anderen die Natur nahezubringen. Am Telefon erzählte er mir nun von seiner Idee, einen Fußweg quer durch Italien, von der Adria bis ans Tyrrhenische Meer zu erschließen, in den Spuren der Wanderschäfer.
Die „Transumanza“ war vom 15. Jahrhundert bis zur Einheit Italiens und der industriellen Revolution ein tragender Wirtschaftszweig für die Toskana. Im Frühling verließen die Schäfer die meernahe Maremma und trieben ihre Schaf-, Ziegen- und Rinderherden hoch auf die Weiden der kühlen Berge, den Pratomagno und Apennin. Millionen Tiere zogen durch die Lande und die Schäfer waren stolz und roh. Sie gingen entlang der Bergrücken, wenn möglich immer ganz oben, auf breiten Trampelpfaden, die „tratturi“ genannt wurden. Der Eindruck von Weg war ganz verschieden von unseren heutigen Vorstellungen, wo die Straßen möglichst tallängs führten. Die Schäfer lebten viele Monate fernab der Zivilisation und wenn sie durch Dörfer kamen, redeten sie mit den Bauern und Handwerkern und waren nah am Leben. Der Brummbär hatte zusammen mit einem mittlerweile pensionierten Professor die alten Wege genau studiert. Ob ich ihn nicht bei seinem Versuch der Vergangenheit nachzugehen begleiten wolle?
In einem ersten Anlauf wollte er die Via Romea Germanica, auf der im Mittelalter deutsche Kaiser und Pilger über Ravenna und Arezzo gen Rom zogen, mit der Via Francigena verknüpfen, welche die Ewige Stadt via Lucca und Siena erreichte. Der Plan des Brummbären war eine sehr konkrete, traditionelle Querverbindung zwischen zwei ideellen Routen von Macht und Spiritualität. Nachdem der Brummbär geeignete Pfade ausfindig gemacht hatte, suchte er für eine allererste Begehung Mitwanderer, die sich nicht zu schade waren, zur Not auch umzukehren, falls sich der Weg als nicht praktikabel erwies oder in die Irre führte. Er plante, vier Tage und über hundert Kilometer zu wandern, von Rassina im verwunschenen Casentino-Tal über den beinahe sechzehnhundert Meter hohen Pratomagno-Berg, durchs Arno-Tal und über die Hügel des Chianti bis nach Monteriggioni. Ohne lange nachzudenken, sagte ich zu. Es war einer jener Momente, wenn sich etwas im Bauch richtig anfühlte. Erst als ich das Telefon weglegte, fiel mir ein, dass ich überhaupt keine Kondition hatte. Zweifel befielen mich, ob ich dem Unternehmen gewachsen war, den Kilometern, der Hitze und der Gesellschaft. Wer konnte wissen, ob es auszuhalten war? Und dann der Pass, das Virus, und wie sollte ich von der letzten Etappe auf der anderen Seite der Toskana zurück zum Auto kommen? Die großen Zentren waren mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erschlossen, aber wehe, jemand wollte in ländliche Gebiete reisen. Gelbe Bedenken und Zweifel in h-Moll zogen auf. Inwendig blies und strich Schuberts 7. Symphonie, die Unvollendete, und schwankte zwischen Unruhe und Zuversicht. Aber zumindest hatte nun auch ich ein Ziel. Bevor es losging, blieben mir vier Wochen und ich nahm mir vor, jeden Tag eine oder zwei Stunden zu laufen, um meine Kondition zu verbessern. In jenen Tagen trat mir das eigene Ungenügen vor Augen, ich spürte schlackernde Knie und Muskelkater bis auf die Knochen. Aber nichts davon hielt mich ab.
Im Jahr zuvor war ich für Recherchen zu einem Buch über Dante Alighieri zu den Orten gefahren, an denen sich der Dichter der „Göttlichen Komödie“ im 13. und 14. Jahrhundert aufgehalten hatte, nachdem die Florentiner ihn ins Exil gejagt hatten. Ich fragte mich damals, was 700 Jahre nach Alighieris Tod an Verbindung zwischen ihm und den Orten erlebbar blieb. Ich hatte das Casentino-Tal besucht, war über den Apennin gefahren, nach Padua und vom Tyrrhenischen Meer bis nach Ravenna an der adriatischen Küste. Als ich die Orte sah, wo der ghibellinische Kriegsherr Montefeltro bei Bibbiena tödlich verwundet wurde, wo Meister Adam in der Burg Romena Geld fälschte, das flammende Magra-Tal und die paradiesischen Mosaike in Ravenna, verstand ich Dantes Bilderwelten besser, oder glaubte dies zumindest. Nun aber wollte ich einen Schritt weitergehen, das hieß eigentlich viele, denn ich würde die einzelnen Stationen nicht bequem mit dem Auto aufsuchen, sondern sie erlaufen. Machte dies einen Unterschied?
Am Abend des 10. September passierte ich die einstige ghibellinische Hochburg Arezzo und zweigte ab ins Casentino-Tal. Ein paar letzte Straßenwindungen brachten mich hoch ins Städtchen Bibbiena, wo ich übernachten wollte, um am nächsten Morgen rechtzeitig am Treffpunkt zu sein.
An jenem Abend war der Himmel ähnlich unentschlossen wie meine Stimmung. Die Luft drückte schwül und graue, schwere Wolken hingen über der schnuckligen kleinen Altstadt und drohten mit Regen. Bibbiena war allerliebst und etwas charakterlos. Ganz oben auf der Piazza blickte eine hübsche Terrasse hinunter über das Städtchen Poppi mit seiner feudalen Burg. Dahinter streckte sich lang der Pratomagno-Berg, über den ich am nächsten Tag musste. Es wurde bereits dunkel, als ich durch die engen Straßen streunte. Alte Renaissance-Palazzi mit schweren Bossenquadern wirkten abweisend, doch aus einer Bar ertönte Wildwestmusik. Durchs Fenster sah ich, wie innen der Fernseher jaulte. Um Diskussionen aus dem Weg zu gehen, ob ich den Pass hätte, setzte ich mich für eine „Zuppa di cavolo nero“ auf die überdachte Terrasse einer Tavernetta. Suppe mit Schwarzkohl und geröstetem Brot galt als eine Spezialität der Gegend. Ich hoffte, dass es nicht regnete, denn im Falle des Falles hätte ich meine Suppe draußen auslöffeln müssen.
Bibbiena hatte durchaus seine glorreichen Momente in der Geschichte gehabt. Im Jahr 1470 wurde Bernardo Dovizi hier geboren. Der spätere Kardinal lernte zunächst unter dem Borgia Alexander VI., wie es im Vatikan zuging und war dann ein großer Freund des Medici-Papstes Leo X. Die Kumpanei ging so weit, dass Leo dem Dovizi den Necknamen „alter Papa“ (anderer Papst) verpasste. Es war eine Zeit der Höflinge, Speichellecker und doppelzüngigen Egos. Der „alter Papa“ schrieb auch eine Verwechslungskomödie „La Calandria“, die von Zwillingen handelte. Sie war verwickelt, gebildet und mit viel doppelter Moral, die nach außen hin den Schein des Guten wahrte und mich irgendwie an die heutige Zeit erinnerte. Der düstere und verschlossene Palazzo Dovizi lag direkt gegenüber meinem Hotel, wo mich zum Glück niemand nach dem Pass gefragt hatte. Ich dankte dem Himmel für die absichtsvolle Nachlässigkeit der Italiener, aber die ständige Sorge, wie weit mein Glück tragen würde, hatte sich bereits im Hinterkopf eingenistet.
Heute kannte man Bibbiena italienweit als Stadt der Fotografie, denn hier wurde durch die Linse Geschichte gesammelt. Vielleicht half das auch, die eigene Identität zu klären, denn der Ort schien mir in einer grauen Schwebe zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Als ich den Fensterladen meines Zimmers zur Straße hin öffnete, blickte ich an der Hauswand gegenüber auf das riesige Foto eines berühmten Fotografen, den ich vor Jahren persönlich kennengelernt hatte. Diesen Zufall nahm ich als gutes Omen, auf dass allem ein Sinn innewohnte – und sei es nur im Kleinen und für mich selbst.
Während meine Gedanken so vor sich hin quollen, packte ich die wenigen Habseligkeiten aus dem Rucksack. Es war gar nicht einfach gewesen, nur das Nötigste für vier Tage mitzunehmen und alles so kompakt zu rollen, dass es in dem 20-Liter-Behälter Platz fand. Dazu kamen noch eine Wasserflasche sowie ein paar Energieriegel für etwaige Durchhänger. Endlich schlüpfte ich unter das Bettlaken, welches angenehm frisch roch und schlief guten Mutes ein.
Am nächsten Morgen blaute der Himmel nur leicht verschleiert und in fünf Autominuten war ich an der Pfarrkirche von Sócana bei Rassina, wo wir uns verabredet hatten. Fünf Jahrhunderte vor Christus hatten hier Etrusker gewohnt. Mit dem Wort „Rasna“ benannten sie sich selbst, also musste es ein bedeutender Ort gewesen sein. Sócana trug nach etruskischen Gepflogenheiten den Akzent auf der drittletzten Silbe. Einst lag Rassina an einem wichtigen Wegkreuz, wo sich entlang des Flusses Arno mehrere Straßen von Ravenna nach Arezzo und vom Valdarno hinauf nach Chiusi della Verna begegneten. Die Pfarrkirche von Sócana befand sich etwas ober- und außerhalb des Städtchens. Jahrhundertelang hatten die Alten im Dorf gemunkelt, es gebe im Ort etruskische Reste, bis man in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts hinter der Kirche anfing zu graben und tatsächlich einen riesigen Altar fand. Heute lagen die freigelegten Steinquader einfach in der Gegend verstreut. Über dem heidnischen Heiligtum hatten die Christen dann später ihre dreischiffige Kirche erbaut und den Eingang nach Westen ausgerichtet, während die Etrusker den Ort von der entgegengesetzten Seite betraten. Der Brummbär wartete bereits vor der Kirche. Ein wenig aufgeregt und auch stolz zupfte er an seinem kurzgeschnittenen Bart und zählte seine Schäfchen. Noch war der Morgen ein bisschen kühl, aber die Aufgeregtheit schien die Luft zu erwärmen. Vom Kirchturm stob ein Schwarm Tauben auf. Ich bemerkte seine lustige Form, unten rund und der neuere Teil oben sechseckig. Geschmäcker änderten sich mit der Kultur und Zeit. Das Rund des Lebens war vielleicht doch etwas ausweglos und nicht so fortschrittlich, während die Symbolik des Hexagons die Harmonie zwischen Göttlichem und Weltlichem beschwor oder auch die sechstägige Schöpfungsgeschichte. Dafür musste man jedoch schon einiges in die Form hineindenken. Alle beeilten sich in der Bar gegenüber noch einmal auf die Toilette zu gehen und kauften als Gegenleistung der Höflichkeit halber Kekse oder einen Caffè. Ich tat es den anderen gleich. Meine knöchelhohen Wanderstiefel fühlten sich hart und unbequem an, aber ich versuchte nicht an sie zu denken. Nachdem sich das Hin und Her gelegt hatte, versammelten wir uns um den Etruskeraltar.