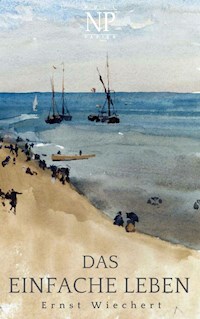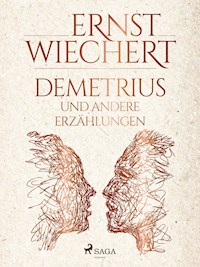Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In seinem autobiografischen Roman erzählt Ernst Wiechert über seine glückliche Kindheit in den idyllischen Wäldern Ostpreußens. Er beschreibt Stunden der Geborgenheit und des Miteinanders. In diesem Roman lässt der Autor seine Leserschaft mit großer Liebe, Humor, leichter Ironie und auch Sehnsucht durch Wälder und an Seen entlang wandern, an geheimnisvollen Mooren verweilen und die Schönheit seiner Heimat erleben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ernst Wiechert
Wälder und Menschen - Eine Jugend
Saga
Wälder und Menschen - Eine Jugend
Coverimage/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1936, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726927443
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
Zum Geleit
Manchmal, wenn ich vorlese, in großen Städten und besonders in fremden Ländern, widerfährt es mir, daß ich den Gang entlangblicke, der von meinem Pult zwischen den Menschen an das Ende des Saales läuft. Und dann wird er plötzlich vor meinen Augen immer länger, so wie eine endlose Straße, die zwischen dunklen Büschen bis an den Rand der Erde läuft. Und dort hinten, wo die Ränder schon zusammenfließen, sehe ich mich dann stehen, wie ich einmal war: ein Kind, barfuß, den Hirtenstab in der Hand, das mit seiner Herde auszieht, um seine Welt zu erobern.
Dann sehen wir einander an, Anfang und Ende einer Brücke, und mit einemmal kann ich mein ganzes Leben in diesem Bild umfassen. Dann schwelge ich einen Augenblick lang, mit einem leisen Erschrecken, und es wird mir alles bewußt, was ich sonst nicht weiß: der ungeheure Abstand, der uns von unsrem Anfang trennt.
In solchen Augenblicken habe ich dies Buch wohl begonnen, lange bevor ich es zu schreiben begann. In der Demut also und in einer leisen Angst, es könnte dies Kind wieder verschwinden am Ende jenes Weges und niemals mehr würde ich es wiedersehen.
Aber nun ist es da. Ich habe es beschworen, aus Lebenden und Toten, mit einem stillen und heiteren Zauber, vor dem Ofenfeuer am Abend, wenn die Flamme um das Holz spielt und der Wind im Schornstein klagt.
Zwar weiß ich nicht, wen es angehen wird außer mir. Ich habe ein Gewebe gesponnen und breite es aus. Ich sitze an der Straße, und alle können es sehen. Und wer stehenbleibt und sich niederbeugt, wird vielleicht erkennen können, gleich mir, was Gott geplant hat mit der Mühe und Arbeit einer Menschenhand.
Ambach am Starnberger See,
im Januar 1936
Ursprung und Lebensraum
Ich kann nicht bei den Wurzeln meines Geschlechts beginnen und mich als die Krone unsres Lebensbaumes betrachten, denn ich weiß wenig von unsren Vorfahren. Meinen Großvater gleichen Namens habe ich nie gekannt. Ich weiß von ihm nur, daß er in der Johannisburger Heide lebte, in einem Dorf, dessen Name viele Geheimnisse für mich enthielt; daß er ein einfaches bürgerliches Amt bekleidete und von meiner Mutter als ein »sehr ordentlicher« Mann hoch geachtet wurde; und daß der eigentliche Inhalt seines Lebens in den großen Wasserjagden gelegen zu haben scheint, die er gepachtet hatte und auf deren Inseln und Rohrkämpen mein Vater den größten, sicherlich aber den schönsten Teil seiner Jugend verlebt haben muß.
An meine Großmutter habe ich eine dunkle und wenig freundliche Erinnerung als an eine schwarz gekleidete, magere und hoch gewachsene Frau. Wahrscheinlich hat sie mir niemals etwas zuleide getan, sondern mich herzlich geliebt, aber die Wortkargheit, die in unsrem Geschlecht zu Hause ist, hat wohl bewirkt, daß ich sie für streng und unfreundlich hielt, während sie dem Kinde doch nur die Erfahrung voraushatte, daß Schweigen nicht Silber, sondern Gold ist. Sie ist über neunzig Jahre alt geworden, und ich glaube, daß die Erde ihr leichter geworden ist als das Leben.
Von den Eltern meiner Mutter habe ich nur ihren Vater gekannt. Sein Familienname war französischen Ursprungs, und ich schließe nicht nur daraus und aus seinem dunklen Haar, daß hier ein fremdes Blut durch viele Schicksale seinen Weg in unsre masurische Verschlossenheit gefunden hat. Er besaß einen alten Hof, mit dem eine Gastwirtschaft verbunden war, und muß ein Mann von hoher Rechtlichkeit gewesen sein, die er nicht nur seinen Kindern, sondern auch seinen Enkelkindern vererbt zu haben scheint. Er lebte in Cruttinnen, einem kleinen Dorf zwischen unendlichen Wäldern und am Ufer des durch seine Schönheit berühmten Cruttinnenflusses, und durch viele Jahre meines Lebens ist dieser Ort mir als der Inbegriff des Herrlichen, des Abenteuers und der zauberischen Verschlossenheit erschienen.
Wahrscheinlich enthielt er von allen diesen Dingen nicht mehr als andre Walddörfer meiner Heimat, aber nirgends auf der Welt gab es so viele Seen und Moore, so viele Reiher und Adler, so viele Jäger mit wunderbar schimmernden Büchsen, so viele uralte Eichen und so viele süße Himbeeren wie auf der zweistündigen Wagenfahrt von unsrem Forsthaus nach dem großelterlichen Hause. Da zog hoch über unsrem Wagen der Fischadler zu seinem Horst, der aus unsrem See die Hechte holte und bei dessen schwermütigem Schrei in meiner Brust vielleicht zum erstenmal sich das rührte, was ich das »Unnennbare« hieß. Da lag zur Linken das dunkle Waldgewässer, dessen Tiefe nicht zu messen sein sollte und dessen Fischnutzung uns gehörte. Dort horstete der Schreiadler und dort standen auf unbetretbaren Wiesen die ersten Kraniche, die ich jemals sah. Da schimmerte dann aus finsteren Wäldern der See, bei dessen Anblick ich jedesmal mit klopfendem Herzen lauschte, ob ich nicht die Glocken hören würde, die in ihm versunken sein sollten. Und dann neigte der Weg sich zur Morawa, einer Graslichtung unter alten Eichen, wo die dunkle Seenkette begann, die bis zum riesigen Muckersee lief, und wo aus dem schwarzen Moorwasser der Seen wie ein Wunder die klare, bewegte und durchsichtige Flut des Cruttinnenflusses entsprang, lautlos strömend, von grauen Holzsteigen überspannt, vom schimmernden Blitz des Eisvogels durchzuckt, von hängenden Wäldern überdacht, aus denen der Ruf der Adler sich klagend hob.
Meine Großmutter muß früh gestorben sein, denn ich habe sie nie gesehen, aber in der Erinnerung ihrer fünf Kinder hat sie lange gelebt, und wahrscheinlich mehr durch die Güte eines reinen Herzens als durch Strenge oder Schönheit. Sie stammte aus einer Familie, die in ganz Masuren weit verbreitet war und in einzelnen Mitgliedern bis tief nach Polen und Rußland reichte, bis der letzte große polnische Aufstand viele von ihnen ins Elend brachte.
Mein Großvater heiratete dann ein paar Jahre später ein zweites Mal, und dadurch wurden wir mit einer Familie verbunden, die sicherlich, nicht nur ihrem Namen nach, polnischen Ursprungs war. Und so kann ich, auch mit bescheidener Phantasie, mir denken, daß germanisches, slawisches und romanisches Blut sich in mir vereinigt hat, wie ja im Süden meiner Heimatprovinz die Völkerströme seit Jahrhunderten durcheinandergeflutet sind und jahrhundertelang an dem Gesicht der Nachgeborenen geformt haben, so daß niemand mehr das Gesicht des Ursprungs zu erkennen vermag. Doch stammt mein Vater aus einem großgewachsenen, blonden Geschlecht, und auch unser Name ist entweder vom althochdeutschen › fihuhirti‹ – der Viehhirt – abzuleiten oder, sehr viel wahrscheinlicher, von › wichart‹, das ist der Kampfesharte, was mir beides als ein ehrenvoller Ursprung erscheinen will.
Am Rande meiner Erinnerung erscheint schließlich noch eine dritte Familie als ein blutsverwandter Zweig, die meiner Heimat viele tüchtige Lehrer geschenkt hat, die ohne Zweifel litauischen Ursprungs war und die mich durch ihr hervorragendstes Mitglied, meine Tante Veronika, von Kind an mit der Fülle der Märchen, Sagen und Geschichten beschenkt hat, die von jeher ein Merkmal dieses Volksstammes gewesen sind.
Und dies ist nun alles, was ich von meinem dunklen Ursprung zu sagen weiß. Vielleicht sind diejenigen glücklicher, die den Weg ihres Blutes zurückverfolgen können bis in Jahrhunderte, in denen Sage und Geschichte einander schon die Hand reichen, und es mag wohl Sicherheit und Stolz eines Menschen erhöht werden, wenn er weiß, daß eine seiner Urahnen als Hexe verbrannt worden ist, daß einer seiner Vorfahren auf dem Schafott geendet hat, nachdem er im Bauernkrieg mit dem Morgenstern das Seinige getan hatte, oder auch daß einer ein Gemeindewesen zur Blüte geführt oder in schwerer Stunde neben seinem König gestanden hat. Aber wenn mich einmal verlangt hat, den Spuren meiner Ahnen nachzugehen, so hat mich noch jedesmal eine dunkle Scheu befallen, den Frieden der Toten zu stören, und ich habe es genug sein lassen an der schmalen Lichtung, bis zu der die erste Erinnerung mich führt, eine Lichtung, auf der meine Eltern stehen und um die der unendliche Wald meiner Heimat sich schweigend aufhebt. Und vielleicht gelingt es mir, aus diesen drei Quellen mein Leben abzuleiten.
Mein Großvater hatte einen Sohn und vier Töchter. Der Sohn empfing auf dem Gymnasium einer Kleinstadt eine gute Schulbildung, wurde Kaufmann und hat es bis zum Prokuristen einer sehr angesehenen Handlung in Königsberg gebracht. Er war somit gleichsam der erste »Abtrünnige« eines Geschlechtes, das den Bezirk seines Lebens in der alten Ordnung von Wald und Feld erblickte. Die Töchter aber heirateten alle in die »grüne Farbe«, wie man bei uns zulande sagt, das heißt, sie wurden Försterfrauen. Mein Vater muß, nachdem er bei den Jägern gedient und ein Jahr im Elsaß verbracht hatte, gegen Anfang der achtziger Jahre nach Cruttinnen gekommen sein. Dort heiratete er meine Mutter und bekam eine Forstaufseherstelle im Norden der Provinz, wo mein älterer Bruder im nächsten Jahr geboren wurde.
Dieser erste Ausflug in die weite Welt muß meiner Mutter nicht leicht geworden sein. Aus einem gesicherten, behüteten und fröhlichen Haus kam sie in eine einsame Fremde, und in einem halbverfallenen Bauernhaus, dessen eine Hälfte ihre Wohnung war, bei wenig mehr als sechzig Taler Jahresgehalt, die mein Vater empfing, in der düsteren Einsamkeit der litauischen Wälder und Moore mag ihr Hang zur Schwermut sich bereits damals vertieft haben, der dann ihr Leben immer mehr überschattete, bis sie es schließlich, dreißig Jahre später, nicht mehr zu tragen vermochte.
Ich erinnere mich, daß sie mitunter von ihrem ersten Abend in jenem Bauernhaus mit schmerzlichem Lächeln erzählte. Wie da über dem Sofa in der »guten Stube« die Wand sich plötzlich bewegt habe, eine dünne Wand aus Flechtwerk und Lehm, und so lange hin und her geschwankt habe, bis schließlich ein Loch in ihr erschienen sei und in dem Loch der Kopf einer Kuh. Denn nebenan sei der Kuhstall des Bauern gewesen. Meine Mutter mochte wohl gemeint haben, daß an jenem Abend nun das Paradies des Lebens für sie beginne, aber nicht, daß die Kühe nun so dicht an diesem Paradiese stehen müßten. Wahrscheinlich war es für sie der Anfang einer bitteren Erfahrungsreihe, und sie hat bis zum Ende ihres Lebens nie ganz begreifen können, weshalb neben ihren bunten Träumen immer eine so harte und graue Wirklichkeit stehen mußte.
Zu Beginn des Jahres 1887 muß mein Vater dann die Försterstelle in Kleinort bekommen haben, und dort wurde ich am 18. Mai des gleichen Jahres geboren.
Auch wenn es wahr ist, daß in dem Unerkennbaren und Verwirrenden der Welt zunächst die Gesichter der Eltern für ein Kind das immer Wiederkehrende und Bleibende sind, so will ich hier doch zuerst von dem Raum der Erde sprechen, in dem ich aufwuchs und der mich viel mehr geformt hat, als es bei anderen Kindern zu sein pflegt.
Das Haus kann noch nicht lange gestanden haben, als meine Eltern es bezogen. Es war aus roten Ziegeln gebaut, mit einem roten Pfannendach, und erwies sich somit schon von fern als ein Erzeugnis fiskalischer Ordnung und Dauerhaftigkeit, denn in unsrer Landschaft waren der Holzbau und das Rohr- oder Strohdach noch etwas Selbstverständliches. Auch Waschhaus und Stall, die in einigem Abstand den Hofraum abgrenzten, hatten dasselbe »solide« Ansehen, und nur die Scheune in ihrem braunen Holzwerk hätte ebenso auf einem Bauernhof stehen können, und desgleichen ein angebautes Holzhäuschen, in dem der Aufenthalt bei 20 Grad Frost nicht gerade zu einem »Lob des Landlebens« begeisterte.
Erst viele Jahre später bewilligte der Forstfiskus, wie er damals nicht ohne Ehrfurcht genannt wurde, am Nordgiebel eine hölzerne Veranda mit großen Glasfenstern, in der naheliegenden Annahme wahrscheinlich, daß ein Förster, der seinen Dienst ordentlich versehe, so viel in frischer Luft sein müsse, daß er zu Hause ihrer nicht mehr bedürfe. Zunächst aber trat man durch eine schwere Tür in den Hausflur, der einen Ziegelfußboden hatte und von dem zur Rechten eine Treppe von lebensgefährlicher Steilheit auf den Boden, die »Lucht«, und, von gleicher Beschaffenheit, in den Keller führte, die ich beide in jungen Jahren oft genug kopfüber ausgemessen habe.
Aus dem Hausflur, in dessen Dämmerlicht nur der Riegel mit den Gewehren eine leuchtende Insel des Begehrens war, kam man zur Rechten in die Küche und zur Linken in die »gute Stube«, die an der einen Seite noch ein kleines, wenig benutztes »Kabinett« besaß. Dahinter lagen die Wohnstube und das Schlafzimmer der Eltern, ein etwas verbreiterter schmaler Gang, der mir doch mit seiner bunten Tapete und seinem gerahmten Spiegel als ein Märchenpalast erschien, wenn ich in Zeiten der Krankheit ihn allein bewohnte. Auf der Lucht, nach Süden zu, gab es dann eine kleine »Oberstube«, mit einem Fenster und einem grünen Kachelofen. Es war der Raum, in dem ich als Kind den größten Teil meiner Wissenschaft und meiner Träume, meiner Schmerzen und Freuden empfangen habe. Alle andre Menschheit, die zu uns gehörte, war durchaus ländlich untergebracht, das Mädchen in der »Schlafbank« der Küche, der Knecht und der Hütejunge im Stall bei Pferden und Kühen.
Auf drei Seiten war das Haus vom Garten umgeben. Es war nach heutigen Begriffen sicherlich ein kümmerlicher Garten, mit ein paar uralten vermoosten Apfel- und Kirschbäumen, etwas jungem Edelobst, das mein Vater gepflanzt hatte, mit spärlichen Beerenbüschen und ein paar Blumenbeeten. Aber seine Herrlichkeit bestand in einer Reihe alter Fichten, die den Zaun nach Osten und Süden säumten, und in einem Fliederwald, der den Garten nach zwei Seiten abschloß. Und wenn in den schwermütigen Jahren meiner städtischen Verbannung das Bild meiner Heimat vor meinen Augen aufstand, so war es dieser Garten, zu dem meine Blicke sich aufhoben und in dem mir alles versammelt schien, was das Herz eines Kindes mit Seligkeit erfüllen konnte.
Rings um das Gehöft senkten sich unsre Felder, die fast sechzig Morgen umfaßten und um die in unendlichem Schweigen die Mauer des Hochwaldes sich erhob. Nur nach Südosten konnte der Blick weiter hinausgehen. Dort lag zwischen sumpfigen Wiesen, Schilf und alten Erlen unser See und auf der sandigen Höhe dahinter die einzigen Siedlungen, die wir sahen: die drei oder vier Gehöfte des Dorfes Kleinort, Rohrdächer unter uralten Ahornbäumen, und die beiden Gehöfte von Kleinbrück, wo die feindlichen Brüder lebten. Dicht an der Försterei, am Rande des Waldes, zog die alte Landstraße entlang, kam unter alten Kiefern hervor und tauchte in jungen Schonungen wieder unter, die mein Vater schon gepflanzt hatte, und das war nun alles, was wir von der großen Welt zu sehen vermochten.
Ahnung und Anfang
Als ich drei Jahre alt war, wurde uns noch ein Bruder geboren, und es scheint mir nach allen Erzählungen unserer Hausgenossen, als hätten wir in seltener Eintracht Hand in Hand die Eroberung unsrer Umwelt begonnen, in guten und bösen Werken, so treu und unzertrennlich, wie es mitunter in Märchen beschrieben ist.
Aber es war nicht etwa die Geburt meines jüngsten Bruders, bis zu der als zu einem ersten Licht in grauer Dämmerung meine Erinnerung zurückreicht. An der Schwelle meines Bewußtseins steht der Tod meines Großvaters in Cruttinnen. Ich sehe mich zur Nachtzeit in dem schmalen Schlafzimmer meiner Eltern. Eine Kerze brennt und ihr flackernder Schein fällt auf ein gelbliches Papier. Es ist ein Telegramm, das man aus dem Dorf gebracht hat, und meine Mutter ringt die Hände und weint. Dann wird das Haus geweckt, es wird angespannt, die Eltern und der Knecht fahren ab, und wir bleiben mit dem Mädchen allein.
Dann versinkt wieder alles, und ein paar Tage später erst taucht das Begräbnis aus der Erinnerung auf. Ich glaube, daß es ein schöner Herbsttag ist, sehr blau und warm. Ich sehe einen Saal – für Kinder gibt es ja viele »Säle« – mit vielen Menschen, und in der Mitte steht der Sarg mit dem Toten. Der Deckel ist nach damaliger Sitte noch nicht geschlossen, und ich kann das vertraute und so schrecklich erstarrte Gesicht lange betrachten. Ich begreife nichts. Ich sehe, daß die Menschen weinen, und sehe, daß das Gesicht sich nicht darum kümmert. Ich höre predigen und singen, aber alles dies geht in dem unter, das langsam und unwiderstehlich aus Kränzen, Tränen und Farben emporsteigt, das mich umhüllt und langsam zu erwürgen beginnt: in einem leisen, schrecklich fremden und schrecklich süßlichen Geruch, der aus dem Sarge aufsteigt und sich über mich stürzt. Und dann werde ich ohnmächtig und werde fortgetragen, und lange Zeit ist wieder alles im Dunklen.
Was sehe ich weiter? Wir müssen eine meilenlange Wagenfahrt gemacht haben, zu einer Stadt an einem großen See, und ich sehe über graublauem Wasser einen Vogel fliegen, eine Möwe wahrscheinlich, und das Bild schmaler Schwingen und des lautlos fallenden und steigenden Fluges, von einem zarten Spiegelbild wiederholt, erfüllt mich mit solcher Seligkeit, daß es haftengeblieben ist bis heute.
Ich sehe die Mutter meines Vaters und ein kleines Mädchen, ihr Enkelkind. Es verlangt, daß ich es auf meinen Schultern trage, und ich tue es, wobei das Gefühl der Schande und des Stolzes einander die Waage halten.
Aus diesen für immer im Dunklen verborgenen ersten Jahren hat man mir auch später nicht viel erzählt, und nur eines habe ich aufbewahrt, weil es nicht eine einzelne Betrachtung, sondern bereits die Summe vieler Erfahrungen enthielt. Danach muß ich ein sehr stilles Kind gewesen sein, immer in einem Winkel schweigsam mit mir beschäftigt, und auch wenn Besuch im Hause war, soll ich auf einer Fußbank in der entferntesten Ecke gesessen haben, den Kopf in die Hände gestützt, in Zusehen und Zuhören verloren. Auch die Anwesenheit vieler Kinder soll daran nichts geändert haben. Mitunter aber, ohne erkennbaren Anlaß, sei ich aufgestanden, auf die Fußbank gestiegen, und von dort aus hätte ich dann lange und glühende Reden an die teils verblüffte, teils begeisterte Versammlung gehalten, gleich einem kleinen Prediger, über den plötzlich der Geist Gottes gekommen sei.
Auch das Räumliche meiner Kinderwelt bleibt lange in Dunkel gehüllt, das Haus, der Garten, der Hof, der Wald. Und nur eines taucht am frühesten aus dem Verhüllten: das Feuer im Küchenherd und darüber der riesige »Mantel«. Das war eine Art von Rauchfang, der in der ganzen Größe des Herdes etwa meterhoch über diesem begann und sich langsam zu der Öffnung des Schornsteins verengte. Er war schwarz und glänzend von Ruß und Rauch, und wenn die Flamme einmal höher hinaufschlug, funkelten rote Lichter in seiner feuchten Schwärze, und einzelne Funken stoben hinauf und verschwanden im bereits Überweltlichen.
Dort habe ich wenn nicht die ersten so doch die eindringlichsten Märchen in mich aufgenommen. Immer war das Bild des ersterbenden Feuers etwas Zauberhaftes für mich, und der klagende und singende Laut verglühenden Holzes war mir vom ersten Bewußtsein an der »Gesang des Feuermannes«. Ging aber der Blick darüber hinaus, in den schwarzen Mantelschlund, in dem der Wind mit schauerlicher Klage stöhnte, so hatten die Teufel, Hexen und Zauberer einen kurzen Weg zu meiner zitternden Seele, und ich glaube, daß die Mächte der Unterwelt früh Besitz von mir ergriffen und an meiner Seele geformt haben.
Und noch ein Letztes muß ich aus jener ersten Dämmerung berichten, das seine Erklärung und Bedeutung zwar erst viele Jahre später gefunden hat, von dem ich aber weiß, daß es mich damals bereits mit dem dumpfen Gefühl eines Unrechts oder einer Gewalttat berührt hat. Es war natürlich, daß wir unsre Dienstmädchen sehr liebten. Für mich, der ich in einem ländlichen Leben aufwuchs, gab es ja weder »Angestellte« noch soziale Unterschiede, und das noch unberührte Herz umfaßte mit gleicher Liebe alle Lebewesen, die den Raum des Hauses erfüllten, Menschen und Tiere, Herren und Knechte.
Unter den Dienstmädchen jener Jahre nun ist mir eines in erster und besonderer Erinnerung geblieben, das Lotte hieß und sehr viele Jahre bei uns war. Und nun ist ein Tag im Herbst, und es ist Treibjagd in unsrem Schutzbezirk. Meine Mutter ist krank und in einer Königsberger Klinik – sie hat ihr halbes Leben in Kliniken zugebracht –, und am frühen Morgen versammeln sich Jäger, Hunde, Wagen und Pferde auf unsrem Hof. Da ist ein sehr beleibter und sehr freundlicher Forstaufseher, der ein Waldhorn über der Schulter trägt, und ich weiß, daß die Herrlichkeit dieses herrliches Tages in seinen Händen allein beschlossen ist. Und noch heute sehe ich die Jagdgesellschaft vom Hofe gehen und höre noch heute den unbeschreiblichen Klang des Waldhorns, mit dem das erste Treiben angeblasen wird. Später bricht die Sonne durch den Nebel, ich höre, immer weiter sich entfernend, Schüsse und Signale, und es müßte dieser Tag also als etwas Strahlendes in meiner Erinnerung bewahrt liegen.
Aber das ist nicht so, denn dieser Tag ist von einer dumpfen Unruhe und Ratlosigkeit beschwert. Ich glaube, daß Lotte krank ist, denn ich habe ein verzweifeltes Gesicht vor Augen und ein leises Jammern treppauf und treppab im Ohr. Die Jäger kommen wieder, um die Abendzeit, aber nichts ist fröhlich wie sonst. Sie fahren fort, in das Wirtshaus des nächsten Dorfes, auch das Waldhorn verschwindet, dieses sicherlich aus dem Himmel Stammende und golden Glänzende, und in einem dunklen, traurigen Nebel schließt die Erinnerung des Tages sich zu.
Aber dann kommt meine Mutter wieder, und es ist irgendein Unglück geschehen. Es gibt laute und harte Worte, Tränen und Verstörung, und plötzlich ist Lotte fort. Und auf eine unverständliche Weise geht die Tatsache in mein Bewußtsein über, daß Lotte an dem Abend jenes Tages zwei Kinder geboren hat. Ich kann mir nichts dabei denken, und ich verstehe nur, daß ein von mir geliebter Mensch plötzlich fort ist, unglücklich, verstoßen, ausgelöscht.
Ich könnte sagen, daß hier zum erstenmal die »soziale Frage«, wenn man in diesem Fall so sagen darf, in meinem Leben aufgetreten sei, und es scheint, daß der dumpfe Instinkt des Kindes sie bereits in der gleichen Weise beantwortet hat wie Verstand und Erfahrung späterer Jahre lang nachher; als ich bereits erkannte, worum es sich hier gehandelt hatte, hat dieses Ereignis wie ein Schatten über der Liebe zu meiner Mutter gelegen, weil ich nicht dulden wollte, daß auf den Glanz eine Trübung fiel, in dem ihre Gestalt mir erschien.
Und dieses konnte ich nicht verstehen und verzeihen. Ich dachte ja nicht daran, daß Arbeit und Alltag eine andre Lösung wahrscheinlich gar nicht zuließen. Ich hörte zum erstenmal das Wort »Schande« und sah zum erstenmal, daß die Schande alles auslöschte, was gewesen war, Arbeit und Treue, und daß sie den Betroffenen in Unglück und Elend stieß.
Ich habe Lottes Nachfolgerinnen ebenso liebgehabt wie diese, aber ich weiß, daß ich lange Zeit nachher jeden Abend gebetet habe, sie möchten doch keine Kinder bekommen und mir so wieder entrissen werden. Was dann wohl auch, wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, nicht mehr eingetreten zu sein scheint.
Erst mit dem Auftreten des »Geistes« beginnt in meiner Erinnerung die mattschimmernde Kette der Begebnisse sich Glied an Glied zusammenzuschließen, das heißt, der Tag, an dem wir mit unsrer ersten Erzieherin zum erstenmal am Schultisch in der Oberstube saßen, ist auch der Beginn meines eigentlich bewußten Lebens. Aber vorher glaube ich noch ein paar traumhafte Erinnerungen erwähnen zu müssen, weil in ihnen mehr als etwas zufällig Bewußtes enthalten ist: meine erste Liebe und meinen ersten Haß, mein erstes Grauen und meine erste Berührung mit der Kunst.
Ich habe viel geliebt als Kind. Meine erste Liebe nun war eine Frau aus jener Familie polnischen Ursprungs, die ich bereits erwähnt habe. Sie war, wenn ich mich richtig erinnere, mit einem Kaufmann verheiratet, ist später ins Reich gezogen und hat ein schweres Leben gehabt. Ich habe sie nur ein oder zweimal gesehen, und zwar im Hause meines Großvaters in Cruttinnen. Sie soll eine sehr schöne Frau gewesen sein, aber ich habe nur ein bleiches, stilles Gesicht in der Erinnerung, mit einer goldenen Kette um den Hals, sehr sanfte Augen, und ich weiß, daß ich sie ganz tief in meiner Seele »marmorn« nannte. Ich hatte niemals ein Stück Marmor gesehen und weiß auf keine Weise, wie ich dazu kam, mich so früh eines altertümlichen poetischen Vergleiches zu bedienen, aber ich weiß, daß ich stundenlang kein Auge von ihr wandte und daß mein Leben für viele Monate in ihrem Dasein beschlossen war.
Vielleicht war es ein natürlicher Ausgleich meiner frühen Liebesfähigkeit, daß auch der Haß schon meine Seele erfüllen konnte, als ich noch gar nicht wußte, was das Wort bedeutete. Zu meiner Kinderzeit lebte der größte Teil der einsamen Dörfer unsrer Landschaft von der Waldarbeit, und es geschah oft um die Abendzeit, wenn wir etwas entfernter vom Hause noch mit unsren Spielen beschäftigt waren, daß die heimkehrenden Waldarbeiter an uns vorüberkamen, von denen wir jeden kannten und die uns immer ein freundliches Wort zuriefen. Unter diesen nun war einer, dessen Namen und Aussehen ich längst vergessen habe, aber der niemals an uns vorüberging, ohne daß er uns etwas Unsauberes an Wort oder Gebärde zuwarf. Es war bemerkenswert, daß wir weder das eine noch das andre verstanden. Da wir mit anderen Kindern keinen Umgang hatten und auch unsre Dienstboten eine natürliche Achtung vor unsrer Unschuld gehabt haben mochten, so wußten wir sehr lange nicht, was gut und böse ist, aber es schien sehr früh ein feines Schamgefühl in uns lebendig zu sein, und wir wußten, vielleicht nur aus dem Gesichtsausdruck eben dieses Waldarbeiters, daß eine unreine Freude ihn dazu trieb, alles Reine zu trüben, das ihm begegnete.
Und gegen diesen Menschen empfand ich meinen ersten Haß, der so weit ging, daß ich ihm den Tod wünschte. Dieser kindliche Wunsch hat über sein Leben keine Macht gehabt, aber ich weiß, daß seine Gestalt lange Zeit wie ein Schatten über unsren Spielen gelegen hat und daß eine ganz tiefe Glückseligkeit uns erfüllte, wenn wir an manchem Abend in der tröstlichen Gewißheit einander ansahen: »Heute hat er nichts gesagt«.
Auch mein erstes Grauen reicht weit zurück, weiter noch als meine erste Erkenntnis des Todes, und doch war es mit diesem verbunden. Es war damals wie überall auf dem Lande üblich, daß die winterlichen Hausschlachtungen von einem Fleischer der Umgegend vorgenommen wurden, und dieses Mannes wie seines blutigen Handwerks erinnere ich mich mit einem dumpfen Gefühl, das ich nicht anders als grauenvoll nennen kann. Es kann nicht allein der Tod eines Tieres gewesen sein, denn niemals hat ein totes Wild, das mein Vater heimbrachte, dieses Gefühl in mir erweckt. Es muß die Zurüstung zum Töten gewesen sein, eben das Handwerksmäßige, und wohl auch der Einbruch des Todes in den friedenvollen Bezirk häuslicher Gemeinschaft, zu der ja auch die Tiere gehörten, was mir den Vorgang nicht als etwas Natürliches, sondern als einen Mord erscheinen ließ.
Aber ich will mich nun zu einer freundlicheren Erinnerung wenden, damit man nicht denke, alles Erste meines Lebens sei in Dunkel und Angst getaucht. Die erste Beseligung durch die Kunst habe ich von der Musik und, etwas später, glaube ich, von der Zeichenkunst erfahren, während die Dichtung erst in mein Leben trat, als mit der ersten Erzieherin auch die ersten Werke der Dichtkunst in unser an Büchern sehr armes Haus kamen.
Es ist mir immer seltsam erschienen, daß der Mensch, aus dessen Flötenspiel ich eine bis zu Tränen reichende Erschütterung gewann, ein schlechter Mensch war. Es war ein Schwager meines Vaters, ein Zollbeamter von der russischen Grenze, verschuldet und dem Trunke ergeben, und ich erinnere mich, daß er später versucht haben muß, meinen Vater zu einem unehrlichen Handel zu bereden, vielleicht zu einer falschen Angabe in einem Erbschaftsstreit, der unsrem Verwandten zu einem unredlichen Gewinn verholfen haben würde. Er hat unser Haus dann, als mein Vater sich weigerte, mit einem tiefen Haß bedacht, und es muß sich ein Prozeß daran geschlossen haben, den mein Vater zuerst gewann und dann verlor und dessen Folgen als ein finsterer Schatten lange über unsrem Hause gelegen haben.
Ob er sehr schön gespielt hat, weiß ich nicht. Aber ich weiß, wie unvergeßlich es war, als er in einer Dämmerstunde zum erstenmal die Flöte in den Händen hielt, ein Instrument, das schon in seinem Äußeren mit dunklem Holz und silbernen Klappen von seligen Geheimnissen erfüllt war. Und als dann die erste Melodie unter seinen Händen geboren wurde und sich aufhob und den ganzen Raum mit ihrer dunklen Schönheit erfüllte, erbebte etwas in mir, das ich bis dahin nicht gekannt hatte und vor dem es eine Rettung nur in dem geben konnte, was ich die ersten »seligen Tränen« nennen möchte.
Ich glaube nicht, daß man mich verstand, ja ich erinnere mich, daß man mich tadelte und verspottete, weil meine träumerische und weiche Art meine Eltern mit früher Sorge erfüllen mochte. Und doch war etwas Großes geschehen: eine neue Welt hatte zum erstenmal ihre Tore vor mir aufgetan, und niemand wußte, daß ich ihr verfallen bleiben würde.
Um etwa die gleiche Zeit ist die Musik noch einmal, und zwar in einer vielfach verstärkten und berauschenderen Form in mein Leben getreten. Es muß damals ein Orchester aus einer entfernten Stadt durch unsre Landschaft gezogen sein und auch in Dörfern, in denen ein Saal vorhanden war, Konzerte gegeben haben. Und wiewohl ich alle mit meinem Leben nur flüchtig verbundenen Namen in kurzer Zeit zu vergessen pflege, so weiß ich doch heute, nach mehr als vierzig Jahren, daß der Leiter dieses Orchesters Poppek hieß. Ein gewiß gänzlich ungenialer Name, doch reichte er aus, um mich in eine Verzauberung ohnegleichen zu ziehen.
Bei diesem Konzert, zu dem meine Eltern mich mitnahmen, erfuhr ich zum erstenmal das Berauschende des Klanges, und auf eine gleich unwiderstehliche Weise muß das Bild der Instrumente auf mich gewirkt haben, die ich in den Pausen auch aus der Nähe sehen durfte. Und wiewohl der Glanz und die zum Teil mir ungeheuerlich erscheinenden Formen der Blasinstrumente mir fast den Atem nahmen; obwohl die bescheidene Gestalt der Flöte nun weit hinter den prächtigeren Gestalten der Klarinetten, Oboen und Fagotts versinken mußte; obwohl die ernste Würde des Cellos und die fast drohende Majestät des Kontrabasses mich mit einem Schauer der Ehrfurcht erfüllten: so erinnere ich mich doch, daß meine glühende und verzauberte Liebe den Geigen gehörte, die auf eine so zärtliche und behutsame Weise an die Brust gedrückt wurden und aus deren Saiten Töne gelockt wurden, die ich noch niemals vernommen hatte, und von denen ich glaubte, daß nur vom Himmel Herabgestiegene sie spielen könnten.
Es ist mir, als hätte ich jahrelang von der Erinnerung an dieses Konzert gelebt, das heißt, daß mein äußeres Leben wohl fortgefahren sei, die alltäglichen Kinderwege zu gehen, aber daß meine Seele sich nur von dem Nachklang dieser Töne genährt und eine unendliche Sehnsucht in mir zurückgelassen hätte. Und daß alle Kunst »Nachahmung der Natur« sei, habe ich dann früh auf eine kindliche Art zu beweisen versucht. Es war natürlich, daß ich mit Tränen und Beschwörungen meine Eltern zu bewegen versuchte, mir eine Geige zu schenken. Aber der Kauf einer Geige wäre für sie wohl dasselbe gewesen wie für mich heute der Kauf eines Ozeandampfers. Und da Kinder und Liebende immer der Meinung sind, ohne bestimmte Dinge nicht weiterleben zu können, so machte ich mich eben daran, mir selbst eine Geige zu bauen. An Zigarrenkisten war kein Mangel in unsrem Hause, und wahrscheinlich hat ein gutmütiger Knecht mir geholfen, den Hals der Geige mit ihrem etwas primitiven Leib zu verbinden. Alles andre gelang meinen eignen Kräften; denn Pferdehaare zu Saiten zusammenzudrehen, war eine geringe Kunst, und unsre alten Kirschbäume waren gern damit einverstanden, daß ihr Harz zur Abwechslung nicht von mir gegessen, sondern, in erhärtetem Zustande, als Kolophonium benutzt wurde.