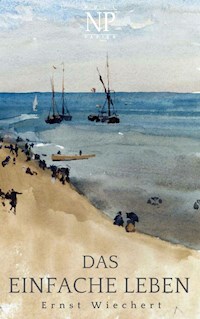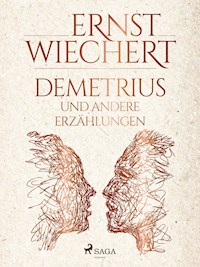
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
In dieser Kurzgeschichten-Sammlung setzt Wiechert sich mit dem menschlichen Sein und der Rastlosigkeit des Menschen auseinander. In "Demetrius" erzählt er von Christoph, von seiner Mutter Joseph genannt, der in seinem Dorf nicht akzeptiert wird. So verlässt er das Leben, das er kannte. Auch in "Joneleit" geht es um einen Helden, der alles hinter sich lässt. Abgerundet wird die Sammluing durch "Das Fenster der Andromeda", einer von Wiecherts weniger bekannten Geschichten.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ernst Wiechert
Demetrius und andere Erzählungen
Saga
Demetrius und andere Erzählungen
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1945, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726927542
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
DEMETRIUS UND ANDERE ERZÄHLUNGEN
DEMETRIUS
Er war einfacher Leute Kind, aber die Natur hatte ihn als ein Herrenkind geschaffen. Freunde und Anverwandte verwunderten sich, als er noch in der ländlichen Wiege lag, über die Zartheit des jungen Leibes und blickten zwischen Spott und Scheu auf seine winzigen Hände und Füße, auf die bläuliche Äderung der Schläfen und den weichen Strich der Wimpern.
Und da die Beschauer es an nachsichtigen wie an zweideutigen Bemerkungen nicht fehlen ließen, wie es in ländlichen Gegenden der Fall ist, wo selbst Zeugung und Tod alltägliche Dinge sind, so nistete sich in dem einfachen, ein wenig dumpfen Herzen des Vaters ein frühes Mißtrauen ein, ob dieses absonderliche Menschenkind Fleisch von seinem Fleisch sei, und vor der beweglicheren Seele der Mutter erhoben sich Gesichte vom Glanz der Zukunft.
Indessen bewegte der kleine Kätnersohn sich in dem engen Raum seiner kleinen Welt mit tierhafter Unschuld und Einfachheit, zwischen der nährenden Brust seiner Mutter und der Wärme seiner Wiege auf und nieder treibend, und er wußte weder von dem feindlichen Mißtrauen seines Vaters noch von den Zukunftsbildern mütterlicher Träume.
Als seine Mutter verlangte, daß man ihn Joseph taufe, und an dem bunten Rock zu häkeln begann, der ihn aus der Plumpheit seiner Brüder herausheben sollte, griff der Vater nach dem Pferdezügel, der an einem Holzpflock der niedrigen Stube zu hängen pflegte, und er wurde auf den Namen Christoph getauft, wie es dem Brauch der Landschaft angemessen war. Doch begann von diesem Ereignis ab seine Mutter ein verstecktes und fast höhnisches Lächeln in den Mundwinkeln zu tragen, sobald im Kreis der Familie die Rede auf den Jüngstgeborenen kam; auch ließ sie zeit ihres Lebens nicht von dem. Namen Joseph, obwohl die Erhöhung in Ägypten Jahr für Jahr auf sich warten ließ und das Kind zwischen Feld und Tier barhäuptig heranzuwachsen begann.
Und wiewohl Joseph frühzeitig erfuhr, daß bei den Brüdern und Dorfgespielen nur die Faust den Weg zur Hochachtung erkämpfte, erkannte er mit früher Beweglichkeit des Geistes und der Erfahrung, daß es nur einer Bewegung seiner Hand, eines Zuges um seine Lippen, einer Beugung seiner Stirne bedurfte, um von seiner Mutter zu erlangen, was er wollte. Er wußte, daß Zukker, Weißbrot und Sparbüchse ihm zukamen; er wußte, daß die Augen der Mädchen verstohlen an ihm hingen und daß man die Berührung seiner zarten Haut, das einmalige Hingleiten über den seidigen Glanz seines Haares verkaufen konnte um eine Süßigkeit, ein buntes Tuch oder ein Körbchen voller Beeren; er wußte auch, daß man die Mängel der Faust oder des Fleißes oder der Aufrichtigkeit ersetzen konnte. Und er war noch nicht zehn Jahre alt, als er schon ein Virtuose in dem kleinen Kreis seines Lebens war.
Doch ging seine Schulzeit dahin, ohne daß er, der Prophezeiung seines Vaters gemäß, am Galgen endete. Es war nicht so, daß die Menschen ihn für böse hielten, sondern daß er vielmehr sein Dasein scheinbar untätig und ohne die geringste Anstrengung nur wirken ließ, so daß er anzog, was er brauchte, und abstieß, was er nicht wollte. So rollten die Äpfel fremder Gärten in seine nachlässig geöffneten Hände; so gingen die Mädchen fremder Sehnsucht mit ihm durch die abendlichen Felder; so hob er seine klare Stirn lächelnd in alle Anerkennung, die den andern zugedacht war und auf ihm haften blieb wie auf der Kornähre des Alten Testaments, vor der die andern sich neigten und von der mit glänzenden Augen zu sprechen seine Mutter nicht müde wurde.
Der Lehrer sagte, er sei begabt, aber träge, der Pfarrer, er sei nicht böse, aber lau, die Mädchen, er sei gut, aber treulos, seine wenigen Kameraden, er sei feige, aber schlau. Man verhehlte es ihm nicht, aber er lächelte nur.
Er widersprach auch nicht, als am Ende seiner Schulzeit ein Bruder seiner Mutter, der einen Laden in der Stadt besaß, ihn zu sich nehmen wollte, um einen Kaufmann aus ihm zu machen. Der Oheim wußte, was ein hübsches und glattes Gesicht für sein Geschäft bedeutete, aber noch bevor er um die Abendzeit wieder in seinen Wagen stieg, hielt er eine kleine Rede über den Aufstieg des Geschlechtes und die zahlreichen Pflichten der Dankbarkeit.
Aber Joseph lächelte. Er lächelte auch beim Abschied, als seine Mutter bittere Tränen weinte. Doch zupfte er sie mit einer gütigen Zerstreutheit an dem linken ihrer silbernen Ohrringe, wie er als Kind getan hatte, wenn er eine leise bedrückende Situation zu beenden wünschte.
Er beging nichts Böses in seiner Lehrzeit. Die Portokasse war in Ordnung. Die Bücher waren in Ordnung. Es kam vor, daß ein Seidentuch bei der Inventur fehlte, ein Kasten mit Haarschleifen, eine Kollektion billiger Spangen. Er wartete nicht, bis man zu suchen begann. Ja, sagte er freundlich, im Vorübergehen stehenbleibend, die habe er gelegentlich verschenkt, um eine etwas großzügigere Reklame für das Geschäft zu betreiben. Drohungen und Flüche des Oheims empfing er mit erstauntem Lächeln und ging dann kopfschüttelnd an seine Arbeit.
Als der Krieg ausbrach und er nach kurzer Ausbildungszeit ins Feld rückte, vermochte er die Blumen und Liebesgaben nicht zu tragen, mit denen das weibliche Geschlecht der Stadt ihn überschüttete, und auf dem Bahnsteig fragte der Unteroffizier ihn bissig, ob man noch einen Wagen für ihn anhängen solle.
Er ging ohne Erschütterung durch die vier langen Jahre, ausgezeichnet, unverwundet, von der Front zu den Depots, von den Depots zur Etappe, von der Etappe zur Garnison. Aber er kehrte nicht in seine Heimat zurück. Er schrieb freundliche Briefe an alle, die ihn erwarteten, mietete ein Zimmer in einer großen Stadt und stieg in den Zeiten des Währungsverfalls zu einer jener Größen empor, die damals zu Tausenden ihr Schmarotzerdasein führten.
Und als es zu Ende war, trat er heiter vom Schauplatz ab, reiste, tanzte, spielte ein wenig, und als das letzte Markstück dahin war, ging er mit der leutseligen Miene eines Freiherrn zum Arbeitsamt, um zu stempeln.
Sein Äußeres wurde ein wenig verblichen, seine Mahlzeiten etwas frugaler, seine Liebschaften etwas anspruchsloser, aber wiewohl er mitunter als Zeuge vor den Schranken des Gerichts zu stehen hatte, glitt er unbeschadet an Ruf und Ehre auch durch diese Jahre und empfand nur, je älter er wurde, ein unbefriedigendes Gefühl der Langeweile, eines grauen, der Masse zugehörigen Daseins, einen Mangel an Isolierung, ein langsames Zerbröckeln magnetischer Kräfte. So daß er zuweilen eine untergeordnete Arbeit annahm, nur um der gestaltlosen Eintönigkeit zu entgehen. Auch legte er sie nach Belieben nieder, sobald auf dem Gang zur Arbeitsstelle ein hübsches Gesicht oder ein blühender Baum ihm zulächelte.
So nahm er es auch mit Heiterkeit auf, als ein hoher Postbeamter, dem er bei einem Straßenbahnunfall Hilfe geleistet hatte, ihm statt einer Geldzuwendung eine Aushelferstelle bei einem ländlichen Postamt vermittelte. Er schrieb einen höflichen Dankesbrief, packte seine geringen Habseligkeiten, teilte auf einer Reihe von farbigen Ansichtskarten seinen zahlreichen Freundinnen mit, daß er ein neues Amt „in der Ferne“ antrete, und traf an einem Frühlingsabend in dem freundlichen, von Wiesen, Äckern und Wäldern erfüllten Hügelland ein, das nun seine Heimat werden sollte. Er mietete ein kleines Zimmer, von dem er einen Teil des Flusses und die ihn säumenden Pappeln überblicken konnte, besprach mit seiner Wirtin, wie sie für ihn sorgen sollte, meldete sich bei seinem Postmeister, der ihn auf Grund der privaten Empfehlung seines hohen Vorgesetzten achtungsvoll empfing, und schlenderte dann noch ein wenig durch die sich begrünenden Dorfstraßen, um zu sehen, ob die Mädchen hübsch seien und ob es sich in dieser stillen, etwas herben Luft werde leben lassen.
Zwei Wochen später, wenn er mit seinem Rade hügelauf und hügelab durch seinen ländlichen Bestellbezirk fuhr, jedem der Höfe, die aus der Ferne ihn zu erwarten schienen, in Gedanken die ihnen bestimmte Post zuteilend, einige Ansichtskarten, ein paar schwerfällige Briefe, Zahlungsaufforderungen, amtliche Schreiben und ein geringes Bündel von Zeitungen, schien es ihm, als sei er von Kind an auf seinem gelbgestrichenen Postrade durch das Land gefahren, von bangen oder sehnsüchtigen Augen erwartet, und als trage er in seiner Hand das Schicksal all derer, bei denen er eintrat oder an denen er vorüberging.
Nachdem Straßen, Höfe und Menschen ihm vertraut geworden waren, liebte er es, in schneller Fahrt einen bewaldeten Hügel zu erreichen, wo man unter tief beasteten Linden im Grase liegen und der Blick über die Landschaft gleiten konnte. Dort pflegte der Posthelfer Joseph eine Zigarette zu rauchen und sich dabei mit einer losen Teilnahme in die Post zu vertiefen, die er mit sich führte. Aus dem dürftigen Inhalt der Karten, aus Schriftzügen, Stempel und Absender der Briefe versuchte er den Inhalt zu erraten, verknüpfte das angenommene mit dem ihm bekannten Schicksal der Empfänger, riet, kombinierte, ergänzte, träumte und verflocht, ihm unbewußt, sein Dasein auf diese Weise immer fester mit fremdem Leben.
Mitunter wandelte eine leise Lust ihn an, vergessene Fertigkeiten wieder zu üben und Briefe zu öffnen, ohne daß eine Spur verbotener Handlung an ihnen haften blieb, um ein noch näherer Zuschauer fremden Lebens zu sein; aber wenn er die Briefe in der Hand wog, auf das schwerfällig Stolpernde ihrer Schriftzüge blickte, auf das unharmonisch Hingesetzte ihrer Freimarken, schien ihm die angewendete Mühe zu groß.
So würde er weiter als ein stummer und pflichtgetreuer Bote des Schicksals sein Leben in dieser stillen Landschaft erfüllt haben, wenn nicht am Rande seines Bestellbezirkes auf einem bewaldeten Hügel ein weißes Haus gestanden hätte, in dem vom Frühling bis in den späten Herbst ein Schriftsteller lebte, den man den „Doktor“ nannte und der den größten Teil der Post empfing, die Joseph aus seiner Tasche über das Land verteilte. Von allen Häusern, die Joseph betrat, war dieses das einzige, das ihn auf eine seltsame, fast schmerzliche Art fesselte. Da saß ein großer, noch junger Mensch an einem breiten Schreibtisch, Blumen, Bücher und Manuskriptblätter auf der spiegelnden Platte, und sah durch die geöffneten Fenster über das Land hinaus, über das die Wolken sich breiteten und das darauf zu warten schien, daß man es in Träume, Verse und Bilder verwandle.
Wenn er klopfte, rief eine dunkle und gleichsam aus einer schönen Ferne rückkehrende Stimme: „Herein“, ein ernstes Gesicht wandte sich ihm zu, und eine von keiner Arbeit entstellte Hand streckte sich aus, um die Post zu empfangen. Dann gab es ein kurzes, aber freundliches Gespräch, ein paar Fragen nach Weg, Wolken und Wind, eine Zigarette, aus einem silbernen Kasten höflich gereicht, einen freundlichen Abschied und gute Wünsche für den Heimweg.
Hier war das fremde Reich, hier müßte es Freuden geben, die nicht gekauft werden konnten, eine stille Herrschaft, die nicht erworben werden konnte, die mit einem leisen Neid erfüllte und mit einer stillen Traurigkeit, vor der das eigene Besitztum flach und alltäglich erschien.
Es kamen Korrekturen für den Doktor an, und Joseph brauchte nur die dünnen Messingklammern aus den Umschlägen zu ziehen, um die langen seltsamen Fahnen in den Händen zu halten. So lag er nun auf seinem Lindenhügel und las die stillen, ein wenig traurigen Verse, las die Erzählung von einem Mann, der sich vom Leben des Tages gewendet hatte und in strenger Einsamkeit ein neues Leben baute, las Aufsätze für Zeitungen: und aus allem strömte ein starkes, ungebrochenes und ungefälschtes Licht über die plattgewordenen Linien der Welt, der Menschen, ihrer Taten und Gedanken. Die Sonne spiegelte sich in den Speichen des an einem Baume lehnenden Rades, die Bienen hingen über den roten Kleeblüten, und ein Vogel rief über dem rauschenden Wald. Und die Seele des Lesenden erfüllte sich langsam mit der Traurigkeit und Bitterkeit eines Verbannten oder eines Bettlers, der vor fremden Türen wartend steht.
Und so bedurfte es keiner Überwindung, als bald darauf der Posthelfer Joseph alle Briefe zu öffnen, zu lesen und wieder sorgfältig zu verschließen begann, die er in das weiße Haus zu tragen hatte. Er suchte nicht nach Geld und nicht nach Geheimnissen. Er suchte nur nach dem Geheimnis und Zauber eines fremden und nie erfahrenen Lebens, nach der Macht, die größer war als die seinige und andere Mittel besitzen mußte, als er kannte. Er las die Worte, aber er suchte, was hinter den Worten stand.
Da waren Briefe der Mutter, die seine Gedanken zurückgehen ließen nach dem Kätnerhaus und den silbernen Ohrringen, an denen er spielend gezogen hatte. Da waren Briefe von Freunden, wie er sie nie besessen hatte; von jungen Dichtern, die Rat und Hilfe suchten und von Schmerzen berichteten, die ihn wie eine fremde Krankheit anrührten; und da waren schließlich die Briefe von Frauen und Mädchen, mit andern Worten als er sie kannte, so daß ihm schien, als müßte auch das Geschenk, das sie darzubringen hatten, anders sein, und als müßte es hinter der Liebe, die er kannte, noch eine andere geben.
Und wenn ihn schon alles dieses in Verwirrung stürzte, so hielt er mit bebenden Händen die behutsamen Briefe, die als Antwort an alle diese Fragen hinausgingen, und die Worte fanden wie aus einer fremden Sprache.
Und bald darauf begann Joseph diese Briefe abzuschreiben, schnell und heimlich, und ein verborgenes Heft mit ihnen zu füllen. Begann er, die Verse abzuschreiben, sie vor sich hinzusprechen, während er auf dem Rade saß, die Geschichten weiterzudenken, deren Bruchstücke er in den Korrekturen las, die Antworten auszudenken, die auf Briefe eintreffen müßten: das heißt, er begann, sich seines eigenen Lebens zu entäußern und ein fremdes anzulegen.
Bis im Sommer desselben Jahres ein Briefwechsel begann, der aus diesem Spiel ein unwiderstehliches Schicksal machte. Er hätte nicht sagen können, weshalb unter allen Unbekannten gerade diese eine in seiner Vorstellung sich über alle andern erhöhte, weshalb ihre Anschrift, die Wahl ihrer Worte, die Form ihrer Fragen und Behauptungen, ihrer Anreden und Grüße seine Gedanken ihr unterwarf, weshalb er hundert Bilder von ihr über ihren Zeilen ausmalte, weshalb er die Bewegungen ihrer Hände sah, das Schreiten ihrer Füße, das große Haus, in dem sie lebte, die Bäume des Gartens, unter denen sie schreibend saß. Sie schrieb über die letzte Erzählung des Doktors, die in einer Zeitschrift erschienen war, und über ein Gedicht, das Joseph aus dem Korrekturbogen kannte. Es schien ihm unerhört klug, was sie dazu zu sagen wußte, aber mehr als dieses berührte ihn die bescheidene Ferne, in der sie selbst verborgen blieb, eine Art von Verzauberung, aus der ihre Stimme herüberklang, die Ahnung von etwas unendlich Kostbarem an Schönheit, Hoheit und Adel, das er niemals angetroffen hatte auf seinen Lebenswegen.
Er entwarf die Antworten auf jeden dieser Briefe. Er verglich sie mit denen, die er aus dem weißen Hause mitzunehmen hatte, und Bitterkeit erfüllte ihn, wenn er sich vorstellte, wie sie die beiden Briefe empfing, wie ihre Augen über die beiden Handschriften glitten, über die stille, anspruchslose und zusammengeschlossene des Dichters, und die geschwungene, weitausholende, mit Zierat und Schleifen geschmückte seiner eigenen Hand. Wie sie die Umschläge öffnete und nun nacheinander die zwei fremden Seelen sich vor ihr enthüllten, die eine, die mit der gleichen Sprache antwortete, in der sie gefragt worden war, und die andere, die nur zu stammeln vermochte.
Bitterkeit erfüllte ihn und eine tiefe Traurigkeit, ein schwindelndes Gefühl der Ohnmacht und des Nicht-zu-Haus-Seins. Er sparte an seinem geringen Geld und ließ sich die Bücher des Doktors schicken. Er las sie in den Nächten, bis er sie nahezu auswendig wußte. Er begrub seine eigene Sprache und begann, mit den Worten eines Fremden zu sich zu sprechen, aber er hatte ein fröstelndes Gefühl dabei, das Gefühl einer Spaltung seiner Seele, als hebe ein Teil sich aus ihm heraus und spreche aus der Entfernung zu ihm, und er müsse alle Worte zuerst in seine Muttersprache übersetzen, ehe sie Bedeutung und Sinn gewannen.
„Es ist schön“, schrieb sie, „von einem Menschen nur die Seele zu kennen. Es ist schön, daß keines Ihrer Bücher Ihr Bild trägt, denn es ist nun für mich im Unendlichen zu Hause und jeder Form sich unterwerfend, die ich ihm gebe. Es ist an vielen Orten verboten, das körperliche Kleid zu lieben, aber es ist nirgends verboten, die Seele zu lieben.“
„Was Sie von meiner Seele schrieben“, erwiderte Joseph, „hat mich mit Begeisterung erfüllt. Das Seelische ist immer das Ideale und Märchenhafte, aber die Menschen sind nie zufrieden, und wenn einer etwas hat, will er immer mehr haben.“
„Wenn nicht Angst vor Enttäuschung in dem ist, was Sie von der Seele schreiben“, erwiderte der Doktor, „so ist es gut, bei Ihnen zu Hause sein zu dürfen. Wer seine Seele in seinen Büchern entkleidet, ist dankbar, wenn man die Augen vor seiner Entkleidung schließt und mit nicht neugieriger Hand ihm den Dank reicht, von dem er leben muß. Und sollte der schöne Wunsch uns einmal erfüllen, einander zu sehen, so wird es erst dann sein, wenn keine Enttäuschung mehr möglich ist, weil das Seelische sich nicht enttäuschen kann.“
Und Joseph stützte die Stirn in die Hände und saß lange über den beiden Blättern, aus denen er sein Urteil entnahm. Er schickte keinen seiner Briefe jemals ab. Er lehnte die Zigarette ab, die der Doktor ihm anbot, und gab vor, daß er nicht mehr rauche. Er zögerte, bevor er in das weiße Haus eintrat, und wenn er, wie es mitunter vorkam, gebeten wurde, ein wenig zu warten, weil ein Brief noch beendet werden mußte, suchten seine Augen mit leidenschaftlicher Eindringlichkeit das Bild des Raumes und seines Bewohners in sich aufzunehmen, das Geringste an Eigenart, Bewegung, Gebärde, um hier den Schlüssel zu dem zu finden, was in den Briefen als die Vergeistigung alles dieses sich niederschlug. Blickte er so von seinem Stuhl im Hintergrund des Zimmers auf die über den Schreibtisch gebeugte Gestalt, auf die Ruhe ihrer Bewegungen, das Gesammelte ihrer Erscheinung, so kam es wohl vor, daß er sich fragte, ob er sie hasse, ob er wünsche, daß sie nicht da sein möchte und er statt ihrer dort säße.
Aber er fühlte keinen Haß. Es war nichts Aufreizendes in dieser Gestalt, nur dieselbe Bescheidenheit und Ferne, die in jenen Briefen lebte, die sich dem Haß entzog, weil sie einem andern Element zugehörig war. Alle vierzehn Tage gingen die Briefe zwischen dem Doktor und Margarete hin und her. Und dann, gegen Ende des Sommers, verstummte die Unbekannte. Plötzlich, ohne Erklärung, ohne Vorbereitung. Ein paar Tage gingen in Sorgen hin, aber von Hoffnung erhellt. Nach einer Woche zitterten Josephs Hände, wenn er die Post zu sortieren hatte. Nach zwei Wochen verzweifelte er. Ein fragender, besorgter Brief des Doktors ging hinaus, kam nicht zurück, blieb ohne Antwort. Es kam vor, daß der Doktor auf der Schwelle des weißen Hauses stand, wenn Joseph den Hügel heraufkam, und die Hand mit vorgetäuschter Gleichgültigkeit nach der Post ausstreckte, die er empfing. Noch eine Frage ging hinaus, kehrte nicht wieder, blieb ohne Antwort. Und dann schien es, als habe der Doktor vergessen, als habe er es eingeordnet in andere Erfahrungen ähnlicher Art, als versinke er nun tiefer noch als bisher in seine Arbeit, und seine Hand war wieder so ruhig wie früher, wenn sie sich hob, um die Post zu empfangen.
Aber Joseph vergaß nicht. Er litt. Er wußte, daß etwas geschehen sein mußte. Aber er konnte es nicht enträtseln. Er dachte, um Urlaub zu bitten und nach der fernen Stadt zu fahren, um zu wissen, selbst das Schlimmste, aber er lächelte bitter, wenn er das rote Postamt sah, die Schar seiner Kollegen, sein gelbes Fahrrad, die abgegriffene Tasche, die er jeden Morgen über die Schulter schob . . .
Nach sechs Wochen, als keine Hoffnung mehr in seinen sortierenden Händen war, lag der Brief da, ihre ernste Handschrift, die schwere breite Form des Umschlags, die sorgfältig eingefügte Marke. Er hob die Hand, aber der Hammer schlug nicht zu, sondern drückte sich leise auf das weiße Papier.
Unter den sich färbenden Linden öffnete er den Brief. „Ich bin sehr krank gewesen“, stand in müden Buchstaben da. „Schweres ist geschehen und soll geschehen. Vergeben Sie das Schweigen und lassen Sie mir etwas Zeit.“
Er legte die Post auf den Schreibtisch, suchte noch einmal in seiner Tasche und legte dann den Brief dazu, etwas abseits, so daß er allein auf der spiegelnden Platte lag.
„Noch etwas?“ sagte der Doktor ruhig. Aber dann legte die Hand sich hastig um das weiße Papier und blieb dort liegen, solange Joseph im Zimmer war. Es gelang Joseph nicht, die Antwort zu lesen. Als er die Nachmittagspost zum Bahnhof brachte und den grauen Beutel dem Zugführer reichte, stand der Doktor schon da und schob den weißen Umschlag in den Briefkasten des Zuges. Joseph hörte das Metallschild herunterklirren, und es war ihm, als versinke der Brief im Bodenlosen. Er stand noch da, regungslos, mit gehobenen Händen, als die Trillerpfeife schon erklang und der Zug sich in Bewegung setzte. Er sah nicht, daß der Doktor ihm zunickte. Er starrte dem Zug nach, bis der letzte Wagen hinter dem Sägewerk verschwand. „Er hatte vergessen . . .“, murmelte er, „er hatte kein Recht zu schreiben . . .“
Dann schob er den gelben Karren zum Dorfe zurück.
Er war krank. Er fieberte in den schlaflosen Nächten und schleppte sich an das kleine Fenster, weil er eine Stimme hörte, die von den nebligen Feldern nach ihm rief. Aber nur die Bäume rauschten im nächtlichen Wind, und der ferne Fluß ging als ein helles Band unter dem weißen Mond in die dunkle Welt. Er taumelte, wenn er zum Dienst ging, aber er meldete sich nicht krank. Der Brief würde kommen, der nächste, und er würde die Entscheidung bringen, die Klarheit, das Wissen.
Er kam, als die ersten Lindenblätter schon fielen. Joseph lag auf dem Hügel und hielt ihn in der Hand. Er war nun ganz ruhig. Die Krankheit war fort. Eine schwere Müdigkeit lag über seinen Gliedern, aber seine Seele war klar. Er erschrak nicht, als er las. Er zweifelte nicht, er zögerte nicht. Sie bat ihn zu kommen, sofort, ohne weitere Fragen, sie müsse ihn sprechen. Es gäbe kein Orakel mehr und keine Götter, die man fragen könnte. Aber es gäbe ihn und er werde alles wissen und entscheiden. Sie wohne für eine Woche in einem kleinen Landhaus in der Nähe der Stadt, allein, und bitte ihn, ihr zu telegraphieren. Sie werde ihn vom Bahnhof abholen. Die Zugverbindungen füge sie hinzu.
Joseph saß noch eine Weile, die Hände mit dem Brief um die Knie gefaltet, und sah auf die abgeernteten Felder hinunter. Braun und rot lag die Landschaft unter ihm gebreitet, nur die Pappeln hatten noch ihr grünes Laub. Das Fieber fiel von ihm ab, und als er aufstand und den Brief in seine Rocktasche schob, formten seine Lippen schon an den Worten, die er sprechen würde, dort an der kleinen Station, die bis zu den Geranien vor den Fenstern vor seinen Augen stand.
„Sonst nichts?“ fragte der Doktor und schob den Umschlag mit Korrekturen auf die Tischplatte zurück.
„Nein, sonst nichts, Herr Doktor“, erwiderte Joseph.
Am Nachmittag bat er um Urlaub, da er seit Wochen krank sei, erhielt ihn und fuhr am Abend schon in das dunkelnde Land hinaus, mit den Resten seiner glänzenden Zeit bekleidet und in einer dunklen Ledertasche die Abschriften aller Briefe mit sich führend, die zwischen zwei Fremden hin und her gegangen waren.
Er hatte ein paar lange Aufenthalte auf kleinen, verlassenen Stationen, ruhelos und ohne Schlaf, telegraphierte in der Morgenfrühe und traf um die Nachmittagszeit eines wolkenerfüllten, lautlosen Tages auf dem Bahnhof einer hügligen, waldumhüllten Landschaft ein.
Er sah nicht aus dem Fenster, stieg langsam aus, fühlte sein Herz in jagenden Stößen durch seinen erschöpften Körper schlagen, reichte dem Beamten an der Sperre seine Fahrkarte und hob dann erst, als sei nun alles hinter ihm geblieben, Geburt, Dasein und Name, als ein neuer Mensch den veränderten Blick in einen fremden Raum. Er sah die Geranientöpfe, die Uniform eines Postbeamten, den gelben Karren, rötlich gefärbten wilden Wein um einen Staketzaun und dahinter eine schreckliche Leere. Daß er aufrecht gehen müsse, dachte er noch, aufrecht und heiter wie ein Mensch, der in seiner Sommerfrische eintreffe. Aber als er den gelben Karren hinter sich gelassen hatte, verzerrte sich sein Gesicht, und die fremde Landschaft stürzte sich begrabend über ihn.
Und dann, als er um das Bahnhofgebäude bog, erhob sie sich von einer grüngestrichenen Bank. Er sah alles, was in seinem Gesichtsfelde lag, das Kleine wie das Große, mit gleicher Schärfe: den Kies des Bodens und ein paar verwelkte Birkenblätter, das Weinlaub um die Tür des Güterschuppens, ein verrostetes Schloß und die steile, glühende Wand der Wälder, die gleich hinter der Straße sich aufwärts hob. Und er sah ihr schwarzes, von schmalen Schultern lose fallendes Kleid, ihren dunklen Scheitel, das von innen Erleuchtete ihres blassen Gesichtes und die verwirrende Zartheit ihrer Hände, die mit einer Weinranke spielten.
Er blieb stehen und sah ihr entgegen. Jeder Schlag seines Herzens lief über das Entbundene seines Gesichtes. Er sagte nicht, was er die ganze Nacht vor sich hingesprochen hatte. „Es ist schön, daß sie gekommen sind“, sagte er und fühlte ein fremdes, vergangenes Lächeln um seine Lippen.