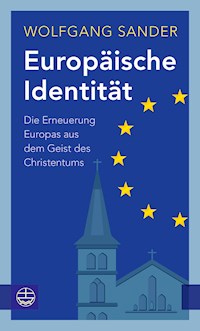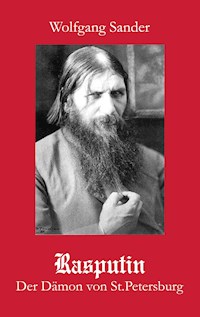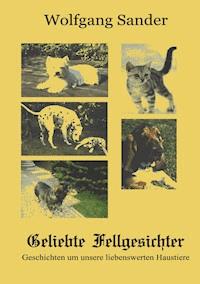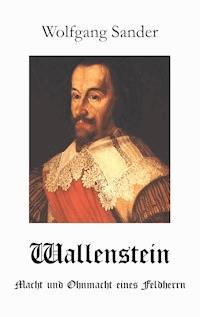
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Die historische Figur Wallensteins ist in der deutschen Geschichte umstritten. Die Historiker sind sich in ihrer Beurteilung der Person nicht einig. Während die einen den Menschen und Feldmarschall Wallenstein positiv einordnen, da er zweifellos ehrbare Absichten um die Einheit des damaligen Reiches hegte - insbesondere für liberaleres Denken in Glaubensangelegenheiten eintrat - werfen ihm andere Historiker seine politisch oft undurchschaubare Handlungsweise vor, die konträr zu seinem Einheitsgedanken stand. Die politisch fragwürdigen Entscheidungen könnten jedoch in seinem von schwerer Gicht geplagten Körper eine Erklärung finden, da die unter starken Schmerzen getroffenen Entscheidungen oft der politischen Situation nicht immer angepasst waren. So bleibt festzuhalten, dass neben seiner zweifellos hervorragenden militärischen Weitsicht und Klugheit auch ein übertriebener Ehrgeiz und seine - durch große Schwankungen gekennzeichnete Untreue dem Haus Habsburg gegenüber - ein nicht immer charakterfester Mann an seinen damals nicht zeitgemäßen Plänen scheiterte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 236
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kurfürstentag in Regensburg 1630
Ferdinand und Gustav Adolf – die Gegner
Das Massaker von Magdeburg
Zeiten des Übergangs
Questenbergs Auftrag, Leonores Besuch in Eger und Wallensteins Taktik
Im Lager vor Nürnberg
Ungewöhnliche Ereignisse
Der schlesische Feldzug
Unüberwindbare Gegensätze
Die Pilsener Reverse
Gärende Unruhe im Heer
Konspirationen
Wallensteins Ende
Zeittafel
Vorwort
Zum besseren Verständnis des Romans sei ein kurzer geschichtlicher Überblick – dessen Schwerpunkt auf der Biographie Wallensteins liegt – vorangestellt.
Wallenstein: Geboren am 15.09.1583 auf dem Gut Hermanic in Böhmen. Er verwaiste früh, sein Onkel brachte ihn in das von Jesuiten geleitete Adelsinternat in Olmütz. 1599 ging er zum Studium an die Universität Altdorf. Während dieser Zeit unternahm Wallenstein mehrere Reisen, die ihn nach Frankreich, Deutschland und in die Niederlande führten. Seinen Studienort verlegte er nach Padua, wo er nur das Fach Astrologie belegte.
1609 heiratete er Lucretia von Landeck, die aber schon 1614 verstarb. Von ihr erbte er große Besitztümer in Mähren, zu denen noch 14 Güter in Böhmen von seinem Onkel kamen. Damit zählte er zu den reichsten Edelleuten in Böhmen und Mähren.
In den folgenden Jahren errang er für Kaiser Ferdinand mehrere bedeutende Siege, wofür ihm die Herrschaft über Friedland gegeben wurde; er wurde zum Reichsgrafen ernannt, dann zum Fürsten, schließlich 1624 zum Herzog von Friedland. Gleichzeitig wurde er auch Mitglied im Kaiserlichen Kriegsrat.
1617 ging er die zweite Ehe mit der Gräfin Elisabeth von Harrach ein.
Es folgten Jahre, in denen er ein Heer aufstellte und als General-Obrist-Feldhauptmann für den Kaiser und die Liga viele Siege erfocht. Er schlug den Grafen Mansfeld an der Dessauer Brücke 1626; im August besetzte er ganz Mecklenburg und befestigte viele Häfen an der Ostseeküste (nur Stralsund konnte er nicht erobern); es war sein Plan, des Kaisers Herrschaft im Norden Deutschlands durch den Aufbau einer Seemacht zu stützen.
Er besetzte Teile von Brandenburg und Pommern; er wurde 1629 Lehnsherr und Herzog von Mecklenburg; aber seine Landsknechte wüteten unter der Zivilbevölkerung schrecklich; sie verwüsteten Häuser, ja, ganze Dörfer und Ländereien, so dass der Name Wallenstein gehasst wurde in weiten Teilen Deutschlands und die Eifersucht der Fürsten auf den Emporkömmling keine Grenzen kannte und sie in Opposition zu ihm gingen. Katholische und protestantische Reichsfürsten unter Federführung Maximilians von Bayern übten enormen Druck auf Kaiser Ferdinand aus, so dass er auf dem Kurfürstentag zu Regensburg im September 1630 Wallenstein absetzen musste.
Den Absetzungsbescheid erhielt Wallenstein vom Kriegsrat Questenberg in Memmingen, wo er sich zur Zeit aufhielt.
Nach seiner Absetzung begab Wallenstein sich auf seine Güter in Böhmen, wo er in aller Ruhe abwartete, bis er wieder gebraucht wurde. Er wusste nämlich von den kriegerischen Bemühungen und Absichten des Schwedenkönigs Gustav Adolf, der in der Schlacht bei Breitenfeld 1631 das kaiserliche Heer unter Tilly schlug, der bei Rain am Lech 1632 seinen tödlichen Verletzungen erlag.
Kaiser Ferdinand geriet darüber in arge Bedrängnis, er hatte nur noch wenige Bundesgenossen und kein einsatzfähiges Heer mehr. Deshalb wandte er sich wieder an Wallenstein, der nur unter schwerwiegenden Zugeständnissen seine Hilfe zusagte. So erhielt er den alleinigen Oberbefehl über ein neu aufzustellendes Heer, Begnadigungen und alle Konfiskationen wurden ihm allein übertragen. Der Kaiser sagte ihm außerdem ein österreichisches Erbland zu und die Oberlehnsherrschaft über die künftig eroberten Länder.
Wallenstein schaffte es tatsächlich, in relativ kurzer Zeit ein gewaltiges Heer auf die Beine zu stellen; dabei halfen ihm die allgemeine Not im Lande, der hohe Sold, den er den angeworbenen Landsknechten zahlte und ihre Hoffnung auf reiche Beute. So strömten Söldner aller Nationen und Religionen unter seinen Fahnen zusammen.
Mit diesem Heer vertrieb er die Sachsen aus Böhmen, und nach langem Zögern wandte er sich Bayern zu, um dem Kurfürsten Maximilian zu helfen, denn König Gustav Adolf bedrängte Nürnberg, der in der Nähe der Stadt eine feste Stellung bezogen hatte.
Wallenstein lagerte ihm gegenüber, wollte jedoch keine Schlacht. Da die Vorräte des Schwedenkönigs zu Ende gingen, griff er notgedrungen Wallensteins Lager an, wurde jedoch unter hohen Verlusten zurückgeschlagen. Die Schweden zogen sich in Richtung Donau zurück.
Wallenstein marschierte nach Sachsen, das mit Gustav Adolf verbündet war, eroberte Leipzig und vereinigte sich mit Pappenheim. Diese Gefahr erkannte der Schwedenkönig und wollte sie in ihren Anfängen verhindern. Bei Lützen kam es zur Schlacht (November 1632), in der Gustav Adolf tödlich verwundet wurde. Bernhard von Weimar übernahm die Führung des schwedischen Heeres, schlug Wallenstein, der sich daraufhin nach Böhmen zurückzog, um dort sein Heer zu ergänzen und zu reorganisieren.
Die Schweden bedrängten den Kurfürsten von Bayern, Wallenstein verharrte in Untätigkeit, er stellte sich taub gegenüber den Bitten des Kaisers, dem Kurfürsten zu helfen.
Zu dieser Zeit ist die Rolle Wallensteins äußerst undurchsichtig, seine politischen Pläne waren schwankend und nicht genau aufzuklären. Am wahrscheinlichsten waren sie wohl gerichtet auf eine starke Territorialmacht unter seiner Führung, einen dauerhaften Frieden mit den Protestanten, ohne dass ausländische Mächte darauf Einfluss nehmen konnten; aber auch auf Beschränkung der bayerischen Macht; gegen die Absichten des Kaisers und der klerikalen Hofpartei, die die unbedingte Niederwerfung des Protestantismus zum Ziele hatten.
Wallenstein begann auf eigene Faust Unterhandlungen mit den Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, auch mit dem schwedischen Kanzler Oxenstierna unter dem Vorwand, die in der Union Verbündeten voneinander zu trennen, einen Keil zwischen sie zu treiben.
Mit seinen Truppen ging er dann ins Winterquartier nach Böhmen und nicht, wie der Kaiser ihm durch Rat Questenberg befahl, nach Bayern, um Maximilian vor den Truppen der Union zu schützen. Und als dem General de Suys vom Kaiser befohlen wurde, nach Bayern zu marschieren, spielte Wallenstein seine Machtbefugnisse aus und befahl dem General unter Androhung der Todesstrafe, umzukehren.
Durch alle diese eigenmächtigen Handlungen gewannen seine Feinde am kaiserlichen Hof an Boden. Dem setzte Wallenstein den Versuch entgegen, die Armee für seine Pläne zu gewinnen. Es gelang ihm aber nicht, am 12. Januar 1634 in Pilsen seine Generäle durch ihre Unterschrift an ihn zu binden, ihm damit ihre unbedingte Treue zu erweisen. Die Generäle Octavio Piccolomini, Gallas und Aldringen verrieten seine Pläne dem Kaiser, und dieser unterzeichnete am 24. Januar ein Dekret, das Wallenstein als Verräter auswies und er deshalb zu Tode kommen sollte, zusammen mit seinen Vertrauten Terzky und Illo.
Ferdinand trieb hier ein arges politisches Spiel, denn er korrespondierte noch drei Wochen in freundlicher Weise mit Wallenstein; er erlaubte ihm sogar, mit Sachsen und Brandenburg über einen Frieden zu verhandeln.
Am 18. Februar, während Wallenstein auf dem Weg von Pilsen nach Eger war, erschien das gegen ihn gerichtete Pamphlet, in dem ihm Treulosigkeit und Tyrannei vorgeworfen wurde. Er versuchte noch, die Gunst des Kaisers zu erhalten, indem er Kuriere nach Wien sandte mit dem Erbieten, das Kommando über das Heer niederzulegen, aber die Nachricht erreichte den Kaiser nicht mehr.
In Eger traf Wallenstein am 24. Februar ein mit etwa sechshundert Dragonern, die unter dem Kommando des Iren Butler standen. Er war so krank, dass er in einer Sänfte befördert werden musste. Seine Frau und die Generäle Kinsky, Terzky und Illo begleiteten ihn.
In Eger schmiedete Butler mit einigen Offizieren ein Komplott gegen Wallenstein, in das Lesley, Deveroux und Geraldino verwickelt waren. Sie wollten den Kaiser von seinem angeblich untreuen Feldmarschall erlösen.
Während die Generäle Terzky, Kinsky, Illo und der Rittmeister Neumann bei einem Zechgelage niedergemacht wurden, drangen Deveroux und Geraldino in Wallensteins Zimmer ein, und Deveroux ermordete Wallenstein kaltblütig mit einer Partisane.
Der kaiserliche Hof gab eine offizielle Erklärung heraus, in der versucht wurde, die feige Tat an Wallenstein wegen Untreue und Verrat an der Sache zu rechtfertigen. Angeblich wurde diese Rechtfertigung durch die Aussagen seines Vertrauten Sesyma Raschin begründet und erhärtet.
„Der Krieg ernährt den Krieg“
(Schiller: Piccolomini 1,2)
Kurfürstentag in Regensburg 1630
Im Juni legten die kaiserlichen Schiffe in Wien ab und fuhren donauaufwärts nach Regensburg zum Kurfürstentag.
Fast über Nacht war der Sommer gekommen, er legte das Land lahm mit sengender Hitze. Die Schiffe glitten auf dem Strom dahin, rechts und links vorbei an den grünen Ufern des Donautales, vorbei an Klöstern und Burgen und Städten, die in ihrer Pracht leuchteten.
Doch die Schiffe waren schwarz geteert und zogen dunkel und drohend durch die sie umgebende gleißende Helle des Sommers. An jedem Bug stand ein Kreuz aus silberglänzenden Balken, in denen sich die Sonne spiegelte. Schwarz gestrichen zeigten sich auch Masten, Tauwerk und Rahen. Sie vollendeten den unheimlichen Eindruck. Nur die blähenden Segel hoben sich wohltuend von der Unheimlichkeit ab, weil auf ihnen die Jungfrau Maria mit dem Knaben im Arm in Blau und Rot gemalt war, umgeben von goldenen Sternen.
Die Donau hinauf fuhren zehn Schiffe, sie fuhren zum Kurfürstentag nach Regensburg. Der Kaiser und die Kaiserin wohnten im ersten, in den anderen waren die Räte untergebracht, vor allem auch Bedienstete, die für das leibliche Wohl des Kaiserpaares sorgten, und Soldaten der Leibwache. Es war früher Morgen. Aus den Kabinen des ersten Schiffes trat der Kaiser an Deck, ein schwarzgekleideter, schmalschultriger Mann, dem wohl der Krieg anzulasten war, der Krieg, der dreißig Jahre dauern sollte. Er strebte mit kleinen Schritten zum Heck, das einen hohen Aufbau auswies, der als Kapelle diente. Weihrauchduft umgab ihn, als er die Kapelle betrat, deren Wände schwarz getäfelt waren, nur im Hintergrund prangte ein elfenbeinernes Kruzifix, das mit goldenen Nägeln auf dem schwarzen Holz befestigt war. Rote Ampeln verbreiteten einen flackernden, unruhigen Schein zu beiden Seiten des Kreuzes.
Ferdinand, der Kaiser, nahm den spitzen Samthut vom Kopf, verneigte sich vor dem Kruzifix, kniete nieder und bekreuzigte sich. Dann begann er zu beten, zuerst ruhig und gefasst, als aber der Weihrauch stärker und stärker den Raum ausfüllte, geriet der hagere Körper in eine tranceartige Bewegung, und er bat Gott, er möge ihn stark sein lassen über die Unbill in der Welt, ihn – dessen Haus der alleinseligmachenden Kirche über Jahrhunderte hinweg treu gedient habe.
„Ich verstehe nicht, warum du die Ketzerei zuließest, Gott, verderbe sie, lass’ sie nicht weiterwachsen“, rief er betend aus. „Schütze mich und mein Haus, Allmächtiger, schütze all’ meine Heere, die doch auch die deinigen sind. Segne unsere Unternehmungen, Gott, lass’ das Sinnen und Trachten meines Feldherrn Wallenstein zu deiner Ehre gereichen und schütze alle meine Freunde und Getreuen. Aber vernichte unsere Feinde, den mit Blindheit geschlagenen schwedischen König; seine Schiffe sollen an den Küsten zerschellen, damit alle Welt sieht, du bist zornig über den ketzerischen König. Amen!“
Er erhob sich aus seiner knienden Haltung und verließ die weihrauchumnebelte Kapelle, schritt durch die Tür, trat auf das weißgescheuerte Deck und schloss – geblendet durch die strahlende Morgensonne – die Augen. Bedächtig setzte er seinen Spitzhut auf.
Ferdinand sah mit seinen fünfzig Jahren noch jung aus, obwohl sein dunkel gelocktes Haar an den Schläfen zu ergrauen begann. Ein schwarzer Bart umgab das blasse Gesicht, den hageren Körper bedeckte schwarzer Samt, nur spärlicher Silberbrokat quoll aus den Ärmelschlitzen hervor.
Bei seiner Wanderung über das Deck sah er kaum auf, in Gedanken versunken schritt er an den schwarzen gedrechselten Säulen entlang. Ein Schatten fiel auf seinen Weg, die Kaiserin Eleonore, seine Gemahlin, stand vor ihm. Vor einigen Wochen erst war die zwanzigjährige Prinzessin aus Mantua mit ihm vermählt worden. Sie war eine Schönheit, die das blasse Gesicht Ferdinands erröten ließ.
Trotzdem verlief die Begrüßung steif und unpersönlich. Er legte nur zwei Finger an den Spitzhut und meinte abweisend: „Warum musste ich die Kaiserin bei der Morgenandacht vermissen? Kaiser und Kaiserin sollten ihre Bitten gemeinsam vortragen, das bewirkt mehr, als wenn die Bitte nur von einem Herzen kommt.“
Bedrückt und niedergeschlagen sagte sie fast demutsvoll: „Ich kann nicht neben dem Kaiser beten, wenn er in seinem Gebet Mantuas Vernichtung erbittet; denn die Stadt ist die Stätte meiner glücklichen Kindheit und Jugend. Die Erinnerungen an meine Freundinnen, an meine erste Beichte in der Kathedrale, an das gewaltige Rauschen der Orgel, wie könnte ich um die Vernichtung dieser Stätten beten? Das kann der Kaiser doch nicht wollen!“
Ferdinands Blick war verschleiert, seine Stimme jedoch klang nüchtern und sachlich: „Mit der Belagerung Mantuas begann ich aus Überzeugung und auf Anraten meines Generals Wallenstein. Vorher aber ließ ich Euch durch meinen Rat Eggenberg schonungsvoll darauf vorbereiten. Das könnt Ihr nicht leugnen.“
Mit verbitterter und gereizter Stimme wiederholte sie: „Ja, schonungsvoll, das leugne ich nicht.“
Ihr Ton ließ den Kaiser schärfer darauf antworten:
„Ihr, Eleonore, seid nicht mehr die Prinzessin von Mantua, sondern die Kaiserin des Hauses Habsburg. Und als Folge daraus habt Ihr die Interessen des Reiches zu vertreten. Wenn der Kaiser seinen Machtbereich erweitern will, so kann ihn unangebrachte Mädchenschwärmerei nicht daran hindern. Uns missfällt auch die schwarze Kleidung der Kaiserin. Wir sehen darin einen Ausdruck der Trauer und des Widerspruchs.“
Eleonore stand mit gesenktem Kopf vor ihm, stumm nahm sie seine Vorwürfe entgegen.
„Das könnte als ein Zeichen des Widerstandes gedeutet werden“, fuhr der Kaiser fort, „in Regensburg aber, auf dem Kurfürstentag, wo mein Sohn Ferdinand zum künftigen Kaiser gewählt werden soll, darf jedoch nicht die Spur einer Unstimmigkeit gezeigt werden. Daher wünsche ich, dass die Kaiserin sich in heller Kleidung zeigt und gelassen und lächelnd die Aufwartung der Kurfürsten entgegennimmt.“
Nach einer kurzen Pause: „Nun wollen wir gehen.“ Damit begannen sie ihren morgendlichen Gang auf dem Bootsdeck, die Umgebung betrachtend, ab und zu kurze Gespräche führend.
Am Abend tafelten sie hinter einem Windschutz im Schein der Kerzen mit silbernen Gedecken und tranken roten Burgunder aus venezianischen Gläsern. Nur spärlich plätscherte das Gespräch dahin, und wenn Ferdinand sprach – er sprach jedoch mehr zu sich selbst – dann spürte man den Stolz über seine Macht, die sich auf das gesamte Reich erstreckte. Der Aufmarsch Wallensteins war beendet, fast überall standen die kaiserlichen Heere: in der sächsischen Lausitz, in Pommern, Mecklenburg und Brandenburg. Seine Truppen übten Druck aus auf die protestantischen Gebiete, nur Maximilian von Bayern brauchte Wallensteins militärischen Schutz nicht, er lehnte ihn ab.
Ferdinand hielt mit seinem Selbstgespräch inne, als ob er schon zuviel verraten hätte. Fröstelnd sah er in die hereinbrechende Dämmerung: „Die Luft ist feucht. Das ist schädlich. Lasst uns gehen, Eleonore.“
Eleonore wäre gern an Deck geblieben, um die Luft zu fühlen und die Sterne am Nachthimmel zu sehen, aber sie musste dem Kaiser in die nach Weihrauch und modrigem Wasser riechende Unterkunft folgen und sich dem lüsternen Willen ihres Mannes beugen.
Einen Tag Aufenthalt in Passau und weiter schoben sich die Schiffe stromaufwärts nach Regensburg. Das Herrscherpaar erging sich an Deck, wie es zur täglichen Gewohnheit geworden war. Der Oberhofmeister und Direktor des Geheimen Rates, Fürst von Eggenberg, trat auf sie zu und verneigte sich.
„In Passau empfing ich die Abordnung von Memminger Bürgern“, begann Eggenberg, dessen offenes, klares Gesicht einen ernsten Zug verriet. „Wallensteiner sind gestern eingefallen und hausen wie die Vandalen in der Stadt mit Überfällen, Gewalttätigkeiten und Erpressungen.“
Die Botschaft ließ den Kaiser kalt.
„Der dort befehlende General erhält eine Anweisung, er möge auf seine Männer mäßigend einwirken“, lautete seine Antwort.
Darauf Eggenberg, äußerst besorgt: „Es ist Wallenstein selbst, Majestät, er wohnt in Memmingen im Fuggerhaus, lässt sich jedoch nicht blicken. Seine Gicht plagt ihn und seine Galle. Dem Volk kam er nur bei seinem Einzug zu Gesicht, er soll ganz weiß geworden sein und die Haut gleiche zerknittertem Pergament.“
Schadenfreude überflutete des Kaisers Gesicht. „Weiß geworden...“ Er ließ die beiden Wörter auf der Zunge zergehen, kam dann jedoch gleich zur Realität zurück.
„Die Karte, Eggenberg!“
Eggenberg entrollte die Karte, legte sie auf einen schnell herbeigebrachten Tisch und erläuterte die Lage. Aus seinem Bericht ging hervor, dass Wallenstein sein Hauptquartier bis an die Grenze Bayerns zurückgezogen hatte, dennoch konnte er die Residenz des Kurfürsten Maximilian von Bayern und auch den Regensburger Kurfürstentag in wenigen Tagen erreichen.
Der Kaiser: „Was bedeutet das, Eggenberg?“
Der antwortete: „Wallenstein war so geschickt und hat in das Gebiet eines jeden Kurfürsten ein Heer gelegt. Durch diesen politischen Aufmarsch hat er die Mächtigen dieses Reiches in seiner Hand und schuf damit eine Art Gleichgewicht zwischen Frankreich und Schweden. Wahrscheinlich, Majestät, setzte er Eure Billigung voraus.“
Erregt erwiderte Ferdinand: „Das ist nicht zu verstehen. Er bedroht Unsere Kurfürsten ohne Unsere Bestätigung?“
Und, nach einer kurzen Zeit: „Ihr, Eggenberg, werdet sofort an Wallenstein schreiben und ihn ersuchen, seine Truppen aus bayerischem Territorium abzuziehen, ohne Schädigung des kaiserlichen Ansehens. Das Schriftstück soll jedoch freundlich und gnädig abgefasst werden, ohne harte Worte.“
Ein hoheitsvoller Wink, und Eggenberg war entlassen.
Eleonore stand während der Zeit abseits, sie beobachtete, hörte und merkte, dass Wallenstein wieder an Macht gewonnen hatte. Es war ihr jedoch nicht völlig klar, warum das Gebiet Maximilians von Bayern nicht angetastet werden durfte. Still stand sie und hörte die Selbstgespräche ihres Gemahls, der Wallenstein verdammte aus der Angst heraus, er könne sich mit dem Schwager Ferdinands gegen ihn verbünden.
„Nein, Wallenstein ist zu mächtig geworden, er nimmt sich zuviel heraus“, mit diesen Worten blieb er vor Eleonore stehen und mahnte: „Sieht die Kaiserin, wie das Haus Habsburg bedroht wird und wie notwendig es ist, meine Macht zu festigen?“
Eine Antwort wartete er nicht ab und begab sich unter Deck.
Am Nachmittag dachte die Kaiserin in ihrer Kabine über all’ das Gehörte nach und kam zu dem Schluss, dass auch ihr Gemahl, der herrische Kaiser, bestimmte Männer fürchten musste, Männer, über die er keine Macht hatte; da gab es Wallenstein, der sein Heer führte, und seinen Schwager Maximilian von Bayern, der die Armee der Katholischen Liga mit seinen Generälen Tilly und Pappenheim befehligte. Nichts hatte Ferdinand dagegen zu setzen, nur seine kümmerliche Leibwache. Er war also abhängig, und das erfüllte Eleonore mit einem Hochgefühl an Rachsucht – wegen Mantua.
In diese Überlegungen hinein platzte der Jesuitenpater Lamormain, der Beichtvater Ferdinands. Von großer Gestalt, musste er sich bücken, um nicht die Decke zu berühren. Mit wohltönender Stimme richtete er das Wort an die Kaiserin.
„Ich sehe, dass Ihr leidet, Majestät, ich sehe es an den Augen der Kaiserin und an ihrer Traurigkeit, die die Schönheit überschattet. Dem muss ich Einhalt gebieten, indem ich aufgrund meines Amtes versuche zu helfen.“
Eleonore blickte auf und sah in ein asketisches Gesicht, in dem wissende Augen etwas Tröstliches ausstrahlten.
„Ach, Lamormain, in den wenigen Wochen meines Lebens am Hofe seid Ihr der erste, der ein paar teilnehmende Worte zu mir spricht.“
Der Pater wirkte beruhigend: „Ihre großen Hoffnungen sind enttäuscht worden, Majestät, die junge Dame aus Mantua träumte sicherlich von großen Taten und weit reichender Macht. Euer Sehnen nach dem Guten hat sich bis jetzt nicht erfüllt. Hinzu kommt der Krieg um die Heimat Mantua, da muss ein junges Herz verzagen.“
Verständnisvoll nickte die Kaiserin ihm zu.
„Der Kaiser“, fuhr Lamormain fort, „wandelte sich in den letzten Jahrzehnten in seinen Meinungen und Anschauungen; auch er war voller Glauben und Hoffnung, aber immer wieder wurde er enttäuscht. Das macht hartherzig. Nun denkt er nur noch an die Vergrößerung seiner Macht; deshalb der Krieg gegen Mantua, deshalb will er seinen Sohn Ferdinand zu seinem Nachfolger bestimmen lassen in Regensburg, deshalb benutzt er jeden, der Habsburgs Macht stärkt und voranbringt. Braucht er ihn nicht mehr, lässt er ihn erbarmungslos fallen.“
Seine Worte sollten auf Eleonore wirken, daher eine kleine Pause und dann: „Dahinter versteckt sich sein Wissen, dass er sein Reich nicht wirklich beherrscht. Das tut ein anderer, den man in Wien kaum persönlich kennt, der wie ein Schatten hinter dem Kaiser steht – Wallenstein!“
„Ich ahnte es“, leise sprach Eleonore, „er führte den Krieg gegen Mantua, er zerstörte meine Heimat, er ist ein Böser. Aber Gott straft ihn, er leidet an Gicht und ist ergraut.“
„Majestät haben Recht, wir haben die Aufgabe, die Mauern der Kirche zu schützen und ihren Bestand zu wahren. Neue Gedanken würden die alte Ordnung zerstören. So sind auch wir Instrumente unseres Feldherrn, unseres Heiligen Vaters.“
„Und wem untersteht der Papst, Pater?“
„Er ist ein Werkzeug Gottes.“
„Aber der Herzog von Friedland?“
Schlau erwiderte Lamormain nach einer Pause: „Er befehligt zwar die Heere des Kaisers, ist jedoch ein Zweifler am Althergebrachten, in unseren Augen ein Ketzer. Solche Menschen wollen zerstören, darin sind sie unermüdlich bis an ihr Ende. Dem aber muss vorgebeugt werden, um der Gefährlichkeit die Spitze zu nehmen. Er wird in Regensburg scheitern. Er wird stürzen!“
„Eure Worte lassen mich besser die Wirrnisse dieser Vorgänge verstehen. Dafür danke ich Euch.“ „Mit Eurer Erlaubnis zeige ich Euch den Weg zur Macht, den es immer lohnt zu gehen, Majestät.“
Eleonore blickte ihn ungläubig an, noch verstand sie nicht, worauf der Pater hinauswollte.
„Meine Bitte an die Kaiserin“, leise und fast beschwörend fuhr der Pater fort, „lasst das Gewesene hinter Euch. Denkt nicht mehr an Mantua, ihr Schicksal ist besiegelt. Stemmt Euch nicht mehr gegen das Unvermeidliche. Versucht vielmehr, die Sorgen des Kaisers zu verstehen. Denn Euer Gemahl hat Sorgen, die um das Haus Habsburg und Wallenstein kreisen.“
Die Kaiserin schaute ihn verständnislos an.
Lamormain fuhr fort: „Wallenstein“, eindringlich klang seine Stimme, „ein Mann, der die Menschen stark beeindruckt. Aber was hat er schon geleistet? Fünf Jahre ist es her, seit er den Mansfeld an der Dessauer Brücke besiegte und ihn dann bis weit nach Ungarn hinein verfolgte. Dabei verlor er fast sein ganzes Heer. Ein zu teuer erkaufter Sieg. Nachdem Tilly den Dänenkönig geschlagen hatte, war es Wallenstein, der die Länder des Dänenkönigs, Schleswig und Jütland, besetzte und die Herzöge von Pommern und Mecklenburg vertrieb. War das eines Feldherrn würdig? Und dann sein absurder Befehl, die Stadt Stralsund zu belagern, ohne auch nur ein Schiff zu besitzen. Warum hält er seine mächtigen Heere zurück, hat er Angst, sie einzusetzen? Ihr, Majestät, dürft solche Fragen an den Kaiser stellen, weil Ihr begehrenswert seid, darum werden sie wie ätzende Säure wirken.“
„Ich meine, es gibt wohl noch mehr solche und ähnliche Fragen …“ Eleonore ließ den Satz unvollendet.
„Ja, um Wallenstein ist alles rätselhaft und geheimnisvoll“, setzte Lamormain seine Hetzkampagne gegen den Feldherrn fort, „seine starken Heere kosten Geld; das erpresste er aus den besetzten Gebieten, gab die Millionen Taler aber nicht alle für seine Soldaten und Landsknechte aus. Da drängt sich doch ein Verdacht auf!“
Nach einer kurzen Pause: „Warum verkleinert er sein Heer nicht? Der Kaiser müsse beschützt werden, sagt er. Das aber ist uns unverständlich. Wovor soll denn Majestät beschützt werden? Oder hat Wallenstein selbst damit vielleicht eine gewisse Bedrohung der Majestäten im Auge?“
Entsetzt schaute Eleonore den Pater an.
„Nach Euren Worten sind also das Reich, der Kaiser und Wien und selbst ich von der Gnade des Feldherrn abhängig? Das ist entwürdigend.“
Lamormain hakte mit leidenschaftsloser, jedoch wohltönender Stimme nach: „Ketzer sogar hält er in seiner Armee, Tausende von Soldaten und auch Fürstensöhne aus norddeutschen Landen. Herr von Arnim, ein Lutheraner, ist gar ein General geworden, und das in einer katholischen Armee! Damit kann kein Glaubenskrieg geführt werden; die von Ketzern durchsetzten Regimenter können den Schutz der katholischen Majestät nicht gewährleisten.“
Aufs höchste entsetzt und schwer atmend forderte Eleonore noch weitere Details zu erfahren.
„Dem kann der Kaiser nur die Würde der Krone entgegensetzen. Für den Ketzer Wallenstein bedeutet sie nichts. Er will die alten Mächte ablösen und sich selbst als neue Macht einsetzen. Das ist wohl sein Ziel. Vielleicht, Majestät, hängt von Eurem weiteren Verhalten als schöne, begehrenswerte Dame die Zukunft Europas ab.“
Hochroten Gesichtes flüsterte Eleonore: „Habt Dank für Eure ehrlichen Worte, Lamormain, ich habe in Euch einen Freund gefunden.“
Lamormain kreuzte die Arme, verneigte sich in gespielter Demut: „Und auch das Wohl der Kirche, meine Kaiserin.“
In den verbleibenden Stunden des Tages stellte Ferdinand überrascht fest, dass seine Gemahlin eine andere geworden war, nicht mehr so herb und verschlossen, ihre Stimme klang weich und hingebungsvoll, sie kleidete sich mit bunten, farbigen Gewändern. Und als der Morgen graute in ihrer spärlichen Kammer, als sie den schlafenden Kaiser neben sich sah, umspielte ein wissendes Lächeln ihren Mund: In diesen letzten Stunden hatte sie Macht über ihn bekommen, eine schrankenlose Macht, und sie nahm sich vor, diese Macht künftig auch auszunutzen.
Es war Abend geworden, als die kaiserliche Flotte in Regensburg vor Anker ging. Heiß war es an diesem Tag, ein heißer Wind wirbelte Staub auf, der in die allerfeinsten Ritzen und Öffnungen drang. Nachdem die Wiener die Schiffe verlassen hatten, standen sie wie verloren am Ufer und warteten auf das feierliche Einholen durch die Vertreter der Stadt. Ihre pompös anzusehende Kleidung stand in krassem Gegensatz zu ihrer Ungeduld, die sie mit leichten, trippelnden Schritten auf der Stelle zu überwinden versuchten.
Wie unbeabsichtigt schob sich Maximilian von Trautmannsdorf , der kaiserliche Rat, dicht neben die Kaiserin. Ein gnomenhafter, verwachsener Mensch, der seine missratene Gestalt durch hohe Absätze und einen hohen Spitzhut zu kaschieren versuchte.
„Majestät“, begann er leise, boshaft lächelnd, „der Dunst über der Stadt, die Rednertribüne mit dem verwelkten Laub, die Ehrenpforte mit ihren verstaubten Schnüren und Quasten, alles das sollte man für einen Wink des Schicksals halten und den Kurfürstentag nicht stattfinden lassen. Denn es gibt gewaltige Probleme, die ungeahnte Verwirrungen nach sich ziehen. Wenn Majestät einen Rat brauchen in diesem Spiel der Gedanken und Meinungen …“
„Womit, Herr von Trautmannsdorf, habe ich dieses fürsorgliche Ansinnen verdient?“
Von Trautmannsdorf kam auf sein eigentliches Ansinnen: „Unser gemeinsamer Freund ist der Pater Lamormain, Majestät. Der Feldherr jedoch ist unser gemeinsamer Feind. In der Stadt erwarten uns viele Helfer. Wir sollten sie nicht im Stich lassen.“
Damit verbeugte er sich zierlich und tänzelte mit seinen Stöckelschuhen davon. Verunsichert blieb die Kaiserin zurück.
Bald aber wurde sie abgelenkt durch die Ankunft der Magistratsbeamten, die atemlos angestürzt kamen, keuchend dienerten und sich für die nicht völlig abgeschlossenen Vorbereitungen entschuldigten: erst am nächsten Morgen sei der Kaiser erwartet worden. Daher kein Redner, kein Ehrentrunk und keine Absperrung der Straßen. In der Stadt zwängte und drängte sich das Gefolge aus Wien unter vielen Entschuldigungen der Beamten durch schmale Gassen, finstere Winkel und schiefe Häuser, durch Hitze und Staub, Kreischen und Gelächter, Wohlgerüche und Gestank. Die Leibwache musste alle nur erdenkliche Mühe aufbringen, um einen Weg durch die Menschenmassen zu bahnen.
Zornig schritt der Kaiser durch dieses ungebremste Gewühl, die Magistratsbeamten schwatzten unaufhörlich, um die Wut des Kaisers zu besänftigen. Die Stadt sei noch nie so überfüllt gewesen, aber die Kurfürsten von Köln, Trier und Mainz seien persönlich angereist, andere Kurfürsten hätten Bevollmächtigte geschickt, und alle hätten sie ein Heer von Untergebenen mitgebracht, Sekretäre und Schreiber, Köche und Diener, auch Kutschen, Fuhrwerke und Reitpferde; dazu die Gesandten aus Polen, Ungarn, Holland und Dänemark mit ihren Bediensteten. Daher seien alle Häuser bis unter die Dächer belegt, sie bedauerten das, aber der Kurfürstentag sei nun einmal einberufen worden und man müsse nun damit zurechtkommen.
Je mehr sich der Zug der Stadtmitte näherte, desto lärmender wurde das Gewühl. Düfte von Braten, Bier und Pfeifenqualm quollen ihnen entgegen, laute Musik dröhnte in ihren Ohren, Landsknechte und Nonnen schoben sich vorbei, Wagen, Sänften, Karossen versperrten ihnen oft den Weg. So gelangten die Wiener endlich in den Palast des Erzbischofs, dem Wohnsitz des Kaisers für die Zeit des Kurfürstentages.
Später, beim Abendmahl, betete der Erzbischof: „Lasset uns beten, dazu haben wir alle Ursach’; denn eben kam eine Nachricht: Die Flotte Gustav Adolfs liegt an der schwedischen Küste zum Auslaufen bereit.“-
Mit der Wiener Delegation war auch eine Schiffsladung Akten mitgekommen, die nach dem bischöflichen Palast befördert werden musste, und damit war Meggau beauftragt worden, der jüngste der kaiserlichen Räte, die mit nach Regensburg gekommen waren. Von mittelgroßer, hagerer Gestalt, mit rotblondem, schütterem Haar und einem nichtssagenden Gesicht, hielt er sich auch in den Sitzungen der Räte zurück mit seinen Aussagen und Urteilen. Er war kein Adeliger, sondern entstammte dem gehobenen Bürgertum. Dieser junge Rat Meggau nun musste die Beförderung und Lagerung der Akten überwachen.
In einem Raum ließ er die Bände an einer Längswand aufstapeln. Das erforderte Zeit, und darüber war es fast schon Morgen geworden, der in grauen Schleiern vor dem Fenster hing.
Meggau ging übermüdet und mit brennenden Augen an der Aktenmauer entlang, ein gequältes Lächeln in seinem Gesicht: Hier lag gebündelt der nun schon über zehn Jahre dauernde Krieg mit seinen Schlachtenberichten, Siegesmeldungen, Beschwerden, Bitten und Geschehnissen; das alles zusammengetragen in mühseliger Kleinarbeit, um letztendlich Archiv zu werden, verstaubt, begraben, vergessen.