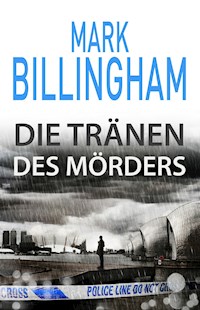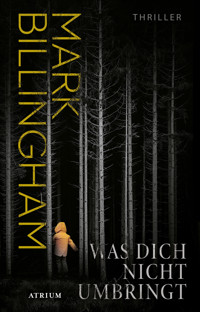
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Im Sommer 1996 laufen zwei kleine Jungen von einem Spielplatz in den angrenzenden Wald – doch nur einer von ihnen kommt wieder heraus, von dem anderen fehlt seither jede Spur. DS Tom Thorne nimmt sich des Falls an. Dieser gerät jedoch schnell außer Kontrolle, als zwei Personen, die mit dem vermissten Jungen in Verbindung stehen, ermordet werden. Und so kämpft Thorne, während sich London auf die Ausrichtung der Fußballeuropameisterschaften vorbereitet, mit den Wirrungen dieses rätselhaften Falls – und mit den hässlichen Folgen seiner zerbrochenen Ehe …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mark Billingham
Was dich nicht umbringt
Thriller
© Atrium Verlag AG, Zürich, 2023
Alle Rechte vorbehalten
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel Cry Baby bei Little, Brown Book Group, London
© 2020 by Mark Billingham
Aus dem Englischen von Stefan Lux
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03792-178-4
www.atrium-verlag.com
www.facebook.com/atriumverlag
www.instagram.com/atriumverlag
Für Claire.
Zwanzig Jahre später.
Immer noch Schokolade …
Auf halber Höhe der Haustür, dort wo die kackbraune Farbe nicht langsam abblättert oder vollständig fehlt, sieht er eine Reihe von Handabdrücken. Er stößt den Atem aus, den er unwillkürlich angehalten hat, beugt sich ein Stück vor und denkt an die feuchte Hand, die er am Tag zuvor im Revier geschüttelt hat, an den schwieligen Daumen und die dicken Finger; ihre Umrisse sind auf der Oberfläche perfekt zu erkennen, in Ziegelstaub und Blut.
Er legt seine eigene, viel kleinere Hand auf einen der Abdrücke und schiebt die Tür auf.
Schnell wie immer tritt er ins Haus.
Ein paar Sekunden bleibt er im Halbdunkel stehen.
Er lauscht und atmet prüfend ein.
Die Musik, die er aus einem der an die Diele grenzenden Zimmer hört – blechern, wie aus einem billigen Radio – ist dieselbe, die er am Tag zuvor aus dem Umkleideraum des Reviers gehört hat. Dieser Eurythmics-Song über Engel und Herzen. Auch die Gerüche sind vertraut, wenn auch nicht auf Anhieb zu identifizieren.
Aus der Küche etwas … Verbranntes oder im Topf Angesetztes. Der Schimmel hinter der Strukturtapete oder vielleicht in den nackten Dielen unter seinen Füßen … und ein wesentlich satterer Gestank, der aus dem oberen Geschoss herunterdringt und stärker zu werden scheint. Schwitzend bleibt er stehen und streckt einen Arm aus, um Halt zu suchen. Er könnte schwören, dass der Gestank sich wie weicher Nieselregen auf sein Gesicht und seinen Hals legt.
Verwesendes Fleisch und feuchtes Metall.
Im Gegensatz zur Diele ist die Treppe mit einem dicken Teppich ausgelegt. Sobald er den ersten Schritt nach oben macht, spürt er, wie sein Fuß tief in den Flor einsinkt. Er sieht hinab und entdeckt eine zähflüssige graugrüne Flüssigkeit, die hochsteigt und in seine Schuhe sickert. Schnell hebt er den Kopf und fixiert die oberste Stufe. In diesem Moment spürt er, wie etwas an seinem Fußgelenk entlangstreift. Als er das obere Ende der Treppe erreicht, ist er außer Atem, seine Socken sind durchweicht, und unter seinen Schuhsohlen bewegt es sich. Er drückt beide Füße fest auf den Boden, etwas wird zusammengepresst und platzt schließlich.
Die Galle steigt ihm hoch, er greift nach dem Treppengeländer. Für einen Moment hat er das Gefühl, jeden Augenblick hintenüberzufallen und die Treppen hinunterzustürzen.
Zu fallen wäre in Ordnung, denkt er, immer weiter zu fallen. Der Schmerz würde nicht lange dauern, und die Dunkelheit wäre besser als das hier.
Die Leere.
Er zwingt sich, einen Schritt zu machen, hält sich nach rechts und geht durch die Tür am Ende des Gangs, der schmaler wird und einen Bogen um den Fuß einer zweiten Treppe macht. Über ihm liegt das ausgebaute Dachgeschoss, und er weiß, dass die drei kleinen Betten, die dort stehen, ordentlich gemacht sind, eins wie das andere. Er muss nicht nachschauen, denn er weiß, dass dort oben niemand ist. Die Zeit drängt, er kann sich keine Verzögerung leisten.
Drei dicke Kissen, das ist alles. Drei Paare plüschiger Pantoffeln mit Augen, Ohren und Schnurrhaaren. Drei frisch gewaschene Kissenbezüge mit in Rot, Blau und Grün eingestickten Initialen.
L, S, A-M.
Er geht weiter auf das große Zimmer auf der Vorderseite des Hauses zu, das Elternschlafzimmer. Auf dieser Etage gibt es noch andere Räume, eine ganze Reihe von Türen, aber er weiß genau, wohin er gehen muss.
Wo er gebraucht wird.
Es sind noch sechs Meter, mehr als sechs Meter, aber es kommt ihm vor, als würde er die Tür mit wenigen Schritten erreichen. Sie öffnet sich, als er nach dem Türknauf greifen will. Sofort hebt er die Hand, um Nase und Mund zu bedecken.
Der Mann, der dort mit ausgebreiteten Beinen im Kamin sitzt, schaut auf, als würde er sich nicht darum scheren, dass sein halbes Gesicht fehlt und dass der größte Teil seines Gehirns wie getrockneter Porridge auf dem Spiegel über dem Kaminsims klebt. Als wäre ihm nicht klar, dass er eigentlich nichts sehen kann. Sanft schüttelt der Mann die Reste seines Kopfes, ein bisschen eingeschnappt, weil man ihn hat warten lassen.
Er sagt: »Da sind Sie ja endlich.«
Die drei Gestalten, die Seite an Seite auf dem Bett gegenüber liegen, rühren sich nicht. Ihre Haare sind gewaschen und gebürstet, ihre Nachthemden tadellos sauber. Sie schlafen, das ist alles, so muss es sein, auch wenn es natürlich seltsam ist, dass der Gewehrschuss sie nicht geweckt hat.
Um auf sich aufmerksam zu machen, räuspert sich der Mann im Kamin. Es klingt rasselnd vor Blut, wobei es kaum vorstellbar ist, dass er noch Blut in sich hat. Es rinnt so viel an der Wand herunter, durchtränkt seine Weste, kriecht an seinen Beinen entlang über die Fliesen. Er hebt einen Arm und bietet Thorne das Gewehr an. Lässt es baumeln.
»Es ist immer besser, auf Nummer sicher zu gehen«, sagt er. »Und ich weiß, wie sehr Sie es wollen.«
Beim ersten Mal hat er gezögert, auch noch bei den nächsten paar Malen. Jetzt aber tritt er vor, nimmt in Ruhe, was ihm angeboten wird, und beugt sich hinunter, um den Lauf gegen die Stirn des Mörders zu pressen. Er sieht, wie das Metall ins zerrissene weiße Fleisch eindringt, schiebt es in die Höhle, die einmal das Gehirn des Mannes enthalten hat.
»Netz und doppelter Boden, Tom«, sagt der tote Mann. »Netz und doppelter Boden …«
Er schließt die Augen und drückt nur zu gern den Abzug.
Als er den Rückstoß nach der Explosion spürt, spritzt etwas Warmes auf seine Wange und seine Ohren dröhnen. Er dreht sich um und sieht die sechs weißen Füße, die in einer Reihe auf der Bettkante liegen. Es ist eigentlich seltsam, denn er kann kaum etwas hören, aber plötzlich wird diese Stimme lauter – die Musik, die immer noch unten aus der Küche dringt, das Lied über Engel. Wenn man es gründlicher bedenkt, ist es vielleicht nicht seltsamer als alles andere, trotzdem ist ihm jedes Mal bewusst, wie sonderbar es ist, und wie passend.
Inzwischen glaubt er, dass es einfach daran liegt, dass der Song den perfekten Soundtrack für den Moment bietet, wenn das jüngste Mädchen leise stöhnt und dann die Augen öffnet. Wenn die drei sich, eins nach dem anderen, aufsetzen und ihn mit großen Augen anschauen, blinzelnd und verwirrt.
Inzwischen wachte Thorne morgens nicht mehr ruckartig auf. Er keuchte und schrie nicht mehr. Stattdessen war es mittlerweile eher so, als stiege er aus der dunklen Tiefe des Wassers langsam an die helle Oberfläche. Dabei blieb alles still, bis seine Bartstoppeln über das Kissen kratzten, wenn er mit einem Ruck den Kopf drehte, um zu sehen, ob seine Frau neben ihm lag.
Natürlich tat sie das nicht.
Es war besser, dachte er, dass Jan nicht mehr da war, die nur noch auf dem Papier seine Ehefrau war. Er konnte sich gut ausmalen, was sie wahrscheinlich gesagt hätte. Und in welchem Tonfall. Darin hätte Sorge mitgeschwungen, klar, aber auch etwas anderes, das ihm deutlich machte, dass sie der Sache überdrüssig war und langsam die Geduld verlor. Was auch für viele andere Dinge galt.
Wieder der Traum?
Nicht genau derselbe.
Zehn Jahre, Tom.
Es ist wohl kaum meine Schuld.
Sogar noch mehr …
Er zog sich schnell an und ging nach unten. In der Küche schaltete er den Wasserkocher ein, dann das Radio und steckte zwei Scheiben Brot in den Toaster. Er holte Butter und Marmite aus dem Kühlschrank und merkte, dass er »There Must Be An Angel« vor sich hin summte. Als er sich schließlich Milch in seinen Tee goss, ging er allerdings dazu über, stumm den Song der beiden Comedians aus Fantasy Football League mitzusingen, der alle fünf Minuten im Radio zu laufen schien. Ehrlich gesagt ging er ihm langsam auf die Nerven, was auch daran liegen mochte, dass einer der beiden ein verdammter Chelsea-Fan war. Thorne konnte nicht richtig glauben, dass der Fußball nach Hause kommen und der Schmerz von dreißig Jahren in der nahen Zukunft enden würde. Aber es ließ sich nicht leugnen, er freute sich auf die drei bevorstehenden Wochen.
Vorausgesetzt, es kam nichts dazwischen.
Jan und der Wichser, mit dem sie jetzt zusammenlebte.
Ein Mord.
Er hatte mit ein paar Jungs auf der Arbeit gesprochen und versucht, seine Schicht zu tauschen, um am Nachmittag das Eröffnungsspiel zwischen England und der Schweiz sehen zu können, aber davon wollte sein DI nichts wissen. Thorne hatte sich alle Mühe gegeben, seinen Ärger nicht zu offen zu zeigen. Sicher lag es daran, dass der Mann Schotte war. Wahrscheinlich würde das miese Arschloch sowieso die Schweizer anfeuern. Sollte ein Wunder geschehen und der Arbeitstag ruhig verlaufen, hatte er vielleicht immer noch die Möglichkeit, um die Ecke ins Oak zu laufen und das Spiel dort zu sehen. Im schlimmsten Fall würde er irgendwo ein Radio auftreiben.
Bis dahin würde er auch damit aufgehört haben, seine Wange zu berühren, um Spritzer abzuwischen, die nicht da waren. Und der üble Geruch, von dem er glaubte, er klebte an ihm, würde ein wenig nachgelassen haben.
Nicht, dass es viel zu bedeuten hatte.
Er machte sich nichts vor.
Die Erinnerung daran, was in dem Haus tatsächlich geschehen war, würde natürlich immer gegenwärtig sein, aber so hartnäckig sie sich auch hielt, der Traum unterschied sich doch deutlich von der Wirklichkeit. Aus unerfindlichen Gründen tauchte die Ehefrau selten auf, die erwürgt in der Küche lag, die Thorne nie betrat. Die Mädchen waren in Wirklichkeit in einem kleinen Schlafzimmer im hinteren Teil des Hauses gefunden worden, nebeneinander auf dem Boden liegend, zwischen Etagenbetten und einer Matratze. Und das Entscheidende: Menschen starben immer nur einmal.
Thorne brachte sein schmutziges Geschirr zum Abtropfbrett. Er schaltete das Radio aus. Dann nahm er seine Tasche und die Lederjacke vom Stuhl, auf den er sie am Abend zuvor geworfen hatte, und ging hinaus in den Flur.
Er hob eine Hand, drückte sie flach gegen die Haustür und staunte, wie klein sie wirkte. Die Abdrücke auf jener Tür waren ein neues Element in seinem Traum gewesen, wie auch das schleimige Zeug auf der Treppe. Alles so unangenehm wie immer, aber nichts, womit er nicht leben konnte, nichts, mit dem er nicht bereitwillig leben würde. Er öffnete die Tür, blinzelte ins Sonnenlicht und sah dem Nachbarn von gegenüber eine Weile dabei zu, wie er sich abmühte, eine Fahne mit dem Georgskreuz an die Antenne seines Wagens zu montieren.
Der Mann schaute auf und winkte. »Was meinen Sie, lockerer Sieg heute?«
»Ich will es hoffen«, sagte Thorne.
Er dachte: Netz und doppelter Boden …
Der Traum war jedes Mal viel besser als die Erinnerung.
Denn im Traum konnte er sie retten.
TEIL EINSVERSTECKEN
EINS
»Süß«, sagte Maria.
Cat schaute sie an. »Was?«
»Die beiden zusammen.« Maria lehnte sich auf der Bank zurück und deutete mit dem Kinn zu den beiden Jungen auf dem Spielplatz. Ihr Sohn, Josh, war gerade in den Sand am Ende der Rutsche gefallen, und Cats Sohn, Kieron, half ihm auf. Die Jungen klatschten ein wenig unbeholfen ab und liefen schreiend und lachend zum Klettergerüst.
»Ja«, sagte Cat grinsend. »Echte Kumpels.«
»Wir können so was doch immer noch machen, oder?«, fragte Maria. »Wenn du umgezogen bist.«
»Noch bin ich ja nicht umgezogen.« Cat trank einen Schluck vom Tee, den sie in der kleinen Cafeteria in der Nähe des Eingangs besorgt hatten. »Es kann immer noch schiefgehen.«
Maria schaute sie an, als erwartete sie, dass ihre Freundin noch etwas hinzufügen würde, was sie ihr bisher verschwiegen hatte.
»Ich meine, so was kommt vor, oder? Mehr sage ich ja nicht. Irgendein Formular, das nicht ordentlich ausgefüllt ist oder so.«
»Aber angenommen, alles läuft glatt«, sagte Maria. »Es wäre doch jammerschade, wenn wir nicht mehr mit ihnen herkommen können.« Sie schaute wieder zum Spielplatz, wo die beiden Jungen von der höchsten Stelle des Klettergerüsts winkten. Die beiden Frauen winkten zurück und riefen ihren Kindern beinahe unisono zu, sie sollten vorsichtig sein. »Sie haben wirklich Spaß.«
»Weit weg ziehe ich ja nicht.«
»Das fände ich auch schlimm.«
Lächelnd lehnte Cat sich an sie. »Du kannst Josh auch zu mir rüberbringen. Setz deinen faulen Hintern ins Auto. In Walthamstow gibt es auch anständige Parks.«
»Aber das hier ist unser Ort«, sagte Maria. »Es ist ihr Ort.«
Eine ältere Frau, der sie oft im Wald begegneten, kam mit ihrem kleinen Hund vorbei. Wie immer kamen die Jungs angelaufen und sorgten für ordentlich Aufregung. Cat und Maria hörten der Frau zu, wie sie sagte, es sei so schön, draußen herumzulaufen, jetzt, wo es endlich warm geworden war. Dann erzählte sie den Jungen von einer Kampagne für neue Fledermauskästen und Futterhäuser für die Vögel. Sie redete noch ein paar Minuten weiter, auch als die Jungen das Interesse schon verloren hatten und auf den Spielplatz zurückgerannt waren. Dann verabschiedete sie sich.
»Wie macht Josh sich in der Schule?«, fragte Cat.
Maria zuckte die Achseln. »Nicht so toll, aber ich glaube, es wird langsam besser.«
»Das ist gut.«
»Und Kieron?«
»Na ja, er vermisst Josh immer noch. Er sagt immer, wie unfair es ist, dass sie nicht in dieselbe Schule gehen können.«
»Es ist wirklich unfair.« Verärgert schüttelte Maria den Kopf. »Eine Nachbarin von mir hat sich so ein Messrad gekauft. Damit ist sie die ganze Strecke von ihrer Haustür bis zum Schultor abgegangen, um der Gemeinde zu beweisen, dass sie innerhalb des Einzugsgebiets wohnt. Anscheinend fehlen dreißig Meter. Das ist lächerlich …«
»Wahrscheinlich wird er da sowieso nicht mehr lange bleiben«, sagte Cat.
»Stimmt.«
»Hoffen wir das Beste.«
»Wie sieht es in der neuen Gegend mit Schulen aus?«
»Ziemlich gut, tatsächlich. Die nächste liegt nur eine Viertelstunde zu Fuß von der Wohnung entfernt, aber es ist eine kirchliche Schule.« Cat schüttelte sich. »Wenn er da hinwill, muss ich so tun, als ob ich eine echte Betschwester wäre.«
»Ein paar Kirchenlieder wirst du doch kennen«, sagte Maria.
»›All Things Bright And Beautiful‹, und damit hört’s schon auf. Ich weiß auch nicht, ob ich mit dem ganzen Drum und Dran zurechtkommen würde. Als ich da war, um mir den Laden mal anzuschauen, hatte eine von den anderen Müttern einen Schnurrbart, auf den Magnum stolz gewesen wäre.«
»Wie bitte?«
»Anscheinend weil sie nichts an dem ändern will, was der Herr ihr gegeben hat.«
»Du willst mich auf den Arm nehmen.«
»Verrückt, oder? Egal, es gibt noch eine andere Schule, die mit dem Bus gut zu erreichen ist, also kein Problem. Es wird schon irgendwie funktionieren.« Sie stand auf und wischte Blütenblätter von ihrer Jeans. »Ich muss mal dringend pinkeln …«
»Pizza, wenn du wieder da bist?«
Cat blickte zu ihrem Sohn und seinem besten Freund hinüber.
Die Jungen gingen langsam am Rand des Spielplatzes entlang, im Gleichschritt und offenbar in ein ernstes Gespräch vertieft. Josh hob die Arme und schüttelte den Kopf. Kieron machte es ihm nach. Höchstwahrscheinlich unterhielten sie sich über Rugrats, aber es sah aus, als könnten sie ebenso gut über Rinderwahnsinn oder die wachsenden Spannungen im Nahen Osten diskutieren.
Cat lächelte. »Das klingt nach einem Plan.«
»Ich hole die Jungs dann.«
Maria sah Cat hinterher, wie sie durch die Bäume hindurch zu den Toiletten beim Café ging, dann drehte sie sich wieder zu den spielenden Kindern um. Es war kein leeres Gerede gewesen: Sie würde Cat nach deren Umzug wirklich vermissen. Es wäre schade, sie nicht mehr so oft sehen zu können. Ihre Freundschaft war ungewöhnlich, das sagten sie sich immer wieder. Maria war fünf Jahre älter und wohnte in einem hübschen Haus in Muswell Hill, während Cats Nachbarschaft in Archway ein bisschen … rauer und bodenständiger war, genau wie Cat selbst.
Sie hatte mitgekriegt, wie andere sie als seltsames Paar bezeichnet hatten.
Aber sie waren richtig gute Freundinnen geworden, egal, wie unpassend es auf andere wirkte. Wahrscheinlich war Cat Marias engste Freundin, ganz sicher sogar. Gelegentlich erwischte Maria sich bei einem Anflug von Eifersucht, wenn Cat zu ausführlich über irgendwelche anderen Bekannten sprach. Maria hatte schon vor Ewigkeiten den Kontakt zu ihren Freundinnen von der Uni verloren, und auch an ihrer Arbeitsstelle stand sie niemandem besonders nahe. Die meisten Frauen, die sie bis vor wenigen Jahren als Freundinnen betrachtet hatte, waren nach der Scheidung auf mysteriöse Weise aus ihrem Leben verschwunden. Fast alle waren in einer Beziehung gewesen und hatten vielleicht einfach keine peinlichen Situationen aufkommen lassen wollen. Doch Maria glaubte eher, dass diese Frauen sie von Anfang an nicht besonders gemocht hatten und dass sie letztlich ohne sie besser dran war.
Dass sie immer noch Zeit hatte, sich neue Freunde zu suchen. Echte Freunde.
Inzwischen jagten Josh und Kieron sich gegenseitig über den ganzen Spielplatz. Als sie an ihr vorbeikamen, schnitten sie Grimassen. Am hinteren Ende des Geländes blieben sie einen Augenblick stehen, um Atem zu holen. Dann flüsterte Kieron Josh etwas zu und rannte los in den Wald.
Maria rief ihnen zu, warnte ihren Sohn, nicht zu weit weg zu gehen, dann sah sie ihn seinem Freund hinterherlaufen.
Sie und Cat hatten sich vor fünf Jahren kennengelernt, in einer Gruppe für Mütter und Kleinkinder in Highgate, vielleicht anderthalb Kilometer entfernt von wo sie jetzt saß. Beide hatten dem Charme des grimmig blickenden Gruppenleiters widerstanden. Beide hatten sich über den kleinlichen Geltungsdrang einiger ehrgeiziger Mitglieder amüsiert. Sie hatten darin übereingestimmt, dass Wein – oder besser noch: Whisky – eine wesentlich erfrischendere Wirkung hatte als grüner Tee und Kekse. Schnell hatten sie beschlossen, sich auch außerhalb der Gruppe zu treffen.
Voller Freude hatten sie entdeckt, wie viele Gemeinsamkeiten sie hatten. Zumindest in den wichtigen Dingen. Sie beide waren zum Beispiel alleinstehend, wenn auch aus ziemlich unterschiedlichen Gründen.
Maria blickte auf und sah Josh in seiner knallgelben Jacke zwischen den Bäumen hinter dem Spielplatz laufen. Lächelnd erinnerte sie sich an seine Reaktion, als sie ihm die Jacke mit nach Hause gebracht hatte.
»Damit sehe ich aus wie eine Riesenbanane, Mummy.«
Natürlich hatte Cat recht, wie in den meisten Fällen. Sie war die Tapfere mit der Verdammt-wen-interessiert’s-Haltung, deren Glas immer halb voll war. Es gab keinen Grund, warum sich etwas ändern sollte, jedenfalls nichts, worauf es ankam. Maria brauchte sich keine Sorgen zu machen. Sie würden nicht mehr so oft zu viert in den Wald kommen, aber es war auch nicht so, als wären Cat und Kieron aus der Welt. Außerdem bestand natürlich immer noch die Möglichkeit, dass es gar nicht zum Umzug kommen würde. Das hatte Cat ja selbst gesagt. Aber was immer passieren würde, entscheidend war, dass die Jungs in Kontakt blieben und sich so oft wie möglich sahen.
Das war auch für Maria wichtig.
Sie nahm die Zigaretten aus ihrer Handtasche und zündete sich eine an. In Joshs Gegenwart rauchte sie nie, aber wenn er nicht zu sehen war, konnte sie der Gelegenheit zu einer schnellen Zigarette manchmal nicht widerstehen. Sie hatte sich das Rauchen auf das Drängen ihres Mannes hin abgewöhnt und wieder damit angefangen, als er ihr Exmann geworden war.
Eine Zigarette zu einem Glas Wein am Abend. Mehrere zu mehreren Gläsern.
Sie lehnte sich zurück, schloss die Augen und stieß den Rauch langsam aus. Sie blickte wieder auf, als sie einen der Jungen irgendwo im Wald rufen hörte. Sie konnte ihn nicht verstehen, war nicht mal sicher, welcher von beiden es war, denn sie ähnelten sich in so vielen Dingen. Sie waren gleich groß, hatten dieselbe Statur und dieselbe Haarfarbe. Maria hatte aufgehört zu zählen, wie oft sie versehentlich Kieron an die Hand genommen hatte und mit ihm losgegangen war.
»Du kannst sie auch beide mitnehmen, wenn du das wirklich willst«, hatte Cat beim letzten Mal gesagt und gelacht, obwohl sie selbst schon mehrmals denselben Fehler gemacht hatte. »Dann nehme ich einen Flug nach Mallorca und bleibe zwei Wochen weg.«
Als sie sich umschaute und Cat zurück zur Bank kommen sah, drückte Maria sofort die Zigarette aus. Aber die Miene ihrer Freundin verriet ihr, dass sie nicht schnell genug gewesen war.
»Ich dachte, damit wolltest du aufhören.«
»Ich versuche es«, sagte Maria. »Aber es ist nicht so leicht.«
»Wenn du mir eine gibst, tue ich so, als hätte ich nichts gesehen.«
Wieder griff Maria in ihre Tasche und streckte ihrer Freundin die Schachtel Silk Cut entgegen. Cat nahm eine Zigarette und schaute zum Spielplatz. »Wo sind die Jungs?«
»Sie spielen im Wald«, sagte Maria und deutete in die Richtung. »Ich hab Josh gerade gesehen …«
Ohne auf Feuer zu warten, ging Cat Richtung Spielplatz.
Auch Maria stand auf. »Ich hab sie rufen gehört …«
Mit schnellen Schritten überquerte Cat den Spielplatz und ging auf den Ausgang am anderen Ende zu. Sie rief den Namen ihres Sohnes, ohne auf die Blicke der anderen Eltern zu achten, deren Kinder jetzt aufhörten zu spielen und neugierig herüberschauten. Maria eilte ihr nach. Beide blieben abrupt stehen, als Josh plötzlich zwischen den Bäumen auftauchte und auf sie zulief.
Seine gelbe Jacke war lehmverschmiert. Sobald er seine Mutter entdeckte, brach er in Tränen aus.
»Josh?« Maria beugte sich hinunter und legte die Hände ans Gesicht ihres Sohnes. »Alles in Ordnung?«
»Wo ist Kieron?«, fragte Cat und schaute zu den Bäumen hinüber. »Josh, wo ist Kieron?«
Der Junge begann zu heulen und vergrub sein Gesicht im Bauch seiner Mutter.
Cat ließ die unangezündete Zigarette fallen und lief los.
ZWEI
Im traditionellen Sinne hätte Thorne sich nicht als abergläubisch bezeichnet. Er hatte kein Problem damit, unter Leitern hindurchzugehen, und hielt nichts von dem Unsinn, dass schwarze Katzen Glück – oder Unglück – bringen sollten. Doch wie die meisten Polizisten, die er kannte, und wie fast alle, die auf die eine oder andere Weise mit Notfalleinsätzen zu tun hatten, achtete er peinlich genau darauf, niemals von einer ruhigen Schicht zu sprechen. Es gab nicht viele Regeln, auf die er schwor, aber diese – auch wenn es eine ungeschriebene war – gehörte eindeutig dazu. Nur Masochisten und Geisteskranke redeten so. Wer dumm genug war, es trotzdem zu tun, musste mit einem leichten Klaps oder zumindest mit etwas ziemlich Ekligem in seinem Tee rechnen.
Bestimmte Dinge sagte man einfach nicht.
Vor einer halben Stunde hatte Thorne noch entspannt im Oak gesessen und vergnügt mit einem Kollegen darüber diskutiert, welche Aufstellung Terry Venables wohl ins Spiel schicken würde. Plötzlich hatte sich der hirnlose DC aber zu ihm herübergebeugt, die Hände gerieben und gesagt: »Zum Glück ist es eine ruhige Schicht.« In diesem Augenblick war Thorne klar gewesen, dass seine Chancen, das England-Spiel live zu sehen, komplett den Bach runtergegangen waren.
Logischerweise hatte sich keine fünf Minuten später sein Piepser gemeldet.
Er hatte eigentlich gerade ein neues Guinness bestellen wollen, jetzt stürzte er stattdessen den Rest seines alten herunter und ging zum Telefon hinter der Bar, um die Zentrale anzurufen. Während er sich Notizen machte, warf er dem DC, der nun von allen am Tisch eins aufs Dach kriegte, zornige Blicke zu. Gleichzeitig fragte er sich, wie er den Arbeitstag, der plötzlich ziemlich lang zu werden versprach, hinter sich bringen sollte, ohne das Resultat zu erfahren. Unwillkürlich musste er an diese Episode der Serie Whatever Happened to the Likely Lads? denken, in der Bob und Terry vor dem gleichen Problem stehen.
Thorne parkte auf der Muswell Hill Road hinter einer Reihe von Streifenwagen und ging ein Stück zurück den Hügel hinauf zum Eingang am Gypsy Gate. Er wurde von einem PC angehalten, der noch unglücklicher wirkte, hier sein zu müssen, als er selbst. In unmissverständlichen Worten wurde ihm erklärt, der Wald sei im Augenblick für die Öffentlichkeit gesperrt. Thorne zeigte dem Mann seinen Dienstausweis und betrat das Gelände. Der Weg unter seinen Füßen war nach einer guten Woche mehr oder weniger ununterbrochenen Sonnenscheins steinhart. Als er an einem der Wärterhäuschen vorbeiging und sich nach links in Richtung Spielplatz wendete, konnte er sich die künstlich aufgeregte Stimme John Motsons vorstellen: »Perfekte Bedingungen fürs Spiel hier in Wembley heute Nachmittag …«
Thorne kannte den Highgate Wood ein bisschen, da er ein- oder zweimal mit Jan hier gewesen war. Er hatte sich nie besonders für Spaziergänge begeistert, es sei denn, sie führten möglichst direkt zu einem Pub. In den unglücklichen Fällen, in denen es Jan gelungen war, ihn aus dem Haus zu zerren, waren sie meist nach Highbury Fields gegangen, was näher an ihrem Haus lag, oder hinüber zum Waterlow Park, etwa anderthalb Kilometer südlich, zwischen hier und Archway.
Vielleicht machte ihr Dozentja gerne Spaziergänge, dachte Thorne.
Er schob einen Ast zur Seite.
Vielleicht hatte das die große Anziehungskraft ausgemacht.
Vielleicht war das rückgratlose Arschloch ein Wandersmann.
Thorne nickte einem vage bekannten DC zu, der eins dieser hochmodernen tragbaren Telefone mit sich herumschleppte, die inzwischen an ausgewählte Einsatzgruppen ausgegeben wurden, meist zur Benutzung in entlegenen Gebieten. Sie sahen aus, als hätte ein Schweißer-Azubi sie zusammengebaut: unförmige graue Kästen mit einem angedeuteten Griff, einer Gummiantenne und einem Hörer. Thorne begriff den Sinn dieser Geräte, und im Notfall, wenn die nächste Telefonzelle kilometerweit entfernt war, mochten sie ihren Nutzen haben. Bei den wenigen Gelegenheiten allerdings, bei denen er Anlass gehabt hatte, eins zu benutzen, hatte er keinerlei Signal empfangen.
In letzter Zeit allerdings hatte er häufiger richtige Mobiltelefone gesehen. Bei mehreren Gelegenheiten hatte er Yuppies mittleren Alters dabei beobachtet, wie sie in Geräte brüllten, die wie riesige Walkie-Talkies aussahen. Gelegentlich hatte er auch in Autos gesessen, in deren Mittelkonsole das Kabel eines Telefons eingesteckt war. Er rechnete damit, dass diese Dinger in absehbarer Zeit ziemlich verbreitet – und sicher auch kleiner – sein würden, aber seit er im Schaufenster von Dixons ein Preisschild gesehen hatte, bezweifelte er, dass Leute, die nicht mehrere Hunderttausend Pfund im Jahr verdienten, sich je so etwas leisten können würden.
Ein modisches Spielzeug für Deppen und Reiche.
Bis Thorne endlich den oberen Teil des Klettergerüsts sehen konnte, hatte er bei einem weiteren halben Dutzend männlicher und weiblicher Constables seinen Dienstausweis vorzeigen müssen. Rund dreimal so viele Beamte hatte er langsam zwischen den Bäumen hindurchstreifen oder sich den Weg durchs dichte Unterholz bahnen sehen. Was kaum überraschend war. Er wusste, wenn ein Kind vermisst wurde, trommelten die meisten uniformierten Polizisten zunächst so viele Kollegen zusammen wie irgend möglich. Erst wenn das Kind nach einer halben Stunde noch nicht wiederaufgetaucht war, wurde die Kriminalpolizei alarmiert.
Es sei denn, das andere Kind hatte etwas beobachtet.
Das Kind, das nicht vermisst wurde.
Als Thorne aus dem dichter bewaldeten Gebiet heraustrat und das Cricketfeld erreichte, sah er bereits das Absperrband, das um den Spielplatz herum gespannt worden war und auch die beiden Zugänge versperrte. Er entdeckte ein oder zwei bekannte Gesichter und hob die Hand zum Gruß. Egal, wie viele Einsatzkräfte für die Suche nach dem vermissten Jungen mobilisiert worden waren, sie würden alle Hände voll zu tun haben, wenn sie den gesamten Wald vor Einbruch der Dunkelheit gründlich durchkämmen wollten – ob nun Mitte Juni oder nicht.
Auf einer Fläche von rund 300 Hektar konnte sich ein Kind lange verstecken.
Eine Leiche sogar noch länger.
»Tom …«
Er blickte auf und sah, dass sein Vorgesetzter ihn energisch zu sich winkte. Thorne nickte und ging schneller. In mehr als fünf Jahren als Detective Sergeant hatte er unter einer Reihe von DIs gearbeitet, doch Gordon Boyle zählte zu denen, die er am wenigsten mochte. Und das lag nicht nur an ihren Differenzen beim Thema Fußball. Der Schotte war ihm zu sehr darauf bedacht, den erfolgreichen Teamleiter herauszukehren, sobald eine Ermittlung gut lief, bei Fehlschlägen dagegen die Verantwortung anderen zuzuschieben. Für Thornes Geschmack war er einfach zu selbstverliebt.
Fünf Jahre …
Je nachdem, mit wem man sprach, war Thorne entweder zu faul für die Prüfung zum Inspector oder er hatte zu viel Angst vor dem Durchfallen. Vielleicht hatte er aber auch Angst, sie zu bestehen. Wenn er sich selbst gegenüber ehrlich war, musste Thorne einräumen, dass jede dieser Theorien ein Körnchen Wahrheit enthielt. Gott sei Dank hatte zumindest Jan es aufgegeben, ihm damit auf die Nerven zu fallen, seit sie begriffen hatte, dass der Gehaltsunterschied die Mühe kaum lohnte.
»Irgendwann mach ich es«, hatte er gesagt, als sie zum letzten Mal darüber gesprochen hatte. Damals, als es zwischen ihnen noch Gespräche gab.
Thorne kam an DC Ajay Roth vorbei, der sich, Stift und Notizbuch gezückt, mit einer alten Frau mit Hund unterhielt. Der Blick, den er Thorne zuwarf, ließ durchblicken, dass es sich nicht um das aufschlussreichste Gespräch aller Zeiten handelte.
»Na endlich«, rief Boyle herüber, ehe er sich wieder einer Unterhaltung zuwandte, die er über Funk führte. Als Thorne ihn erreichte, beugte der DI sich vor und brummte: »Schön, dass Sie es zu uns geschafft haben.«
»Sir«, sagte Thorne, als käme die respektvolle Anrede von Herzen; als würde sein Atem nicht nach Bier riechen; als wäre ihm nicht klar, dass auch Boyle noch nicht lange hier sein konnte.
Der DI führte ihn zum Rand des Spielplatzes, wo Thorne einem uniformierten Inspector namens Bob Docherty die Hand schüttelte, mit dem er schon ein- oder zweimal zu tun gehabt hatte und der offensichtlich die Suchaktion koordinierte. »Um ehrlich zu sein, könnte ich noch fünfzig Beamte gebrauchen«, sagte Docherty leise und atmete scharf ein. Dann gingen sie zu dritt zu einer Bank ganz in der Nähe, auf der ein kleiner Junge in einer gelben Jacke zwischen zwei Frauen saß.
Boyle wirkte ein wenig verlegen, als sei er unschlüssig, welche Miene er aufsetzen solle. Ernst, aber nicht zu ernst? Entspannt, um zu demonstrieren, dass kein Anlass zur Panik bestand? Wenn man den Mann mit einem Kerl in den Verhörraum setzte, der einen bewaffneten Raubüberfall begangen hatte, war er ganz in seinem Element. Aber der Umgang mit normalen Bürgern, vor allem, wenn sie Angst hatten oder zu Schaden gekommen waren, war nie seine starke Seite gewesen.
»Also gut«, sagte er.
In letzter Zeit dachte Thorne nicht gern darüber nach, ob vielleicht auch er sich damit schwertat. Seine Empathie – oder das, was er dafür gehalten hatte – hatte zehn Jahre zuvor genug Unheil angerichtet. Trotzdem war es für ihn ziemlich offensichtlich, welche der beiden Frauen, die vor ihm saßen, die Mutter des vermissten Kindes war. Sie schüttelte weinend den Kopf und klammerte sich am Rand der Bank fest, während die andere reglos geradeaus starrte. Der Junge blickte auf seine Füße und stocherte mit einem abgebrochenen Ast im sandigen Boden herum.
Boyle stellte sie einander vor.
Maria Ashton, die ältere der beiden Frauen, blickte zu ihnen hoch, hörte aber nicht auf, sich mit einem Knäuel aus feuchten Papiertaschentüchern das Gesicht abzutupfen. »Ich hab die beiden nur ein paar Sekunden aus den Augen gelassen, das schwöre ich.« Sie nahm die Hand herunter und wandte sich ihrer Freundin zu. »Ein paar Sekunden, mehr nicht.«
Thorne bemerkte, dass er die Situation falsch gedeutet hatte. Offenbar war die jüngere Frau diejenige, nach deren Sohn der Wald durchkämmt wurde. Sie sagte nichts, ihr Gesicht war eine starre Maske, auch wenn Thorne die mühsam unterdrückte Angst nicht entging. Genauso wenig wie das, was sich in ihren Augen offenbarte. Eine Grimmigkeit.
»Es hilft nichts, wenn Sie sich Vorwürfe machen«, sagte Boyle.
»Auf keinen Fall«, stimmte Docherty ihm zu.
Thorne trat einen Schritt auf Maria Ashton zu und deutete mit dem Kopf auf den Jungen. »Hat Ihr Sohn irgendetwas gesagt, als er zurückgekommen ist?« Er beugte sich zu dem Siebenjährigen hinunter, doch der Junge löste den Blick nicht vom Boden und von dem Stock, mit dem er inzwischen noch heftiger stocherte.
Die Frau unterdrückte ein Schluchzen und schüttelte den Kopf.
»Überhaupt nichts?«
»Josh war völlig durcheinander.« Sie griff nach der Hand ihres Sohnes. »Hysterisch.«
»Und seitdem hat er nichts gesagt? Vielleicht …«
Boyle hob die Hand und unterbrach Thorne. »Lassen wir die Uniformierten ihre Arbeit machen.« Docherty nickte zustimmend. »Wir müssen Mrs Ashton und Mrs Coyne so schnell wie möglich befragen. Das Revier Highgate dürfte der beste Ort dafür sein.«
Sofort wurde die jüngere Frau lebendig. Sie schaute Boyle an, als wäre er geisteskrank, und sagte scharf: »Ich gehe nirgendwohin.«
»Hm«, sagte Boyle.
»Das meine ich ernst.«
Boyle hob eine Hand, als wollte er kapitulieren. »Ich verstehe, dass Sie erregt sind, aber es ist wichtig, dass wir Ihre Aussagen aufnehmen, solange die Erinnerungen noch frisch sind.«
Catrin Coyne schüttelte den Kopf. »Auf keinen Fall. Nicht, bevor hier nicht jeder einzelne Zentimeter abgesucht ist.« Sie schaute zu Docherty auf. »Warum kann ich nicht bei der Suche helfen?«
»Wir könnten beide helfen«, sagte Maria.
Catrin starrte Docherty immer noch an. »Ich kenne mich im Wald aus, und ich weiß, welche Stellen Kieron am meisten liebt.«
»Diese Information haben wir schon von Ihnen bekommen«, sagte der Inspector. »Das war sehr hilfreich.«
»Vertrauen Sie mir.« Boyle beugte sich vor und legte ihr eine Hand auf die Schulter. Die Frau sah aus, als hätte er ihr einen Stromschlag verpasst. »Das Beste ist, wenn wir Sie aufs Revier bringen. Ich verspreche Ihnen, dass Sie es als Erste erfahren, wenn wir irgendetwas finden.«
Thorne sah, wie ein Schatten über Catrins Gesicht huschte und Maria die Hand vor den Mund schlug. Er warf Boyle einen Blick zu. Offenbar hatte der DI selbst begriffen, was er gesagt hatte. Wie es geklungen hatte.
»Irgendetwas« implizierte, dass er mit einer Leiche rechnete.
»Wir nehmen mein Auto«, erklärte Boyle schnell. Er wandte sich an Thorne. »Tom, Sie folgen mir mit DC Roth. Ich habe schon über Funk Bescheid gegeben. Der Chef erwartet uns dort.«
Kurz darauf machte sich die lose Gruppe auf den Weg zu dem Tor, durch das Thorne gekommen war. Boyle und die Frauen gingen voraus, Thorne und Ajay Roth folgten in zehn Metern Abstand. Inzwischen waren noch mehr uniformierte Beamte zu sehen als zuvor, auch wenn manche nicht viel zu tun schienen. Thorne, der sich leise mit Roth unterhielt, sah einen Beamten hinter einem Baum eine schnelle Zigarette rauchen.
»Sie müssten ihn längst gefunden haben.« Roth schob eine Hand unter den Rand seines Turbans und kratzte sich. »Meinen Sie nicht?«
»Das Gelände ist groß.« Thorne beobachtete das Trio vor ihnen. Er sah, dass Gordon Boyle sein Bestes tat, um die Frauen zum Weitergehen zu drängen. Und er registrierte, dass Maria Ashton und Catrin Coyne einen langen Blick wechselten und deutlich Abstand voneinander hielten.
»Trotzdem«, sagte Roth.
Sie waren nur noch wenige Meter vom Tor entfernt, und Thorne hielt den Autoschlüssel bereits in der Hand. In diesem Moment machte die Gruppe vor ihnen abrupt halt. Catrin Coyne drehte auf dem Absatz um und rief den Namen ihres Sohnes in den Wald hinein. Noch bevor ihr Schrei verhallt war, rief auch Josh Ashton nach seinem Freund, bis seine Lungen zu platzen schienen. Seine Mutter begann wieder zu weinen.
DREI
In Fällen wie diesem lag die oberste Priorität zunächst darauf, so schnell wie möglich die notwendigen nächsten Schritte einzuleiten. Boyle hatte das Revier Highgate vorgeschlagen, gleich neben dem Amtsgericht des Bezirks Haringey, weil es dem Park am nächsten lag.
Andy Frankham erwartete sie an seinem Schreibtisch.
Er wirkte, als wolle er gleich zur Sache kommen.
Als Detective Chief Inspector des in Islington angesiedelten Dezernats für Schwerverbrechen war er de factoder Ermittlungsleiter in diesem Fall. Wahrscheinlich hatte er, noch während Thorne im Pub gesessen hatte und die ersten Streifenpolizisten im Highgate Wood zusammengezogen worden waren, die Zügel in die Hand genommen und ein Team zusammengestellt. In der Hoffnung, wenn auch nicht der Erwartung, dass es nicht gebraucht würde.
Frankham stellte sich den beiden Frauen vor. Seine Stimme klang sanft, aber geschäftsmäßig. Maria Ashton trat einen Schritt vor, um seine Hand zu schütteln, während ihr Sohn sich an ihren Mantel klammerte.
Catrin Coyne nickte einfach und schaute am DCI vorbei zu dem uniformierten Beamten hinter dem Schreibtisch.
»Ich bin nicht so dumm, Ihnen zu sagen, Sie sollen sich keine Sorgen machen«, sagte Frankham. »Ich habe selbst Kinder. Aber ich will Ihnen versichern, dass ich sämtliche zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzen werde, um Kieron zu finden.«
»Danke«, sagte Maria.
Thorne registrierte den Blick, den Catrin Coyne ihrer Freundin zuwarf. Er meinte, eine Spur von Widerwillen zu entdecken.
Es ist nicht dein Sohn, der vermisst wird.
Er spürte den nachvollziehbaren Ärger der Frau an der Art, wie sie unbewegt an Ort und Stelle verharrte, daran, wie sie atmete.
Hättest du auf sie aufgepasst, was deine Aufgabe gewesen ist …
»Im Augenblick ist es wichtig, schnell die ersten Aussagen aufzunehmen.« Frankham schaute den Jungen an. »Vor allem von Josh.«
Maria zog ihren Sohn dicht an sich. »Joshy? Willst du dem Polizisten erzählen, was im Wald passiert ist?«
Der Junge machte einen Schritt zurück, als würde er aus irgendeinem Grund schmollen. Er trat an ein Anschlagbrett und starrte es mit dem Rücken zu ihnen an. Dann ging er zu einer Reihe von Plastikstühlen und ließ sich auf einen fallen.
»Er ist durcheinander«, sagte Maria. »Das ist doch verständlich.«
Catrin Coyne drehte sich zu ihr um und starrte sie an.
»Absolut«, sagte Frankham. »Das ist ganz natürlich. Also gut, ich lasse Sie für den Moment in der Obhut von Inspector Boyle und den anderen. Falls Sie mit mir sprechen wollen, worüber auch immer, sagen Sie einfach einem von ihnen Bescheid.«
Maria nickte und errötete unter Catrins Blick.
Nach einer kurzen unbehaglichen Pause tauchte aus einer Seitentür eine Polizistin auf und führte die beiden Frauen und das Kind in Richtung der Vernehmungsräume.
Frankham sah ihnen nach. Dann wandte er sich an Thorne und die anderen. »Lassen Sie uns so schnell wie möglich in die Gänge kommen, ja? Ich gehe zurück ins Büro und kümmere mich darum, dass alles vorbereitet ist. Sobald ich einen Ort gefunden habe, wo wir die Zeugen befragen können, gebe ich Ihnen Bescheid.«
»Alles klar, Boss«, sagte Boyle.
»Wir brauchen eine Sozialarbeiterin«, sagte Roth. »Videoräume und was nicht alles.«
»Danke für den Hinweis, Ajay.« Frankham blieb freundlich im Ton, ließ aber unmissverständlich durchklingen, dass er genau wusste, was gebraucht wurde. Mit seiner schmalen Gestalt und der dicken Brille wirkte der DCI wie ein Akademiker und erinnerte Thorne an einen Geografielehrer aus seiner Schulzeit. Trotzdem würde er niemals riskieren, Frankham zu verärgern.
»Also los«, sagte Boyle. »Ich übernehme die Mutter … Ajay, Sie sprechen mit der Freundin.« Er deutete auf Thorne. »Schauen Sie, was Sie aus dem Jungen rausbekommen, Tom. Und hören Sie darauf, was Ihr Bauch Ihnen sagt.«
Roth grinste.
Mit dem Gedanken, seinen unmittelbaren Vorgesetzten zu verärgern, hatte Thorne nicht das geringste Problem. Auch wenn der Begriff verärgern in diesem Zusammenhang vielleicht zu höflich war. Seine Fantasien kreisten häufiger darum, in einer schlecht beleuchteten Seitenstraße auf Gordon Boyle herabzublicken, während der Schotte diverse Zähne ausspuckte.
»Sir«, sagte Thorne.
Auf dem Weg zu den Verhörräumen kamen sie an einem Büro vorbei, in dem sich eine Gruppe vor einem Fernseher versammelt hatte. Boyle steckte den Kopf ins Zimmer und stellte eine Frage. Dann schloss er die Tür, und sie gingen zu dritt weiter.
»Eins zu null für Ihre Jungs«, sagte er und wirkte nicht allzu angetan. Den Namen des Torschützen murmelte er, als handelte es sich um einen berüchtigten Serienmörder. »Shearer.«
»Bitte, Mrs Ashton.« Thorne sah, wie Maria Ashton den Mund aufmachte, und hob die Hand. Sie hatte Ajay Roth gegenüber schon ihre eigene kurze Aussage gemacht, hatte aber offensichtlich noch deutlich mehr zu sagen. »Bitte.« Vor dem Betreten des Raums hatte er ihr deutlich gemacht, dass sie jetzt allein Joshs Darstellung hören wollten. Dass sie nur dabei war, um ihren Sohn zu beruhigen. Dass jede Ermunterung, jedes Soufflieren ihrerseits seine Aussage beeinflussen und letztlich den Ermittlungen schaden konnte.
»Tut mir leid«, sagte Maria. Sie beugte sich zu dem tragbaren Kassettenrekorder mit den zwei Laufwerken vor, sagte noch einmal »Tut mir leid« und schüttelte dann über ihre eigene Dummheit den Kopf.
Thorne nickte ihr beruhigend zu und wandte sich wieder an den Jungen.
»Warum habt ihr beide, Kieron und du, den Spielplatz verlassen?«
Aus den ersten, noch an Ort und Stelle aufgenommenen Aussagen war deutlich geworden, dass die Jungen vom Spielplatz in den Teil des Waldes gelaufen waren, der an die U-Bahn-Strecke grenzte. Beunruhigend war, dass die Stelle keine fünfzig Meter von einem Ausgang zur Archway Road entfernt lag.
»Auf dem Spielplatz kann man sich nirgendwo verstecken.« Der Junge trat alle paar Sekunden gegen das Tischbein und spielte mit einem Modellauto herum, das er aus der Tasche gezogen hatte, als sie sich hingesetzt hatten.
»Dann wolltet ihr Verstecken spielen?«
Die uniformierten Kollegen hatten bereits mit Haustürbefragungen auf dem Straßenstück in der Nähe des Ausgangs angefangen und handgeschriebene Flugblätter mit der Bitte um Informationen verteilt. Auf der Straße war ziemlich viel los.
»Nein.« Josh schüttelte entschieden den Kopf. »Kieron wollte Verstecken spielen.«
»Dann ist Kieron also losgerannt, um sich zu verstecken, richtig?«
Wieder schüttelte der Junge den Kopf, als wäre Thorne begriffsstutzig. »Ich hab mich versteckt.«
»Oh … klar, sich zu verstecken macht mehr Spaß, stimmt’s?«
»Ich bin besser im Verstecken als er.«
»Okay. Also, wo hast du dich versteckt?«
Josh blickte kurz auf, ehe er sich wieder seinem Spielzeugauto zuwandte. »Da ist ein großer Baum, in den man reingehen kann. Da hab ich mich früher schon mal versteckt.«
Wieder begann Maria Ashton zu weinen. Thorne schob ihr die Schachtel mit Papiertaschentüchern hinüber, ließ den Jungen aber nicht aus den Augen. »Hat Kieron dich gefunden?«
Josh schüttelte den Kopf, diesmal langsamer.
»Glaubst du, er konnte dich nicht finden?« Thorne wartete. »Oder glaubst du, er hat nicht richtig gesucht?«
Josh zuckte die Achseln und kaute auf seiner Unterlippe herum.
»Ich meine, es klingt nach einem fantastischen Versteck.«
»Ja, aber Kieron weiß, dass ich mich da manchmal verstecke, und ich hab ihn nicht mal gehört.« Der Jungen schnaubte und hob die Arme, als würde er sich nachträglich wundern. »Also, man hört ja immer, wenn einen jemand sucht, wegen der Äste und der raschelnden Blätter. Aber als ich in dem Baum war, war alles richtig still.«
Thorne spürte, dass die Mutter des Jungen ihn anschaute, spürte, wie sie versuchte, so leise wie möglich zu weinen. »Was glaubst du, wie lange du gewartet hast, Josh?«
»Richtig lange.«
»Okay.« Thorne malte sich die Gegend aus, in der Josh sich versteckt hatte. Dann beugte er sich zu dem Jungen vor. »Hast du irgendwelche Züge vorbeifahren hören?«
Ein langsames, ernsthaftes Nicken. »Ja.«
»Wie viele?«
Bei dem Versuch, sich zu erinnern, verzog der Junge angestrengt das Gesicht. »Zwei, glaube ich.«
Thorne wusste, dass dieser Teil der Strecke regelmäßig in beiden Richtungen von der Northern Line befahren wurde. »Also … fünf Minuten vielleicht? Kommt das ungefähr hin?«
Josh nickte. »Ewigkeiten.«
»Was hast du dann gemacht?«
»Ich bin aus dem Baum rausgekommen und hab versucht, Kieron zu finden. Ich hab ihn gerufen und bin zu der Stelle gelaufen, wo er sich die Augen zugehalten hat und wo er angefangen hat zu zählen.« Wieder hob er die Arme, dazu riss er verblüfft die Augen auf. »Er war nicht da. Er war nirgendwo.«
»Dann ist er aus dem Wald gekommen«, sagte Maria. »Als Cat und ich gerade losgegangen waren, um die beiden zu suchen.«
Thorne ignorierte sie. »Hast du im Wald sonst irgendjemanden gesehen, Josh?«
»Da waren jede Menge Leute«, sagte Josh. »Die komische alte Frau mit dem stinkenden Hund. Jede Menge Leute.«
»Zwischen den Bäumen, meine ich. Nachdem ihr vom Spielplatz weggegangen seid.«
Der Junge schüttelte den Kopf.
»Bist du sicher?«
Maria lehnte sich vor. »Das hat er alles schon im Wald gesagt.«
»Hast du Kieron mit jemandem sprechen sehen?«
»Das hat er dem Inspector schon gesagt, bevor Sie gekommen sind.«
»Können wir jetzt nach Hause?«, fragte Josh.
Thorne schaltete den Kassettenrekorder aus.
Nach seiner Befragung von Catrin Coyne wartete Boyle zusammen mit Ajay Roth draußen auf dem Gang. »Interessant«, sagte er.
»Was?«
»Der Alte von der Mutter wohnt gerade auf Kosten Ihrer Majestät, und das nicht zum ersten Mal. Vor sieben Jahren hat er achtzehn Monate wegen schwerer Körperverletzung abgesessen, und im Augenblick sitzt er wegen versuchten Mordes für zehn Jahre in Whitehill.« Boyle schüttelte den Kopf. »Klingt nach einem richtig miesen Typen. Hat jemanden halb totgeprügelt, weil der ihn auf der North Circular beim Überholen geschnitten hat.«
»Nett«, sagte Roth.
»Und?«, fragte Thorne.
Boyle schaute ihn an.
»Glauben Sie, er ist aus einem Hochsicherheitsgefängnis ausgebrochen und hat seinen Sohn entführt?«
»Interessant, hab ich gesagt, mehr nicht.« Boyle schob einen Finger in den Mund und stocherte zwischen seinen Zähnen herum. »Und das ist es schließlich auch.«
»Hat Mrs Coyne irgendetwas gesagt, woraus Sie schließen, dass wir uns den Mann näher anschauen sollten?«
»Ms Coyne«, sagte Roth. »Sie trägt seinen Namen, aber sie sind nicht verheiratet.«
»Sie leben in Sünde.« Boyle hatte seine Suche beendet und drehte den Kopf, um etwas auszuspucken. »Jedenfalls haben sie das getan, bevor er in den Knast ging.«
»Und, hat sie etwas gesagt?«
»Hören Sie, ich wollte einfach rausfinden, was im Wald passiert ist«, sagte Boyle. »Genau wie Sie. Die Frau hat seinen Namen erwähnt, also hab ich ihn durch den Computer laufen lassen.«
»Also gut«, sagte Thorne. »Schadet sicher nicht, es zu wissen.«
Mit einem Mal wirkte Boyle gereizt. »Ich sag Ihnen was, Tom, warum nehmen Sie nicht Ms Coynes offizielle Zeugenaussage auf?«
»Der Boss hat vor zehn Minuten angerufen«, sagte Roth. »An der Upper Street ist alles vorbereitet. Die Autos warten schon.«
»Klar, wie Sie wollen«, sagte Thorne. Er bemerkte den verschwörerischen Blick, den der DI dem DC zuwarf. Er begriff, dass er ihn bemerken sollte.
»Ich weiß nicht … Vielleicht können Sie ihr die Hand schütteln.« Als er Thornes Miene sah, gab Boyle sich keine Mühe mehr, sein hämisches Grinsen zu verbergen. »Mal sehen, was Ihr Bauchgefühl sagt.«
VIER
Es war nicht nötig, noch einmal durchzugehen, was vor vier Stunden im Highgate Wood passiert war. Thorne wusste inzwischen, dass Catrin Coyne nichts gesehen hatte. Und natürlich wusste er auch, dass sie – wie jemand, der nicht aufhören konnte, an einer Entzündung im Mund herumzukauen – es sich höchstwahrscheinlich immer wieder auszumalen versuchte.
Was passiert sein könnte.
Das Schlimmste, immer das Schlimmste.
Im Moment zwang der Job Thorne dazu, in ihren schrecklichsten Ängsten zu stochern und sie ans Tageslicht zu zerren. Mit aller gebotenen Einfühlsamkeit Fragen zu stellen, die diesen Ängsten nur weitere Nahrung gaben. Er kam sich vor, als flüsterte er durch ein Megafon. Als schliche er auf Zehenspitzen in Doc Martens Größe 44 um das schlimmstmögliche Szenario herum.
»War mit Kieron alles … okay?«
»Okay?« Die Frau starrte ihn an. »Was soll das überhaupt heißen?«
Sie redeten jetzt seit einer halben Stunde, und sie hatte eindeutig genug. Vielleicht sehnte sie sich nach ein bisschen Zeit für sich, um mit ihren Qualen allein zu sein. Oder sie wollte mit Freunden oder Familienmitgliedern sprechen, von denen Thorne noch nichts wusste. Vielleicht wollte sie jetzt, wenige Stunden vor Einbruch der Dunkelheit, auch zurück in den Highgate Wood und sich an der Suche beteiligen. Möglicherweise fragte sie sich inzwischen aber auch einfach, wie diese dummen Fragen dabei helfen sollten, ihren Sohn zurückzubekommen. Und warum dieser Detective sie ein weiteres Mal stellte.
»Gab es irgendwelche Probleme in der Schule?«, fragte Thorne.
»Eigentlich nicht.«
»Dann vielleicht irgendwelche anderen Probleme?«
Thorne hatte sein Bestes gegeben. Vor dem Gespräch hatte er, ohne die Gründe näher auszuführen, erklärt, diese zweite ausführliche Fragerunde könne entscheidend sein. Er hatte sie darauf hingewiesen, dass ihre Unterhaltung aufgezeichnet wurde – wie auch die Gespräche, die an anderer Stelle im selben Gebäude mit Josh Ashton und seiner Mutter geführt wurden –, weil sie sich später als wichtig erweisen konnte. Dies sei das übliche Vorgehen. Thorne merkte, dass die Frau nicht dumm war, vermied aber trotzdem den Hinweis darauf, dass die Befragungen beweiserheblich waren und vor Gericht verwendet werden konnten, falls wegen des Verschwindens ihres Sohnes am Ende eine oder mehrere Personen vor Gericht gestellt werden sollten.
Wegen … welcher Anklage auch immer.
Wieder diese Sache mit der Empathie.
»Er hatte ein bisschen Mühe, sich einzugewöhnen, aber das ist schon zwei Jahre her.« Im Wald war ihm Catrin Coyne erregt vorgekommen, bereit zu kämpfen. Inzwischen machte sie einen müden, erschöpften Eindruck. Thorne wusste, dass sie noch nicht ganz dreißig war, doch im Augenblick hätte sie auch für vierzig durchgehen können. Sie zupfte an ihren kurzen dunklen Haaren und schien in der Puffa-Jacke zu verschwinden, die sie angelassen hatte, obwohl der Raum geheizt war. »Es gefiel ihm nicht, dass er Josh nicht mehr so oft sehen konnte. Es gefällt ihm immer noch nicht.«
»Wo ist seine Schule?«
»In Tufnell Park. Ich hab versucht, ihn in derselben anzumelden, in die Josh geht, aber es hat nicht geklappt.«
»Das ist schade«, sagte Thorne. »Offenbar sind sie richtig gute Freunde.«
»Ja.«
»Und Sie sind gut befreundet mit Joshs Mutter.«
Sie stieß ein tiefes, knappes Brummen aus. Dann wandte sie den Blick ab und schüttelte den Kopf. Auf Thorne wirkte es eher wie eine Geste der Verwirrung oder Ungläubigkeit, nicht wie eine entschlossene Verneinung. Er begriff, dass man in Situationen wie der, in die sie so unerwartet geraten war, um sich schlug und nach etwas – oder besser jemandem – suchte, dem man die Verantwortung zuschieben konnte. Als er sah, wie sie die Augen schloss und in ihrer großen blauen Jacke noch kleiner zu werden schien, vermutete Thorne, dass die Wut, die sie auf Maria Ashton gespürt hatte, schon ein wenig nachließ. Und dass sie begonnen hatte, sich Selbstvorwürfe zu machen, weil sie jemanden anderes – enge Freundin oder nicht – auf ihren Sohn hatte aufpassen lassen.
Eine Verletzung, über die sich über kurz oder lang eine hübsche dicke Kruste legen würde, die sie immer wieder aufkratzen konnte.
Thorne warf einen Blick auf die Uhr und auf das rote Licht der Videokamera, die gleich daneben montiert war. »Gibt es irgendjemanden, von dem Sie sich vorstellen können, dass er Ihrem Sohn etwas antun würde, Catrin?«
Sie riss die Augen auf. »Was?«
»Tut mir leid, aber ich muss das fragen.«
»Er ist sieben!«
»Also schön … Gibt es jemanden, von dem Sie sich vorstellen können, dass er Ihnen etwas antun würde?«
Sie lehnte sich zurück, verschränkte die Arme und starrte ihn mehrere Sekunden lang an. »Nein.«
»Wirklich niemanden?«
»Nein.«
»Erzählen Sie mir von Kierons Vater«, forderte Thorne sie auf.
Sie nickte und seufzte, als hätte sie bereits darauf gewartet. »Ist das wirklich nötig? Ich meine, Sie wissen doch offensichtlich schon alles.«
»Ich würde es gern von Ihnen hören.«
»Schauen Sie, Billy ist ein richtig guter Vater, klar?«
Thorne mühte sich um eine ausdruckslose Miene, was ihm offenbar nicht ganz gelang.
»Ja, okay, er ist im Augenblick nicht bei uns. Ich meine, in der Zeit, als er bei uns war. Er liebt Kieron wie verrückt. Er … liebt uns beide.«
»Aber er hat eindeutig einen Hang zur Gewalttätigkeit. Sie können also hoffentlich verstehen, warum wir ein bisschen mehr über ihn erfahren möchten.«
»Er ist das eine Mal ausgerastet.«
»Es war nicht nur das eine Mal, Catrin.«
»Die erste Sache war gar nichts«, sagte sie. »Die sogenannte schwere Körperverletzung. Ein Bier zu viel im Pub, und er hat nicht mal angefangen. Die Sache mit dem Autofahrer war idiotisch, da widerspreche ich Ihnen nicht. Und das weiß er.«
»Also ist zu Hause nichts in der Art vorgefallen?«
»Ich sag doch …«
»Gegenüber Ihnen oder …«
»Billy hat nie die Hand gegen mich erhoben, und er würde Kieron auf keinen Fall etwas antun.« Sie schüttelte den Kopf und lehnte sich entschlossen zurück. »Niemals.«
»Ist angekommen«, sagte Thorne. »Vielen Dank.«
»Ich kapiere es sowieso nicht.« Plötzlich wirkte die Frau wieder aufgebracht. »Ich meine, der arme Kerl sitzt in seiner Zelle, wozu soll die Fragerei also gut sein?«
Thorne nickte. Hatte er Boyle nicht mehr oder weniger dieselbe Frage gestellt? »Wie gesagt, ich muss diese Fragen stellen.«
Es klopfte laut an der Tür. Ajay Roth steckte den Kopf herein und erklärte, er müsse Thorne kurz sprechen. Thorne unterbrach die Befragung und versprach Catrin Coyne, sich zu beeilen.
Vor der Tür sagte Roth: »Ich hab’s dem Boss schon gesagt, aber ich dachte, Sie sollten auch Bescheid wissen: Wir mussten mit Josh Ashton aufhören.«
»Weil …?«
»Weil der arme kleine Kerl fix und fertig ist. Es ist, als würde man gegen eine kleine Ziegelwand anreden.«
»Hat er etwas zu essen bekommen?«
»Ja, klar. Die Sozialarbeiterin hat ihm ein Sandwich besorgt, ehe wir angefangen haben, aber sie meint, dass er immer noch nicht in der Lage ist. Es könnte mehr schaden als nützen, sagt sie.«
»Vielleicht braucht er ein bisschen Schokolade oder so was.«
Roth nickte. »Das war auch mein erster Gedanke. Soll er ein bisschen Zucker bekommen, ein paar Dosen Fanta vielleicht. Aber seine Mutter sagt, er darf nichts mit Kohlensäure trinken.«
»Orangensaft?«
Der DC schüttelte den Kopf. »Er und seine Mutter sind schon auf dem Weg nach Hause, Kumpel. Sie sagt, sie kommt gleich morgen früh wieder mit ihm her.«
»Also gut.« Thorne trat auf die Tür des Vernehmungsraums zu.
»Wie läuft’s da drin?«, fragte Roth.
»Tja, zuerst hatte ich den Eindruck, sie macht auch dicht, aber dann ist sie wieder etwas munterer geworden. Mal sehen.«
Ehe Thorne die Tür öffnen konnte, kam Gordon Boyle mit einem Plastikbecher Kaffee um die Ecke. Er schaute auf die Uhr. »Was glauben Sie, wie lange Sie noch brauchen?«
»Eine Stunde vielleicht«, sagte Thorne.
»Gut.« Boyle trank seinen Becher aus und schaute sich nach einem Abfalleimer um. »Ich organisiere ein Auto, das sie nach Hause bringt, und suche jemanden, der sie begleitet.«
»Das mache ich schon.« Thorne wandte sich an Roth. »Haben Sie Lust, mitzukommen?«
Roth antwortete, dass er nichts Besseres zu tun habe.
»Wie Sie wollen«, sagte Boyle. »Das übliche Vorgehen, wenn Sie da sind, klar? Sie wissen, was wir brauchen.«
»Aber auf die sanfte Tour.« Thorne warf Roth einen fragenden Blick zu. »Einverstanden?«
»Sanft wie ein Baby, Kumpel.«
Thorne wandte sich zur Tür.
»Eigentlich schade«, sagte Boyle.
Thorne hielt inne. »Was?«
»Der Ausgleich der Schweizer.« Er schüttelte den Kopf. »Ich schätze, eure Jungs wollten nicht mit einem Unentschieden anfangen.«
»Das haben wir 1966 auch«, sagte Roth. »Null-null gegen Uruguay.«
Thorne hörte schon nicht mehr zu. Er ging im Kopf noch einmal das Gespräch mit Catrin Coyne durch. Wie lebhaft sie unmittelbar vor der Unterbrechung gewesen war und was sie ihm über den Vater ihres vermissten Kindes gesagt hatte.
Vielleicht hatte Boyle nicht ganz unrecht gehabt, als er ihn ins Spiel gebracht hatte.
Dieses kurze Zögern.
Er … liebt uns beide.
FÜNF
Einen Arm ausgestreckt, um sich an der Kücheninsel mit der Granitplatte abzustützen, nahm Maria den ersten Schluck Wein und seufzte vor Zufriedenheit. Schnell folgte ein zweiter Schluck, dann griff sie nach der Flasche und schenkte sich nach. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie zuletzt so dringend etwas zu trinken gebraucht hatte.
Sie zitterte noch immer. Den ganzen Weg vom Polizeirevier hierher hatte sie an die offene Flasche Pinot im Kühlschrank gedacht. Sie hatte daran gedacht, als sie den Streifenwagen wieder losfahren sah und die Haustür hinter sich schloss. Als sie ihren Mantel abgeschüttelt und Josh in sein Schlafzimmer gebracht hatte, wo sie ihm beim Ausziehen half und ihn schweigend ins Bett steigen sah. Als sie ihm die Tränen abgewischt hatte, die flossen, sobald sie das Zimmer verlassen wollte. Und als sie ihm gesagt hatte, er solle tapfer sein, denn am Ende würde alles gut.
Als sie es sich selbst gesagt hatte.
Josh hatte noch eine halbe Stunde gequengelt, bis sie sich schließlich in der Lage sah, ihn allein zu lassen und nach unten zu gehen. Jetzt, wo sie auf einen der lederbezogenen Barhocker stieg und tief seufzend ihr Glas hob, schämte sie sich. Denn schon in Joshs Zimmer – sein warmes, feuchtes Gesicht an ihrem Hals – hatte sie ihm gegenüber einen Anflug von Unmut verspürt, weil er sie von ihrem Wein abhielt.
Mummys Medizin.
Sie stellte das Glas ab und ermahnte sich, sich nicht lächerlich zu machen. Denn wenn es je eine Entschuldigung … nein, keine Entschuldigung, einen Grund zum Trinken gegeben hatte, dann sicher jetzt.
Was für ein schrecklicher, furchtbarer Tag. Alles war gelaufen wie immer, ganz normal. Sie alle waren glücklich gewesen … Und plötzlich war alles ganz anders, innerhalb – was? – weniger Sekunden? Viel länger konnte es nicht gedauert haben. Bloß die Zeit, in der sie eine Zigarette geraucht hatte, mehr nicht, in der sie für einen kurzen Moment die Augen geschlossen hatte.
Es war nicht ihre Schuld.
Beim Gedanken an Cat schwappte eine Welle von Schuldgefühlen über sie hinweg. Zum ersten Mal, seit sie durch die Haustür getreten war, wenn sie ehrlich sein sollte.
Sie fragte sich, ob Cat schon zu Hause war und, wenn ja, was sie gerade machte.
Sie fragte sich, ob sie anrufen sollte.
Maria trank noch ein Glas und kam zu dem Entschluss, dass es wahrscheinlich keine gute Idee war. Sie würde gleich morgen früh anrufen. Natürlich würde es kein leichtes Gespräch werden, aber es musste sein. Sie wollte helfen, wollte Cat wissen lassen, dass sie für sie da war und alles tun würde, was in ihrer Macht stand.
Ich denke, du hast schon genug getan, oder?
Bitte sag das nicht. Du musst versuchen, die Ruhe zu bewahren.
So würdest du nicht reden, wenn es um deinen Sohn ginge …
Nein, wahrhaftig kein leichtes Gespräch.
Sie setzte sich wieder hin und versuchte, sich vorzustellen, wie sie sich fühlen würde, wenn es tatsächlich Josh wäre, nach dem jetzt gesucht wurde. Wenn sie diejenige wäre, die allein in ein leeres Haus zurückkehren musste. Aber es war unmöglich, nicht nur, weil sie im Kopf langsam den Wein spürte. Sie nahm noch einen Schluck und bemerkte plötzlich, dass sie seit dem Frühstück nichts mehr gegessen hatte. Ich kann es mir nicht vorstellen,das sagten die Leute immer, wenn etwas Schreckliches geschah, und es war letztlich einfach die Wahrheit. Man konnte sich nicht annähernd in eine solche Situation hineinversetzen. Trauer war sicher am ehesten vergleichbar. Diese innere Kälte, dieses Zumachen, das sie empfunden hatte, als ihr Vater gestorben war.
Oder als Jeffrey gegangen war.
Natürlich war auch das eine Art Trauer gewesen. Eine Leblosigkeit, die zurückgeblieben war. Im Rückblick war es kaum überraschend gekommen. Zwischen ihnen hatte eine Distanz geherrscht, eine Fremdheit. So sehr sie es auch versucht hatte, war sie offenbar nie wirklich die Frau gewesen, die er wollte, und trotzdem … Als er endlich den Mund aufgemacht und ihr erklärt hatte, er wolle die Scheidung – ganz so, als hätte er gesagt, die Socken seien ihm ausgegangen oder er wünsche sich Lamm zum Abendessen –, war es für sie ein echter Tiefschlag gewesen.
Erst Monate später hatte sie wieder Luft bekommen.
Natürlich gingen sie jetzt sehr zivilisiert miteinander um. Alles Schnee von gestern. Sie beide hatten sich um ihr eigenes Leben zu kümmern, und natürlich mussten sie an ihren Sohn denken, vor allem in letzter Zeit, wo er derart aus dem Gleichgewicht geraten zu sein schien. Ihr fiel die Szene im Park wieder ein, als sie Cats Frage ausgewichen war, wie Josh in der Schule zurechtkomme. Es gab weiterhin Probleme, die immer schwieriger zu ignorieren waren – schlechtes Benehmen und gewalttätige Ausbrüche. Auch das Bettnässen kam inzwischen beinahe jede Nacht vor.
Himmel, was machte sie sich eigentlich für Gedanken?
Das alles war meilenweit von dem entfernt, was Cat im Moment durchmachen musste. Sicher lagen überall die Sachen ihres Sohnes herum, sein Geruch war überall in der Wohnung. Und dann daran denken zu müssen, dass er allein dort draußen im Wald war oder … wo auch immer. Noch schlimmer, daran denken zu müssen, dass er vielleicht nicht allein war.
Wieder griff Maria nach der Flasche, doch sie war leer.
Es war nicht ihre Schuld.
»Mummy …«
Sie atmete überrascht ein, dann drehte sie sich um und sah Josh in der Tür stehen. Wieder war er den Tränen nahe, seine dicke Unterlippe bebte. Bis zum heutigen Tag hatte dieser Gesichtsausdruck eigentlich immer bedeutet, dass er etwas wollte. Meistens eine weitere Gutenachtgeschichte.
»Ich glaube, ich kann besser schlafen, wenn ich in dein Bett komme«, sagte er.
Das hatte er schon lange nicht mehr gewollt.
»Dann komm, mein Hühnchen«, sagte Maria. »Packen wir dich gut ein.«
Auf dem Weg zur Treppe nahm Josh ihre Hand und sagte: »Ich hab darüber nachgedacht. Vielleicht hat Kieron es einfach verwechselt. Wer mit Suchen dran war, meine ich.«
»Ja, vielleicht hast du recht«, sagte Maria.
Der Junge nickte zufrieden, als hätte er ein schwieriges Rätsel gelöst. Er streckte ihr die freie Hand entgegen. Nach kurzem Zögern bückte Maria sich und klatschte ihn ab. »Wahrscheinlich hockt er noch immer in seinem Versteck, das ist es.«
SECHS
Catrin Coyne wohnte in einer Dreizimmerwohnung an der Holloway Road, wenige Minuten südlich der U-Bahn-Station Archway, in der sechsten von insgesamt zwölf Etagen des Seacole House.
Anderthalb Kilometer von Highgate Village entfernt, aber in einer ganz anderen Welt.