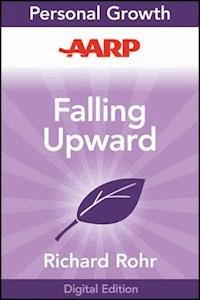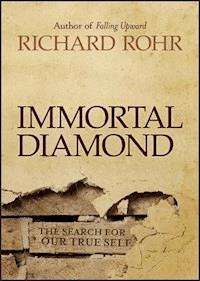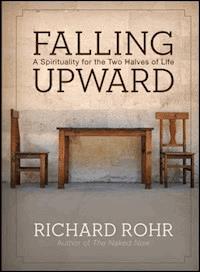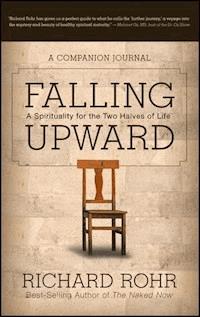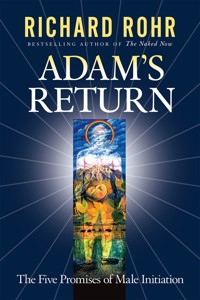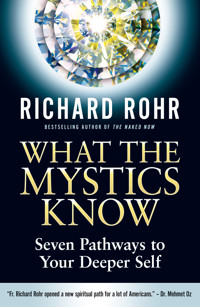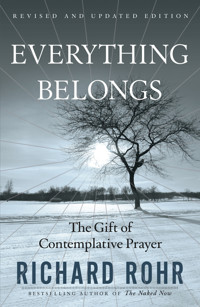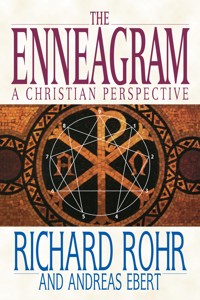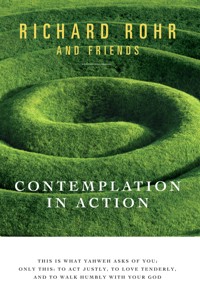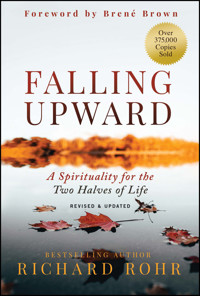Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Claudius Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Wie sollen wir die Bibel lesen? Was hat uns dieser alte, zum Teil grausame und widersprüchliche Text heute noch zu sagen? Einseitige Auslegungen durch Prediger und Politiker dienten der Legitimation von Gewalt, Rassismus, Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit und Homophobie. Was also bleibt von der „Heiligen Schrift“? Dieser Frage stellt sich Richard Rohr in seinem neuen Werk und entwickelt eine eingängige Hermeneutik der Hoffnung, in deren Mittelpunkt der Gedanke der Menschwerdung Gottes steht. Rohr konzentriert sich auf Jesu eigene Art, die hebräischen Texte auszulegen: Er las zwischen den Zeilen und entdeckte dort Gottes Gnade und mitfühlende Gerechtigkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 64
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
What Do We Do with the Bible?
Copyright © 2018 Center for Action and Contemplation
CAC Publishing, Center for Action and Contemplation, PO Box 12464, Albuquerque, New Mexico 87195, USA, cac.org
Copyright © Claudius Verlag, München 2020
www.claudius.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Umschlaggestaltung: Weiss Werkstatt, München
Layout: Mario Moths, Marl
Foto S. 47: © Andreas Praefcke/Wikipedia
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, 2020
ISBN 978-3-532-60056-6
Inhalt
Einführung
Hermeneutik
Was die Bibel nicht sagt
Die Jesus-Hermeneutik
Verwendete und weiterführende Literatur
EINFÜHRUNG
Trotz all ihrer Inspirationskraft, trotz all ihrer wundervollen Aussprüche und trotz all der Menschenleben, die sie nachhaltig geprägt und verändert hat, stellt die Bibel für viele Menschen nach wie vor ein großes Problem dar. Wenn man sie ich-süchtigen, lieblosen oder machtbesessenen Zeitgenossen ausliefert oder Leuten, die niemals wirklich gelernt haben, mit spirituell inspirierter Literatur sachgerecht umzugehen, endet das fast immer in einem Desaster. Die bisherige Geschichte hat das viele Jahrhunderte lang bewiesen, sodass diese Behauptung durchaus nicht an den Haaren herbeigezogen, respektlos oder von Vorurteilen geleitet ist. Ketzerverbrennungen, Kreuzzüge, Sklaverei, Apartheid und die Verachtung und Unterdrückung von indigenen Völkern wurden allesamt mit ausgewählten Bibelstellen gerechtfertigt.
Damit von Anfang an klar ist, worauf ich hinauswill: Es geht mir darum, unsere Sichtweise zu verändern – und nicht den Text. Nur transformierten Menschen kann man inspirierte Schriften anvertrauen. Nur sie werden sich auf eine symbiotische („gemeinsam erlebte“) Beziehung zu Texten und Geschichten einlassen. Nur sie werden die Bibel vermutlich nicht als Herrschaftswissen, als Waffe oder als Rechtfertigung für übles Verhalten missbrauchen, das im Gewand der „Vernunft“ daherkommt. Wenn man hingegen in einer betenden Haltung und im echten Dialog mit fast allen beliebigen geistlichen Texten – sogar mit problematischen – verweilt, wird sich das fast immer als fruchtbar erweisen.
Es besteht kein Zweifel, dass die Bibel auch künftig die maßgebliche Quelle für Christen und Juden sein und bleiben wird und muss, auch wenn beide Gruppen im Laufe der Geschichte immer wieder versucht haben, dieses wilde Raubtier auf die eine oder andere Weise zu domestizieren, normalerweise ohne selbst völlig zu begreifen, was sie auf diese Weise angerichtet haben. Katholiken irritierten die vielen Probleme ungemein, die die Bibel insbesondere in Gesellschaften aufwarf, die des Lesens und Schreibens unkundig waren. Deswegen haben sie jahrhundertelang die Bibellektüre letztlich völlig vermieden. (Man muss zugeben, dass das einfach war, weil es noch keine Druckerpresse gab.) Katholische und orthodoxe Christen haben schlussendlich de facto so getan, als müsse man ein theologisches Diplom ihrer spezifischen Tradition besitzen, um das Wort Gottes richtig verstehen zu können. Unser gesunder christlicher Menschenverstand sagt uns freilich, dass das ja so nicht stimmen kann. Der Zugang zu Gott kann sich nicht von oben nach unten erschließen. Paradoxerweise sind es ja die Autoren des wahrhaftig subversiven Bibeltextes selbst, die fast immer dem sozialen Bodensatz, gesellschaftlichen Randgruppen, Außenseitern und der Schar der Unterdrückten, den Vorzug geben, angefangen beim versklavten Volk Israel. In Exodus (2. Mose) 14,25 heißt es: „Jahwe kämpfte auf ihrer Seite und gegen die Ägypter.“ Wir haben es offenbar mit einem eindeutig parteiischen Gott zu tun.
Schon früh entwickelten unsere jüdischen Vorfahren Auslegungstraditionen wie den Midrasch, einen Versuch, für jeden biblischen Text verschiedene geistliche Bedeutungsebenen herauszuschälen, und sie schufen daneben den Talmud (Mischna und Gemara). Er versuchte, historisch bedeutsame Auslegungskommentare zur Verfügung zu stellen.1 Das bewirkte eine gewisse Demokratisierung des Bibelstudiums und empfahl die heiligen Schriften der gemeinsamen Lektüre von ganz normalen Gläubigen und nicht nur abgehobenen Akademikern.
Das ähnelte dem, wie viele lateinamerikanische Theologen unter dem Einfluss der Befreiungstheologie gegen Ende des 20. Jahrhunderts vorgingen und was sie „Basisgemeinden“ nannten.2 Das Papsttum hatte die verbindliche Schriftauslegung ausschließlich in die Hände des römischen Lehramts, der Bischöfe und der Priester gelegt und so eine äußerst verengte Sichtweise zementiert. Das war vermutlich unvermeidlich, weil der größte Teil Europas noch nicht alphabetisiert war und die „göttliche Legitimation“ von Königen und anderen Autoritätsfiguren weitgehend fraglos hinnahm. Und es verhinderte gleichzeitig, dass die Bibel für einfache Christenmenschen ihre kritische Funktion als „Sauerteig“ wahrnehmen konnte. Es sicherte darüber hinaus dem Klerus eine falsche Machtfülle – obwohl die Kleriker ihrerseits häufig wenig Ahnung von der Schrift hatten.
Den meisten Christen der nachreformatorischen Zeit ist nicht bewusst, dass bereits die frühen christlichen Jahrhunderte aufgrund maßgeblicher Lehrer wie Origenes, Kyrill von Alexandrien, Augustinus und Gregor dem Großen bis zu sieben Bedeutungsebenen der Heiligen Schrift gekannt und praktiziert haben: die buchstäbliche, die historische, die allegorische, die ethisch-moralische, die symbolische, die eschatologische (das heißt, die zukunfts- und wachstumsorientierte) und die primordiale oder archetypische (allgemein als „Symbolismus“ verstanden). Gerade der letzten Ebene eines Textes wurde von den Gelehrten häufig großes Gewicht beigemessen. Diese Ebenen wurden von gewöhnlichen Christinnen und Christen durch die sonntäglichen Predigten nach und nach internalisiert (was bis heute gilt) und von den Hörerinnen und Hörern als normativ aufgefasst.
Die verschiedenen Sinnschichten wurden mitunter mit den menschlichen Sinneswahrnehmungen des Hörens, Sehens, Schmeckens, Riechens und Berührens verglichen, die ja fünf klar unterscheidbare Weisen sind, ein und dasselbe zu erkennen, aber eben in verschiedenen „Sprachen“. Nach der Reformation und der Aufklärung allerdings haben wir die Erkenntniswege praktisch auf einen einzigen – den angeblich rationalen/wörtlichen/historischen – reduziert und die Bibel jahrhundertelang weitgehend in diese eine Bedeutungskategorie gepresst und auf sie begrenzt. Das betrifft, wenn auch jeweils unterschiedlich akzentuiert, sowohl den Katholizismus als auch den Protestantismus. Die Bandbreite unserer Zugänge zur Bibel wurde, wie mir scheint, in der Folge immer mehr reduziert – und zwar, wie viele sagen würden, auf die spirituell am wenigsten hilfreiche Ebene: Die Behauptung, dass irgendetwas zu einem bestimmten Zeitpunkt angeblich buchstäblich passiert ist, überträgt diese Erfahrung nicht automatisch ins Heute, auf mich, auf uns. (Ich glaube, die Absicht jedes spirituellen Textes ist eindeutig eine solche Transformation – oder es handelt sich nicht um einen spirituellen oder wenigstens spirituell bereichernden Text. So etwas wäre ausschließlich toter Ballast.)
Solch ein enggeführter Ansatz führt in der Regel zu einer antiquierten Institution, die lieber Rückschau hält, anstatt nach vorn zu blicken. Nach meiner Erfahrung entsteht so leichter eine transaktionale Religion3 als eine transformative Spiritualität. Diese beschränkte Sichtweise idealisiert und belohnt eher individuelle Anpassung und Gruppenzugehörigkeit als Liebe, Dienst an anderen oder eine tatsächliche Veränderung des Herzens.
Der Buchstabenglaube wird im Neuen Testament von Anfang an ad absurdum geführt, indem man vier Evangelienberichte desselben Jesusereignisses in den Kanon aufgenommen hat, die an kaum einer Stelle eins zu eins übereinstimmen. Welches Evangelium wäre dann das „irrtumslose“?
Um dieses Thema geht es in der Bibel sogar schon früher. Die ersten fünf Bücher der Bibel – die den Pentateuch ausmachen – wurden von den meisten Gelehrten für eine Kompilation von mindestens vier klar unterscheidbaren Quellen gehalten. Man nannte diese vier Quellen gewöhnlich Jahwist, Elohist, Deuteronomist und Priesterschrift.4 Der Pentateuch (die Thora) beinhaltet häufig Wiederholungen, die sich stilistisch unterscheiden, und enthält zahlreiche offenkundige Widersprüche, die uns geradezu zu der Erkenntnis zwingen, dass die Texte von unterschiedlichen Autoren stammen, unterschiedlichen Primärquellen entstammen und in ganz unterschiedlichen Perioden der jüdischen Geschichte verfasst wurden. Welche von ihnen ist die „inspirierteste“? Welche von ihnen ist „richtig“?
Die frühen Jahrhunderte der Christenheit waren natürlich der transrationalen Welt Jesu und seines Lehrstils als Geschichtenerzähler noch wesentlich näher (was sich in der dogmatischen oder systematischen Theologie konzeptionell nicht darstellen lässt). Das Evangelium sagt: „Er sprach niemals zu ihnen – es sei denn in Gleichnissen“ (Matthäus 13,34). Jesus bevorzugte, wie es scheint, die indirekte, bildhafte und symbolische Ebene einer Geschichte oder Parabel, wenn er spirituelle Zusammenhänge vermittelte. Ein protestantischer Gelehrter geht sogar so weit zu behaupten, dass Jesu Umgang mit der Heiligen Schrift „andeutend, umschreibend und – soweit sich das feststellen lässt – eklektisch“ sei. Erstaunlich!5
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: