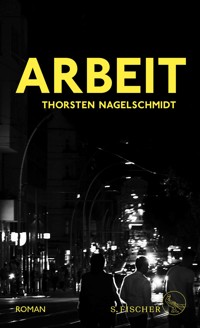Inhaltsverzeichnis
ZUM BUCH
ZUM AUTOR
Inschrift
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Copyright
ZUM BUCH
15.000 Euro, so viel Geld hat der Taugenichts Meise noch nie in seinem Leben besessen. Das ist die Summe, die er nach dem Tod seines Vaters geerbt hat. Doch er will dieses Geld nicht behalten, sondern es möglichst so ausgeben, wie es sein Vater nie getan hätte: fürs Reisen. Als Meise nach ein paar Monaten in fremden Ländern nach Berlin zurückkehrt, kommt er in seinem alten Leben nicht mehr zurecht. Kurzerhand nimmt er seine letzten 1.000 Euro und verbringt ein Wochenende auf einem Weingut im Moseltal. In der tiefsten westdeutschen Provinz wird er mit ein paar unbequemen Wahrheiten konfrontiert, denen er sich wohl oder übel stellen muss.
ZUM AUTOR
Nagel, geboren 1976 in Nordrhein-Westfalen, war Sänger, Texter und Gitarrist der Punkband Muff Potter, die sich nach 16 Jahren im Dezember 2009 auflöste. Sein Debütroman Wo die wilden Maden graben erschien 2007, im Frühjahr 2009 wurde das gleichnamige Hörbuch veröffentlicht, das von Axel Prahl, Farin Urlaub und Nagel gelesen wurde. Besuchen Sie seine Website: www.nagel2000.de
»Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht.«
UNBEKANNTER PHILOSOPH
1
»Bitte schalten Sie jetzt alle elektronischen Geräte ab, bringen Sie Ihren Sitz in die aufrechte Position, klappen Sie Ihre Tische hoch und stellen Sie sicher, dass Ihr Sitzgurt fest angezogen ist. Danke.«
»Bitte!«, ruft die Frau im Sitz vor mir und lacht wiehernd über ihren eigenen Scherz.
Sie hat offensichtlich einen Eid geschworen: Sie darf niemals aufhören zu sprechen. Seit wir hier sitzen, kommentiert sie alles, was sie sieht, liest oder hört. Noch auf dem Rollfeld müssen die fünf Reihen vor und hinter ihr unfreiwillig ihren lautstarken Exkursen lauschen. Über den Sonnenuntergang, die Temperatur, das schwüle Wetter. Den geilen Dollarkurs und den Ami an sich. Beim Durchblättern der Frankfurter Allgemeinen, die die Stewardess ausgeteilt hat, kommentiert sie jede Seite, wie ein Kind, das gerade erst lesen gelernt hat.
»Oh, Shopping! Oh, Reise!«, und dann: »Wat iss’n ditte für’ne Scheißzeitung, sind ja nur Stellenanzeigen drinne!«
Sobald wir in der Luft sind und die Anschnallzeichen erlöschen, klappt sie ihren Sitz zurück. Rammt ihn mir ohne Vorwarnung fast ins Gesicht. Wälzt sich ungelenk hin und her und beschwert sich über das Wackeln des Flugzeugs.
»Bin ich hier im Karussell, oder was!«
Sie trägt eine Kurzhaarfrisur mit blonden Strähnchen, geordnet strubbelig, wie es deutsche Frauen über fünfzig mögen, die gerne von sich selbst behaupten, für ihr Alter noch »ganz flott unterwegs« zu sein. Ihr Gesicht ist stark geschminkt. Augen, Nase und Mund schwimmen in einer Pfütze aus Fett und Talg. Über diesem unappetitlichen See aus Farben thront eine randlose Brille mit kleinen eckigen Gläsern und neongrünen Schnörkeln am Gestell. Drum herum spannt sich die verbrannte Haut wie ein alter Lederlappen.
Mit den Fingern wühlt sie sich in den Haaren, und damit mir fast im Gesicht herum. Ihre Fingernägel glänzen, als wären sie mit Zuckerglasur überzogen. Lang und manikürt wuchern sie aus stumpigen Fingern, die ihrerseits ohne Übergang an den Armen sitzen. Man sieht nicht mal Handgelenke, nur am rechten Arm eine winzige goldene Uhr, die fast in den Wülsten ihres speckigen Unterarms verschwindet.
Ihre Kapuzenjacke ziert ein eBay-Logo. Vielleicht arbeitet sie dort, das würde zu ihrem Akzent passen, der nach Bürojob in Kleinmachnow klingt, nach Doppelhaushälfte in Ludwigsfelde, nach Wohnwagenurlaub am Zeuthener See, das New-York-Wochenende für zwei bei Antenne Brandenburg gewonnen.
Ihr Mann sitzt daneben und verhält sich still. Er ist das Gegenteil seiner Frau: unauffällig, grau, dünn, leise. Das Haar schütter, der Pullover ein paar Nummern zu groß, so dass er darin verschwindet wie ein Erstklässler in Mamas Bademantel. Sogar der Oberlippenbart wirkt irgendwie zu schmal.
Die Frau hat hier eindeutig die Hosen an. Es sind weiße Jeansshorts. Ihre Beine stecken in pinken Socken mit der Aufschrift Princess, aus denen fast gleichfarbig ihre Waden hervorquillen.
Auch das Essen wird ausgiebig kommentiert. Wie erwartet kommt es nicht gut weg.
»Das ist doch’ne Zumutung, ist doch wahr!«
Sie stößt ihrem Mann verschwörerisch den Ellbogen in die Rippen.
»Jau.«
Niemand hat ihr je den Punkt gezeigt, an dem Dummheit in Penetranz umschlägt. Ich würde gerne eine rauchen. Bestelle noch ein Bier. Einen Wodka dazu.
Das amerikanische Ehepaar neben mir blättert in einem Lonely Planet für Germany. Die Frau ist hübsch und geschmackvoll gekleidet. Anfang vierzig. Typ erfolgreiche Geschäftsfrau. Vielleicht Inhaberin einer Casting-Agentur. Oder Staatsanwältin? Von Zeit zu Zeit schaut sie sich irritiert um, wenn vor uns wieder eine laute Wolke Unsinn durch das Flugzeug gejagt wird. Ihr erster Eindruck vom originär deutschen Lifestyle, das ist jetzt nicht gerade die sanfte Einführung.
Ich verspüre ein leichtes Ziehen in den Schultern. Auch ich hätte mir den ersten Kontakt mit meiner Heimat nach der langen Zeit etwas weniger brutal gewünscht.
»Schönheit!«, bellt Frau Randlos, als ihr Mann niest, und kriegt sich gar nicht mehr ein vor Lachen. Ein nach Luft schnappendes Gequieke, wie eine kaputte Sirene. Bis sie einen schlimmen Hustenanfall bekommt. Der Mann klopft ihr mit seinen schmalen Fingerchen zaghaft auf den Rücken. Es sieht aus wie ein Dackel, der ein Nilpferd massiert. Kurz darauf beginnt sie zu schnarchen.
Es ist dunkel und ruhig. Frau Randlos schläft, das Ehepaar neben mir schläft, und Verena schläft vermutlich auch. Sie sitzt einige Reihen hinter mir, wir haben zu spät eingecheckt, es waren nebeneinander keine Plätze mehr frei. Ich kann damit leben, nach den mehr als zwei Monaten, die wir aufeinandergehangen haben. Es war gut, aber es reicht jetzt auch.
Ich frage mich, ob sie ahnt, was ich weiß. Nämlich dass wir zwar ein paar schöne Wochen hinter uns, aber keine Zukunft vor uns haben. Zumindest keine gemeinsame. Wenn wir um neun Uhr Berliner Zeit landen, werden wir zu mir fahren, noch ein paar Stunden in meinem Bett schlafen, vielleicht ein letztes Mal miteinander, und abends wird sie ein Taxi zum Bahnhof nehmen und den Zug nach Hannover. Ich werde sie nicht begleiten, sondern mich leise und unaufgeregt auf der Straße von ihr verabschieden, weil es so einfacher für alle ist. Sie wird in ihr Leben zurückfahren, und ich werde in meinem bleiben, bis wir uns vielleicht irgendwann mal wiedersehen. Und dann mal gucken.
Ich versuche einzuschlafen, doch es klappt nicht. Ich ziehe die Kapuze über den Kopf, klappe den Sitz nach hinten und setze mir sogar zum ersten Mal in meinem Leben eine Schlafbrille auf, so ein dämliches rotes Ding, das sie einem mit Kopfhörer und Ohrstöpsel in die Hand drücken und das einen aussehen lässt wie einen dieser gestörten Typen aus Eyes Wide Shut.
Es geht einfach nicht. Müde und aufgedreht zugleich schalte ich das Licht wieder ein und blättere in einem amerikanischen Frauenmagazin, das ich am Flughafen gekauft habe. Es geht um Mode, um Style, um Musik und um Anzeigen. Eigentlich sind die Anzeigen das Beste am ganzen Heft, besonders die mit den gut gekleideten hübschen Frauen, von namhaften Fotografen in interessanten Posen abgelichtet.
Als ich die Klotür schließe, wird die enge Parzelle von einem breiten Strahl aus weißem Licht überflutet. Ich lasse meine Hose auf die Knöchel sacken, breite die Zeitschrift auf dem zahnarztpraxisfarbenen Waschbecken aus und onaniere mit dem Blick auf das magersüchtige Model aus der Hugo-Boss-Werbung, das sich mit halboffenem Mund und den Beinen auf der Lehne eines weißen Designersofas räkelt. In meinem Kopf räkelt sich dort meine amerikanische Sitznachbarin.
In 10.965 Metern Höhe über dem Atlantischen Ozean, bei 876 km/h und minus 58 Grad Celsius Außentemperatur, tropft mein warmer Samen in die Toilette und wird mit Hochdruck weggesaugt.
2
Mein Nachbar hat seinen Wecker auf 05:44 Uhr stehen, und ich somit zwangsläufig auch. Zwar höre ich kein Klingeln, Piepen oder irgendein anderes Weckgeräusch, aber es kann kein Zufall sein, dass der Mann jeden Morgen um die gleiche Zeit anfängt zu husten. Und er hustet sich die Lunge aus dem Leib, so laut und exzessiv, dass ich wach im Bett liege und gar nicht glauben kann, dass da überhaupt noch eine Wand zwischen uns ist.
Ich weiß nicht, wie mein Nachbar aussieht, habe aber ein Bild im Kopf. Es beinhaltet schlechte Haut und jede Menge Körperbehaarung.
Seine morgendlichen Hustorgien jedenfalls klingen nach achtunddreißig Jahren Kohlebergwerk, nach zweiundvierzig Jahren Reval ohne Filter, ein Röcheln und Würgen aus den tiefsten Tiefen seines Körpers, der einem rostigen alten Kahn zu ähneln scheint. Er macht sich keine besondere Mühe, das zu verstecken. Es klingt eher, als ob er extra laut hustet, damit er nicht als Einziger darunter leiden muss.
So geht das in unregelmäßigen Abständen bis ungefähr halb sieben. Dann scheint er aufzustehen, das Husten entfernt sich. Seit ich wieder hier bin, werde ich jeden Morgen so geweckt. Ich weiß nicht, ob das neu ist oder ob ich es früher nur nicht gehört habe.
Nachdem ich mich eine Weile im Halbschlaf hin und her gewälzt habe, stehe ich schließlich auf. Ich koche mir einen starken Kaffee und setze mich in den schmutzigen Plastikstuhl auf dem Balkon. Die Junisonne klettert gerade über die Hausdächer. Es ist noch ziemlich frisch, aber die Straße sieht schon erstaunlich belebt aus. Leere Gesichter auf dem Weg zur Arbeit, oder zur Schule, oder zur Uni, was weiß ich, wo die alle hinwollen. Vielleicht auch alle nur zum Jobcenter Neukölln, um sich dort mit den anderen Hartz-IV-Empfängern die Beine in den Bauch zu stehen.
Meine Straße um sieben Uhr morgens, eine Welt, von der ich selten etwas mitbekomme. Wenn ich überhaupt mal um diese Uhrzeit unterwegs bin, dann auf dem Heimweg vom Feiern. Das zählt nicht. Es ist dann zwar hell, aber eigentlich noch Nacht, weil ich besoffen bin und der nächste Tag erst beginnt, wenn man geschlafen hat.
Jetzt habe ich sogar diesen Rest an Lebensrhythmus verloren. Nach all den verschiedenen Zeitzonen, in denen ich die letzten Monate verbracht habe, ist meine innere Uhr nicht um soundso viele Stunden verschoben – sie ist schlicht und einfach nicht existent.
Ich weiß nicht mal, welcher Tag heute ist.
Na gut, das passiert mir sonst auch schon mal. Wenn ich zum Beispiel nachts im Radetzky hinterm Tresen stehe und mich wundere, warum es plötzlich um zwei Uhr nochmal so voll wird, bis ich registriere, dass schon wieder Wochenende oder der nächste Tag ein Feiertag ist.
Aber jetzt ist alles durcheinander. Ich schlafe, wenn ich schlafen kann, und bin wach, wenn ich nicht schlafen kann. Ich esse selten und rauche ständig. Trinke einen starken, zuckrigen Kaffee nach dem anderen. Ich versuche zu lesen, kann mich aber kaum auf zwei aufeinanderfolgende Sätze konzentrieren. Mein Hirn ist ein poröser Klumpen hinter einer Wand aus Watte, und mein Körper hat sich zu einem tauben Brei zusammengeschoben. Manchmal habe ich das Gefühl, meine Wirbelsäule wäre aus hartem Gummi, dann wieder spüre ich meine Füße nicht mehr. Irgendetwas zieht mich zu Boden, als hätte ich einen schweren Stein verschluckt. Und ständig verwechsle ich, was ich gesehen, gelesen oder geträumt habe.
Ich müsste eigentlich mal meine Sachen waschen gehen. Staubsaugen könnte ich auch mal wieder, und wischen, und die Fenster müssen auch mal geputzt werden, man kann kaum noch durchgucken. Kein Bock. Später vielleicht.
Es wird ein schöner Tag werden, freundlich und warm. Mir fallen die Augen zu, also schlurfe ich zurück ins Schlafzimmer und lege mich nochmal hin.
Als ich das nächste Mal aufwache, ist es schon fast Mittag. Ich gehe ins Badezimmer, wasche mir mit kaltem Wasser den Schlaf aus den Augen und setze mich auf den Badewannenrand. Dort bleibe ich ein paar Minuten sitzen. Wenn die Balkontür und das Badezimmerfenster offen stehen, entsteht genau an dieser Stelle so ein warmer Luftzug, es hat etwas von Südsee. Ich war noch nie in der Südsee, aber so stelle ich mir das vor – immer eine warme Brise, die einen einlullt. Der Badewannenrand ist im Sommer auf jeden Fall der beste Platz in meiner Wohnung.
Irgendwann hat sich aber auch das erschöpft. Außerdem knurrt mein Magen, also verlasse ich die Wohnung in Richtung Siebenbürgen.
Wie in den letzten Tagen staune ich auch heute wieder darüber, wie sehr sich dieses Viertel in meiner Abwesenheit verändert hat. Das Sonnenstudio gegenüber ist nicht mehr da, stattdessen gibt es dort jetzt ein Café, das auf seiner Scheibe mit kostenlosem Internetzugang wirbt.
Verschwunden ist auch der Second-Hand-Ramschladen, der auf dem Bürgersteig wacklige Stühle, kaputte Spiegel und alte Bongotrommeln feilbot, nicht zu vergessen die zwei Bilderrahmen mit welligen Livefotos von Howard Carpendale, selbst geschossen aus der ersten Reihe vor einer schmucklosen Bühne, obsessiv und überbelichtet. Nun befindet sich an gleicher Stelle ein Fahrradladen, dessen Betreiber mit ihren sorgfältig zerzausten Frisuren aussehen wie Schauspieler. In der schmierigen Videothek daneben gibt es neuerdings eine kleine Ecke, in der die Filme nach Regisseuren geordnet sind, und wenige Hundert Meter weiter die Straße runter hat die erste linke Kneipe des Viertels eröffnet. Wo vor meinem Abflug noch schnurrbärtige alte Türken in grellem Neonlicht Karten gekloppt und um die Wette geraucht haben, wird nun in schummrigem Kerzenschein bei einem Glas Merlot die Gentrifizierung des Kiezes diskutiert. Der Laden heißt VeränderBar. Abends gehen dort Typen ein und aus, deren Frisuren Protest signalisieren und auf deren Klamotten meistens irgendwo irgendwas mit »Capitalism«, »Fascism« oder »Sexism« steht. Antifa rein, Türken raus.
Im Café Siebenbürgen machen sie einen ganz hervorragenden Espresso, und es gibt Frühstück bis siebzehn Uhr. Vor einem halben Jahr stand diese ehemalige Eckkneipe noch leer. »Zu vermieten« konnte man wochenlang in Krakelschrift auf einer Pommesschale lesen, die mit Tesafilm ins Fenster geklebt war. Darunter eine Telefonnummer.
Ich habe die Nummer damals angerufen und mich erkundigt. Die Miete betrug keine Tausend Euro im Monat, als Abstand wollten die Vorbesitzer fünfzehntausend Euro haben, für Theke, Zapfanlage, Schanklizenz und alles. Das war genau der Betrag, den ich auf dem Konto hatte, nachdem Silvia mir meinen Anteil von unserem Erbe überwiesen hatte.
Ein eigener Laden, das war ein reizvoller Gedanke. Holger wollte gleich einsteigen. Er war völlig aus dem Häuschen, so kannte ich ihn gar nicht.
Einen Namen für die Pinte hatte ich auch schon: »Alter Vatter«.
Holger präferierte »Bredouille«.
»Klingt doch super: Gestern war ich in der Bredouille und hab zu viel Schnaps getrunken!«, rief er, als wir im Radetzky standen und uns ausmalten, wie das alles werden würde: die Musik, die Werbung, die Wände, die Gäste.
»Los, wir gehen zum Alten Vatter und saufen uns einen an!«, entgegnete ich, und wir lachten und umarmten uns und tanzten auf der Stelle, bis einer von uns dem nächsten Gast ein Bier zapfte, denn man weiß oft nicht so genau, wer von uns beiden gerade Schicht hat und wer nur zum Trinken da ist.
An diesen feuchtfröhlichen Abenden verliebte ich mich in die Idee, einen eigenen Laden zu haben – nach all den Jahren, die ich in den Kneipen anderer malocht hatte.
Alter Vatter oder Bredouille – dass es eine Goldgrube werden würde, galt uns hier, in diesem boomenden Viertel, als absolut sicher. Yolandas Segen hatten wir auch. Sie sagte, sie würde ihre beiden besten Barkeeper zwar vermissen, uns aber auf jeden Fall bei dem ganzen Behördenquatsch helfen, den sie mit dem Radetzky vor Jahren schon hinter sich gebracht hatte.
Nachdem sich die erste Euphorie gelegt hatte, wurde mir aber klar, dass ich die Verantwortung für einen eigenen Laden eigentlich gar nicht wollte. Mir wäre ja schon das Haus meines Vaters zu viel gewesen. Allein die Idee, Hausbesitzer zu sein, jagte mir richtig Angst ein.
Mieter suchen? Renovierungen anleiern? Kostenvoranschläge prüfen? Noch bevor die Formalitäten für den Erbantritt geklärt waren, brachte ich Silvia dazu, alles für den Verkauf des Hauses vorzubereiten.
Außerdem war da noch so eine Ahnung, die immer mehr zur Gewissheit wurde: Ich durfte das geerbte Geld nicht investieren. Es war einzig und allein dazu da, verschleudert zu werden. Nichts übrig behalten von dem Besitz, der immer nur für Streit und Hass gesorgt hatte. Ich sah es als meine Pflicht an, aus den Fehlern meines Vaters zu lernen und gar nicht erst in Versuchung zu kommen, diese zu wiederholen. Nichts sparen, nichts auf die hohe Kante legen und auf keinen Fall versuchen, das Geld anzulegen oder zu vermehren. Ich musste es benutzen, es ausgeben – und zwar alles, bis auf den letzten Cent.
Weihnachten in Portugal wurde mir dann endgültig klar, was ich mit meinem Erbanteil zu tun hatte. Holger hatte drauf bestanden, dass ich die Feiertage mit ihm und Anne an der Algarve verbringe. Er dachte vermutlich, er müsste sich um mich kümmern. Ich wiederum dachte, ich müsste ihm einen Gefallen tun, als Dankeschön dafür, dass er sich so um mich gekümmert hatte. Allein die ganzen Schichten, die er für mich übernommen hatte. Die Hilfe mit dem Steuerberater und das alles.
Wir kraxelten gerade die Felsen des Cabo de São Vicente entlang. Der südwestlichste Punkt Europas, das sogenannte Ende der Welt. Über uns stand ein großer Leuchtturm, unter uns tobte der Atlantik, und als ich die beiden eingeholt hatte, zeigte Holger schweigend auf eine Steinplatte, die in einen Felsen gehauen war.
IN ERINNERUNG AN UNSEREN SOHN UND FREUND, ZUR WARNUNG AN ALLE, DIE SICH HIER NICHT AUSKENNEN.
Wir setzten uns hin und schauten aufs Meer hinaus. Vor ein paar Jahrhunderten war hier für die Menschen die Welt zu Ende gewesen, weil sie nichts ahnten von Amerika und Indien und so. Ich dachte darüber nach, wie beschwerlich die Reisen damals gewesen sein mussten, wie einfach sie dagegen jetzt waren. Dann dachte ich an meinen Vater, der so gut wie nichts von der Welt gesehen hat. Und mir fiel auf, dass es bei mir ja bisher nicht viel anders aussah. Ich war sechsundzwanzigeinhalb Jahre alt und hatte den Kontinent noch nie verlassen. Ich war noch nicht mal in Paris, London oder Rom gewesen.
Die Liste der Orte, die ich nicht gesehen hatte, war endlos. Und es war keine sehr exotische Liste.
Warum eigentlich?
Weil ich mein ganzes Erwachsenenleben lang notorisch pleite war?
Vielleicht, aber das Argument zog jetzt nicht mehr. Ich kam mir plötzlich so klein vor, und das war genau der Moment, in dem mir klarwurde, dass ich das Geld meines Vaters benutzen musste, um zu reisen.
»Holger, das mit dem Alten Vatter …«
»Du meinst die Bredouille?«
»Wie auch immer. Jedenfalls, das wird nichts.«
»Ich weiß.«
Als ich abends in unserem Häuschen in Albufeira ins Bett fiel – ich hatte das Kinderzimmer und konnte meine Beine nie ganz ausstrecken -, fühlte es sich an, als hätte ich gerade Tag eins meines neuen Lebens hinter mich gebracht.
Ich weiß noch, wie ich erschrak, weil mir so ein Gedanke eigentlich viel zu kitschig war.
Aber so fühlte es sich nun mal an.
Und nun trage ich mein Geld in genau den Laden, der meiner hätte sein können. Ich sitze zwischen mit Zeitungen, Laptops und Babys bewaffneten Menschen an einem Tisch in der Sonne und kaue apathisch auf meinem Croissant herum, und Weihnachten an der Algarve kommt mir irre weit weg vor. Obwohl es gerade mal ein halbes Jahr her ist.
Nachdem ich bei dem hübschen Mädchen mit den kurzen dunklen Haaren bezahlt habe, mache ich mich auf zum Kanal, mit einem kurzen Schlenker zum Späti an der Ecke.
»Morgen, Frau Schenk. Einmal Benson & Hedges Lights, bitte.«
»Es ist nicht Morgen, sondern Mittag, Herr Meise. Und das heißt auch nicht Lights, das heißt Silver!«, sagt Frau Schenk. Frau Schenk ist die Besitzerin dieses Spätkaufs, der den guten Namen »Spätkauf« trägt. Seit ich vor drei Jahren in dieses Viertel gezogen bin, habe ich es noch nicht erlebt, dass sie nicht selbst hinter der Kasse saß.
»Ach ja, Silver!«, sage ich, gucke an die Decke und schlage mir leicht die flache Hand vor die Stirn. Meine »Was bin ich nur für ein Dummerchen«-Geste. Frau Schenk lacht, und ich lache auch. Es ist so ein Ritual zwischen uns. Manchmal ärgere ich sie und verlange von vornherein eine Schachtel Benson & Hedges Silver, dann gibt sie mir jedes Mal einen beleidigten »Spielverderber!«-Blick, bevor sie umso lauter loslacht.
Als Verena und ich vor einer Woche vom Flughafen kamen, ging ich gleich rüber zu Frau Schenk. Ihre Augen leuchteten, als sie mich sah. »Ach, sieh einer an!«, rief sie freudig erregt. »Ich dachte schon, ich könnte die Silvers ganz aus dem Sortiment nehmen!«
Ich glaube, sie hatte mich in den letzten Wochen und Monaten wirklich vermisst. Kein Wunder, vergeht doch kaum ein Tag, an dem ich nicht mindestens eine Schachtel Kippen bei ihr kaufe.
»Bis später«, sagt Frau Schenk.
»Bis später«, sage ich, öffne die Schachtel und zünde mir eine an. Ich rauche nicht nur sehr viel, sondern vor allem sehr gerne. Es ist mehr als eine Sucht. Zum Beispiel diese Zigarette jetzt gerade, die erste nach dem Frühstück, wie gut die schmeckt! Der erste Zug, dieses bewusste, tiefe Inhalieren des Rauchs, das kurze Innehalten und Wiederausatmen. Wie schön betäubt dann alles für einen kurzen Moment ist. Herrlich.
»Du bist ein Gelegenheitsraucher – du rauchst bei jeder Gelegenheit«, sagt Silvia immer. Meine Schwester war noch nie die lustigste Person auf dem Planeten. Ich mag sie trotzdem. Weil sie so schlau ist. Oder eher: klug. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Unterschied gibt, aber klug, das passt irgendwie noch besser. Wenn man in einem Lexikon nach dem Begriff »klug« sucht, ist da bestimmt ein Foto von meiner Schwester.
Manchmal schießt sie aber auch übers Ziel hinaus. Seit ein paar Jahren versucht sie mir ständig eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung unterzujubeln. ADS. Ihrer Meinung nach leide ich an Dopaminmangel oder so was. Ihre Theorie ist, dass dieser Botenstoff in meinem Körper zu schnell abgebaut wird, womit sie mein angebliches Suchtverhalten und mein Verlangen nach neuen Kicks durch Nikotin, Kaffee, Alkohol, Drogen und Sex erklären will. Schon mehrmals wollte sie mich zum Neurologen schleppen. Sie als Akademikerin will die Dinge immer benennen, alles muss erklärbar sein, nichts passiert einfach so, und wenn ich sie nicht stoppe, schmeißt sie so lange mit Begriffen wie »Neurotransmitter«, »Impulsivität« und »Dysfunktion« um sich, bis mir ganz schwindelig wird und ich mich tatsächlich völlig labil und hilfsbedürftig fühle. Irgendwann hat sie sogar mal meinen angeblich so hohen »Frauenverschleiß« damit begründet.
So klug meine Schwester auch ist, aber das hört sich für mich eher nach einer dieser hilflosen Erklärungen für alles und nichts an. Modekrankheiten, Verlegenheitsdiagnosen, Zeitgeistquatsch.
Da fällt mir ein, ich habe mich noch gar nicht bei ihr gemeldet, seit ich zurück bin. Na ja, mache ich später mal. Jetzt erst mal ans Wasser, ein bisschen abhängen.
Diese Parkbank ist so was wie mein Stammplatz geworden. In den letzten sieben Tagen habe ich jeden Tag mehrere Stunden im Schatten der großen Buche am Paul-Lincke-Ufer verbracht. Morgens, mittags, abends, nachts. Der Boden ist gesäumt von Kronkorken, ausgespuckten Kaugummis und Zigarettenkippen. Die meisten sind wahrscheinlich von mir.
Ich habe hier mehrere Sonnenuntergänge erlebt. Auch einen Sonnenaufgang. Vor ein paar Tagen gab es abends ein plötzliches Wärmegewitter. Ich blieb einfach sitzen und ließ die dicken Tropfen mein Gesicht hinunterlaufen. Ich habe einen Ehestreit beobachtet, eine Schlägerei zwischen drei arabischen Kids mit dunklem Flaum auf den Oberlippen und einen Unfall mit zwei Fahrrädern und einem Hund.
»Können Sie mal Ihren Scheißköter von mir entfernen!«
»Ich entfern gleich deine Scheißzähne, Alter.«
Ein Mann schrie eine Frau an, die ein Kind anschrie. Das Kind weinte, woraufhin ein anderes Kind in seinem Kinderwagen vor Schreck aufhörte zu weinen. Einmal bin ich in der Abenddämmerung auf der Bank eingeschlafen, und als ich im Dunkeln wieder wach wurde, saß zwei Meter neben mir ein Fuchs und starrte mich an. Vorgestern, oder vorvorgestern, sank ein schlafender Mann auf der Bank neben mir zu Boden und schiffte sich komplett ein. Dem Geruch nach hatte er drei Wochen lang nichts anderes als Benzin getrunken.
Manchmal duftet es vom Kanal her ein bisschen nach Kloake, und aus den Büschen weht ein Hauch von Müllhalde herüber. Man gewöhnt sich dran.
Heute ist es ziemlich windstill, da riecht man gar nichts. Ein traumhaftes Wetter. Trocken, freundlich und heiß. Normalerweise stehe ich ja nicht besonders auf Hitze, aber nach den letzten zwei Wochen in New York kommt mir hier alles absolut erträglich vor. Besonders Manhattan war tagsüber kaum zu ertragen.
Ich lockere die Schnürsenkel meiner Turnschuhe, stelle die Füße auf die kleine Mauer vor mir, zünde mir eine Zigarette an und betrachte, was mein Blickfeld kreuzt.
Jogger und Radfahrer. Raver, Hippies, Punks. Schüler und Studenten, Eltern und Kinder, Arbeitslose und Künstler, Rentner und Jugendliche. Paare und Schwangere. Schwule und Lesben. Boulespieler und Gitarristen. Kiffer und Pillenfresser. Säufer der verschiedensten Schattierungen, manche alt und melancholisch, andere jung und albern. Pfandgeier und Landeier. Wochenend-Berlin-Besucher, die in Stadtpläne oder Reiseführer vertieft den Joggern im Weg rumstehen. Betrunkene, die vor Fahrräder torkeln. Halbnackte und komplett Verschleierte. Frauen in Kopftüchern und Frauen unter Burkas, ganz in Schwarz in der prallen Sonne. Streitende, Küssende, Feiernde, Fluchende und Verwirrte, die wild gestikulierend mit sich selbst reden. Ein junges Mädchen weint in ihr Telefon, in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Es gibt Hunde, Ratten, Mäuse, Katzen, Schwäne, Enten, Spinnen, Vögel. Und Schiffe. Ausflugsdampfer voller Menschen mit Sonnenbrillen und Schlapphüten. Und eine Ansagerin, die ihnen vom Wasser aus die Stadt erklärt. Die Bootsgäste gaffen die Menschen am Ufer an wie Affen im Zoo. Die Menschen am Ufer gaffen genauso zurück. Da ist die Kreuzberg, die Schöneberg, die Charlottenburg, die Prenzlauer Berg, die Rixdorf. Die Brasil und die Sanssouci, die Spree Athen, die Spree Comtess, die Spree-Prinzessin, die Spree-Perle, da sind Schlauchboote, Tretboote, Motorboote – beladen mit jungen Leuten, die den Sommer in der Stadt genießen.
Das sollte ich vielleicht auch mal machen.
Aber irgendwie werde ich einfach nicht richtig wach. Es erscheint mir viel zu anstrengend, mich zu amüsieren.
Plötzlich eine vertraute Stimme.
»Meise, alte Hütte!«
Es ist Heiko. Heiko ist einer der Stammgäste im Radetzky. Wenn er nicht da ist, nennen wir ihn Psycho-Heiko. Manchmal auch, wenn er da ist. Er hatte wohl mal eine Psychose. Ich habe aber nie mitbekommen, wie sich das äußert. Ich kenne ihn nur als stillen und ausdauernden Zecher mit gut trainiertem Schluckmuskel. Wenn man in einem Lexikon nach dem Begriff »Durst« sucht, ist da bestimmt ein Foto von Psycho-Heiko.
Er existiert für mich nur als Barfliege, ich weiß nicht mal, ob ich ihn schon mal bei Tageslicht gesehen habe. Ich hätte eher erwartet, dass er sofort zu Staub zerfällt, wenn seine dünne gelbe Pergamenthaut mit der Sonne in Berührung kommt. Jetzt haben seine Wangen einen leicht rötlichen Touch, und er sitzt auf einem Mountainbike, was nun wirklich gar nicht zu ihm passt.
»Hallo Heiko. Wie geht’s?«
»Gut, und selbst? Was machst du hier?«
»Abhängen. Und du?«
»Bin auf dem Weg nach Hause. Mann, long time no see. Ich dachte schon, du hättest dich abgesetzt oder so was.«
»Ja, ich war’ne Weile unterwegs.«
»Hab ich gehört. Wo warste denn gewesen?«
»Ach, so hier und da.«
»Erzähl mal. Auch in den Staaten, meinte Holger.«
»Ja.«
»Richtiger Globetrotter, was?«
»Na ja.«
»Und, wie war’s?«
»Gut war’s.«
»Ja, lass dir nicht alles aus der Nase ziehen.« Heiko lächelt. Das kann der also auch?
»Erzähl ich die Tage mal. Ich bin gerade auf dem Sprung«, lüge ich.
»Okay. Arbeitest du denn mal wieder, oder haste das jetzt nicht mehr nötig?«
»Doch, doch. Ich werd mir nachher mal neue Schichten holen.«
»Alles klar, dann sieht man sich später, machet jut.«
»Ja, bis später, Heiko.«
Hallo Psycho-Heiko, alte Saufziege.
Eigentlich pflege ich ja keinen privaten Kontakt zu Stammkunden, und ich hab jetzt auch gar keinen Bock, mich mit dir zu unterhalten, aber wenn du’s genau wissen willst: Ich war Weihnachten mit Holger und Anne in Portugal, im Januar ein verlängertes Wochenende in Krakau, und dann habe ich verschiedene kürzere Trips gemacht, nach Paris, Bilbao, Barcelona, Madrid, London, Stockholm, Oslo. Dann war ich in Nordafrika. Marokko, Tunesien, Ägypten, und rüber nach Israel.
Dort habe ich eine Frau aus Hannover namens Verena kennengelernt und bin fast zweieinhalb Monate mit ihr durch die USA gefahren. Einmal die Westküste rauf und runter, nach Mexiko rein, dann im Zickzack durch den Süden bis zur Ostküste, da hoch und noch zwei Wochen in New York abgehangen, bei Brian, einem Kumpel von Holger, der war mal eine Weile in Berlin, vielleicht hast du ihn mal im Radetzky gesehen.
Seit einer Woche bin ich jetzt wieder hier und komm nicht so richtig klar. Weiß nicht, warum.
Das alles sage ich natürlich nicht, weil ich mir dann nur vorkommen würde wie ein kosmopolitischer Angeber und Psycho-Heiko wahrscheinlich noch stundenlang an der Backe hätte. Stattdessen schnüre ich mir die Schuhe zu, damit er glaubt, dass ich wirklich gerade abhauen wollte. Er radelt weiter, und ich gehe tatsächlich. Ich stehe einfach auf und laufe los, obwohl ich das doch gar nicht vorhatte.
Irgendwie habe ich mich nicht mehr unter Kontrolle. Es ist, als würde ich nur noch auf Impulse reagieren. Der Körper tut, was er will, und auch mein Kopf hat sich selbstständig gemacht. Plötzlich stehe ich vor meiner Haustür, gehe die Treppen hoch, stecke den Schlüssel ins Schloss, stelle den Fernseher an und lasse mich aufs Sofa fallen. Und frage mich, was ich hier eigentlich mache, da läuft doch sowieso nur Schrott.
Am späten Nachmittag werde ich wieder wach, schalte den Fernseher aus und gehe zurück zum Kanal, wo ich mich auf dieselbe Bank setze, auf der ich vor ein paar Stunden schon saß. Irgendwie zieht es mich immer wieder hierher.
Wenigstens bin ich nicht der Einzige, dem es so geht. Auf der anderen Bank wartet schon mein Kollege, der Nichtstuer. Der Nichtstuer hat das Äußere eines Obdachlosen: weiße Haare, weißer Bart, fleckiger Pullover, sackartiger Anorak, schorfige Füße in ausgelatschten Lederslippern und dazu eine Jeanshose im Stonewashed-Look, der vor zwanzig Jahren mal angesagt war. Die Hose sieht aus, als wäre sie kurz nach dem Mauerfall gekauft und seitdem auch nicht mehr ausgezogen worden.
Der Nichtstuer sitzt jeden Abend hier. Er liest nicht, er schreibt nicht, er telefoniert nicht, er schläft nicht, er redet nicht. Er hockt einfach nur da. Auch die vorbeiziehenden Menschen scheinen ihn nicht im Geringsten zu interessieren. Alle zwanzig oder dreißig Minuten zieht er eine große Flasche Sangria aus den Untiefen seines Anoraks hervor und nimmt einen vorsichtigen Schluck, als müsse er noch den ganzen Sommer mit dieser einen Flasche auskommen. Manchmal dreht er sich eine streichholzdünne Kippe, langsam und bedächtig, um bloß nicht zu viel Energie zu verschwenden.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht obdachlos ist, sondern irgendwo ein kleines Zimmer hat. Hier auf der Bank wohnt er jedenfalls nicht, und Gepäck hat er auch nie dabei. Scheint eher so was wie sein Wohnzimmer zu sein, ein Freiluft-Wohnzimmer am Wasser, so wie bei mir.
Wir sind schon eine gute Gang, der Nichtstuer und ich. Weder reden wir miteinander noch mit anderen. Wir kommen immer allein. Wir sind der harte Kern. Das schweigsame Duo, das lethargische Tandem, die stillen Wasser vom Landwehrkanal.
Während ich darüber nachdenke, warum mir dieser verlotterte Typ, mit dem ich noch nie ein Wort gewechselt habe, wie ein alter Kumpel vorkommt, ich aber seit meiner Rückkehr meinen wirklichen Freunden aus dem Weg zu gehen versuche, ertönen von der gegenüberliegenden Uferseite die zähnelockernden Schreie einer Frau. Es hört sich an, als würde sie bei lebendigem Leibe ausgeweidet, doch es ist nur ein Orgasmus. Ein sehr langer und intensiver Orgasmus, der aus einem offenen Fenster irgendwo hinter der mächtigen Trauerweide in die Abenddämmerung gebrüllt wird.
Der Nichtstuer verzieht keine Miene. Vielleicht ist er ja nicht nur stumm, sondern auch noch taub. Auch ich traue meinen Ohren nicht mehr richtig. Ich fühle mich wie unter einer Glocke, in der sich das libidinöse Geblöke der Frau mit sämtlichen anderen Lauten zu einem dumpfen Geräuschteppich vermischt. Die singenden und schnatternden Vögel, das Knirschen des Kiesweges, die Fahrradklingeln, die kreischenden Kinder, das Stimmengewirr und Geschepper aus den Biergärten hinter mir, das Akkordeonspiel der Schnorrer davor, die bimmelnden Mobiltelefone und das Gelächter – alles wird geschluckt und in meinem Kopf zu einem konstanten Rauschen zusammengebacken. Sogar die mit schrillen Sirenen die Glogauer Straße runterbretternden Krankenwagen schleichen sich verschwommen wie eine weit entfernte Melodie in meine Gehörgänge. Meine eigene Stimme höre ich kaum noch.
Vielleicht brauche ich ein Hörgerät, eine Brille und ein Megaphon, um zurück in die wirkliche Welt treten zu können. Oder eine Schocktherapie. Oder eine infernoartige Sauftour. Zweimal habe ich probiert, mich zu betrinken. Es blieb bei dem Versuch. Die befreiende rauschhafte Wirkung wollte sich einfach nicht einstellen.
ENDE DER LESEPROBE
Copyright © 2010 by Nagel
Copyright © 2010 by Wilhelm Heyne Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH Redaktion: Thomas Brill
eISBN 978-3-641-05027-6V002
www.heyne-hardcore.de
www.randomhouse.de