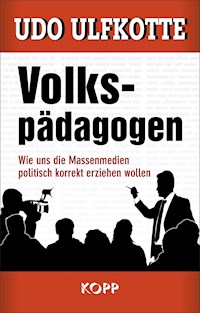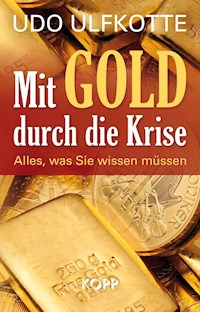6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kopp Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Strom kommt aus der Steckdose, und Lebensmittel kommen aus dem Supermarkt. Doch so einfach ist das nicht. Schon gar nicht in Krisenzeiten. Die ausreichende und verlässliche Versorgung mit Nahrung und Trinkwasser ist keine Selbstverständlichkeit. Schon kleinste Störungen im komplexen Räderwerk der Logistik können schwerwiegende Konsequenzen haben.
Und plötzlich sind die Regale leer!
Wir leben von weltweiten Importen und täglich rollenden Lebensmitteltransportern. Einige wenige Supermarktketten sichern die Versorgung der städtischen Zentren. Gleichzeitig haben wir höchstens Vorräte für vielleicht zwei, drei Tage, können wenig selber kochen und wissen gar nicht mehr, wie und wo unsere Lebensmittel produziert werden. Sich selbst zu versorgen, diese Fähigkeit ist uns gänzlich abhandengekommen. Kommt es zu Engpässen, sitzen wir in der Falle. Und die Wahrscheinlichkeit, dass aus der Wirtschafts- und Finanzkrise eine Versorgungskrise entsteht, ist beängstigend groß.
Klug ist, wer jetzt vorsorgt.
Es braucht an sich nicht viel, um auch Krisen gut zu überstehen. Das Buch knüpft am Wissen unserer Großeltern an, die mehr als eine existenzielle Versorgungskrise zu überstehen hatten, und bietet weise Ratschläge, einfache Rezepte und bewährte Einsichten, wie wir auch ohne Geld, Strom und Supermarkt für eine lange Zeit gut, gesund und nachhaltig überleben können.
So düster die Voraussagen des Autors sind, seine Ausführungen für ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben machen Mut und machen Spaß. Fischen, Pilze suchen, Wildkräuter vom Wegesrand sammeln, Beeren einkochen, Brot backen, wursten, einen Räucherofen mauern und vieles mehr - unser Tisch ist reich gedeckt, wir haben nur verlernt, dies zu erkennen.
Dieses Buch liefert Ihnen kompetentes Wissen für ein unabhängiges und autarkes Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
1. Auflage September 2012 2. Auflage November 2012 3. Auflage Januar 2013 4. Auflage Mai 2015 als Sonderausgabe 5. Auflage Januar 2016 als Sonderausgabe 6. Auflage Juni 2016 als Sonderausgabe 7. Auflage Februar 2017 als Sonderausgabe 8. Auflage November 2017 als Sonderausgabe 9. Auflage Oktober 2018 als Sonderausgabe 10. Auflage Juli 2019 als Sonderausgabe 11. Auflage Februar 2020 als Sonderausgabe 12. Auflage April 2020 als Sonderausgabe 13. Auflage August 2020 als Sonderausgabe 14. Auflage Dezember 2020 als Sonderausgabe 15. Auflage Marz 2021 als Sonderausgabe 16. Auflage September 2021 als Sonderausgabe 17. Auflage Mai 2022 als Sonderausgabe Copyright © 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 bei Kopp Verlag, Bertha-Benz-Straße 10, D-72108 Rottenburg Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Christine Ibele Satz und Layout: opus verum, München ISBN E-Book 978-3-86445-335-9 eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck Die veröffentlichten Ratschläge wurden mit größter Sorgfalt von Verfasser und Verlag erarbeitet und geprüft. Eine Garantie kann jedoch nicht übernommen werden. Ebenso ist eine Haftung des Verfassers bzw. des Verlages und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden ausgeschlossen.
Gerne senden wir Ihnen unser Verlagsverzeichnis Kopp Verlag Bertha-Benz-Straße 10 D-72108 Rottenburg E-Mail: [email protected] Tel.: (07472) 98 06-10 Fax: (07472) 98 06-11Unser Buchprogramm finden Sie auch im Internet unter:www.kopp-verlag.de
Motto
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, dann darf man den Kopf nicht hängen lassen.
Ingrid Matthäus-Maier (Politikerin und Finanzexpertin)
Vorwort
Vorwort
Sie halten ein ungewöhnliches Buch in Händen. Die Regale in den Lebensmittelabteilungen der Supermärkte sind prall gefüllt. Wir werfen mehr Nahrungsmittel weg als jemals zuvor. Und Sie lesen nun die erste Seite in einem Buch, das sich mit Haushalten und Ernährungssicherung in Krisenzeiten beschäftigt. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe kommt zu einem desaströsen Untersuchungsergebnis: Weit weniger als ein Prozent der Deutschen bereitet sich ernsthaft persönlich auf eine künftige Krise vor. Und das, obwohl die Bundesregierung jedem Haushalt empfiehlt, Vorräte für mindestens zwei Wochen einzulagern. Wissenschaftler haben 2012 ergründet, warum sich die Menschen im deutschsprachigen Raum nicht auf eine mögliche Krise vorbereiten. Die Antwort: Mehr als 80 Prozent der Menschen schalten bei unbequemen Themen einfach ab, sie entwickeln stattdessen einen unrealistischen Optimismus. Dieses Buch wird also vielen Menschen mit dem »unrealistischen Optimismus« auf den ersten Blick absurd erscheinen. Doch offenkundig zählen Sie nicht zu jenen Menschen, die das geschönte Bild von der angeblichen Lage da draußen für bare Münze nehmen. Immerhin haben wir seit 2008 eine große Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Zeiten erinnern an die große Weltwirtschaftskrise des letzten Jahrhunderts, die 1929 begann. Drei Jahre nach den ersten schweren Börsenturbulenzen erschien damals von Ingeborg Hahn ein 24 Seiten dünnes Büchlein mit dem Titel MeinKrisenkochbuch. In jener Zeit war es noch selbstverständlich, dass man daheim einen Gemüsegarten hatte und mindestens jede zweite Familie hielt Nutzvieh. Überall gab es um die Städte herum Bauern, die auf ihren Feldern nicht Raps oder Mais für Biokraftstoffe, sondern Nahrungsmittel anbauten. Seit 2008 haben wir nun wieder eine immer verheerender werdende Wirtschaftskrise. Heute ist es viel schwieriger, bei einer weiteren Verschärfung der Lage an jene Lebensmittel zu kommen, die 1929 überall vor den Haustüren produziert wurden. Dieses neue Krisenkochbuch kann sich daher nicht auf 24 Seiten beschränken.
Immer mehr Menschen verlieren ihre Arbeit oder haben Angst um ihren Job. Der Industrie brechen die Aufträge ein. Die Regierung weiß nicht mehr, wie sie die sozialen Verpflichtungen finanziell erfüllen soll. Die politische und gesellschaftliche Instabilität in Europa wächst von Tag zu Tag. In Griechenland leben seit Anfang 2012 mehr Menschen von Tauschgeschäften als von bezahlter Arbeit. Man tauscht einen Haarschnitt gegen ein Stück Brot, Unterricht, Impfungen, ärztliche Dienstleistungen oder als Elektriker eine Arbeitsstunde gegen Lebensmittel. »Haarschnitt gegen Brot« – so lautete im Juni 2012 ein Bericht der deutschen Tageszeitung Die Welt über die neue Kreativität jener Griechen, die in Arbeitslosigkeit und Armut verfallen. Bürgerkriege, Aufstände und Unruhen, die wir bislang nur aus weit entfernten Ländern kannten, kommen immer näher. Wir blenden das alles innerlich aus. Schließlich behaupten unsere Politiker, sie hätten alles im Griff. Das haben sie auch gesagt, als die D-Mark abgeschafft wurde. Sie haben uns nicht die Wahrheit gesagt. Und sie sagten es, bevor das erste Geld aus den Rettungspaketen an Länder wie Griechenland überwiesen wurde. Auch da haben sie uns belogen. Wann also öffnen wir endlich die Augen und befassen uns mit der Realität?
Von Griechenland bis Spanien brandet langsam eine Welle der Unruhe durch Europa. In Deutschland, vor allem in den Großstädten, gibt es wachsende soziale Proteste und immer öfter gewaltsame Ausschreitungen, die von der Polizei häufig kaum noch unter Kontrolle gehalten werden können. Die Arbeitslosigkeit steigt erkennbar immer stärker an, obwohl die Zahlen von den Politikern geschönt werden. Zugleich werden staatliche Leistungen zurückgefahren. Mehr als eine Million Deutsche müssen schon jetzt von der Tafel-Bewegung mit Lebensmitteln versorgt werden. Was aber passiert, wenn sich die Lage noch weiter verschlechtert? Wenn der Hunger, der in Europa zunächst in Griechenland anklopfte, sich auch im deutschsprachigen Raum ausbreitet? Wer das für Utopie hält, der hat sich nie mit der Verletzlichkeit unserer Lebensmittelversorgung befasst. Die Lage kann sehr schnell eskalieren. Wir sind auf beinahe allen Gebieten vom guten Willen vieler Länder abhängig. Was passiert, wenn Russland uns kein Erdgas mehr liefert, das kann sich jeder selbst ausmalen. Wenn es am Persischen Golf Kämpfe gibt und die Ölversorgung dadurch um mindestens 75 Prozent reduziert wird, muss auch nicht näher beschrieben werden. Dann werden nur noch Polizei und Hilfsdienste vorrangig mit Treibstoffen versorgt. Was aber passiert, wenn die Euro-Krise wieder einmal an Schärfe zunimmt, wenn es in den Städten immer häufiger zu Unruhen kommt, weil die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern an immer mehr Orten nicht mehr wie gewohnt aufrecht erhalten werden kann? Viele können – oder besser wollen – sich das (noch) nicht vorstellen. Aber ganz sicher sind viele Menschen im deutschsprachigen Raum dann auf sich allein gestellt.
Dieses Buch will jene, die sich auf mögliche Krisensituationen vorbereiten wollen, zum Nachdenken anregen. Wie überlebt man eigentlich in einer Krisenzeit? Was kann man essen, wenn die gewohnte Versorgung plötzlich zusammenbricht? Dann braucht man wieder einmal jenes Wissen, welches unsere Vorfahren über Generationen weitergereicht haben. Doch statt überlebenswichtiger Fragen der Existenzsicherung stehen heute bei den meisten Menschen vor allem Sex, Ballaballa und das nächste Besäufnis im Vordergrund. An diese Menschen richtet sich das vorliegende Buch garantiert nicht. Ihnen ist nicht mehr zu helfen. Aber Sie können sich als Leser mit jenen Fragen befassen, die Ihnen im möglichen Krisenfall eine Grundlage für das Überleben bieten.
Beantworten Sie sich doch nur einmal eine einzige Frage: »Wer ist der Schlauere?« Jener, der sich auf absehbare und mögliche Entwicklungen in aller Ruhe vorbereitet oder jener, der nach dem Motto lebt »Es wird schon nichts passieren«. Sicher ist, dass wir in turbulenten Zeiten leben. Und es kann sehr schnell sehr ungemütlich werden. Von harten Wintern, die Straßen unpassierbar machen, über Sonnenstürme, die auf einen Schlag viele elektrische Geräte zerstören bis hin zu sozialen Spannungen müssen wir mit immer mehr Risiken leben. Und wir sind im deutschsprachigen Raum verwundbarer denn je zuvor. Denn die globalisierte Welt hat einen großen Nachteil: Fällt in dem globalisierten System auch nur ein Zahnrad aus, dann funktionieren Teile des Systems oder aber das ganze System nicht mehr. Was machen Sie, wenn Sie an einen Bankautomaten kommen und der Bildschirm zeigt nichts mehr an? Was, wenn an der Tankstelle die Benzinpumpen versagen? Und was ist, wenn im Supermarkt die elektronischen Kassen nicht mehr funktionieren? Das alles sind nur winzige Systeme im Vergleich zu unserer Nahrungsmittelversorgung. Schon der Ausfall der Bankautomaten wäre katastrophal für uns, noch schlimmer der länger andauernde Ausfall elektronischer Kassen in den Einkaufsmärkten. Was aber, wenn ein großer Teil des Nachschubs an Lebensmitteln ausbleibt? Und zwar wegen Gründen, auf die wir keinen Einfluss haben. Schließlich werden unsere Lebensmittel nicht mehr direkt vor unserer Haustüre produziert. Wird die Versorgungskette etwa durch soziale Unruhen in Nachbarländern gestört (und dafür genügen gezielte Sitzblockaden auf Autobahnen in anderen Staaten), dann haben wir sehr schnell ein sehr großes Problem.
Wir sind abhängig von Lebensmittelimporten
Warum überlassen wir Supermärkten die Ernährungssicherung?
Bei vielen ist es noch ein unbestimmtes Gefühl: Wir sollten sparsamer leben. Denn wer weiß schon, was in diesen Krisenzeiten noch auf uns zukommt. Andere merken schon deutlich, dass das Geld am Ende des Monats knapper wird. Sie mussten auf Gehalt verzichten, machen Kurzarbeit oder haben ihren Arbeitsplatz inzwischen ganz verloren. Die Krise trifft immer mehr Menschen. Und zwar auch Menschen, die sich in der Vergangenheit niemals Gedanken darüber machen mussten, wie man sparsam einkauft und lebt. Die Einschläge kommen immer näher. Kein Mensch kann heute verlässlich sagen, welche Entwicklung die schwere Wirtschafts- und Finanzkrise nehmen wird. Sicher ist nur, dass auch die Griechen und Spanier vor einiger Zeit noch keinesfalls geglaubt hätten, wie schlecht es ihnen heute geht. Wir leben aber im deutschsprachigen Raum nicht auf einer Insel der Glückseligkeit. Schließlich bürgen wir für die gigantischen Schulden anderer Länder. Das System kann jederzeit auch bei uns zusammenbrechen. Und wer garantiert uns eigentlich, dass wir in Krisensituationen einen ungehinderten Zugang zu jenen Vorräten haben, die wir dann gerade daheim brauchen? Die Antwort lautet: »niemand«. Die Anschaffung von persönlichen Notvorräten ist deshalb unerlässlich. Wir leben jetzt am Ende einer Zeit, in der alle Verbraucher sich daran gewöhnt haben, nach ihren Bedürfnissen jederzeit aus einem vielfältigen Angebot von qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln auswählen zu können. Lebensmittel waren in der Vergangenheit preiswert für uns. Und das Angebot an Produkten aus anderen Ländern und Kontinenten war so groß, dass zu keiner Zeit im Jahr ein Wunsch unerfüllt blieb. Die reibungslos verlaufende Versorgung durch den Markt setzt jedoch neben der inländischen Erzeugung einen auf nationaler und internationaler Ebene funktionierenden Nahrungsgüteraustausch voraus. Die Nahrungsmittelversorgung und damit die Lebensgrundlage einer Gesellschaft kann aber von einem Tag auf den anderen stark gefährdet werden. Und deshalb sollten Sie wissen, wovon Sie dann leben, wenn der Nachschub in den Geschäften ausbleibt oder Sie sich immer öfter Lebensmittel schlicht nicht mehr leisten können.
Haben auch Sie im letzten Spätherbst einige Äpfel unter Bäumen liegen sehen, die dort einfach so verfaulten? Wer bückt sich heute schon noch für einen Apfel? Schließlich liegen Äpfel aus Neuseeland, Chile und Südafrika genau in Griffhöhe in den Regalen der Supermärkte. Diese »Bioäpfel« vom anderen Ende der Welt werden einmal um den halben Globus geflogen. Warum sollen wir uns da noch für einen heimischen Apfel bücken? Das alles ist seit vielen Jahren eine Selbstverständlichkeit für uns. Als intelligenter Mensch sollten Sie jetzt nachdenklich werden. Sie müssen Denkweisen kennen, die für unsere Vorfahren noch vor wenigen Jahren selbstverständlich waren. Die Politik, die uns in die schwerste Wirtschafts- und Finanzkrise seit vielen Jahrzehnten führte, und die Medien haben uns das naturnahe Denken und die Vorratshaltung von Lebensmitteln sowie jede Form der Selbstversorgung aberzogen. Jene, die uns suggerierten, dass unsere Sparguthaben und der Euro ewig Bestand haben würden, versichern uns auch, dass es bei unseren Lebensmitteln nie wieder Knappheit geben werde. Dabei ist unser Lebensmittelangebot ebenso »sicher« oder »unsicher« wie der Euro.
In den letzten Jahrzehnten wurde der Lebensmittelmarkt immer mehr mit Halbfertigprodukten und Fertigprodukten überschwemmt. Die Industrie übernahm die Versorgung der Bevölkerung, die bis dahin vor Ort von Kleinstbetrieben und Bauern abgedeckt wurde. Wo früher viele Bäcker vor Ort waren, da verschwand einer nach dem anderen. Und jene Orte, die heute noch einen Bäcker haben, der ohne zugelieferte Teiglinge backt, können sich glücklich schätzen. Nicht anders ist es bei Metzgern oder Gemüsebauern. Im Gegensatz zu unseren Großeltern haben wir die Verantwortung für unsere Ernährung an Supermärkte und Logistikunternehmen abgetreten. Nicht erst die Ereignisse im japanischen Fukushima sollten uns deutlich machen, dass auch vermeintlich krisensichere Regionen (wie Japan) nicht vor unerwarteten Notfällen gefeit sind. Unruhen, Rohstoffknappheit und Lieferengpässe durch politische Turbulenzen, Klimakatastrophen oder andere plötzlich eintretende Ereignisse sind in vielen Teilen der Welt Realität und können jederzeit auch zu uns kommen.
Doch selbst die Ärmsten in Deutschland verlassen sich massenweise auf andere, wenn es um ihre Existenzsicherung geht. Ein Beispiel für diese Versorgung ist die Tafel-Organisation. Allein in Deutschland gibt es mehr als 890 Tafeln, die einmal pro Woche rund 1,2 Millionen ärmere Menschen (Stand Sommer 2012) mit 3,4 Kilogramm Nahrungsmitteln versorgen. Die bekommen sie von Supermärkten oder vom Lebensmittelhandel, weil die Ware unansehnlich ist oder das Verfalldatum näher rückt. Zudem unterhalten sie Suppenküchen. Was aber geschieht mit den Empfängern dieser Lebensmittellieferungen, wenn die Nachschublieferungen durch unvorhersehbare Ereignisse ausbleiben? In einer Überflussgesellschaft gibt es ständig Nachschub für die Unterstützung der Ärmsten. In einer Krise wächst allerdings die Zahl der Hilfebedürftigen, während das Angebot an »Überflüssigem« zurückgeht. Allein dieses eine Beispiel zeigt, wie verwundbar wir bei der Lebensmittelversorgung auch in guten Zeiten längst geworden sind. Hinzu kommt: Auf die kostenlosen Lebensmittelgaben der Tafeln gibt es natürlich keinen Rechtsanspruch. Es sind freiwillige Leistungen des Gebers an den Empfänger. Je nach Tafel und deren Möglichkeit oder Willen zur Beschaffung von Lebensmitteln fallen die Spenden mal größer und mal geringer aus. Tafeln können Menschen aus ihrer Gemeinschaft (Berechtigung zum Abholen) jederzeit ausschließen, was auch praktiziert wird. Damit ist der Charakter der Gaben der Tafeln ein anderer als der von gesetzlichen Mindestleistungen – Gaben der Tafeln sind Almosen. In Krisenzeiten können sie von einer Sekunde auf die andere einfach wegfallen. Was tun die 1,2 Millionen Empfänger dieser Lebensmittelspenden dann? Sie machen sich in guten Zeiten darüber wahrscheinlich keine Gedanken.
Dabei sind viele Deutsche gar nicht in der Lage, sich im Notfall selbst zu versorgen. Glücklich ist, wer für solche Fälle einen finanziellen Notgroschen angespart hat. Doch das trifft nicht einmal auf jeden zweiten Bundesbürger zu. Laut einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens TNS Infratest unter tausend Bundesbürgern im Jahr 2012 könnten 54 Prozent der Deutschen nicht innerhalb eines Monats Geld auftreiben, wenn ein finanzieller Notfall auftritt. Sie leben von einem Monat in den nächsten – ohne irgendeinen Plan. Vor allem die 25- bis 45-Jährigen haben keine Rücklagen gebildet. Elf Prozent müssten Wertgegenstände verkaufen, wenn es eine Krise gäbe und 14 Prozent hoffen darauf, dass ihr Arbeitgeber ihnen dann einfach mehr Geld gibt. 52 Prozent haben keinen Notgroschen. Und sie denken auch nicht daran, für eine Krise vorzusorgen. Für sie ist es einfach unvorstellbar, dass prall gefüllte Regale nichts Selbstverständliches sind.
In den vergangenen Jahrzehnten haben wir vergessen, wie unauflöslich unsere Ernährung an klimatische und jahreszeitliche Bedingungen geknüpft ist. Vor hundert Jahren konnten sich nur die wirklich Reichen Lebensmittel aus anderen Regionen und Ländern leisten, es war damals ein exklusives Vorrecht. Für Durchschnittsbürger sah das Leben völlig anders aus: Ihr Nahrungsmittelbedarf wurde fast ausschließlich durch Hausgemachtes gedeckt. Die verfügbaren Lebensmittel waren stark an die Jahreszeiten geknüpft. Nicht einmal Brot kam jeden Tag auf den Tisch. Die Speisenauswahl war durch Ernte- und Schlachtzeiten saisonal begrenzt. Und nur wenige Lebensmittel konnten über einen längeren Zeitraum haltbar gemacht und gelagert werden. Damals gab es in jeder Familie Vorratshaltung. Vor hundert Jahren hätte kein vernünftig denkender Mensch den Sinn der Vorratshaltung von Nahrungsmitteln in Frage gestellt. Nun gab es zu jener Zeit auch noch keine Milch aus der Kühltheke im Supermarkt um die Ecke und auch keinen Strom aus der Steckdose. Seit vielen Jahrzehnten schon haben wir überall prall mit Lebensmitteln gefüllte Regale. Der Überfluss ist so gewaltig, dass Jahr für Jahr Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll landen. Die Not vergangener Zeiten haben wir längst vergessen.
Krisen kennen wir nur noch aus dem Fernsehen. Not und Hunger haben heute vielleicht weit entfernt lebende Menschen, aber wir ganz bestimmt nicht. Das haben auch die Griechen noch vor kurzer Zeit gedacht. Doch die Sicherstellung unserer Lebensmittelgrundversorgung ist keine Selbstverständlichkeit. Es gibt viele Faktoren, die innerhalb weniger Tage die Not auch wieder zu uns bringen könnten. Dazu gehören schwere Wirtschaftskrisen mit Massenarbeitslosigkeit und dem Zusammenbruch des Währungssystems ebenso wie Naturkatastrophen, Ernteausfälle durch Schädlinge oder Pflanzenkrankheiten, eine Energiekrise und internationale Ereignisse wie plötzlich an unseren Grenzen ausbrechende Konflikte oder gar Bürgerkriege. Erinnern Sie sich noch an den Dezember 2010 und was einige starke Schneefälle da anrichteten? Stillstand auf Straßen, Flughäfen und Schienen, Stromausfall und schulfrei. Dann kam es in weiten Teilen Deutschlands zu weiteren Problemen. Erst fehlte nur Streusalz, dann ging den ersten Tankstellen der Treibstoff aus. Und dann kam die ganze Lieferkette der Lebensmittelindustrie für einige Tage durcheinander. Und was war im Frühjahr 2010? Da brach ein bis dahin völlig unbekannter Vulkan in Island aus. Und europaweit wurde der Flugverkehr lahmgelegt. Alle Lebensmittel, die per Luftfracht aus fernen Ländern kamen, verrotteten irgendwo. Und das Schweizer Bundesamt für Bevölkerungsschutz meldete im Oktober 2010 aus unserem Nachbarland Frankreich: »Mit der Blockierung von wichtigen Zufahrtsstrassen und des Streiks der Lastwagenfahrer ergibt sich eine brenzlige Lage für die Teilsektoren Erdölversorgung, Luftverkehr, Straßenverkehr, Lebensmittelversorgung und die Abfälle in Frankreich. Der Streik der Lastwagenfahrer ist besonders kritisch, da sie durch ihre Straßensperren auch die Versorgung mit Lebensmitteln verschlechtern können, bzw. die Abfallentsorgung teilweise lahmlegen können.« Kleine Ereignisse können eben sehr schnell große Folgen haben. Wir verdrängen das gern.
Wir sind es gewohnt, dass jeden Tag knackig frische Salate aus Spanien und Kartoffeln aus Ägypten im Supermarkt um die Ecke zu finden sind. Ein Lastkraftwagen mit spanischen Salaten muss allerdings mehr als 2000 Kilometer fahren, bis die Fracht in Deutschland oder Österreich angekommen ist. Und im Falle Ägyptens sind es mehr als 3000 Kilometer Luftlinie. Früher waren die Märkte, unter anderem auf Grund hoher Transportkosten, nahezu abgeschottet. Lebensmittel aus fernen Ländern gab es höchstens im Kolonialwarenladen. Sie waren etwas ganz Besonderes. Heute beschweren sich Chefköche darüber, dass es immer schwieriger wird, etwas Außergewöhnliches zu kochen, weil die exotischsten Dinge nun für jeden zugänglich und in fast jedem Supermarkt erhältlich sind. Achten Sie einfach einmal bei Ihrem nächsten Einkauf darauf, aus welchen Ländern die Lebensmittel in den Regalen kommen. Vieles stammt garantiert nicht aus dem deutschsprachigen Raum. Das gilt inzwischen vor allem auch für die so beliebten Bioprodukte.
Die Nachfrage nach Biolebensmitteln steigt in Deutschland so rasant, dass die deutschen Landwirte seit Jahren schon mit der Produktion nicht nachkommen. Jede zweite Bio-Möhre, jeder zweite Bioapfel und sogar 80 Prozent der Biotomaten müssen importiert werden. In Deutschland gibt es nur 7,9 Prozent ökologische Anbaufläche. Sie kann kaum noch ausgeweitet werden, weil die Flächen für Biokraftstoffe (Raps, Mais) benötigt werden. Rund zwei Drittel der Deutschen kaufen inzwischen regelmäßig Biolebensmittel. Und vier Fünftel kaufen vor allem ökologische Produkte aus der Region. Doch die sind bei näherem Hinschauen eben meist auch importiert und werden nur »in der Region« umgepackt.
Wir sind umgeben von importierten Lebensmitteln, ohne die wir kaum noch leben könnten. Wir essen beispielsweise immer mehr importierten Reis anstelle von heimischem Getreide. Der Verbrauch an geschältem und geschliffenem Reis ist von 1,8 Kilogramm pro Kopf im Jahr 1973 auf fünf Kilogramm im Jahr 2008 gestiegen. Er liegt damit bereits über dem Pro-Kopf-Verbrauch an Hafer. Haferschleim war für unsere Vorfahren eine ganz normale Nahrung. Heute hat natürliche und gesunde Haferschleimsuppe einen Ekelfaktor. Zugleich essen wir immer mehr Hartweizen. In den 1980er- und 1990er-Jahren lag der Getreideverbrauch pro Kopf zwischen 90 und 100 Kilogramm pro Jahr und stieg mit Beginn dieses Jahrhunderts auf 120 Kilogramm an. Die Ursachen der Zunahme des Pro-Kopf-Verbrauchs liegen im Trend zu mehr Fastfood wie Pizza, Döner oder Fladenbrot. Parallel dazu produzieren wir allerdings immer weniger Hartweizen, weil die Anbauflächen für Mais genutzt werden, aus dem dann Treibstoffe gewonnen werden. Bei Hartweizen haben wir in Deutschland eine Selbstversorgung von nur noch fünf Prozent. Im Klartext: 95 Prozent dieser beliebten Lebensmittel müssen inzwischen importiert werden, zumeist in fertiger Produktform wie Nudeln.
Kaum jemand nimmt auch wahr, dass es in Deutschland zwar bis auf Stadtstaaten wie Hamburg, Bremen und Berlin große Anbauflächen für Getreide gibt, aber immer weniger Mühlen, in denen das Getreide auch gemahlen werden kann: Während 1950 in ganz Deutschland (West und Ost) noch rund 19.000 aktive Mühlen heimischen Weizen und Roggen verarbeiteten, wurden 1982 in ganz Deutschland nur noch knapp 2500 Mühlen gezählt. 1990 waren nur noch 686 Mühlen, 2000 noch 465, 2001 noch 361 und im Jahr 2009 noch 302. Inzwischen sind es weniger als 250 Mühlen. Es wurden also seit 1950 in Deutschland 98,7 Prozent aller Mühlen geschlossen. Zwar sind die übrig gebliebenen Mühlen nun Großbetriebe, die von der Kapazität her den Vergleich mit 1950 nicht zu scheuen brauchen, aber wir haben eine immer dezentralere Versorgung. Während es in der Krisenzeit des Zweiten Weltkrieges noch überall vor Ort Mühlen gab, müssen bei der nächsten Krise lange Transportwege zurückgelegt werden. Der Bäcker um die Ecke kann heute ohne große Zentralmühlen kein Brot mehr backen, auch wenn das Getreide in großen Mengen beim Bauern um die Ecke lagert. Acht Prozent der übrig gebliebenen 250 Mühlen vermahlen heute 63 Prozent des heimischen Getreides: Wir sind jetzt abhängig von zwanzig Großmühlen. Und weil der Konzentrationsprozess auch in dieser Branche immer weiter fortschreitet, werden es immer weniger – und nicht mehr. Welche Folgen das bei einer ernsthaften Krise hat, muss man nicht näher erläutern. In Hamburg, Bremen und Berlin gibt es schon heute keine Getreidemühle mehr, in Schleswig-Holstein nur noch sechs und in Sachsen-Anhalt nur noch fünf Mühlen. Am besten versorgt sind Bayern mit (noch) 82 und Baden-Württemberg mit (noch) 75 Mühlen.
Noch vor wenigen Jahrzehnten konnte sich jede Region im deutschsprachigen Raum im Notfall selbst mit heimischen Lebensmitteln versorgen. Doch unsere Landwirtschaft hat seither einen gewaltigen Strukturwandel durchgemacht. Den klassischen Bauern, der Gänse, Hühner, Kühe und Schweine hält und auch Getreide und Gemüse anbaut, den gibt es nun nicht mehr. Bauern sind heute Landwirtschaftsunternehmen, die auf Schweinehaltung, Rinderhaltung oder Getreideanbau spezialisiert sind. Das hat verheerende Folgen in Hinblick auf Abhängigkeiten: Unsere Landwirtschaftsbetriebe sind heute extrem von Vorleistungen abhängig. Wird die Einfuhr von Futtermitteln auch nur wenige Tage unterbrochen, dann geht die Erzeugung sofort zurück. Im Klartext: Der Bauer, der beispielsweise in Massentierhaltung Geflügel hält, baut das Futter für die Tiere nicht selbst an. Wird die Lieferkette der ausländischen Zulieferer länger unterbrochen, dann verhungern die Tiere. Ein Städter kann sich heute auch kaum vorstellen, was passiert, wenn in der Landwirtschaft Dünger oder Pflanzenschutzmittel fehlen oder wenn es keine Ersatzteile für Maschinen gibt oder der nötige Treibstoff fehlt. Unser ganzes System der Lebensmittelversorgung ist in Krisenzeiten schnell extrem störanfällig. Schon vereiste oder verschneite Straßen können Ortschaften von der Lebensmittelversorgung abschneiden, Hochwasser oder Erdbeben unter Umständen sogar eine ganze Region.
Bei der Lebensmittelversorgung spielt in Deutschland (vor allem in städtischen Gebieten) die Selbstversorgung kaum noch eine Rolle. Auch bei der Speisenzubereitung setzen die Verbraucher mehr und mehr auf Fertigprodukte, verbunden mit der Nutzung von Mikrowelle und Tiefkühltruhe. Über den laufenden tagesaktuellen Bedarf hinaus verfügen die Haushalte kaum noch über Vorräte. Eine konkrete gesetzliche Vorsorgepflicht für privatwirtschaftliche Unternehmen der Lebensmittelversorgung gibt es nicht. Handelsriesen wie Rewe, Lidl, Aldi, Netto oder Tengelmann können Kunden beliefern – oder auch nicht. Sobald es eine ernste Krise gibt, werden die Medien darüber berichten. Und schon in dieser »Medienphase« wird es sofort Hamsterkäufe geben. Bleibt – aus welchen Gründen auch immer – der Nachschub in den Supermärkten für einige Tage aus, dann bricht Panik aus – und die Hamsterkäufe werden schnell zur Epidemie, die keiner mehr aufhalten kann.
Denken wir jetzt nur einen Moment einmal das »Undenkbare«: Wie sicher ist unsere Lebensmittelversorgung in Deutschland im Ernstfall? Am 30. Juni 2011, wenige Wochen nach der japanischen Reaktorkatastrophe in Fukushima, gab es dazu einen Vortrag von Dr. Helmut Grimm, Sonderbeauftragter der Tengelmann-Gruppe. Er wies die Zuhörer zunächst darauf hin, wie wenig Menschen in Deutschland noch selbst Lebensmittel produzieren. Aus den früheren Hausgärten sind Ziergärten geworden und die meisten Menschen haben allenfalls noch einen Balkon. Tiefkühltruhe und Mikrowelle bestimmen das Leben von immer mehr Haushalten. Allein von 1990 bis 2010 stieg der Absatz von Tiefkühlkost (ohne Speiseeis) nach Grimms Angaben um 97 Prozent pro Bundesbürger auf jährlich 40,2 Kilogramm. Kaum ein Haushalt hat noch Platz für Vorräte, könnte selbst im Krisenfall nichts mehr einlagern, weil man darauf bei der Wohnungsgröße nicht vorbereitet ist. Und der komplette tägliche Bedarf an Lebensmitteln wird fast nur noch über den Lebensmittelhandel gedeckt.
Allein ein einziger Lebensmittelhändler wie Plus/Netto hat in Deutschland 2800 Filialen und 29.000 Mitarbeiter. Pro Regionallager sind täglich 170 Lastkraftwagen unterwegs, um den Nachschub zu sichern. In den Regalen der Zentrallager reicht der Nachschub für die Filialen zwischen einem und 3,5 Tagen. Und die Filialen sind so bestückt, dass die Regale dort bei normalem Kaufverhalten – je nach Produkt – einen bis maximal 4,5 Tage ein Angebot beinhalten. Im Klartext: Der Nachschub muss Tag für Tag funktionieren, sonst findet der Konsument schon nach 24 Stunden die ersten leeren Regale vor. Und das ohne Hamsterkäufe in ganz normalen Zeiten. Ein Lebensmitteldiscounter wie Plus/Netto versorgt täglich 2,6 Millionen Menschen. Wie auch jeder andere Lebensmittelhändler ist das Unternehmen völlig abhängig von der funktionierenden Treibstoff- und Stromversorgung. Deren Ausfall würde nach Angaben von Grimm schnell zu Versorgungsengpässen führen. »Wie sicher ist unsere Ernährungsvorsorge«? lautete die Frage am Ende eines spannenden Vortrags vor Fachleuten an Grimm. Und er antwortete vielsagend: »Aus Sicht der Bevölkerung ist sie sicher«.
Nun unterliegt aber der Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland einem fortschreitenden Wandel. Die Zahl der Einzelhandelsgeschäfte sinkt beständig. Und es gibt bei den Anbietern zugleich eine immer stärkere Konzentration auf einige wenige Großkonzerne. Seit dem Aufkommen neuer Vertriebsformen wie immer größeren Supermärkten (so bedeutet das Motto von real »Einmal hin – alles drin«), Einkaufszentren oder Discountern und den veränderten Lebens- und Essgewohnheiten der Verbraucher steigen auch die Ansprüche der Kunden, was Frische und Qualität der Produkte betrifft. Gleichzeitig wollen die Handelsunternehmen die Lagerkosten senken. Das führt zu gewaltigen Problemen nicht nur bei der Gestaltung der Logistikprozesse für temperaturgeführte Lebensmittel (etwa Kühlware). Ein Beispiel: Wenn Sie als Kunde einen Erdbeerjoghurt eines bekannten Stuttgarter Herstellers kaufen, dann haben die Produktbestandteile bis zu Ihrem Kauf schon 7695 Kilometer zurückgelegt. Sie können das bei einem Glas Erdbeerjoghurt nicht glauben? Die Wege eines solchen Joghurts sind weit und verschlungen: Die Erdbeeren kommen aus Polen, die Pappe für die Umverpackung der Gläser von der Nordseeküste und die Folie auf dem Deckel aus Frankreich. Bis ein Glas Fruchtjoghurt in einer Kühltheke steht, sind seine Bestandteile und die Verpackung schon tausende von Kilometern im Lkw über Autobahnen, Landstraßen und durch Innenstädte gerollt. Alles »just in time« – bedarfsgerecht auf den Zeitpunkt genau vorherberechnet. Wie ein Schnittbogen sehen die Verbindungslinien zwischen Zulieferern in Europa und einem Stuttgarter Hersteller von Erdbeerjoghurt aus. Die polnischen Erdbeeren werden in Aachen verarbeitet und kommen dann als Fruchtzubereitung ins Stuttgarter Werk. Nachfolgend eine Auflistung, welche Strecken die einzelnen Bestandteile der Verkaufsverpackung bis zur Produktion schon zurückgelegt haben: Milch: 36 Kilometer, Fruchtzubereitung: 1246 Kilometer, Joghurtkulturen: 920 Kilometer, Zucker: 107 Kilometer, Glas: 746 Kilometer, Alu-Platine: 864 Kilometer, Etikett: 948 Kilometer, Steige: 402 Kilometer, Zwischenlage: 647 Kilometer, Stretchfolie: 406 Kilometer, Leim (Etiketten): 639 Kilometer, Leim (Steigen): 734 Kilometer. Das macht zusammen 7695 Kilometer. Ganz nebenbei sei erwähnt, dass solche Produkte erstaunlicherweise auch noch prämiert werden und beispielsweise einen »Umweltengel« bekommen.
Seit 2010 hat der Online-Händler Amazon die größte Auswahl an Lebensmitteln, die es in Deutschland im Internet zu kaufen gibt. Es werden dort mehr als 35.000 Produkte von Gemüse, Fleisch und Fisch über Backwaren bis hin zu Delikatessen aus verschiedenen Ländern zur Auswahl angeboten, die »just in time« zum Kunden geliefert werden. Wer das unterstützt, der wird zu einem Kunden, der in einer Krisensituation ganz sicher hilflos auf die leeren Internet-Regale starren wird.
Wie perfekt (und anfällig für Störungen) dieses System inzwischen ist, zeigt die »just-in-time«-Produktion von Lebendtieren für unsere Lebensmittelindustrie. Wo früher Geflügel oder Schweine auf dem Bauernhof artgerecht in Ruhe groß gezogen wurden, da gibt es heute automatisierte Mästereien. In einer dem Autor vorliegenden Anleitung für die »just-in-time«-Schweinemast heißt es: »Ebenso wie in der Industrie wird die Umsetzung dieses Konzeptes in der Schweinemast erst durch die großen technologischen Fortschritte der Schweinehaltung möglich. Die Ansprüche an die Logistik sind erheblich, dies erfordert ein für den technischen Bereich erhöhtes Investitionsvolumen, das die effizientere und letztendlich kostensparendere Produktion erst ermöglicht. Der Stall muss nach den Voraussetzungen dieses Konzeptes erstellt oder entsprechend umgerüstet sein. Der Betriebsleiter muss mit dem Inhalt des Konzeptes vertraut sein und seine überwachende, kontrollierende Funktion permanent ausüben.« Welcher Käufer von Schweinefleisch weiß denn heute, dass die Mastbetriebe noch vor dem Kauf der einzelnen Ferkel schon die Stunde kennen, in denen diese geschlachtet werden? Die Produzenten wissen sogar noch mehr, sie kennen schon das Schlachtgewicht, das durch eine Sensorfütterung für unsere »just-in-time«-Lebensmittelgesellschaft optimiert wurde. In dem Bericht heißt es: »Bei der Fütterung im eigentlichen Stall wird das ›Just in Time‹-Konzept häufig schon seit Jahren angewendet. Ein Beispiel hierfür ist das System der Flüssigfütterung, wo den Tieren in drei Mahlzeiten nur die jeweils benötigte Futtermenge frisch zubereitet angeboten wird. Diese zeitgleiche Verabreichung von Futter an alle Mitglieder einer Gruppe kommt dem natürlichen Fressverhalten der Schweine entgegen. Dennoch kann das Konzept auch hier noch weiter ausgefeilt werden. So kann die dreimal täglich erfolgende Fütterung ganzer Mastställe zugunsten einer verzehrsorientierten Sensorfütterung von Einzelbuchten aufgegeben werden. Im Trog eines jeden Abteils ist dann jeweils eine Grundmenge frischer Futtersuppe verfügbar, die bei Verzehr automatisch ergänzt wird, so dass die Gruppen individuell ad libitum gefüttert werden können. Eine optimale Anpassung der Futterzusammensetzung an die individuellen, vom Mastfortschritt abhängigen Anforderungen einer jeden Gruppe ist bei Installation einer Doppelleitung und Vermischung zweier Futtersuppen unterschiedlicher Zusammensetzung am jeweiligen Ventil möglich.« Stellen Sie sich nun einmal vor, die Stromversorgung einer solchen Großmästerei bräche für mehrere Tage zusammen.
Welche Folgen ein längerer Stromausfall hätte
Der Autor Marc Elsberg beschrieb 2012 in seinem Buch Blackout, wie eine Welt bei einem längeren Stromausfall ganz schnell zu Grunde geht. Das Erschreckende daran: Das Buch ist nicht unrealistisch. Es wird dann viele Dinge geben, die Städter schlicht nicht mitbekommen. Kühe etwa, die vor Schmerzen brüllen. Wenn der Strom ausfällt, dann funktionieren auch die Melkmaschinen nicht. Und weil die Bauern mit den Händen nicht so viele Tiere auf einmal melken können, schwellen die Euter der Kühe langsam an, bis sie platzen. Tausende verenden qualvoll. In den Städten und Dörfern müssen die Menschen mit ganz anderen Dingen kämpfen: Als Erstes geht das Licht aus. Dann brechen die Wasser- und die Nahrungsmittelversorgung zusammen, Krankenhäuser müssen den Betrieb einstellen, und die Kommunikation wird gestoppt. Supermärkte und Tankstellen schließen. In den Häusern versagen die Heizungen, in den Atomkraftwerken fallen die Kühlanlagen aus. Mit Waffen verteidigen die Menschen ihr letztes Brot. Nach einer Woche ohne Strom steht die westliche Welt vor dem GAU. Nein, das ist kein Horrorszenario. Das ist die Realität. Schauen wir sie uns Stück für Stück genauer an.
Christoph Unger vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz sagte 2011 bei einem Fachtreffen im Bundestag zu den Folgen eines jederzeit möglichen längeren Stromausfalls: »Wir haben heute Just-in-time-Transport. Das funktioniert dann eben auch alles nicht mehr so, weil die Computer in den Unternehmen nicht mehr funktionieren, die Kommunikation ausfällt, und dann haben Sie im Geschäft vor Ort nicht mehr, was Sie normalerweise erwarten können, das frische Brot, die frischen Brötchen. Und irgendwann wird das dann schwierig mit der Versorgung der Bevölkerung.«