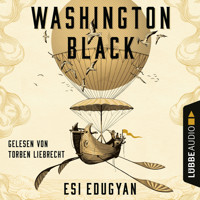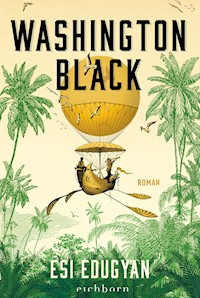
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Die Flucht ist nur der Anfang
Barbados, 1830: Der schwarze Sklavenjunge Washington Black schuftet auf einer Zuckerrohrplantage unter unmenschlichen Bedingungen. Bis er zum Leibdiener Christopher Wildes auserwählt wird, dem Bruder des brutalen Plantagenbesitzers. Christopher ist Erfinder, Entdecker, Naturwissenschaftler - und Gegner der Sklaverei. Das ungleiche Paar entkommt in einem selbst gebauten Luftschiff von der Plantage. Es beginnt eine abenteuerliche Flucht, die die beiden um die halbe Welt führen wird.
Eine Geschichte von Selbstfindung und Verrat, von Liebe und Erlösung. Und eine Geschichte über die Frage: Was bedeutet Freiheit?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 592
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
TEIL EINS
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
TEIL ZWEI
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
TEIL DREI
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
TEIL VIER
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHSZEHN
SIEBZEHN
Danksagung
Über das Buch
Eine Geschichte von Selbstfindung und Verrat, von Liebe und Erlösung. Und eine Geschichte über die Frage: Was bedeutet Freiheit? Barbados, 1830: Der Sklavenjunge Washington Black lebt und arbeitet auf einer Zuckerrohrplantage unter unmenschlichen Bedingungen. Bis er zum Leibdiener Christopher Wildes auserwählt wird, dem Bruder des brutalen Plantagenbesitzers. Christopher ist Erfinder, Entdecker, Naturwissenschaftler – und Gegner der Sklaverei. Das ungleiche Paar flieht von der Plantage in einem selbst gebauten Heißluftballon. Es beginnt eine abenteuerliche Flucht, die die beiden um die halbe Welt führen wird.
Über die Autorin
Esi Edugyan lebt in Victoria, der Hauptstadt der kanadischen Provinz British Columbia. Washington Black ist ihr dritter Roman und wurde von Publikum und Kritik gefeiert. Er stand auf der Shortlist für den Man Booker Prize 2018 und ist für den Giller Prize nominiert.
ESI EDUGYAN
WASHINGTON BLACK
ROMAN
Aus dem kanadischen Englisch von Anabelle Assaf
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Eichborn Verlag in der Bastei Lübbe AG
Titel der kanadischen Originalausgabe:»Washington Black«
Für die Originalausgabe:Copyright © 2018 by Esi Edugyan
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Aylin LaMorey-Salzmann, BerlinCovergestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung einer Illustration von © Joe Wilson/Debut und einem Design von Peter DyerE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-7842-9
www.luebbe.dewww.lesejury.de
Für Cleo & Maddox
TEIL EINS
Faith-Plantage, Barbados1830
EINS
Ich war vielleicht zehn, elf Jahre alt – genau kann ich das nicht sagen –, als mein erster Master starb.
Niemand trauerte um ihn; auf den Feldern ließen wir die Köpfe hängen, aber wir trauerten um uns selbst und um das Anwesen, das nun sicher bald verkauft würde. Er war sehr alt, als er starb. Ich hatte ihn immer nur aus der Ferne gesehen: Gebeugt und dünn saß er oft an einem schattigen Platz auf der Wiese schlafend in einem Stuhl, über dem Schoß eine Decke.
Wenn ich heute an ihn zurückdenke, kommt er mir vor wie ein besonderes, in der Flasche konserviertes Exemplar einer seltenen Spezies. Er hatte einen verrückten König und sogar den Sklavenhandel überlebt, hatte das Französische Kaiserreich fallen und das Britische Imperium aufsteigen sehen genauso wie den Beginn des industriellen Zeitalters, und mit seiner eigenen Nützlichkeit war es vorüber gewesen. Ich erinnere mich, wie ich an jenem letzten Abend mit blanken Fersen auf der steinigen Erde der Faith-Plantage hockte und eine Handfläche gegen Big Kits Wade presste. Ich konnte die Hitze spüren, die von ihrer Haut ausging, ihre Stärke und ihre Macht, während sich um uns herum das rote Sonnenlicht auf die Zuckerrohrpflanzen ergoss. Gemeinsam beobachteten wir stumm die Aufseher, die auf ihren Schultern den Sarg aus dem Haupthaus trugen. Sie ließen ihn mit einem schabenden Geräusch erst ein Stück auf das Stroh im Wagen gleiten und dann mit einem lauten Krachen hineinfallen, bevor sie ratternd davonfuhren.
Und so fing es an: mit Big Kit und mir, die dabei zusahen, wie die Toten die Freiheit fanden.
Sein Neffe traf eines Morgens etwa achtzehn Wochen später am Kopf einer Reihe staubiger Kutschen ein, die direkt vom Hafen in Bridge Town kamen. Dass das Anwesen nicht verkauft worden war, hielten wir zu jenem Zeitpunkt für einen Glücksfall. Die Kutschen schoben sich langsam ächzend im Schatten der Palmbäume die weiche Böschung hinauf. Auf einem flachen Fuhrwerk am Ende der Karawane stand ein seltsames, in Leinen gehülltes Objekt, so groß wie der Felsen im kleinen Feld, an dem wir ausgepeitscht wurden. Ich hatte keine Ahnung, was sich darunter verbergen mochte. An all das erinnere ich mich noch sehr gut, denn ich stand wieder neben Big Kit am Rande des Zuckerrohrs – in jenen Tagen wich ich kaum von ihrer Seite –, und ich sah Gaius und Immanuel, die steif die Kutschentür öffneten und die Treppe ausklappten. Vor dem Haupthaus sah ich die hübsche Émilie stehen. Sie war in meinem Alter, und an manchen Abenden konnte ich einen Blick auf sie erhaschen, wenn sie die Schüsseln mit dem Dreckwasser ins hohe Gras vor der Spülküche entleerte. Jetzt ging sie die ersten beiden Stufen der Veranda hinab und blieb, nachdem sie ihre Schürze geglättet hatte, still stehen.
Der erste Mann, der mit seinem Hut in den Händen heraustrat, hatte schwarzes Haar, ein Kinn, lang wie das eines Pferdekopfs, und Augen, die dunkel verborgen unter dichten Augenbrauen lagen. Er hob den Kopf, während er die Treppe hinunterschritt, und ließ den Blick über das Anwesen und die dort versammelten Männer und Frauen schweifen. Dann sah ich, wie er zu dem merkwürdigen Objekt schlenderte, es umkreiste und die Seile und Leinwände inspizierte. Mit einer Hand schirmte er die Augen gegen die Sonne ab, drehte sich um, und einen beängstigenden Moment lang fiel sein Blick auf mich. Er kaute auf irgendetwas Weichem herum, sein Kiefer arbeitete kaum merklich. Er wandte den Blick nicht ab.
Doch es war der zweite Mann, der finstere Mann in Weiß, der meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Er war unser neuer Master – wir alle sahen es sofort. Er war groß, ungeduldig, kränklich, seine Beine standen voneinander ab wie die Schenkel eines Zirkels. Unter seinem dreieckigen weißen Hut quoll ein Büschel weißer Haare hervor. Ich glaubte, helle Wimpern zu erkennen und milchig blasse Haut. Ein Mann, der einem anderen gehört, lernt schon sehr früh, auf die Augen eines Masters zu achten; was ich im Gesicht dieses Mannes sah, versetzte mich in Angst und Schrecken. Er besaß mich, so wie er all die anderen besaß, unter denen ich lebte. Nicht nur unsere Leben gehörten ihm, sondern auch unser Tod, und es freute ihn zu sehr. Sein Name war Erasmus Wilde.
Ich spürte, wie ein Schaudern durch Big Kit fuhr, und ich konnte sie verstehen. Sein glattes weißes Gesicht glänzte, seine makellos weiße Kleidung leuchtete unmöglich grell, wie ein Gespenst, ein Geist. Ich fürchtete, er könnte in der Lage sein zu verschwinden und unvermittelt woanders wiederaufzutauchen, ganz wie es ihm gefiel; ich fürchtete, dass er sich von Blut ernährte, um sich warm zu halten; ich fürchtete, dass er überall sein könnte, unsichtbar für uns, also verrichtete ich meine Arbeit von nun an stillschweigend. Ich hatte schon viele sterben gesehen: Ich kannte die Natur des Bösen. Es war weiß wie ein Gespenst, es schwebte eines Morgens aus einer Kutsche herab und hinaus in die Hitze, die über einer Plantage stand, auf der die Angst herrschte. Und in seinen Augen lag Leere.
Ich glaube heute, dass dies der Moment war, in dem Big Kit – ruhig und voller Liebe – beschloss, uns beide umzubringen.
ZWEI
Während meiner gesamten Kindheit hatte ich niemanden außer Big Kit, wie man sie auf den Feldern nannte. Ich liebte und fürchtete sie zugleich.
Ich war etwa fünf Jahre alt, als ich die Frau verärgerte, die über unsere Unterbringung bestimmte, und zur Strafe in die unwirtlichste aller Hütten unter dem toten Palmbaum geschickt wurde, wo ich von nun an leben sollte. Kits Hütte. Am ersten Abend stahl man mir das Essen und zerbrach meine Holzschüssel; ein Mann, den ich nicht kannte, schlug mir so hart gegen den Kopf, dass ich das Gleichgewicht verlor und nichts mehr hörte. Zwei kleine Mädchen bespuckten mich. Ihre uralte Großmutter drückte mich zu Boden, ihre Krallen in meine Arme versenkt, und schnitt mir die selbstgemachten Sandalen von den Füßen, um an das Leder zu kommen.
Da hörte ich zum ersten Mal Big Kits Stimme.
»Den nicht«, sagte sie leise.
Das war alles. Doch dann strömte eine monströse Ladung dunkler Energie, gewaltig und unaufhaltsam wie eine Sturzwelle, in unsere Richtung und riss die alte Frau an den Haaren in die Höhe und warf sie zur Seite, als wäre sie nichts als ein knochenloser Stofffetzen. Ich glotzte entsetzt. Big Kit starrte einfach nur aus orangefarbenen Augen auf mich herab, als widerte ich sie an, und kehrte zu ihrem Stuhl in der Ecke zurück.
Am nächsten Morgen kauerte sie jedoch im blassen Licht neben mir. Sie bot mir ihre Schüssel mit Brei, fuhr die Linien meiner Hand entlang. »Du wirst großes, gewaltiges Leben haben, Kind«, raunte sie. »Leben aus vielen Flüssen.« Und dann spuckte sie in meine Hand und schloss meine Faust, sodass der Speichel zwischen meine Knöchel rann. »Das ist erster Fluss, genau hier«, sagte sie und fing an zu lachen.
Ich vergötterte sie. Sie überragte alle, war riesig und unerbittlich. Aufgrund ihrer Größe und weil sie im alten Dahomey, bevor man sie verschleppt hatte, eine Salzwasser-Hexe gewesen war, wurde sie gefürchtet. Sie säte Flüche in die Erdschicht unter den Hütten. Über Türschwellen hingen ausgeweidete Krähen. Drei Wochen lang nahm sie einem kräftigen Schmiedelehrling jeden Morgen und jeden Abend gewaltsam das Essen weg und aß es vor seinen Augen, schöpfte mit den Fingern aus seiner Schüssel, bis sie zu irgendeiner Art Übereinkunft gelangten. In den glimmenden Feldern glänzte sie wie eingeölt, summte leise seltsame Lieder und riss die karge Erde auf, wobei sich unter ihrer Haut die Muskeln wölbten. In manchen Nächten lag sie in der Hütte und murmelte etwas im Schlaf, in dieser tiefen, dichten Sprache ihres Königreichs, bevor sie laut aufschrie. Niemand redete je darüber, und am nächsten Tag arbeitete sie auf den Feldern stets wie eine wild gewordene Furie, wie eine schonungslose Axt, die keinen Unterschied machte, was sie zerstörte und was sie erntete. Ihr wahrer Name sei Nawi, wie sie mir einmal flüsternd erzählte. Sie habe drei Söhne gehabt. Sie habe einen Sohn gehabt. Sie habe keine Söhne gehabt, nicht einmal eine Tochter. Mit jedem Mond veränderten sich ihre Geschichten. Ich erinnere mich daran, wie sie manchmal bei Sonnenaufgang eine Handvoll Erde über ihr Messer rieseln ließ und irgendeine Beschwörungsformel murmelte, ihre Stimme belegt, wie von Gefühlen übermannt. Sie sog die Luft durch die Zähne ein und schielte nach oben, bevor sie zu erzählen begann: »Als ich königliche Wache war in Dahomey« oder »nachdem ich die Antilope mit meinen Händen zerquetscht habe, etwa so«, und sofort hörte ich auf, womit auch immer ich gerade beschäftigt war, und lauschte ihr gebannt. Denn sie war wie ein Wunder, Zeugin einer Welt, die ich mir nicht vorzustellen vermochte, weit weg von den Hütten und grausamen Feldern von Faith.
Unter unserem neuen Master wurde es auf Faith zunehmend düster. In seiner zweiten Woche entließ er die alten Aufseher. An ihrer Stelle erschienen grobschlächtige tätowierte Männer von den Docks, die in der Hitze die roten Gesichter verzogen. Ehemalige Soldaten oder Sklavenhändler oder einfach nur mittellose Inselbewohner, die ihre zerknüllten Papiere in der Tasche trugen und deren teuflische Augen tief in den Höhlen lagen. Dann begannen die Verstümmelungen. Wozu sollten wir mit solchen Verletzungen noch taugen? Ich sah Männer mit blutüberströmten Beinen in die Felder humpeln; ich sah Frauen mit blutdurchtränkten Bandagen über den Ohren. Sie schnitten Edward die Zunge heraus, weil er Widerworte gegeben hatte; Elizabeth zwangen sie, aus einem vollen Nachttopf zu essen, weil sie den vom Vortag nicht gründlich genug geschrubbt hatte. James versuchte, wegzulaufen, also statuierten sie an ihm ein Exempel. Der Master befahl einem Aufseher, ihn vor unseren Augen bei lebendigem Leib zu verbrennen. Später wurde in der Glut seines Scheiterhaufens ein Eisen erhitzt, und wir wurden gezwungen, an seinen entsetzlich verkohlten Überresten vorbeizugehen, während wir einer nach dem anderen ein zweites Mal gebrandmarkt wurden.
Mit James’ Tod begann eine neue Art des Tötens; viele weitere sollten auf ihn folgen. Kranke Männer wurden mit der Peitsche in Fetzen gerissen oder in den Bäumen über den Feldern gehängt oder erschossen. Ich war noch ein Kind und weinte nachts. Doch bei jedem neuen Tod grunzte Big Kit nur in grimmiger Genugtuung, die orangefarbenen Augen zu wütenden schmalen Schlitzen verengt.
Der Tod war eine Tür. Ich denke, sie wollte, dass ich dies begriff. Sie hatte keine Angst vor ihm. Sie gehörte einem alten Glauben an, tief verwurzelt in den hohen Flussregionen Afrikas, und in diesem Glauben wurden Tote wiedergeboren, fanden sich unversehrt und frei in ihrem Heimatland wieder. Mit der Ankunft des Mannes in Weiß hatte diese Idee in ihr zu keimen begonnen wie ein Tropfen Gift in einem Brunnen.
Eines Nachts weihte sie mich in ihre Pläne ein. Sie sagte, es würde schnell gehen. Wir würden nichts spüren.
»Hast du Angst?«, flüsterte sie an unserem Schlafplatz in der Hütte. »Vorm Sterben?«
»Nicht, wenn du keine Angst hast«, sagte ich mutig. Ich konnte den Arm spüren, den sie in der Dunkelheit schützend um mich gelegt hatte.
Sie grunzte. Ein langes tiefes Grollen in ihrer Brust. »Wenn du tot, du wachst wieder in deiner Heimat auf. Du wachst auf frei.« Darauf zuckte ich leicht mit einer Schulter, und als sie das spürte, nahm sie mit den Fingern mein Kinn und drehte mich zu ihr. »Was war das?«, fragte sie. »Glaubst du nicht?«
Ich wollte es ihr nicht sagen; ich hatte Angst, sie könnte wütend werden. Doch dann flüsterte ich: »Ich hab keine Heimat, Kit. Meine Heimat ist hier. Also wache ich hier wieder auf, als Sklave, oder? Nur du bist nicht da.«
»Du kommst mit mir nach Dahomey«, raunte sie nachdrücklich. »So geht das.«
»Hast du sie gesehen? Die aufgewachten Toten? In Dahomey?«
»Ich hab sie gesehen«, flüsterte sie. »Wir alle haben sie gesehen. Wir wussten, was sie waren.«
»Und sie waren glücklich?«
»Sie waren frei.«
Ich konnte spüren, wie mich die Erschöpfung des Tages überkam. »Wie ist das, Kit? Frei sein?«
Ich merkte, wie sie sich auf dem Erdboden bewegte, bevor sie mich an sich zog, ihr Atem heiß an meinem Ohr. »Oh, Kind, das ist wie nichts in dieser Welt. Wenn du frei, du kannst machen, was du willst.«
»Und immer hingehen, wo du willst?«
»Und immer hingehen, wo du willst. Immer aufstehen, wann du willst. Wenn du frei«, flüsterte sie, »und fragt dich jemand was, musst du nicht antworten. Du musst keine Arbeit fertigmachen, die du nicht fertigmachen willst. Du hörst einfach auf.«
Staunend schloss ich die müden Augen. »Stimmt das wirklich?«
Sie gab mir einen Kuss aufs Haar, gleich hinter mein Ohr. »Mhm mhm. Du legst einfach die Schaufel hin und gehst.«
Aber warum wartete sie dann so lange? Die Tage vergingen; auf Faith wurde das Klima rauer, brutaler; und doch tötete sie uns nicht. Vielleicht hatte sie eine Vorahnung, vielleicht warnte sie etwas davor, zu handeln.
Eines Abends führte sie mich hinaus in ihren kleinen Gemüsegarten, in dem wir allein waren. Ich sah die scharfe verrostete Klinge einer Hacke in ihrer Hand und begann zu zittern. Doch sie wollte mir lediglich die kleinen Karotten zeigen, die zu sprießen begannen. In einer anderen Nacht weckte sie mich auf und führte mich schweigend in die Dunkelheit, durch die langen Gräser zu dem abgestorbenen Palmbaum, aber auch dies diente nur dazu, mir einzubläuen, nichts von unseren Plänen zu verraten. »Wenn irgendwer davon hört, Kind, werden wir getrennt«, zischte sie. Ich verstand nicht, warum wir warteten. Ich wolle ihre Heimat sehen, sagte ich. Ich wolle mit ihr durch Dahomey gehen, frei.
»Aber man muss es richtig machen, Kind«, flüsterte sie mir zu. »Unter dem richtigen Mond. Mit den richtigen Worten. Sonst hören die Götter nicht.«
Doch dann begannen die anderen Selbstmorde. Cosimo schnitt sich den Hals mit einer Axt durch, Adam durchlöcherte sein Handgelenk mit einem aus der Schmiede gestohlenen Nagel. Beide fand man morgens verblutet im Gras hinter den Hütten, einen nach dem anderen. Wie Kit waren sie früher Salzwasser-Hexer gewesen, hatten geglaubt, im Land ihrer Vorfahren wiedergeboren zu werden. Doch als der junge William, der auf der Plantage zur Welt gekommen war, sich in der Wäscherei erhängte, begab sich Erasmus Wilde höchstpersönlich zu uns hinaus.
Langsam lief er in seinen blendend weißen Kleidern über den Rasen, mit wenigen Schritten Abstand folgte ihm ein Aufseher. Dieser trug einen zerfledderten Strohhut und schob eine Karre vor sich her. Darin lagen ein hölzerner Pfahl und ein Haufen aus grauem Sackleinen. Sie überquerten die Wiese in der gleißenden Sonne und machten am Rande des Zuckerrohrfelds Halt, wo man uns zusammengetrieben hatte. In der heißen grellen Luft musterte uns der neue Master.
Ich konnte das Fleisch unter seiner Haut sehen, in seinem Gesicht, an seinen Händen, wächsern und blutleer. Seine Lippen waren rosa, die Augen von stechendem Blau. Langsam schritt er an unseren aufgereihten Körpern vorbei, starrte jeden von uns einen kurzen Moment an. Über mir hörte ich Big Kit schwer atmen, und ich begriff, dass auch sie Angst hatte. Als der Master mich ansah, spürte ich seinen sengenden Blick und schaute sofort zitternd zu Boden. Die Luft stand still und roch nach Schweiß.
Dann gab der Mann in Weiß dem Aufseher hinter sich ein Zeichen. Dieser drehte die Griffe der Schubkarre um und kippte deren Ladung auf die staubige Erde.
Wie Wind ging ein Murmeln durch unsere Reihe.
Dort am Boden lag ausgestreckt in einem Bündel grauer Kleidung Williams Leiche. In seinem steifen Gesicht schien der Schmerz wie eingefroren; die Augen traten hervor, aus dem Mund quoll schwarz die Zunge. Seit seinem Tod waren einige Tage vergangen, und es geschahen bereits seltsame Dinge mit seinem Körper. Er sah dicker aus, aufgedunsen; seine Haut war fleckig und schwammig. Mich erfasste ein schleichendes Grauen.
Als der Master endlich zu uns sprach, war seine Stimme ruhig, trocken, gelangweilt.
»Was ihr hier seht, ist ein Nigger, der sich umgebracht hat«, sagte Erasmus Wilde. »Er war mein Sklave, und er hat sich umgebracht. Also hat er mich bestohlen. Er ist ein Dieb.« Er machte eine Pause, faltete die Hände hinter dem Rücken. »Ich habe gehört, dass einige von euch glauben, ihr würdet in eurer Heimat wiedergeboren werden, wenn ihr sterbt.« Er sah aus, als wollte er weitersprechen, hielt jedoch inne. Und dann drehte er sich plötzlich um und gab dem Aufseher bei der Schubkarre erneut ein Zeichen.
Der Mann beugte sich mit einem langen geschwungenen Abhäutmesser über die Leiche. Er griff einmal um sie herum, umfasste mit seiner schwieligen Hand Williams Kinn und begann zu sägen. Wir hörten, wie das grässliche feuchte Fleisch zerriss, hörten das Knirschen der Knochen, sahen, wie Williams lebloser Körper seltsam zusammensackte, als der Kopf sich löste.
Der Aufseher richtete sich auf und hielt den abgetrennten Kopf mit beiden Händen. Dann lief er zur Karre und nahm den hölzernen Pfahl heraus. Er hämmerte ihn erst in die trockene Erde und spießte dann Williams Kopf auf das spitze Ende.
»Kein Mann kann ohne seinen Kopf wiedergeboren werden«, rief der Master. »Dasselbe werde ich bei jedem neuen Selbstmord anordnen. Glaubt mir. Keiner von euch wird jemals sein Land wiedersehen, wenn ihr euch weiter umbringt. Lasst euren Tod auf natürliche Weise geschehen.«
Ich starrte hinauf zu Kit. Sie spähte zu Williams Kopf auf dem Pfahl, zu der Kugel des in der Sonne aufweichenden Fleischs, und in ihrem Gesicht lag etwas, das ich nie zuvor bei ihr gesehen hatte.
Verzweiflung.
DREI
Aber das ist kein richtiger Anfang. Erlauben Sie mir, noch einmal von vorn zu beginnen, fürs Protokoll.
Seit nunmehr achtzehn Jahren weile ich auf dieser Erde. Ich bin ein freier Mann, ich allein bin im Besitz meiner Person.
Im Jahr 1818 wurde ich auf jenem von der Sonne verbrannten Anwesen auf Barbados geboren. So wurde es mir jedenfalls erzählt. Einer anderen Version zufolge kam ich in einem mit Ketten verschlossenen Frachtraum während einer stürmischen Atlantiküberfahrt zur Welt, an Bord eines illegalen niederländischen Sklavenschiffs. Das wäre dann im Herbst 1817 gewesen. Letztere Variante beinhaltet den Tod meiner Mutter, die bei der schwierigen Geburt verstorben sein soll. Jahrelang favorisierte ich keine Herkunft über die andere, doch während meiner ersten Jahre in Freiheit litt ich unter seltsamen Träumen, Bildern, die immer wieder kurzzeitig aufblitzten: hohe Holzpalisaden, hinter denen sich der schwarze Dschungel erhob wie eine Wand. Nackte aneinandergekettete Männer, die verrottete Holzplanken hochwanken und in einer Brigg verschwinden. Träumte ich von der Goldküste, der Sklavenfestung in Annamaboe? Wie das möglich sein soll, fragen Sie? Überlegen Sie doch einmal selbst, was Sie von Ihren eigenen Anfängen wissen und ob Ihr Leben wirklich so anders ist. Die Geschichten über unsere Geburt müssen wir alle hinnehmen, denn obwohl wir bereits in ihnen vorkommen, sind wir darin noch nicht präsent.
Ich war ein Feldnigger. Ich habe Zuckerrohr geerntet, nur mein Schweiß war von Wert. Im Alter von zwei Jahren habe ich die Hacke geschwungen und gejätet, Futter für die Kühe gesammelt und den Dung mit meinen Händen in die Zuckerrohrlöcher geschaufelt. In meinem neunten Lebensjahr bekam ich einen Strohhut und eine Schaufel geschenkt, die ich kaum heben konnte, und ich war stolz, als Mann zu gelten.
Und mein Vater?
Den habe ich nie gekannt.
Mein erster Master gab mir einen Namen, wie er uns allen Namen gab. Getauft wurde ich auf George Washington Black – doch man nannte mich Wash. Voller Hohn behauptete mein Master, er habe in mir die Geburt einer Nation erblickt, einen Krieger und Präsidenten, ein Land der Wonne und Freiheit. Das war natürlich alles, bevor mein Gesicht entstellt wurde. Bevor ich mit einem Schiff in den Nachthimmel segelte und von Barbados floh, bevor ich wusste, was es hieß, gejagt zu werden, da auf den eigenen Kopf eine Belohnung stand.
Bevor der weiße Mann zu meinen Füßen starb.
Bevor ich Titch traf.
VIER
Titch.
Ich begegnete ihm zum ersten Mal am Abend, nachdem sie Williams Leiche geschändet hatten, als Big Kit und ich ins Haupthaus zitiert wurden, um bei Tisch zu bedienen.
Diese Aufforderung war so seltsam, dass sie uns in Alarm versetzte: Ein Feldsklave war nicht mehr als schwarzhäutiges Vieh, geboren für harte Arbeit und sicherlich niemand, der ins Haus gehörte. Wir wussten nicht, warum der Master uns hätte rufen lassen sollen. Wer waren wir schon in seinen Augen? Kits Verzweiflung war mit den Stunden einem stillen Zorn darüber gewichen, was sie nun weder sich selbst noch mir würde antun können. Jetzt kam die Angst hinzu, dass der Master ihr Vorhaben herausgefunden hatte und eine grausame und schwere Strafe für uns bereithielt.
Immanuel und die kleine Émilie kamen in ihren sauberen weiß-grauen Hausuniformen die leicht abschüssige Böschung zu der Ansammlung von Hütten hinabgewatet, um uns zu holen. Kit erhob sich von dem Stein, auf dem sie vor unserer Hütte saß, und schüttelte wütend den Kopf.
»Schick Wash nicht da hoch«, sagte sie. »Ich geh. Aber lass den Jungen.«
»Der Master hat gesagt, ihr beide«, sagte Immanuel.
»Hallo, Wash«, sagte Émilie schüchtern.
»Hallo«, sagte ich. Wärme stieg in mein Gesicht.
»Sie essen, bevor es dunkel«, sagte Immanuel. »Beeilt euch. Ihr sie nicht warten lasst.«
Während meiner gesamten Kindheit hatte ich nie zuvor das schattige Frangipani-Wäldchen durchquert und mich der Veranda des Masters genähert. In der Dämmerung folgte ich Kit die Böschung hinauf, fühlte zum ersten Mal die Kieselsteine und das kühle Gras unter meinen Füßen. Kit starrte mit versteinerter Miene zum Haus hinauf.
Die Türen standen offen. In meinem Hals flatterte wie wild ein Muskel, als hätte ich eine Motte verschluckt. Einmal war ich unter den großen Schornstein in der Wäscherei gekrochen und hatte mir den Hals verrenkt, um zu dem quadratischen Stück Himmel und den vorbeiziehenden Wolken am Ende des langen Schachts hinaufzusehen. Doch dessen Höhe schien nichtig im Vergleich mit dieser Decke; sie war gekrönt von einer gläsernen Kuppel, die als Fenster diente und durch die das schwindende Abendlicht hereinfiel wie ein zum Boden gespanntes Seil. In der Luft schwebte Staub. Über den Türen sah ich Holzverzierungen, und es gab schwere burgunderrote Vorhänge, gepolsterte grüne Stühle auf elegant geschwungenen Beinen. Ich war wie erschlagen von dieser unglaublichen Schönheit.
»Eine feine, feine Stille«, flüsterte Big Kit nickend. »Hör mal.«
Wir wagten nicht, einzutreten, nicht mit unseren dreckigen Füßen und Kleidern, nach – wie ich mir heute denke – Schweiß und Unrat stinkend und mit Insekten im Haar. Wir standen da, unsicher und unglücklich. Man hatte uns hergeholt, also konnten wir nicht zurück zu den Hütten, doch genauso wenig konnten wir an die Tür klopfen, um uns anzukündigen. Wir sahen einander wortlos an.
Endlich kam Gaius, der Hausportier, um die Ecke. In den letzten Wochen seit Erasmus Wildes Ankunft hatte ich ihn etwas besser kennengelernt, da er neuerdings öfter mit Anweisungen des Herrn zu den Aufsehern geschickt wurde. Gaius war groß, dünn, alt wie Treibholz. Seine Gesten waren langsam und wohlüberlegt, und er hatte eine Anmut an sich, die wir anderen in den Hütten allesamt bewunderten und gerade weil wir sie bewunderten, zugleich verspotteten. Früher einmal musste er sehr gut ausgesehen haben, und seine markanten Wangenknochen und die gerade Stirn ließen noch einen Rest majestätischer Haltung erahnen, einen Mann, der über anderen stand. In meinen Augen war er eine Art Ersatzmaster, jemand, der sprach und erzogen worden war wie ein Weißer. Ich fürchtete ihn.
Er war steif und unfreundlich, aber nicht grausam. »Guten Abend, Catherine. Junger Washington.«
»Gaius«, sagte Big Kit argwöhnisch. »Émilie und Immanuel haben uns geholt.« Sie stockte. »Was will er von uns?«
»Der Master?«
»Ja, der.«
»Hat Immanuel es euch nicht gesagt?«
Big Kit legte eine riesige Hand auf meinen Kopf. Ich konnte ihre Anspannung spüren; ich wusste, dass sie den Zorn unseres Masters fürchtete. »Er sagt, wir sollen am Tisch bedienen.«
Stirnrunzelnd sah Gaius an uns vorbei ins Zwielicht, als wartete dort noch jemand. »Dann werdet ihr genau das tun«, sagte er. »Ich bin sicher, er hat seine Gründe. Wartet in der Küche, bis man euch ruft.«
Keiner von uns bewegte sich.
Schließlich sagte Kit: »Unsere Füße.«
Gaius starrte hinunter zu unseren dreckverkrusteten nackten Zehen. Dann öffnete er recht langsam sein Jackett, zog ein riesiges weißes Schnupftuch aus der Innentasche seiner Weste und reichte es Big Kit. »Säubert eure Füße«, sagte er. »Und zwar alle beide. Wenn auch nur einer von euch Fußabdrücke auf seinem Marmor hinterlässt, wird es euch leidtun.«
Wir wischten unsere Füße ab, dann drehte er sich um und führte uns durch den großen Saal. Am anderen Ende traten wir von dem kalten Marmorboden auf Holzparkett. So etwas hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen; miteinander verflochtene Holzwinkel, die ein wunderbares Muster ergaben. Die Luft war kühl und roch nach Minze. Meine Angst wich ein wenig. Big Kit allerdings war gar nicht behaglich zumute. Ich wollte am liebsten alles sehen, wollte mir alles einprägen, wollte diese Wunder mit zurück zu den Hütten nehmen. Weiße Spitze, silberne Kerzenhalter, Holz, das so auf schimmernden Hochglanz poliert war, dass es aussah wie frisches Brot. Wir gingen an Räumen vorbei, ausgelegt mit altertümlichen Teppichen und bestückt mit riesigen alten Uhren und seltsamen eingefrorenen Kreaturen mit gelbbraunen Klauen und wütenden Augen. Ich konnte nicht aufhören zu starren, wagte kaum zu blinzeln.
»Die echt, Gaius?«, flüsterte ich. »Die Tiere da?«
Gaius blieb stehen und schaute kurz zu einer großen weißen Eule, die in einem Alkoven auf einer Stange saß. Ihre gelben Augen starrten mit leerem Blick geradeaus. Sie bewegte sich nicht. »Sie waren einmal lebendig«, murmelte er kaum hörbar. »Jetzt sind sie tot und ausgestopft. Genauso wie der Master.«
»Er war einmal lebendig?«, flüsterte ich.
Gaius hielt inne und betrachtete mich mit seinem undurchschaubaren Gesichtsausdruck. Gerade, als ich dachte, er würde wegsehen, zeichnete sich der Hauch eines Lächelns ab. »So wird behauptet, junger Washington.«
Ich hatte Kit als erbittert kennengelernt, als Kraft, die jederzeit explodieren konnte. Doch hier, während wir durch die Säle von Wilde Hall gingen, schien auch sie wie geschrumpft, eingeschüchtert und verängstigt. Die Veränderung an ihr jagte mir einen größeren Schrecken ein als die eingefrorenen Biester in jenem Raum, mehr als der fremde, schillernde Luxus, der uns umgab. Ich beeilte mich, mit Gaius Schritt zu halten, während er uns tiefer ins Haus hineinführte.
Und dann betraten wir die Küche. In dem großen Raum brodelten silberne Bottiche auf mehreren Herdfeuern, in der Luft stand eine Wand aus Hitze. Die Köchin, Maria, wandte uns überrascht das mit Mehl bestäubte Gesicht zu. Die Ärmel hatte sie hochgekrempelt. Im Hintergrund rangen zwei Dienstmägde mit einem enormen Behältnis. Ich suchte nach Émilie, konnte sie jedoch nicht ausmachen inmitten der Mehlwolken und Türmen aus dreckigen Tellern voller Bratensoße und riesigen hölzernen Blöcken, auf denen gewürfelte Paprika und Süßkartoffeln bereitlagen. In der großen Kochstelle loderte ein beachtliches Feuer, über dem langsam rotierend ein glänzender Vogel garte. Angesichts dieser Fülle blieb mir vor Faszination der Mund offen stehen, und ich spürte zum ersten Mal etwas, das mir bisher unbekannt gewesen war – Verlangen.
»Denk nich mal dran, Nigger«, sagte Maria scharf, als mein Blick auf ein Tablett mit Gebäck in der Nähe der Tür fiel.
Ich fühlte mich ertappt und sah sie mit vor Furcht geweiteten Augen an. Etwas bewegte sich in ihrem Gesicht, es wurde weicher.
»Dafür ist später Zeit«, sagte sie jetzt mit sanfterer Stimme. »Beim Aufräumen kannst du ablecken, was übrig ist.«
»Wirklich?«, sagte ich.
»Aber nur das angebrochene Essen, nur, wenn du ihre Teller abkratzt«, fügte Gaius hinzu. »Das frische Essen wird nicht angerührt.«
»Wir dürfen die Teller ablecken, Kit«, sagte ich und lächelte glückselig zu ihr hinauf.
Die beiden unterhielten sich gerade, als wir hereinschlurften. Big Kit und ich trugen Tabletts mit Brötchen und heißen Speisen aus dampfendem Gemüse. Auf einer niedrigen Anrichte an der hinteren Wand des Raums standen die Teller bereit, die serviert werden sollten und die Gaius uns zuvor beschrieben hatte. Er hatte uns eingeschärft, nicht zu trödeln und aufmerksam und still zu sein. Dass unsere Hände in den merkwürdigen weißen Handschuhen immer präsent sein mussten und unsere Körper stets unsichtbar.
Ich konnte sehen, wie unwohl Big Kit sich fühlte; sie stand da und brütete leise vor sich hin, als verfluche sie die nicht zu verleugnende Präsenz ihres Körpers, und öffnete und schloss in einem fort die Fäuste. Sie wusste, dass die Bestrafung für unseren geplanten Selbstmord nicht milde ausfallen würde. Sie versuchte, alle Regung aus ihrem Gesicht zu verbannen, ihr Blick zögernd und nach innen gerichtet.
Ich hatte auch schreckliche Angst, und doch konnte ich mich nicht davon abhalten, während er aß immer wieder zum Teller des Masters zu schielen. Ich dachte an die Soßen, die darauf schwammen, an die heißen gelben Stücke Kruste, die er achtlos beiseiteschob.
Im glänzenden Kerzenschein sah unser Master genauso aus wie zuvor auf dem Feld – wächsern und krank, von derselben Farbe wie die harte Käserinde, die vor ihnen auf dem Tisch lag. Seine Haut war schlaff und matt. Als ich mich mit zitternden Händen vorbeugte, um ihm Wasser einzuschenken, meinte ich von seinem Körper einen Geruch wahrzunehmen wie von nassem Papier. Unter seinen Fingernägeln fiel mir das getrocknete Blut auf.
Und doch war es der zweite Mann, der meinen Blick immer wieder auf sich zog. In meinem Kopf hatte ich ihn mir düster und unheimlich vorgestellt. Aber das war er nicht. Sein Haar trug er schulterlang, außerdem einen dunkelblauen Gehrock. Er hatte lange dünne Finger, an jedem Zeigefinger steckte ein juwelenbesetzter Ring. Die Füße standen fest und hüftbreit auseinander vor seinem Stuhl, als wolle er jeden Moment aufstehen. Und doch saß er fast reglos da, während ich das lauwarme Wasser in sein Glas goss, und unterbrach sogar seinen Redefluss, um mir ein schwaches Lächeln zuzuwerfen. Mit einem seiner Spinnenfinger strich er sich über den langen gebogenen Nasenrücken, die Nasenlöcher so winzig wie Knopflöcher, und fuhr dann erst in seiner tiefen Stimme fort. »Ich hab’s mit Schwefelsäure auf Eisenspänen versucht. Ich habe tierische Harnblasen ausprobiert, Seidenstrümpfe, Papiersäcke. Sogar einige der absurderen Varianten, um nachzuprüfen, ob bisher vielleicht etwas Vorteilhaftes übersehen wurde. Aber man hat sie alle aus gutem Grund verworfen, Erasmus. Ich glaube, nichts funktioniert besser als einfacher Wasserstoff und Segeltuch. Du solltest die Höhen sehen, die damit erreicht werden können – zehn-, zwanzigtausend Fuß. Wahrlich spektakulär. Die Welt von dort oben gesehen ist einfach … nun, es ist Gottes Erde, was soll ich sagen.«
Der Master kaute und blickte nicht einmal von seinem Fleisch auf. »Aber du warst noch nie dort oben.«
»Nein, ich selbst nicht. Noch nicht.«
»Also weißt du es gar nicht genau.«
»Aber ich habe darüber gelesen. Die Berichte anderer.«
»Und du glaubst, du kannst in dem Ding tatsächlich den Atlantik überqueren.«
»Ich müsste natürlich erst mal einige Testflüge unternehmen, aber ja.«
Der Master gab einen grunzenden Laut von sich. »Du wirst schon sehen, in der Hitze auf den Corvus Peak hochzukommen ist wirklich eine elende Plackerei.«
Der zweite Mann, seine Augen waren leuchtend grün, gab darauf keine Antwort.
Nun hob der Master doch den Kopf. »Du hättest also gern, dass ich einige meiner Sklaven für dich erübrige, damit sie dir deinen Apparat hochschleppen. Nicht wahr?«
Der dunkelhaarige Mann zog die Augenbrauen zusammen.
»Was? Nun sag schon!«
Der Mann hielt in seiner Bewegung inne, Messer und Gabel verharrten in der Luft über seinem Teller. Er sah dem Master direkt in die Augen. »Diese Kartoffeln«, sagte er stattdessen, »sind wirklich ungewöhnlich, findest du nicht? Der Geschmack ist in Ordnung, aber ich bevorzuge doch die sortenreinen weißen daheim in Hampshire.«
»Nun, es freut mich, dass du willens bist, mit den Konventionen zu brechen und an dieser geringen Tafel zu speisen.« Der Master wischte sich mit einem Zipfel des Tischtuchs den Mund ab.
»Erasmus, du fühlst dich wirklich zu schnell angegriffen. Es sind doch nur Kartoffeln.«
»Meine Kartoffeln«, sagte der Master finster. »Kartoffeln, die ich ausgewählt habe. Du hast es schon immer genossen, dich über meine Vorlieben lustig zu machen. Du und Vater, da wart ihr euch wirklich gleich. Immer müsst ihr alles verdammt noch mal bewerten.«
Ich war ganz überrascht von dieser Erwähnung eines Vaters und schielte zu dem zweiten Mann hinüber. Ich hatte nicht erwartet, dass er auch nur im Entferntesten mit dem Master verwandt sein könnte, jetzt aber wurde die Ähnlichkeit plötzlich so ersichtlich wie ein Wasserzeichen: die hellen Augen, die eigentümlich volle Unterlippe, die Art, wie beide Männer das Ende bestimmter Sätze mit einer trägen Handbewegung unterstrichen, als erfolge die Geste unter Wasser.
Der Master ertappte den zweiten Mann dabei, wie er unbehaglich zu Big Kit hinüberblickte, und stieß ein kurzes hartes Lachen aus. »Was ist? Machst du dir etwa Sorgen um die Sau da, Christopher? Die hat kein Feingefühl, das man verletzen könnte.«
Der zweite Mann legte leise sein Besteck zur Seite.
»Was soll’s«, sagte der Master und wedelte langsam, aber ungeduldig mit der Hand. »Du sprachst von deinen Verbesserungen an Vaters Luftballons, von den großen Höhen, die du erreichen willst.«
»Na ja, sie sind genau genommen keine Luftballons. Aber es stimmt …«
»Und dafür brauchst du jetzt Gewichte.«
Der Bruder lachte unbeschwert, ein komisches Geräusch. »Ich benötige neben mir noch einen zweiten Mann im Gefährt, ja. Aber für den Ballast, verstehst du? Allein wird es nicht gehen.«
»Und da muss es unbedingt mein Gewicht sein?« Der Blick des Masters hatte sich verhärtet.
»Erasmus, all deine Eigenschaften sind gewichtig.«
»Willst du damit sagen, ich sei fett?«
Der Mann hielt inne, sah dem Master direkt in die Augen.
»Vielleicht benötigst du auch etwas von geringerem Gewicht.« Der Master drehte sich abrupt um und winkte mich heran. Ich spürte, wie die Wasserkaraffe in meinen Händen zu zittern begann. Ich wagte es nicht, seinen Blick zu erwidern. »Wie wär’s mit ’nem Nigger-Kalb? Er ist doch sicherlich leicht genug.«
»Lass es gut sein, Erasmus.«
»Ist das ein Vorschlag oder ein Befehl?«
Der Mann holte langsam und tief Luft. »Es wird mir auf ewig ein Rätsel bleiben, warum du in allem, was ich sage, einen Angriff siehst. Wir sind hier doch unter uns, du und ich, und meine Anwesenheit ist nur vorübergehend. Wäre unsere gemeinsame Zeit da nicht besser genutzt, indem wir versuchten, einander zu verstehen?«
»Mir mangelt es also an Verständnis?«
»Woran es dir mangelt«, begann der Bruder, brach seinen Gedanken jedoch ab. Stattdessen sagte er: »Ich möchte diese Unterhaltung nicht vor den Bediensteten führen.«
»Das sind keine Bediensteten, Titch. Sie gehören zum Mobiliar.«
Der Bruder atmete aus und verdrehte leicht die Augen.
»Du bist einfach zu weich, kleiner Bruder. Wie willst du ein ganzes Jahr hier überstehen, wenn du schon bei der kleinsten Gotteslästerung in Gegenwart eines Niggers anfängst zu heulen? Himmel noch mal. Vaters ganzer Respekt für dich würde mit einem Mal verpuffen, wenn er mitansähe, wie weichlich du geworden bist. Mal im Ernst: Warum hast du bei deinen Überzeugungen darauf bestanden, mir an diesen elenden Ort zu folgen? Hast du vor, mir all meine Sklaven zu stehlen, während ich schlafe?«
Der Mann lächelte gereizt. »Ich habe dich gebeten, es gut sein zu lassen.«
Als der Master daraufhin seinerseits erst lächelte und dann anfing, richtig zu lachen, war ich baff. »Da schlummert also doch irgendwo ein Mann in dir. Noch Rotwein?«
Ich glaube, sein Lachen war aufrichtig. In jenem Moment begriff ich, dass ich den Sinn hinter dem, was der Master tat oder sagte, niemals verstehen würde, denn es existierte keiner.
Als er den Weindekanter hinüberreichen wollte, verschüttete er ein wenig, und auf der Tischdecke bildete sich eine rote Lache. Ich sah dabei zu, wie sie sich langsam ausbreitete wie sickerndes Blut. Diese Farbe, das tiefe Rot, erschien mir gleichermaßen grauenerregend wie schön. Doch Big Kit schlurfte leise vor, ein großer dunkler Schatten, und fing sofort an, mit einem weißen Tuch den Fleck zu bearbeiten.
Der Master nahm sie gar nicht wahr.
Sein Bruder räusperte sich. »Ich habe heute schon drei Hemden durchgeschwitzt. Ein teuflisches Klima ist das.«
Der Master blähte nur kurz die Backen. Er hatte seinen Gedanken noch nicht beendet. »Meine Arbeit hier ist hart. Dazu braucht man Stahl in den Adern. Wie lange ist die Osterrebellion jetzt her? Vierzehn, fünfzehn Jahre vielleicht? Dass die Nigger die ganze verfluchte Insel in Brand gesetzt haben? Wachsamkeit ist von größter Bedeutung, Titch. Erst diesen Nachmittag bin ich mit John Willard in Bridge Town im Club gewesen.«
»Der Mann, der neulich Abend zum Dinner hier war? Der rundliche mit dem roten verschwitzten Gesicht?«
»Nein, der Kleinere, der Blonde mit der Brille. Er ist der ehemalige Buchhalter der Drax-Plantage, da war er aber immerzu frustriert – hat wohl mehr Niggern nachgejagt als Bücher geführt. Er lässt immer noch kein gutes Haar an den Verwaltern. ›Warum soll man einen fünfzig Jahre alten Mann, der kaum noch stehen kann, weiter durchfüttern, wenn ein zehnjähriger Junge die doppelte Menge Zuckerrohr schneiden kann?‹, hat er gesagt. Willard denkt ökonomisch, wenn du mich fragst. Es ist eine Frage der Verschwendung, sagte er. Und das stimmt. Ein Pflanzer, der wohl respektiert wird, läuft mit dem Hauptbuch unterm Arm durch die Reihen seiner Sklaven, und schon bei seinem Anblick machen sich die Nigger die Hosen voll. Hat er selbst mitangesehen. Du da, Junge! Würdest du dir beim Anblick meines Bruders hier mit einem Buch unterm Arm in die Hose machen?«
Ich spürte die blassen Augen des Masters auf mir.
»Hey, Junge!«, bellte er.
Ich sah nicht auf. »Ja, Sir.«
Der Master gab ein genervtes Geräusch von sich, er war mit meiner Antwort offenbar unzufrieden. »Worauf ich hinauswill: Ohne eine gewisse Entschlossenheit würde hier Chaos herrschen. Meine Aufgabe, lieber Christopher, besteht darin, diese Entschlossenheit zu fördern. Deine Wissenschaft ist mir völlig einerlei, vorausgesetzt, sie behindert mich nicht dabei, diese Plantage zu führen.«
»Wie weit sind wir von Haiti entfernt?«, fragte der Bruder und kratzte dabei gedankenverloren über seinen Teller. »Das erste Schiff, das leichter war als Luft, ist dort gestartet – wenn ich mich nicht täusche, war das in ganz Amerika der erste Start eines solchen überhaupt.«
Der Master antwortete eine Weile nicht und runzelte nur die Stirn. »Glaubst du, so wollte ich mein Leben verbringen? Mich mit dem Dreck dieser Nigger herumschlagen und den ganzen Tag nach Zucker stinken? Ich habe nicht um die Verantwortung gebeten, aber sie wurde mir trotzdem zuteil. Anders als du bin ich nämlich nicht Vaters Liebling und kann durch die Weltgeschichte reisen und mir irgendwelche albernen Apparate ausdenken. Ich muss tatsächlich das tun, was die familiäre Pflicht von mir verlangt.«
»Du bist der Ältere«, sagte der Mann namens Christopher. »Das fällt dir nun mal zu, Bruder.«
»Beim Frühstück hast du etwas gesagt« – die Augen des Masters wurden zu engen Schlitzen –, »das mir erst jetzt wieder einfällt. Sag mal, weiß Mutter eigentlich, dass du hier bist?«
Der Bruder antwortete nicht und starrte den Master unverwandt an.
»Du weißt, dass sie sich darüber zu Tode aufregen wird, nicht wahr? Du hast diese ganze Zeit, die wir miteinander verbracht haben, kein Wort gesagt. Die ganze Zeit nicht. Aber du kannst nicht einfach so verschwunden bleiben und sie im Unklaren lassen. Wo denkt sie, dass du bist?«
»Wie könnte ich mir je anmaßen zu erahnen, was diese Frau denkt?« Der Bruder zuckte mit den Schultern. »Paris vielleicht. Oder London. Mag sein, dass ich einen Besuch am Grosvenor Square erwähnt habe.«
Der Master schüttelte leicht den Kopf und lachte abfällig.
»Schließlich hätte sie mir den Plan sonst verdorben, oder etwa nicht?«
»Also hast du dir gedacht, du triffst mich einfach in Liverpool und segelst mit mir davon? Einfach so? Ohne irgendeine Nachricht zu hinterlassen?«
»Manchmal muss man eben ein wenig verschwinden. Das ist gut für die Seele.«
»Wessen Seele?«
»Meine, nehme ich an.«
»Und ihr bescherst du dieses ganze Leid nur für einen verdammten fliegenden Teppich.«
Der Mann sah unseren Herrn ruhigen Blickes an. »Es ist kein Teppich, Erasmus, sondern ein Wolkenkutter.«
»Und welchem Zweck soll er dienen? Wird er die Menschheit von all ihren Krankheiten heilen? Wird er mich aus den Fesseln dieses gottverlassenen Eilands befreien?« Big Kit war immer noch damit beschäftigt, den Flecken vom Tischtuch abzutupfen, wobei sie den Blick bewusst gesenkt hielt, und jetzt bemerkte der Master sie. »Lass das sein«, blaffte er.
Nervös wischte Big Kit rasch einige letzte Male über den Fleck.
»Ich sagte, du sollst das sein lassen!« Der Master griff nach seinem Teller, richtete sich ein Stück auf und schlug ihn Big Kit mit voller Wucht ins Gesicht.
Ein fürchterliches Krachen folgte, dann war alles voller Blut und Scherben.
Jeder Knochen in meinem Körper fuhr hoch, und ich konnte gerade noch meinen Griff um die Wasserkaraffe verstärken, bevor sie mir endgültig aus den Fingern glitt. Ich starrte auf die Hände des Masters, das frische Blut an seinem Daumen. Ich wollte an Kits Seite stürzen, stand jedoch nur da, die Karaffe fest umklammert, in der die Zitronenkerne gegen die Wände schlugen wie klappernde Zähne.
»Ach, zur Hölle, jetzt habe ich mich geschnitten«, sagte der Master und wischte die Hände am Tischtuch ab. Er ließ den zerbrochenen Teller fallen, drehte sich um und ging aus dem Zimmer. »Maria! Maria! Himmel noch mal, wo bist du?«
Die Stille war fürchterlich. Ich konnte das Blut durch Big Kits Finger tropfen hören, an der Stelle, wo sie sich das Gesicht hielt.
Der zweite Mann, der Bruder, zögerte. Schließlich aber stand er auf und ging zu ihr hinüber, hielt ihr seine Serviette hin. »Hier. Nimm die Hände herunter.«
Big Kit nahm die Hände herunter.
»Dreh den Kopf. Ja. So.«
Der Mann war größer als alle weißen Männer, die ich zuvor gesehen hatte, so groß wie Big Kit selbst, und ich konnte spüren, wie sein Blick mich streifte, während er Kits Gesicht abtupfte. »Wie ist dein Name?«, sagte er zu mir.
Ich sah hilflos zu Kit, starrte in ihre dunklen starken Augen, dann wandte ich den Blick wieder ab.
Ich hörte etwas in der Nähe der Tür rascheln und fiel auf die Knie, um die blutigen Tellerscherben aufzusammeln. Meinen Blick heftete ich nun auf die Bescherung am Boden.
»Herrgott noch mal, Christopher, lass das«, sagte der Master. »Sonst besudelst du dich auch noch. Die wischen das schon auf. Dazu sind sie da.« Er klang jetzt beinahe zufrieden, entspannt. »Gleich ist der Pudding so weit, und ich bin guter Dinge, dass er passabel schmecken wird. Also los, setz dich hin.«
Big Kits Nase war gebrochen.
Ich weinte nicht. Gemeinsam wischten wir schweigend ihr Blut auf, die Augen hielt ich weiter auf den Boden gerichtet und lauschte dabei, wie der Master gedankenversunken mit seinen Schuhen über das Parkett kratzte, um den Dreck abzureiben, der daran klebte.
Der Pudding wurde gebracht, und ihn umgab ein warmer, zuckriger Schimmer. Während der Master genüsslich zulangte, schob sein Bruder den Teller von sich und verlangte stattdessen nach einem weiteren Glas Rotwein. Draußen wurde es allmählich Nacht, und ich sah unser Spiegelbild in den Fenstern, hell erleuchtet und deutlich, als stünde uns gegenüber ein Paar anderer unglücklicher Sklaven mit versteinerten Gesichtern. Ich suchte nach meinen Augen, konnte sie jedoch an dem Jungen, der dort reglos mit seinen weißen Handschuhen an meinem Platz stand, nicht ausmachen. Nachdem der Master und sein Bruder sich endlich zurückgezogen und wir dabei geholfen hatten, die riesigen Kessel in der Spülküche zu schrubben, sowie sämtliches dampfende Geschirr zum Trocken aufgestapelt war, erlaubte uns Gaius, in dem halb verzehrten Essen zu stochern, das auf einer großen Platte zusammengekippt worden war. Meine Vorfreude auf diesen Teil war verflogen, doch Big Kit warf mir einen wütenden Blick zu und begann hastig mit zwei Fingern, die sie wie zu einer Gabel gekrümmt hatte, zu essen. Sie las die Reste auf und zerkaute sie auf einer Seite ihres schief verzogenen Mundes. Dabei zuckte sie immer wieder zusammen, öffnete dann in grimmiger Überraschung die Augen, bevor sie sich erneut vorbeugte, um weiteres Essen in sich hineinzuschaufeln. Ich probierte nur wenig. Stattdessen glotzte ich auf ihre Nase. Ich weigerte mich, zu vergessen, was geschehen war.
Erst später, als Big Kit und ich im gleißenden Mondlicht zu den Hütten hinunterliefen, fing sie an zu sprechen. »Niemals nimmst du nicht, was dir zusteht«, zischte sie. »Das Essen war dir versprochen. Also nimmst du’s.«
»Er hätte dich nicht schlagen sollen, Kit.«
»Was, du meinst das hier?« Sie hob ihr Gesicht. Die Nase hatte von Neuem zu bluten begonnen. »Dachte, er wirft uns ins Spülfeuer, weil wir nach Dahomey zurückwollten. Das hier? Ist gar nix, Junge. Noch nie ’n bisschen Blut gesehen?«
Natürlich hatte ich das. Wir lebten in Blut und Schweiß, seit ich denken konnte. Aber etwas an diesem Abend – die schillernde Schönheit des Hauses, die Vornehmheit, diese träge Eleganz – hatte in mir ein tiefes, beunruhigendes Gefühl von Verzweiflung geweckt. Es war nicht nur, wie sie Williams Leiche früher am Tag geschändet hatten, oder das Wissen, dass sein Kopf in ebendiesem Moment in der Dunkelheit auf die Felder starrte. Was ich in jenem Augenblick spürte und wofür mir damals noch die Worte fehlten, war die rohe, brutale Ungerechtigkeit des Ganzen.
»Das war’s also?«, sagte ich mit belegter Stimme. Ich blieb stehen, um im Mondlicht zu ihr aufzublicken. »Wir gehen nicht zusammen nach Dahomey?«
Sie hielt inne und sah mich sehr ruhig an.
»Kit? Wir geben also einfach auf?«
»Ja, genau«, sagte sie. »Und du vergisst, ich hab je was gesagt. Schlag’s dir aus dem Kopf.«
Ihr Zorn verwirrte mich, und ich nickte nur aus dem Gefühl heraus, etwas falsch gemacht zu haben. »Unsere Hemden sind hinüber, Kit«, sagte ich jämmerlich. »Das gibt mächtig Ärger.«
In diesem Moment hörten wir hinter uns auf dem Weg ein Rascheln. Wir drehten uns gleichzeitig um, und Kit trat leicht vor mich.
Doch es war nur Gaius, immer noch in seiner feinen Arbeitsuniform, der unsicher auf seine steife Art im Dunkeln auf uns zukam. Als er uns sah, nickte er einmal kurz und höflich mit unergründlicher Miene.
»Gaius«, murrte Big Kit. »Sag nicht, die wollen schon wieder essen.«
Er schüttelte den Kopf. »Der Herr hat sich zurückgezogen. Er ist indisponiert.«
Als wir ihn verständnislos anstarrten, fügte er hinzu: »Betrunken. Master Erasmus ist recht betrunken. Wie geht es deiner Nase, Catherine?«
»Hängt noch im Gesicht.«
»Ja.«
Ein Augenblick verstrich. Dann sagte Big Kit: »Du bist nicht hier runtergekommen, um nach meiner Nase zu fragen. Hast dich verlaufen?« Sie fuhr sich mit einer müden Hand über Nacken und Schultern.
»Nein, nein. Du solltest dich schlafen legen, Catherine. Du bist fertig für heute.«
Sie begann, sich von ihm abzuwenden, und ich tat es ihr gleich. Doch dann legte sie ihre große Hand auf meine Schulter und wandte sich wieder um. »Ich bin fertig für heute? Und Wash nicht?«
Gaius betrachtete mich mit seinem sonderbaren, kalten, unlesbaren Blick. »Wie es scheint, nein.«
»Heißt?«
»Mister Wilde hat nach ihm verlangt. Du sollst ihm in seinen Räumlichkeiten zu Diensten sein, Washington. Heute Abend. Jetzt. Verstehst du?«
Das tat ich nicht. »Dem Master?«, sagte ich und sah Gaius mit angsterfülltem Blick an. Was konnte er mit mir vorhaben?
»Nicht dem Master«, sagte Gaius ruhig, »seinem Bruder, Mister Wilde. Er war der andere Mann bei Tisch heute Abend, der dunkelhaarige. Er wünscht, dass du zu ihm ins Gästehaus kommst.«
»Sag ihm, der Junge schläft, Gaius«, erwiderte Big Kit scharf. »Sag, du hast ihn nicht gefunden.«
Gaius befeuchtete die Lippen. »Das kann ich nicht, Catherine. Das weißt du doch.«
Sie trat einen Schritt vor. »Er geht nicht da hoch.«
Sie fixierte Gaius mit eisernem Blick, aber er zuckte nicht einmal, sondern sah ihr nur abwartend und gelassen ins Gesicht. Schließlich sagte er leise: »Es steht uns nicht zu, aufzuhören, Catherine. Ich werde im Haus gebraucht, aber du sorg dafür, dass Washington hochgeht.« Und dann wandte er sich an mich und tat etwas höchst Seltsames: Er zog seine Hose mit den Fingerspitzen ein Stück hoch und begab sich vor mir in die Hocke, um mich direkt anzusehen. »Lass Mister Wilde nicht warten, Washington. Er ist der Bruder des Masters. Du willst nicht, dass er mit dir unzufrieden ist.«
»Werd ihm keinen Grund liefern.«
»Sehr gut.«
»Was will er von ihm?«, sagte Kit.
»Was wollen sie schon je von einem?«, sagte Gaius leise, fast verbittert. »Er will, dass er tut, was er sagt, und nicht fragt, warum.« Er stand wieder auf und begann, in Richtung Haus zu laufen, dann sah er sich noch einmal nach Big Kit und mir um und sagte geheimnisvoll: »Diese Gelegenheit ist günstig, Catherine. Der Junge hat die Chance auf einen sicheren Hafen. Falls Mister Wilde an ihm Gefallen findet …«
»Sprich das ja nicht aus«, sagte Kit, aber ihre Stimme war leise, und sie klang erschöpft.
»Es ist eine Gelegenheit für den Jungen«, sagte Gaius. Sein Gesicht lag im Schatten, und ich war mir nicht ganz sicher, aber in meinen Ohren klang er traurig.
»Geh einfach, Gaius«, sagte Kit. Sie bewegte sich einen bedrohlichen Schritt auf ihn zu. »Du gehst jetzt, sofort.«
Der Mann verschwand.
Ich stand lange einfach nur neben Big Kit im hellen Mondschein. Irgendwann setzten wir uns in Bewegung. Sie schien betrübt, und ich dachte, sie müsse wohl wegen ihrer Nase verärgert sein und dass sie nicht wollte, dass mir dasselbe geschah. Um ihre Ängste etwas zu mindern, sagte ich: »Mach dir keine Sorgen, Kit. Wenn er mir auf die Nase haut, wein ich nicht oder so. Ich mach’s genau wie du. Wirst schon sehen.«
Aber das half offenbar nicht. An der Wassertonne hinter den Hütten wusch ich mir Gesicht und Arme, rieb meine Haare ab, spürte der Berührung des nachtkalten Wassers auf meiner Haut nach. Als ich die Augen öffnete, sah ich Kit im Schatten der Hütte stehen. Sie trat auf mich zu. »Wenn er dich anfasst, Wash«, flüsterte sie, »haust du ihm den ins Auge und hörst nicht auf zu drücken.«
Ich spürte, wie sie mir etwas in die Handfläche legte, und blickte hinab. Es war ein Nagel. Ein langer, dicker, schwerer Eisennagel, noch warm von der Hitze ihrer Faust. Ich sah hinauf zu Kit, aber sie hatte sich bereits umgedreht.
Ich trug diesen Nagel in meiner geschlossenen Hand wie einen Splitter Finsternis. Ich trug ihn wie ein Geheimnis, wie einen Spalt, der den Blick auf eine unmögliche Zukunft freigeben mochte. Ich trug ihn wie einen Schlüssel.
Langsam lief ich mit klopfendem Herzen den Hügel hinauf. Ich wusste, was Big Kit wollte, dass ich tat, doch schon der Gedanke daran erfüllte mich mit Schrecken. Der Weg führte um das hinter Wilde Hall gelegene Feld herum und dort hinaus auf das unbeleuchtete Brachland am Rande der Bäume. Der Bruder des Masters hatte die ehemalige Behausung eines alten Aufsehers bezogen – ein flaches, längliches Gebäude aus Holz mit einem tiefen Keller. Früher waren darin Dinge gelagert worden, nun aber stand es schon seit Jahren leer. Einige der Sklaven erzählten unheimliche Geschichten über längst vergangene Gräuel, die dort stattgefunden haben sollten. Manche sagten, aus dem Keller ertönten in mondlosen Nächten noch immer Schreie. Ich zitterte. Auf der Veranda waren Laternen entzündet worden, und ich blieb in der offenen Tür stehen. Zwar wagte ich es, einen Blick hineinzuwerfen, jedoch nicht zu rufen. Keiner der Diener erschien, um mich in Empfang zu nehmen. Ich schloss meine Hand noch fester um den Nagel. In den dahinter liegenden großen, weiß gekalkten Räumen war nicht eine freie Fläche auszumachen. Auf jedem Tisch, auf jedem Zentimeter Fußboden standen und lagen in Haufen und Stapeln sonderbare Geräte, von denen manche aussahen wie Stöcke, daneben langgliedrige Teleskope mit Beinen wie Grashüpfer und an Ketten hängende Scheiben.
Da lange Zeit nichts geschah, klopfte ich schließlich mit bebender Hand an. Eine Motte flatterte gegen eine der Laternen, die über mir von der Decke hingen.
»Wer ist da?«, rief eine schneidende Stimme. »Bist du das, Junge? Komm. Komm hierher.«
Zögerlich trat ich ein. Und dann sah ich ihn, Mister Wilde. Er stand leicht zusammengekrümmt, mit gebeugten Schultern, am Fenster auf der anderen Seite des länglichen Raums mit dem Rücken zu mir. Ich ließ meinen Blick durch sein wundersames Zimmer gleiten, über die mit Samt ausgeschlagenen Schachteln, die die Fensterbänke übersäten. Dank der aufgeklappten Deckel konnte ich die glitzernden Instrumente darin sehen. Manche beinhalteten auch hölzerne Zylinder mit Gläsern an den jeweiligen Enden, wie das Fernglas des alten Schiffskapitäns, der eine Weile als Aufseher bei uns gearbeitet hatte – aber diese hier waren irgendwie anders, merkwürdiger. Als ich an einem Esstisch vorbeiging, sah ich darauf Fläschchen voller Samen, Gefäße, die einfache Erde enthielten, und auf der Platte aus Mahagoniholz breiteten sich verschiedene verschüttete Pulver aus. Der Boden unter mir ächzte, als ich mich dem Mann näherte. Überall lagen Blätter verstreut.
»Mister, Sir?«, sagte ich.
Meine Hand war immer noch fest um den Eisennagel geschlossen.
Was Mister Wilde sofort sah. Er war fürchterlich groß und nickte mir von dort oben zu. »Was hast du denn da? Eine Klinge? Einen Nagel?« Er runzelte die Stirn.
Ich begann wieder zu zittern. Natürlich wusste er Bescheid. Die Master wussten alles.
»Nun, leg ihn weg und komm näher. Hier, leg ihn dahin.« Er zeigte auf einen Stapel Papier auf dem Boden neben mir.
Was konnte ich schon tun? Ich legte den Nagel weg. Doch zu wissen, dass er dort lag, seine unbestreitbare Existenz, war mein Leben wert.
»Näher«, sagte er ungeduldig. »Hier, halt das mal, aber gerade, so. Wir haben nicht viel Zeit.«
Wenn er dich anfasst, Wash, hörte ich Big Kits Stimme wieder. Ins Auge. Du hörst nicht auf zu drücken.
Ich wollte fortlaufen. Doch er hatte seine Aufmerksamkeit schon wieder der Sache vor ihm zugewandt.
»Spute dich«, rief er. »Also Junge, hast du schon mal einen Erntemond durch ein Spiegelteleskop betrachtet?«
Meine Stimme hatte sich irgendwo zwischen meinen Rippen verkrochen.
Er sah von dem auf, womit er da beschäftigt war, und seine grünen Augen hielten mich an Ort und Stelle. »Ums zu glauben, muss man ihn gesehen haben. Der Mond ist nämlich ganz anders, als wir annehmen. Hier.« Er bewegte sich etwas zur Seite. Angebracht auf einem goldenen Gestell war ein langer, aus dem Fenster hinausragender Holzzylinder. Auf unserer Seite war das Ende mit Glas versehen.
»Hierhin kommt dein Auge.«
Ich tat, wie mir geheißen. Doch ich sah nichts als grässliche Finsternis. Kit hatte mir vor meinem Weggang all die unaussprechlichen Dinge aufgezählt, die die Aufseher mit den Jungen taten; und als ich mich hinabbeugte, um mein Auge an die kalte Messingfassung zu legen, fühlte ich mich ausgeliefert. Ich war entsetzt. Ich wusste nicht, welche Abscheulichkeit jetzt folgen würde, aber ich wusste etwas, das Big Kit nicht verstanden hatte – dass ich mich gegen diesen Mann, der so viel größer war als ich, nicht würde wehren können und dass mir Gewalt nicht im Blut lag. Ich schloss die Augen und wartete.
Ich spürte seinen seichten Atem an meinem Ohr. Er sagte: »Kannst du es sehen, Junge?«
Was sollte ich schon sagen? Ich wusste nicht, wovon er sprach.
»Ja, Mister Wilde, Sir«, sagte ich.
»Überwältigend, nicht wahr?«
»Oh ja, Mister Wilde, Sir«, sagte ich.
Er grunzte zufrieden. »Kannst du die Musterungen sehen? Die Krater? Da hängt ein vollständiger Planet in unserem Gravitationsfeld, mein Sohn. Stell dir vor, über diese Fläche zu laufen, die Ränder dieser Krater abzuschreiten. Kein menschlicher Fuß hat vor uns diesen Boden berührt. Niemals zuvor. Er weiß nicht einmal, dass wir existieren.«
Dann tippte er mir auf die Schulter, damit ich einen Schritt zurücktrat, und spähte selbst mit dem Auge hindurch. Und dann lachte der seltsame Mann.
»Aber du hast ja gar nichts gesehen«, sagte er.
Sein Gesicht klebte immer noch an der Vorrichtung, aber jetzt griff er nach einem kleinen Rädchen und begann, es mit den Fingerspitzen zu drehen. »Dieses Spiegelteleskop«, sagte er, »habe ich selbst entworfen. Es basiert natürlich auf den herausragenden niederländischen Modellen aus dem sechzehnten Jahrhundert. Aber es ist ein wenig kompakter, wie ich finde. So. Jetzt«, sagte er und trat beiseite. »Schau noch mal durch.«
Oh, und was ich dann sah! Der Mond war riesig, so orange wie der Dotter eines Gänseeis. Und auf ihm zeichneten sich deutlich tiefe Krater und Felsspalten ab, genauso wie Mister Wilde es gesagt hatte. Später einmal kam mir der Gedanke, dass der Mond aussah wie ein Land ohne Bäume, Sträucher und Seen, ein Land ohne Menschen. Eine Erde, bevor der liebe Herrgott begann, sie mit Leben zu füllen, eine Erde des dritten Tages.
Ich konnte mich nicht zurückhalten und stieß einen tiefen Seufzer der Faszination aus.
Und wieder lachte Mister Wilde, diesmal aber zufrieden. »Also, Junge, dann erzähl mal. Warum geht ein Erntemond jeden Tag dreißig Minuten später auf, im Gegensatz zu den gewöhnlichen fünfzig während des restlichen Jahres?«
Er betrachtete mich, ohne eine Miene zu verziehen.
»Was meinst du, liegt das daran, dass sein Orbit um diese Jahreszeit parallel zum Horizont verläuft, sodass sich die Erde nicht so weit drehen muss?«, sagte er.
Ich starrte ihn nur verunsichert an. Ich spürte, dass er sich, wenn auch nur zaghaft und sachte, über mich lustig machte.
»Ach«, fuhr er fort. »Welch ein Rätsel.«
Wir standen beide am offenen Fenster, jetzt aber fing er an, sehr hastig etwas in ein Buch zu schreiben, das aufgeschlagen neben seinem Ellbogen auf einem Gestell lag. Einen Moment lang war er still, und dann sagte er, immer noch etwas kritzelnd: »Wie lautet dein Name, Junge?«
Ich senkte den Blick. »Wash, Sir.«
»Wash?«
»Washington. George Washington Black, Sir.«
Er sah von seinem Buch auf. »Ich hatte einen Onkel, der von den Amerikanern freigekauft wurde, als sie für ihre Republik kämpften. Er begann, sie recht aufrichtig zu schätzen. Also, junger George Washington, sollen wir unseren Delaware überqueren?«
Als ich ihn nach wie vor nur verständnislos anstarrte, machte er sich einige weitere Notizen in seinem Buch und kicherte. »Unseren Delaware«, murmelte er fröhlich. Er überprüfte einmal mehr die Position des Rädchens an seinem Teleskop und schrieb erneut etwas auf. Dann hob er den Blick. »Christopher Wilde«, sagte er und nannte mir, wie ich begriff, seinen eigenen Namen. »Aber nenn mich Titch. Das tun alle, die mir nahestehen. Als Kind war ich krank, weißt du, und eine Weile war ich wirklich winzig – na ja, der Name ist geblieben, Titch, der Knirps. Mit den Jahren habe ich mich dran gewöhnt. Anfangs wird es dir natürlich komisch vorkommen, mich so anzusprechen, aber der Name passt um einiges besser als Mister Wilde. Mister Wilde ist mein Vater. Und, wie meine Mutter nie müde wird zu betonen, ich bin nicht er. Hast du deine Sachen mitgebracht? Stehen sie noch draußen auf der Veranda?«
Wieder hatte ich keine Ahnung, wovon er sprach.