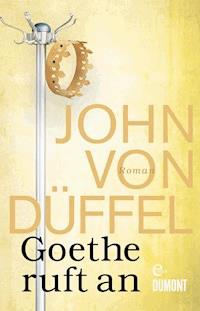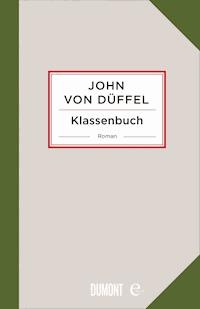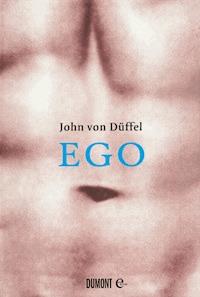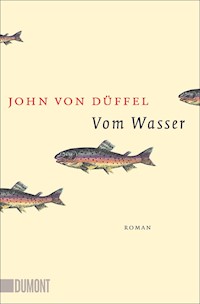8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Schwimmbad, ein See, ein Teich, strömender Regen und das Meer – John von Düffels neue Geschichten spielen im, am, unter oder auf dem Wasser. Sie erzählen von glitzernden Reflexen und schwarzer Tiefe, großer Weite und luftdichter Abgeschlossenheit, eisgrauem Meer im Winter und dem glasklaren Wasser eines Pools. Ein Vater muss lernen, dass seine Tochter ihm entwächst, eine Mutter, dass ihr Kind niemals geboren wird. Ein Lehrer erkennt, dass man anderen Menschen nie das vermitteln kann, was man möchte, sondern nur das Unfreiwillige. Wie ein stummer Fisch im Aquarium dekoriert eine Frau den Pool eines Stararchitekten. Ein junger Mann schwimmt durch die winterkalte Ostsee und stirbt – doch nicht. In elf Geschichten blickt John von Düffel auf Eltern und Kinder, Menschen und Tiere in einer Welt, in der vieles, was früher galt, fortgespült wurde. Mit seinen Wassererzählungen kehrt der leidenschaftliche Schwimmer John von Düffel zu dem Grundmotiv seines Erfolgsromans ›Vom Wasser‹ und zu seinem Lebensthema zurück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
John von Düffel
WASSERERZÄHLUNGEN
Eine frühe Fassung von »Ostsee« ist in der Anthologie Ein extraherrlicher Meersommerabend 2013 im mare Verlag erschienen; eine Kurzversion von »Der schwarze Pool« wurde im Rahmen des MDR-Kurzgeschichtenwettbewerbs 2013 ausgewählt und in dem Erzählband Risikoanalyse abgedruckt.
eBook 2014
© 2014 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Covermotiv: © Rüdiger Trebels
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN eBook: 978-3-8321-8776-7
www.dumont-buchverlag.de
Für Katja und Greta
Ostsee
Die meisten Menschen haben ein falsches Bild von der Kälte. Sie meiden sie, ohne sie jemals kennengelernt zu haben. Sie schrecken vor ihr zurück bei der ersten Berührung und verbringen den Rest ihres Lebens mit einem Kälte-Vorurteil, dessen Lächerlichkeit ihnen nie bewusst wird. Sie sterben und haben die Kälte nicht einmal singen hören, dabei singt sie nicht nur für sich an ihren ausgelassenen Tagen. Doch das werden sie nie erfahren. Sie werden nicht mit ihr lachen und nicht mit ihr weinen, bis zu ihrem Tod.
Wie kann ein Mensch sterben, ohne zu wissen, wie gnädig die Kälte ist.
Sie ist auch nicht starr, ganz und gar nicht. In ihr herrscht die größte Bewegung. Man muss sich ihr nur überlassen und durch den ersten Schrei und Schrecken hindurchgehen, hindurchtauchen. Dann.
Die Kälte hat ein Gedächtnis und eine Gegenwart. Und sie ist vollkommen klar.
Das Wasser an einem Wintertag. Der Himmel über der See ist hauchblau. Eine Bläue, die allen Dunst und Nebel, die Wolken und Schwaden in sich aufgesogen und verwandelt hat in einen Reifatem, der die Sonne blass macht, eine gefrorene Scheibe aus Licht. Der strohige Bewuchs der Dünen ist frosttrocken und knistert, wenn er unter Schritten zerbricht, der Sand hart wie Stein, eine Mondkruste, und wenn man tief Luft holt, ist es, als hätte man die ganze Nacht mit offenem Mund geschlafen.
Ich stehe am Strand und schaue auf das winterglatte Wasser. Da, wo es ruht, da, wo es sich regt. Das Eis ist ganz zart und verletzlich, wie die Haut über einer erkalteten Milch, auch dort, wo die See am stillsten ist. Man kann es streicheln, mit dem Strich der Wellen oder dagegen, ein Fell oder Flaum aus Kristall, weicher Eiswasserflaum. Ich sage, hallo, See, wir kennen uns. Ich bin durch das Frühjahr mit dir gegangen, jeden Tag, während dein Wasser immer heller, leuchtender wurde und geschmeidig unter den Händen wie Gras. Ich war bei dir unzählige Stunden im Sommer, als die Sonne steil im Wasser stand und man abends beim Kraulen die Mücken erschlagen konnte, eingehüllt in die Sommergerüche von heißem Sand und Kiefernharz wie für immer. Und dann weht doch wieder der Herbst herein, lässt die Küstenlinie noch einmal aufleuchten und löscht sie dann, weißgrau, farblos, bis auf ein paar spärliche Striche unter dem Wind, die Segel eingeholt, Sturm gehisst, bis das Eis kommt, das undurchdringliche, und alles endet.
Es riecht nach Schnee, stellst du fest, Ostwind, sagst du laut vor dich hin, so als würdest du dich wundern. Über die eisfreien Priele läuft ein Schauder. Sämtliche Härchen an deinen Armen stellen sich auf. Aber du kannst die See nicht lassen.
Es ist ganz einfach: Wenn du jedes Kleidungsstück genau so ausziehst, wie du es immer ausziehst, wenn du alles genau an die Stelle legst, wo du es immer hinlegst, wenn du genau den Weg ins Wasser gehst, den du immer gegangen bist, Schritt für Schritt, dann kannst du den Körper über die Kälte hinwegtäuschen, über ihre Zumutungen, ihre Ungeheuerlichkeit. So als wäre alles wie immer, jeder Handgriff vertraut, und du kannst in die Kälte gehen wie ins Bett.
Der Trick ist, den Selbsterhaltungstrieb auszuschalten, dieses sehr mächtige Kommando im Gehirn, da nicht reinzugehen, das nicht zu tun, niemals!
Aber darauf darfst du nicht hören, während du durch die Uferwellen watest. Du musst besser wissen, was du tust, besser als dein Körper. Hör nicht auf ihn, aber beobachte ihn ganz genau, wie eine interessante Maschine in einem sehr gewagten Experiment. Es ist wichtig, dass du ihn von oben, von außerhalb siehst. Du musst auf jedes Zeichen achten, jedes Warnsignal, die Sirenen, die losschrillen werden, überall, alle zur selben Zeit. Nimm das zur Kenntnis, schätze es ein, aber hör nicht darauf, sonst verlierst du die Kontrolle, sonst wird die Panik deines Körpers total. In dem Moment, in dem sie dein Denken erfasst, bist du verloren. Doch denk nicht daran.
Das Schwierigste ist der erste Schock. Du weißt, du musst atmen, aber du kannst nicht. Du weißt, du musst jetzt den nächsten Gedanken fassen, aber du bist starr vor Entsetzen, gefangen in Todesangst. Du sagst dir, dass du das kennst, dass du schon oft an diesem Punkt gewesen bist. Es ist nicht das Ende, sondern nur eine Grenze, die du verschiebst, sagst du dir. Aber es ergibt keinen Sinn, du verstehst nicht, was du da sagst, dein Körper versteht es nicht. Du bist eingeschlossen in ein System im Alarmzustand, eine brutale Krise, die alles blockiert. Dein Körper nimmt keine Befehle mehr an. Du kannst nichts tun. Du kannst nur warten, kannst diesen Moment nur überstehen – falls du ihn überstehst –, indem er vorbeigeht.
Und dabei liebe ich mein Leben.
Dann gelingt dir der erste Atemzug. Nur ein kurzer, ein kleiner Schluck Luft, noch einer und noch einer. Du wagst es, schaffst es, tiefer zu atmen und immer mehr Luft einzuziehen, auch wenn mit ihr die Kälte einströmt über deine Lippen, durch deine Haut, die nicht länger ein Panzer ist, keine Front, sondern bloß eine dünne Membran, auf der sich der Schock in Schmerz verwandelt und die Kälte zu einer Empfindung wird, während sie durchzieht. Aber das muss sein, das weißt du, das Unerträgliche ist eine Illusion, die nachlässt, irgendwann. Du darfst nur nicht auf deine Haut vertrauen. Haut ist dumm. Haut denkt nicht voraus. Sie spürt heiß und kalt, hart und weich, die Wucht und den Aufprall der Kälte und die Schärfe der tausend Wasserklingen, ihre fleißigen Schnitte überall, aber sie sieht nicht, dass auch das vorbeigeht, sie sieht nicht voraus. Haut kennt immer nur den Moment und hält ihn für eine Ewigkeit. Sie kann die Uhr nicht vorstellen bis zu dem Punkt, an dem sie nichts mehr spüren wird, gleich schon, in zwei, drei Minuten, fast nichts, nur einen leichten Nesselbrand von Kälte, Nadelstiche, Salzkristalle mit feinen, filigranen Spitzen und Bahnen von kühler Seide, die vorübergleiten, weil sich die Kälte längst nicht mehr auf deiner Haut abspielt, sondern ein Teil von dir geworden ist. Du stößt dich vom Grund ab und schwimmst.
Jedes Mal denke ich, ich könnte die See wärmen. Wenn ich nur oft genug schwimme, wenn ich nur lange genug durchhalte. Ich könnte die See wärmen, und dann wäre es morgen nicht mehr so schlimm. Ich heize das Meer auf mit jedem Zug, und das Eis weicht. Ich glaube das jedes Mal für einen Moment und muss mir dann eingestehen, dass ich nicht einmal imstande wäre, das Wasser in einer Badewanne auf Körpertemperatur zu halten. Sogar in einer Wanne stirbt man irgendwann an Unterkühlung. Und trotzdem gibt es etwas in mir, das an die Macht des Schwimmers glaubt, auch wenn das Meer, der kleinste Teil dieses Meeres, so unendlich viel mächtiger ist.
Ich drehe mich auf den Rücken, trete mit dem Beinschlag eine hohe, schaumweiße Fontäne los und schaue zurück zum Ufer. Wie verwaist und winterlich es daliegt, wie versunken unter dem gefrorenen Himmel, ein Bild, in dem ich der Fehler bin, der Einzige, der das Kältesiegel über der See und dem Sand aufbricht und die Stille zerschlägt. Ein Hochgefühl überkommt mich, so als hätte ich die Zeit besiegt, so als könnte ich weiter und immer weiter schwimmen, über den Rand der Zeit hinaus.
Ich will mich zum Kraulen umwenden, da sehe ich ihn wieder, etwas weiter strandabwärts: den alten Mann, der immer da ist, jeden Tag, und den Sand entlang der Wasserlinie umgräbt. Gott weiß, was er sucht. Aber er sucht unermüdlich, bei Wind und Wetter. Manchmal gräbt er mit einem Stock, einem Stück Treibholz, manchmal mit bloßen Händen, in der Hocke oder auf den Knien – obwohl er Tag für Tag gräbt, hat er nie Werkzeug dabei, Schaufel, Spaten, nicht einmal Handschuhe. Er gräbt, aber behilft sich nicht. Dann richtet er sich wieder auf, steht da und starrt auf die Stelle, das hereinströmende Wasser, die Wunde im Sand, bis das Meer sie verwäscht und der gewölbte Rücken des Ufers sich schließt, als wäre nie etwas gewesen. Der Mann steht einfach da und sieht dem Verschwinden zu.
Anfangs habe ich ihn für einen pensionierten Wissenschaftler gehalten, einen Naturschützer oder Meeresbiologen, der nach Würmern oder einer seltenen Muschelart forscht. Seine Kleidung ist unauffällig, keine Spur von Verunreinigung oder Verwahrlosung, graue Windjacke, blaue Jeans, festes Schuhwerk. Er wechselt seine Sachen nicht oft, aber sie sind immer tadellos, ordentlicher sogar und weniger leger als die der meisten Strandgänger. Seine Gesundheit scheint robust, sein Lebenswandel regelmäßig. Er fehlt nie. Aber er ist verrückt, davon bin ich überzeugt, völlig verrückt, es kann gar nicht anders sein. Nicht, weil er immer allein ist und mit niemandem spricht. Es ist die Art seiner Einsamkeit. Er hat so etwas an sich, um sich, dass man ihm lieber aus dem Weg geht. Noch nie habe ich gesehen, dass ihm jemand die Hand gibt zum Gruß oder ihm auf die Schulter klopft, und wenn, dann würde er vermutlich durch ihn hindurchfassen.
Es ist so weit. Ich senke den Kopf ins Wasser und kraule los, das Stechen an den Schläfen geht von Ohr zu Ohr. Die Kälte schließt sich um meine Stirn, hält sie fest umklammert und drückt zu, drückt sie zusammen, aber die Angst kommt nicht zurück. Ich atme, keuche, muss den Kopf noch zwei, drei Mal über die Wasseroberfläche recken, weil der Kältedruck auf die Stirnhöhlen zu groß wird. Dann nicke ich ins Wasser zurück, brauche mich nicht einmal hinunter zu zwingen, sondern tauche ein in Salz und Eiswasser wie in Schlaf.
Es tut gut, etwas zu haben, woran man denken kann, wie an den alten Mann am Strand, den ich »den Graber« nenne. Jeder Gedanke schlägt die Kälte, bahnt einen Pfad durch sie hindurch. Für einen Moment bin ich dem Alten geradezu dankbar, ich könnte ihm um den Hals fallen, weil er mir über die Eisschwelle hilft, die sonst so viel Willen und Überwindung kostet und über die ich in Gedanken an ihn hinweggleite, als wäre es das Folgerichtigste überhaupt. Ich frage mich, was für ein Leben er hat jenseits der See, ob es eine unsichtbare Frau gibt, die ihm seine Sachen wäscht, ob ihm jemand vorm Verlassen der Wohnung die Schuppen von den Schultern streicht oder ob er sich in einem fleckigen Spiegel selbst korrigiert und so unauffällig macht, als wäre er gar nicht da. Er sieht wirklich jeden Tag gleich aus, nicht einmal die grauen Haare werden länger. Sein Erscheinungsbild hat die Unverwüstlichkeit der Erdkundelehrer oder Hausmeister meiner Schulzeit. Ich sehe über einen sanften Wellenhügel hinweg, wie er in die Knie geht, auf die Knie fällt und einen Stock in den Sand stößt. Heute ist also wieder einer dieser Tage. Dann greife ich nach dem graublauen, graugrauen Wasser in äußerster Reichweite, und vor meinen Augen ist nur noch das Meer.
Jeder Kraulschwimmer hat ein seltsames Verhältnis zur Überwasserwelt. Er nimmt nicht an ihr teil. Für ihn zählen nur die See, sein Atem und die Kälte, nicht auf der Haut – seine Haut bildet längst keine Grenze mehr zwischen ihm und dem Meer –, sondern im Körper. Auf die Kerntemperatur kommt es an, auf den Griff der Kälte nach den Knochen und Eingeweiden, um die sich sämtliche Muskeln und Sehnen zusammenziehen wie ein Netz um ein Kilo Orangen.
Was über Wasser geschieht, ist wie entrückt: flüchtige, dahintreibende Bilder beim Schulterblick, Momentaufnahmen, Schnappschüsse, die vom Kampf mit der Kälte nichts wissen und die ich mir zusammenreime, zusammenträume zu einer Welt ohne Bedeutung. Im Sommer, natürlich, ist es wichtig abzuschätzen, ob und wie schnell ein Boot sich bewegt, ob ein anderer Schwimmer meine Bahn kreuzt oder ob es nur Bojen sind, die zwischen den Wellen herumdümpeln. Doch jetzt ist das Meer ausgestorben, die Boote liegen winterfest in ihren Docks, die meisten Bojen sind eingeholt, und ich bin mit dem Wasser allein. Eine Brise kommt auf, wirft sich in die Wellen und facht die Kälte an, die Jagd macht auf jeden Flecken nackter Haut, mein nasses Haar. Doch so sehr der Wind auch anzieht und die Lufttemperatur fällt, das Wasser bleibt sich gleich. Es wird nie kälter sein als jetzt, es schützt mich und umhüllt mich ganz.
Das Einzige, was ich im Blick behalten muss, ist der Strand. Ich zwinge mich, an den Rückweg zu denken und daran, dass er mindestens doppelt so lang werden wird und jeder Zug um ein Vielfaches schwerer, ich sage mir das, denn in der Kälte ist die Entfernung launisch und ohne Maß. Wer zu lange wartet, zu sehr auskühlt, für den können schon hundert Meter zu weit sein.
Ich schwimme einen leichten Bogen, drehe den Kopf in den Nacken und entwinde mich dem Sog ins Offene. Der Graber kehrt in mein Blickfeld zurück. Der dürre Stock, mit dem er im Sand gestochert hat, ist nicht mehr da, weggeworfen oder zerbrochen, nehme ich an, vielleicht hat er auch nie existiert. Jetzt schaufelt der Alte mit bloßen Händen und häuft einen Sandberg auf vor seinen Knien. Ich kann das alles noch erkennen, aber kleiner, denke ich, winziger darf er nicht werden und auch nicht der Strand, den er umgräbt. Dann wende ich mich wieder dem Wasser zu. Beim nächsten Atemzug sehe ich nur noch eine gefurchte, schaumgeäderte Schräge. Die See gerät unter dem Wind in Bewegung, Wellen heben mich, langsame, gemächliche, mit weit auseinandergezogenen Schaumkappen. Die Schneeluft in meinen Lungen schmeckt nach Blut. Ich muss zurück, ich muss umkehren, höchste Zeit, sage ich mir und denke: jetzt schon? Und: endlich!
Bereits nach wenigen Metern mit Kurs auf den Strand merke ich, dass es die richtige Entscheidung war. Ich brenne herunter, so rasend schnell und erbarmungslos, dass die Kälte kein Zustand mehr ist, sondern freier Fall. Ich schlingere, statt vorwärtszugleiten, keine Bewegung läuft mehr rund. Die Entfernung zum Ufer scheint immer größer zu werden, unüberwindlich, doch das kann nicht sein, sage ich mir, nein, nein, ich bin es, der kleiner wird, immer kleiner, mein Körper schnurrt zusammen auf den eines Kindes, hilflos und verloren, ich kenne dieses Kind, es hat Angst, große Angst.
Es kann nicht mehr, schwimmt nicht mehr, auch das kenne ich von ihm, das Kind hat alles verlernt, stöhnt und krümmt sich, will sich hinsetzen, hinlegen, seiner Not überlassen, aber ich weiß, dass das falsch ist, und treibe es an, immerzu, es muss sein. Der Mann am Strand darf nicht in noch weitere Ferne rücken, nicht noch mehr schrumpfen, auf keinen Fall. Versuch, den Kopf zu heben, die Richtung zu halten, nur keine Umwege jetzt, beschwöre ich es – das Kind gehorcht nicht. Ich schreie es an, aus Leibeskräften, ich höre mich im Wasser brüllen, vergebens. Doch ich weiß genau, wo der Mann ist, weiß es instinktiv und kraule drauflos, unbeirrbar, durch Kältescherben und Schaum, ohne nach links oder rechts zu blicken, ich brülle noch immer, es ist die einzige Art, zu atmen, vorwärtszukommen. Endlich wird die See dünner, durchsichtiger, gläsern fast. Dann ist da Meeresgrund, mit Händen zu greifen, Muschelstückchen und Sand. Ich kann stehen, zwar spüre ich meine Beine nicht mehr, aber ich stehe und stolpere weiter durch seichte Wellenausläufer ans Ufer, ducke mich unter dem Wind und torkle an dem Mann vorbei, der kurz aufschaut und durch mich hindurchsieht. Er hat mich gerettet, mir das Leben gerettet, aber wir grüßen uns nicht.
Handtuch, Hose, Jacke, Kapuze, ich brauche mir keine Befehle zu geben. Die Ankleideroutine ist eingespielt, fast dieselben Handgriffe wie vorhin, nur in umgekehrter Reihenfolge. Meine größte Anstrengung ist, das Zittern im Griff zu behalten. Socken lasse ich weg, Schuhebinden sowieso, es wird Stunden dauern, bis meine Finger das wieder können. Ich muss nach Hause, mich aufwärmen, schnell.
Als ich an der geschlossenen Würstchenbude am Hauptsteg vorbeihusche, mit hochgezogenen Schultern, den Blick gesenkt, steht die Besitzerin da, eine wasserstoffblonde, immergebräunte Endfünfzigerin in einem blau-weiß geringelten Kapuzenpulli. Sie nennt sich Rosi oder Babsi, trinkt gern einen Korn mit ihren Gästen und manchmal auch allein. Ein, zwei totgedrehte Locken ihres spröden, strohigen Haars flattern im Wind, als gehörten sie nicht zu ihr. Wir kennen uns ohne Worte, doch ausgerechnet heute spricht sie mich an mit einem leicht hängenden, leicht verhangenen Lächeln.
»Sagen Sie, haben Sie eine Wette verloren, oder machen Sie das freiwillig?«
»Ich wette nicht«, bringe ich hervor und versuche zu grinsen, trotz eingefrorener Gesichtsmuskeln.
»Sie holen sich noch den Tod«, sagt sie.
»Man gewöhnt sich daran«, winke ich ab, überdeutlich, damit sie nicht auf die Idee kommt, mir etwas zu trinken anzubieten. Doch sie sagt nur: »Also ein büschen verrückt sind Sie schon, junger Mann!«
»Da bin ich hier nicht der Einzige«, sage ich, noch immer grinsend, und deute mit einer Kopfbewegung strandwärts Richtung Graber, schließlich ist er um einiges verrückter als ich. Aber was, wenn er gar nicht mehr da ist, durchzuckt es mich plötzlich, wenn ich ihn mir nur eingebildet habe? Ich drehe mich um und entdecke den Alten erst auf den zweiten Blick. Er hat sich weit nach vorne in seine Grube gebeugt und holt mit beiden Unterarmen den Sand ein.
Die Kioskbesitzerin folgt meinem Blick, langsam, beinahe widerwillig. »Ja«, sagt sie und lässt ihr Lächeln fallen, »so hat jeder sein Päckchen zu tragen.«
»Sagen Sie bloß, Sie wissen, wonach er gräbt!« Ich will auf keinen Fall länger hier stehen bleiben und einen Plausch halten, stutze aber doch.
»Na, wegen seinem Sohn«, sagt sie und schaut auf meine offenen Schuhe. Für einen Moment bin ich wie vor den Kopf gestoßen, ein Sohn kam in den Geschichten, die ich mir vom Graber erzählt habe, nie vor. Aber ich frage nicht nach, sondern denke nur, gut, dann werde ich mir eben morgen eine andere Geschichte von ihm erzählen. Ich bin in Gedanken schon an Rosi vorbei, als sie kaum hörbar hinzufügt: »Der Junge wollte rüberschwimmen, in den Westen. Seine Leiche wurde nie gefunden.«
Das Spiel ohne auf die Erde zu kommen
Als sie den schmalen, geschlängelten Weg hügelan fuhren, erhob sich der Wald vor ihnen wie eine Wand. Die Dämmerung stand zwischen den schwarzen Tannen, während der Himmel noch licht war, hell und stufenlos grau. Die ungemähte Wiese zum Wald hin sah aus, als hätte sich eine Herde von Nebeltieren darin gewälzt. Bleiches, verblühtes Gras lag nass und regenschwer in Wellen danieder.
Sie hielten sich so weit rechts wie möglich auf der engen, an den Rändern bröckelnden Fahrbahn, obwohl mit keinerlei Gegenverkehr zu rechnen war. Die wenigen Anlieger, die ihre Ferienhäuser und Jagdhütten am Waldrand hatten, kamen im Sommer. Mitte November war hier kein Mensch. In einer Kurve stand ein bemooster Gartenzwerg mit Schubkarre. Daneben lag ein umgekipptes Dreirad, das einmal leuchtend rot gewesen sein musste, weiter unten im Graben ein gehörnter Hüpfball. All das hatte im Sommer schon so dagelegen als Warnung an die seltenen Autofahrer, dass hier Kinder spielten. Doch danach sah es nicht mehr aus. Die Kinder des Sommers waren längst wieder abgereist und zurück im wirklichen Leben.
Sie fuhren langsamer. Michael saß leicht vornübergebeugt am Steuer und starrte angestrengt in die ausfällende Dunkelheit. Sie sah ihn von der Seite an und fragte sich, ob er der Kinder wegen vom Gas gegangen war oder nur, um die Einfahrt nicht zu verpassen. Doch sie vergaß, sich darauf zu antworten. Zwei-, dreihundert Meter weiter bog Michael ein und hielt vor dem vollkommen dunklen Haus.
Als es still wurde im Auto, in dem kurzen Moment des Verharrens nach der Fahrt, machte der Wald einen Schritt auf sie zu. Mit der Nacht kam er näher, und die Stille ging ihm voraus. Das Haus war das letzte auf dem Hügel, nur wenige Meter hinter dem Grundstück endete der Asphalt, und die kleine Straße ging in einen unbefestigten Feldweg über, der nur für land- und forstwirtschaftliche Nutzfahrzeuge freigegeben war. Im Sommer konnte man manchmal schon morgens die Motorsägen hören, wie sie in Chören über den Wald herfielen. Trotzdem wurde er immer dichter.
Die Stille war bodenlos.
Mit einem Ruck kletterte Michael aus dem Wagen und fing an, den Kofferraum zu entladen. Sie tat es ihm mit kurzer Verzögerung gleich. Die Novemberluft war feucht und schwer. Vom Nadelboden ringsum stieg eine würzige Kühle auf, die sie dankbar einsog, hungrig nach Gerüchen und frischer Luft. Michael nahm die Koffer, er hatte es eilig, ins Haus zu kommen, hantierte mit einem Schlüsselbund und fluchte über irgendetwas. Ein Keil von Helligkeit riss den verlassenen Garten auf bis hin zur Birke an der Grundstücksgrenze, die wie aufgeschreckt nach ihren eigenen Schatten fasste.
Als sie sich nach ihrem Rucksack bückte, war Michael schon wieder neben ihr und nahm ihn ihr aus der Hand. Er hatte ihr verboten, schwer zu tragen. Sie folgte ihm mit ein paar Jacken und Mänteln. Im Flur blieb sie stehen und staunte über die stille, verschwiegene Ordnung in der Küche, im Wohnzimmer, diese aufgeräumte Einsamkeit überall. Und das sollte dasselbe Haus sein, das sonst so voller Leben war, wenn sie zu Besuch kam.
Im Sommer, vom ersten Ferientag bis zum letzen, gehörte es den Zwillingen, Jakob und dem kleinen Konstantin, der aus unerfindlichen Gründen einen halben Kopf kleiner war als sein Zwillingsbruder. Mitsamt ihren Freunden aus dem im Tal gelegenen Dorf verwandelten sie das Haus jeden Tag aufs Neue in ein riesiges Spielzimmer voller Gelächter, Getrampel und Geschrei. Als Michael ihr vorgeschlagen hatte, die Übergangszeit hier zu verbringen, bis ihre Wohnung renoviert und nach den kleinen baulichen Veränderungen wieder beziehbar sein würde, war ihr nicht klar gewesen, was für eine Leere Kinder zurückließen, wenn sie auf einmal nicht mehr da waren.
Als Michael die Treppe wieder herunterkam und sich an ihr vorbeischob, wollte sie irgendetwas einwenden, etwas Schwerwiegendes. Aber der Gedanke entglitt ihr gleich wieder, und es war ja nicht für lang.
Sie hängte die Mäntel in die Garderobe und stieg mit den Strickjacken hinauf zu den Schlafräumen unterm Dach. Es roch muffig, nach altem Zwieback. Hier oben war seit Monaten kein Mensch mehr gewesen. Dennoch hatte Michael ihr Gepäck ganz selbstverständlich in das Kinderzimmer gebracht, wo sie im Sommer immer schliefen, weil sein älterer Bruder Robert mit seiner Frau das Elternschlafzimmer belegte. Die Zwillinge und ihre Freunde übernachteten meist in Zelten im Garten. Einmal hatte sie den kleinen Konstantin in ihrem Bett gefunden – kein halbes Jahr war das her. Sie hatte sich an dem Abend frühzeitig aus der Runde der Erwachsenen verabschiedet und war nach oben gegangen, weil sie sich nicht wohlfühlte. Als sie sich hinlegen wollte, sah sie seinen kleinen, gekrümmten Körper, halb bedeckt, den biegsamen Rücken, die perfekte Perlenschnur der Wirbel unter seiner Haut. Lange hatte sie neben dem Jungen gesessen und seinem Atem gelauscht. Sie brachte es nicht über sich, ihn zu wecken oder umzubetten. Irgendwann hatte sie einen Weg gefunden, wie sie sich um Konstantin herumlegen und an ihn schmiegen konnte, als wäre er in ihren Armen eingeschlafen, ganz genau so. Es kam ihr vor, als hätte sie kein Auge zugetan, sondern die ganze Nacht nur den Schlaf dieses Kindes beschirmt. Doch am nächsten Morgen fühlte sie sich frisch und munter wie lange nicht mehr.
Beim Aufwachen hatte Konstantin sie mit großen, traumweiten Augen angesehen und gelächelt wie im Vertrauen. Aber er war nie wieder gekommen, in all den Nächten nicht.
Sie öffnete den Wäschekoffer und bezog die Betten mit frischen Laken. Wollmäuse huschten über den Fußboden, eine Motte flog auf und dengelte gegen die Nachttischlampe. Der Geruch von Weichspüler breitete sich aus, ein Zuhause-Geruch, der ihr irgendwie unangemessen vorkam. Wenn sie die Augen schloss, war sie am falschen Ort.
Mit einigem Kraftaufwand öffnete sie das Schlafzimmerfenster, das sich leicht verzogen hatte. Die Nachtluft strömte herein wie unerschöpflich tiefer Atem und mit ihr die Stille des Waldes. Von irgendeinem Hof aus dem Tal hörte sie einen Hund bellen, doch es klang unendlich weit weg und wie aus einer anderen Welt. Die Stille hatte sich verwandelt. Sie war nicht mehr bodenlos, auf ihrem Grund war ein Rauschen, so undeutlich und murmelnd wie ein Bach, viele Bäche. Vermutlich wurde das Haus im Winter von den verschiedensten Arten der Stille bewohnt.
Die Dielen knarrten, Michael stand in der Tür. Sein Gesicht wirkte wie erloschen von der Eintönigkeit der Fahrt, aber er lächelte.
»Wie geht es dir? Hast du Hunger?«, stellte er zwei Fragen auf einmal, so als hätte er Angst, keine Antwort zu bekommen. Sie hielt inne, wie um zu überlegen, doch sie wusste bereits, dass sie gleich den Kopf schütteln würde, und tat es auch. »Ich will noch ein bisschen arbeiten«, sagte sie.
»Wir sind hier in einem Ferienhaus …«, wandte er lächelnd ein und legte ihr eine Hand auf die Schulter.
»Aber es sind keine Ferien.« Sie merkte, dass sie noch immer leicht den Kopf schüttelte, und ließ es.
»Komm, nur eine Kleinigkeit«, entschied Michael für sie und verschwand nach unten in die Küche. Sie zog das Fenster zu, wie um zu verhindern, dass der Wald sie weiter belauschte. Dann schloss sie den Koffer und strich die Betten noch einmal glatt. Für einen Moment war ihr, als würde sie den kleinen Konstantin spüren, seinen warmen Körper, seinen tiefen, bewusstlosen Schlaf. Sie lächelte bei der Erinnerung. Die Stille war schon wieder anders, ein Pfeifen wie mit gespitzten Lippen, tonlos.
Am liebsten wäre sie hier oben geblieben und hätte sich eingegraben in die warme Wäschewolke von zuhause, ein wenig gelesen, ein wenig geschlafen. Stattdessen nahm sie ihren Bücherrucksack und trug ihn hinunter ins Wohnzimmer. Das Feuer im Kachelofen brannte bereits, verbrannte die abgestandene Luft und summte dabei. Doch die Kacheln waren noch kalt. Sie zog die Rouleaus vor den Fenstern hoch, nur um festzustellen, dass es keinen Unterschied machte. Draußen war kein Licht zu sehen, nichts. Jedes Mal, wenn sie aufs Land fuhren, wunderte sie sich darüber, dass in der Nacht der Himmel das Hellste war und die Erde ein schwarzer Planet.
Sie ließ sich, eine Hand über dem Bauch, auf das ausgebeulte Kunstledersofa fallen, legte die Beine hoch und schob sich ein Kissen in den Nacken. Ohne hinzusehen, zog sie ihren Rucksack zu sich heran und griff nach dem nächstbesten Buch, fest entschlossen, in diesem Zwangsurlaub ihre gesamten Lektüreversäumnisse nachzuholen. Doch schon mit den ersten Sätzen tat sie sich schwer. Ihre Gedanken wanderten, sie war zerstreut und abgelenkt, ganz ohne Grund. Michael klapperte in der Küche vor sich hin, der Kachelofen schnurrte, und die weiche Holzfeuerwärme sickerte langsam in die Sofapolster. Wenn man irgendwo in Ruhe lesen konnte, dann hier.
Ihr Blick fiel auf die Kinderfotos von Michael und Robert, die an den weiß verputzten Seiten des Rauchabzugs über dem Kachelofen hingen. Schon oft hatte sie davorgestanden und gestaunt, wie ähnlich sich die Brüder als Kinder gesehen hatten – insofern erschien es ihr nur folgerichtig, dass Robert Vater von Zwillingen geworden war, etwas Zwillingsartiges lag in der Familie. Doch die Ähnlichkeit zwischen ihm und Michael hatte sich mit den Jahren verlebt und verloren. Inzwischen erkannte man nicht einmal, dass sie Brüder waren, sondern entdeckte nur, wenn man es wusste und wollte, eine gewisse Verwandtschaft der Augenpartie, der Züge um Nase und Mund. Sie waren andere geworden, hätte man meinen können. Doch das täuschte. Ihre Ähnlichkeit hatte sich nur verlagert, von außen nach innen. Sie glichen sich nicht mehr, aber sie verhielten sich gleich, dieselben Gesten, dieselbe Mimik in veränderter Gestalt. Sogar ihre Vorlieben und Überzeugungen hatten sich mit der Zeit angenähert, obwohl sie ganz verschiedene Leben lebten und einander bis auf ein paar Wochen im Sommer kaum sahen. Vielleicht fiel es deshalb niemandem auf. Doch wenn sie mit Michael beim Abendessen saß und auf ihrem Teller etwas übrig ließ, verzog er das Gesicht genau wie Robert – beide konnten nichts »verkommen lassen«. Wenn Michael mit unbeirrbarer Geduld ein paar desinteressierten Handwerkern den Sinn und Zweck dieser oder jener Baumaßnahme erklärte, glaubte sie, Robert über Ökosysteme und Nachhaltigkeit reden zu hören. Und wenn Michael verstummte, schwieg er Roberts Schweigen – sein Mund wurde auf genau dieselbe Weise hart. Manchmal erinnerte er sie so sehr an seinen großen Bruder, dass sie es wie einen Verrat empfand, weil sie sich zuerst in Robert und dann in Michael verliebt hatte, dem sie ohne ihre Affäre mit seinem älteren Bruder nie begegnet wäre. Manchmal fühlte es sich an wie zwei verschiedene Beziehungen mit ein und demselben Mann.
Er brachte ihr Spiegeleier, gewendet, mit gestocktem Eigelb. Die letzten Wochen hatte sie regelrecht Heißhunger darauf gehabt, jetzt ekelte sie sich auf einmal davor. Doch das konnte sie Michael unmöglich sagen, auch wenn sie nun vor der Schwierigkeit stand, diese Spiegeleier irgendwie hinunterbekommen zu müssen. Es waren drei, noch dazu recht große Spiegeleier, an denen kein Weg vorbeiführte, nicht nur weil in dieser Familie niemand etwas »verkommen ließ«, sondern vor allem weil Michael so aufmerksam gewesen war, sie nach einer langen Autofahrt mit ihrem vermeintlichen Leibgericht zu überraschen.
»Lass uns am Tisch essen«, sagte sie in der Hoffnung, dass es ihr leichterfallen würde, diese Mahlzeit niederzuringen, wenn sie nicht auf dem Sofa lag wie eine Kranke, sondern Form und Haltung annahm.
Michael stellte ihren Teller auf den Eichentisch in der Essecke, die durch eine Viertelwand vom Wohnzimmer abgeteilt war und sehr rustikal wirkte mit ihrer dunklen Holztäfelung, dem mit Schnitzwerk versehenen Geschirrschrank und den bestickten Gardinen. In dieser zünftigen Umgebung schienen die Eier noch unüberwindlicher.
»Guten Appetit«, wünschte ihr Michael, und ein bisschen hasste sie ihn dafür. Teilnahmslos sah sie zu, wie er sein Schinkenbrot mit Messer und Gabel so sorgfältig zerteilte, als müsste er ein Kleinkind damit füttern. Dann spießte er die einzelnen Happen auf und verzehrte sie mit knappen, knabbernden Kaubewegungen. Beide, Robert und Michael, drehten beim Essen die Gabel im Mund.
Dass die Spiegeleier langsam kalt wurden, erfüllte sie mit einem Gefühl der Hilflosigkeit.
»Was liest du denn gerade?«, erkundigte er sich zwischen zwei Schinkenhappen. Nach einer so langen Fahrt gab es keine Themen mehr.
»Was Biogenetisches«, sagte sie zu ihrer eigenen Überraschung, »etwas über Meme.«
»Meme?«, fragte Michael. Dass er so reagieren würde, hatte sie gewusst.
Um Meme ging es gar nicht in dem Buch, doch das Wort war ihr vor einigen Wochen in einer Zeitschrift begegnet und nicht mehr aus dem Kopf gegangen. »Wenn ich es richtig verstanden habe, sind Meme so etwas wie Gene, nur eben im Bereich des Mimetischen, also all dem, was bisher als eine Frage von Nachahmung und Lernen galt. Meme übertragen Mimik, Gestik, Verhaltensweisen oder auch Wissen, das heißt, falls es sie wirklich gibt …«
Sie sah ihn herausfordernd an. Michael schien ihr der lebendige Beweis zu sein für die Übertragung von Gedanken und Verhaltensweisen, er und sein Bruder. Doch die beiden waren nicht die Einzigen. Seit sie den Artikel gelesen hatte, entdeckte sie überall Meme.
Michaels Hände, um Messer und Gabel zur Faust geballt, ruhten links und rechts des Schinkenbretts. Bauernhände, dachte sie, nur ohne Schwielen.
»Ist das erwiesen?«, fragte er.
»Erwiesen? Nein. Aber mit welchem Recht gehen wir eigentlich davon aus, dass unsere Körpersprache, unsere Gesten und Gesichtsausdrücke uns ganz allein gehören? Die Wörter, mit denen wir uns verständigen, gehören uns ja auch nicht, sondern sind gewissermaßen ein Erbe und das Resultat von Übertragung.«
»Aber es ist nicht erwiesen.« Michael blieb dabei.
»Nur weil wir keine Erklärung haben für die seltsamen Wege der Gedanken- und Verhaltensübertragung, heißt das noch lange nicht, dass es das Phänomen nicht gibt«, sagte sie und fühlte sich dabei im Einklang mit dem Schluss des Artikels.
»Bist du sicher, dass es eine gute Idee ist, sich jetzt mit so etwas zu beschäftigen?« Michael legte das Besteck beiseite und rieb sich die Schläfen. »Ich meine, willst du nicht lieber mal ausruhen?«
»Ich muss wirklich was tun, glaub mir. Im Moment vergesse ich schneller, als ich lernen kann.« Sie machte eine ins Vage schweifende Handbewegung und fragte sich im selben Moment, von wem sie diese Geste wohl hatte. Welche Unterhaltung fand da zwischen ihren Körpern statt, nahezu unbeachtet und unabhängig von ihnen?
»Wenn du gerade so vergesslich bist, wie du sagst, dann ist das vielleicht auch ein Zeichen …«
»Ach, und wofür?«
»Ich will ja nur nicht, dass du dich zu sehr unter Druck setzt«, sagte Michael sanft wie immer, wenn sie einen gereizten Ton anschlug. Doch sie wusste auch um die Hartnäckigkeit dieser Sanftheit und wollte sich nicht ein weiteres Mal darüber streiten, ob dies der richtige Zeitpunkt war, ihr abgebrochenes Studium wieder aufzunehmen.
»Ich sage das wirklich nicht gern, aber …«, seine Stimme klang noch sanfter als sonst, »du wirkst ziemlich erschöpft.«
Ihr Blick landete auf den Spiegeleiern, die immer mehr nach kalter Bratpfanne rochen. Längst waren die glasig goldenen Butterfettaugen auf ihrem Teller fest und trüb geworden wie Pocken.
»Und außerdem glaube ich auch nicht, dass es gut ist für das Kind.« Michael wurde mit jedem Wort leiser, flüsterte fast.
Sie wollte etwas erwidern, Einspruch dagegen erheben, dass er schon wieder davon anfing, doch sie legte nur vorsichtig die Hände auf ihren Bauch, schob sie über die gewölbte Kugel unter sich – ob zum Schutz oder aus Verlegenheit, wusste sie selbst nicht.
»Schläft es?«, fragte Michael unhörbar, sie las nur die Bewegung seiner Lippen. Immer wenn er von dem Kind sprach, wurde er so still, als wüsste er schon im Reden, dass seine Worte sie nicht erreichten. »Sag, hast du wirklich keinen Hunger? Ist dir nicht gut?«
Drei Fragen, zählte sie. Seine Angst, ohne Antwort zu bleiben, wurde offenbar immer größer. Sie starrte weiter auf den Teller und versuchte, die Säule aus Magensäften und Säuren, die ihre Speiseröhre hochstieg, wieder hinunterzudrücken.
»Magst du die Spiegeleier nicht?« Noch eine Frage, wie konnte er so viel fragen? Sie kämpfte mit dem Würgereiz, unter dem sich ihr gesamtes Sonnengeflecht zusammenzog. »Soll ich sie für dich essen?«
Es gelang ihr zu nicken, obwohl sie schon ganz starr war vor Erbrechensangst. Michael griff nach ihrem Teller und zog ihn zu sich, natürlich ließ er nichts verkommen. Die unmittelbare Bedrohung war vorüber. Der Krampf in ihrer Magengrube löste sich ein wenig, sie bekam wieder Luft. Dass er jetzt dasaß und aß, versuchte sie zu ignorieren.
»Sei mir nicht böse, aber ich gehe schon mal nach oben«, sagte sie dann mit fester Stimme, schob ihren Stuhl zurück und schaffte es in den Stand. Michael sprang sofort auf, um ihr seinen Arm zu leihen, doch sie brachte ein Lächeln zustande und verabschiedete sich freihändig.
Einen Moment lang überlegte sie, ob sie das Buch, das sie angefangen hatte, mit nach oben nehmen sollte, und wog es in der Hand, legte es dann aber doch zurück auf den Couchtisch. Es war ein Schwedenkrimi, der sehr brutal begann.
»Schlaft gut«, rief Michael ihr nach, ihnen. Sie sagte nichts gegen den Plural.
Oben im Schlafzimmer war es noch immer klamm. Sie zog sich nur halb aus, behielt T-Shirt und Socken an. Fröstelnd schlüpfte sie unter die Decke zum kleinen Konstantin, der sich in einem Bausch aus Bettwäsche an sie schmiegte. Allmählich wärmten sich ihre Körper aneinander. Sie zog einen Arm unter der Bettdecke hervor und legte ihn schützend über das Knäuel, das sich in sie hineinkrümmte wie ein Löffel in den anderen. Ihr nackter Arm kühlte schnell aus, doch es war eine Kälte, die sie nichts mehr anging.
Am nächsten Morgen erwachte sie aus einem brunnentiefen Schlaf. Sie brauchte lange, bis sie begriff, dass Michael schon aufgestanden war und das Klappern unten in der Küche Frühstück bedeutete. Offenbar hatte er nicht neben ihr, sondern auf einer Matratze am Boden geschlafen, unter einer schlichten Wolldecke. Das Kinderzimmer-Bett war recht schmal für zwei, besonders in ihrem Zustand, doch bisher hatte es immer gereicht, und es wäre wohl noch immer Platz genug gewesen, hätte sie das zweite Federbett nicht zu einem Klumpen gewalkt und umklammert. Vermutlich hatte Michael sie nicht wecken wollen und ihr sein Bettzeug deswegen nicht entrissen, vielleicht hatte sie es sich auch nicht entreißen lassen.
Auf einmal fiel ihr der kleine Konstantin wieder ein, der sie die ganze Nacht lang beschäftigt hatte, nicht im Traum, so klar war kein Traum, es war eine Erkenntnis, die wie ein Traum begonnen hatte, um dann immer klarer zu werden und bilderlos. Plötzlich kannte sie den Grund, warum der kleine Konstantin so klein war, sie wusste es einfach, so wie man seinen eigenen Namen weiß: Er wartete. Deswegen wuchs er nicht. Er musste warten, weil er nicht der Zwilling seines großen Bruders war, sondern des Kindes, das sie in sich trug. Alles, was sie an ihm liebte, das Zarte, Scheue, Schützenswerte, liebte sie, weil sie es inwendig kannte, weil sie es wiedererkannte. In gewisser Weise – auf die gewisseste Weise – war Konstantin ihr Kind, das Ebenbild ihres Kindes, Zwilling eines Ungeborenen. Er würde erst wieder größer werden, wenn sein Bruder auf der Welt war.
In der ersten Aufregung hatte sie sofort Michael rufen wollen, um es ihm zu erzählen. Jetzt fand sie ihr Traumwissen zu kostbar und beschloss, es für sich zu behalten. Lächelnd warf sie ihren Morgenmantel über und ging hinunter in die Küche. Sie hatte Lust auf einen Becher starken schwarzen Kaffee. Doch natürlich hatte Michael den Kräutertee aufgebrüht, den sie zu Hause seit Monaten tranken, mit Rücksicht auf das Kind in ihrem Bauch.
»Gut geschlafen?«, fragte er.
Sie nickte, lächelte und schwieg.
»Ich war noch nicht Einkaufen, leider.« Er schwenkte einen Brotkorb, in dem nur Zwieback und Knäckebrot lagen. »Ich wollte nicht, dass du hier aufwachst und das Haus ist leer.«
Sie nickte noch einmal, gab Michael einen Guten-Morgen-Kuss und folgte ihm ins Wohnzimmer. Vor den Fenstern zum Tal blieb sie stehen. Der Himmel war weit und ungewöhnlich blau, gar nicht wie November. Hingebreitet über die Hügel lag ein Flickenteppich aus Wiesen, Feldern und Gehöften um das im Morgendunst schwimmende Dorf. Ihr Blick wanderte weiter, folgte Bahnen von immer kleiner werdenden Windrädern bis hin zu der Burgruine auf dem kegelförmigen, wie künstlich aufgeschütteten Berg am Horizont, den zu besteigen sich die Kinder jeden Sommer vornahmen, ohne es je zu tun.
»Schön draußen«, hörte sie sich sagen, ihre Stimme klang belegt, »und viel heller als im Sommer …« Sie deutete auf die Buchen zu beiden Seiten, deren ausgreifende Kronen sonst die Aussicht überschatteten. Jetzt hatten sie alles Laub verloren und wirkten mit ihren kahlen grauen Ästen unter dem Blau des Himmels wie entmachtet.
Michael stellte sich neben sie und legte einen Arm um ihre Schultern. »Den Hang hinunter gibt’s noch eine ganze Menge zu tun. Der Garten ist alles andere als winterfest«, sagte er mit Blick auf den von Gestrüpp überwucherten Zaun und das rostige Klettergerüst, an dem eine halb abgerissene Schaukel hing. »Hast du heute wenigstens ein bisschen Appetit?«
»Appetit?«, fragte sie wie überrascht. »Ich habe einen Riesenhunger!«
Sie setzten sich in die Essecke. Michael goss ihr Tee ein. Sie nahm sich zwei Scheiben Knäckebrot aus dem Korb und bestrich sie geduldig mit harter Butter.
»Fürs zweite Frühstück bringe ich uns frische Brötchen mit«, versprach er, »vorausgesetzt, es sind noch welche übrig. Der Bäcker hier kennt seine Kundschaft seit Generationen und backt praktisch abgezählt. Auf Fremde ist man unten im Dorf nicht eingestellt, schon gar nicht zu dieser Jahreszeit. Aber ein Graubrot oder irgendeinen Kuchenrest wird er für uns schon übrig haben. Willst du mitkommen?«
»Nein, nein, fahr du ruhig.« Die Vorstellung, sich in ihrem Zustand beim Einkaufen sehen zu lassen, behagte ihr nicht. »Ich mache so lange einen Spaziergang im Wald.«
»Im Wald?«, fragte er.
»Warum nicht im Wald?«, fragte sie.
»Ich meine ja nur …«, sagte er, ohne zu sagen, was er meinte.
Sie wandten beide die Köpfe zum Fenster längs der Essecke und schauten hinaus auf die Tannenfront, die sich bei Tageslicht weit zurückgezogen hatte und weniger dicht zusammenstand. Einzelne Laubbäume rissen Lücken. Hier und da zeigten sich Schneisen und Pfade durchs Unterholz.
»Kannst du mir einen Weg empfehlen?« Sie sah Michael ins Gesicht und wunderte sich im selben Moment, wie nah es ihr war.
»Ich glaube nicht, dass die Wege noch dieselben sind. Aber wenn ich dir einen guten Rat geben darf: Verlass dich nicht auf deinen Orientierungssinn! Sobald du zwei, drei Bäumen ausgewichen bist, verlierst du jedes Gefühl für Richtung und fängst an, im Kreis zu laufen. Wir haben früher immer Markierungen hinterlassen, Robert und ich, um dann genau denselben Weg wieder zurückzugehen.«
»Wie Hänsel und Gretel.«
Michael sah sie verständnislos an. »Nimm lieber dein Handy mit, und schalte die Ortungsfunktion ein.«
Einen Moment aßen sie wortlos, er einen mit reichlich Frischkäse bestrichenen Zwieback, sie ihr Knäckebrot. Es schmeckte gut, war aber sehr laut inmitten der Stille um sie herum.
»Hast du eigentlich was von dem Anruf mitbekommen? Robert hat heute Morgen angerufen, völlig aus dem Häuschen«, sagte Michael und nahm sich noch einen Zwieback. »Ines hatte gestern plötzlich so starke Wehen, dass sie die Zwillinge schnell zu Freunden gebracht haben und sofort ins Krankenhaus gefahren sind – zehn Tage vor dem Termin!«
»Geht es ihr gut?«, fragte sie wie erstarrt.
»Um kurz nach sieben waren sie im Kreißsaal, und kurz nach der Tagesschau war das Kind schon auf der Welt, gewaschen und gewickelt, Originalton Robert. Beide, Mutter und Kind, sind wohlauf.«