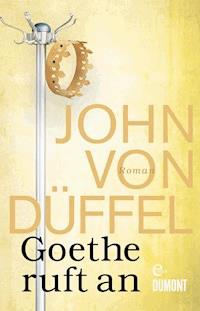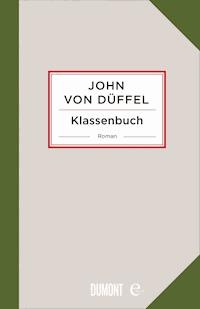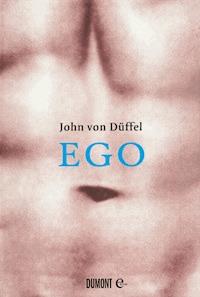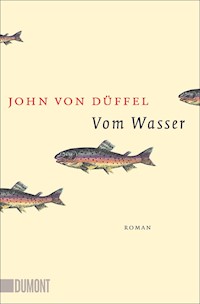
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ausgezeichnet mit dem aspekte Literaturpreis Die dramatische Geschichte einer Papierfabrikantendynastie – erzählt uns von einem, der wie magisch angezogen immer wieder zum Wasser zurückkehrt. Vor unseren Augen läßt dieser Mann die Porträts seiner Ahnengalerie auferstehen. Er erinnert sich an die sommerlichen Szenen seiner Kindheit und stellt sich vor, wie es gewesen sein könnte: Damals, als im letzten Jahrhundert der Ururgroßvater auf seinem Landgut zwischen den Flüssen Orpe und Diemel entdeckte, wie sich Wasser in Papier und Papier in Geld verwandeln läßt; damals, als der Sohn des barocken Firmengründers die Fabrik mit seinem nüchternen Zahlenverstand durch den ersten Krieg rechnete und rettete; damals, als die traditionsreiche Geschichte der erstgeborenen Fabrikherren mit dem nächsten Krieg und einem den Musen zugewandten Direktor zu Ende zu gehen drohte. Damals, als eine Frau die vorläufige Rettung brachte. John von Düffel, erfolgreicher Theaterautor und Dramaturg, erzählt in seinem ersten Roman Vom Wasser mit rhapsodischer Kraft: Das Wasser ist der Stoff, der diese deutsche Fabrikantengeschichte zusammenhält - das Wasser gleicht der rhythmisch erzählenden Prosa des John von Düffel, der sich dem schillernden Strom der Träume, Erinnerungen und Gedanken so hingibt, daß wir Leser uns seinem mächtigen Sog anvertrauen. Und vielleicht werden auch wir mit dem Erzähler, diesem Günstling des Wassers, »am Ende dieses Buches an einem Fluß sitzen, auf das Wasser schauen und es verstehen«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
JOHN VON DÜFFEL
Vom Wasser
Roman
eBook 2014
© 1998 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Ausstattung und Umschlag: Groothuis+Malsy, Bremen
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook: 978-3-8321-8796-5
www.dumont-buchverlag.de
Sie hatten sich schon Lebwohl gesagt, als sie ihn fragte, und wo willst du jetzt hin? Ans Wasser. Ans Wasser? Wir kehren immer zum Wasser zurück, habe er gesagt. Und das erzählte sie mir wie eine Anekdote, in einem Ton der Belustigung, vielleicht noch reichlich böse über Vorgefallenes zwischen ihr und ihm, von dem ich nichts wußte und nichts weiß. Und ich erinnere mich noch genau, wie ich versuchte, darüber den Kopf zu schütteln und belustigt zu tun um ihretwillen. Aber ich hörte diesen Satz aus ihrem Mund und wußte im selben Augenblick, daß er mich nicht mehr loslassen wird.
Ich bin kein besonders gläubiger Mensch. Für große Welterklärungen konnte ich mich nie begeistern. Leute, die mich mit Inbrunst von etwas überzeugen wollen, waren mir immer fremd. Ich habe mir nicht einmal die Mühe gemacht, ein anständiger Atheist zu sein. Im Gegenteil. Ich bin allen Diskussionen aus dem Weg gegangen, weil ich immer der Meinung war und es auch heute noch bin, daß man sich die sogenannte sichtbare Welt erst einmal genauer anschauen sollte, bevor man über Metaphysik argumentiert. Und in einem gewissen Sinne war es genau das, was dieser Satz sagte. Er sprach nicht von der Macht eines Gottes oder dem Wirken unsichtbarer Gewalten. Er sprach von der Macht des Wassers. Und diese Macht ist eine sehr wahrnehmbare, wirkliche Macht, wie ich heute weiß.
Dieses Buch ist ein Versuch, das zu verstehen. Es ist das Buch von einem, der immer zum Wasser zurückkehrt, und der Versuch, das zu verstehen. Ich werde im Laufe dieses Buches, beim Schreiben dieses Buches viele Tage und Nächte an Flüssen verbringen und auf das Wasser schauen. Ich werde mich vieler Tage und Nächte erinnern, die ich am Wasser verbracht habe. Und vielleicht werde ich am Ende dieses Buches an einem Fluß sitzen, auf das Wasser schauen und es verstehen.
Der Geruch des Wassers
Man kann es riechen. Im allgemeinen gilt Wasser als geruchlos. Aber man kann es riechen. Ich kann mich an den Geruch verschiedener Flüsse und Meere erinnern. Und auch wenn es nicht das Wasser selbst ist, das so riecht, sondern nur die Verbindung von Wasser mit etwas anderem, so ist doch das Schöne an diesen Gerüchen, an die ich mich erinnere, daß es Gerüche des Wassers sind. Ich erinnere mich, wie es nach fließendem, strömendem, lebendigem Wasser riecht. Genauso wie es umgekehrt totes Wasser ist, das stinkt.
Es gibt eine besondere Verbindung von Wasser und Geruch. Wenn nach einer langen Zeit der Trockenheit zum ersten Mal wieder Regen fällt und wir hinaus auf die Straße treten, dann wirkt die Luft nicht nur frischer und wie gereinigt. Sie ist voll von Gerüchen. Der auf dem Asphalt verdampfende Regen, die getränkte Erde, das Gras, das Laub, alles fängt nach diesem Wasserguß wieder an zu riechen. Und ein großer Teil der Klarheit und der Frische, die wir nach einem solchen Guß empfinden, rührt daher, daß uns das Wasser die Dimension des Geruchs zurückgegeben hat. Wir nehmen alles stärker, kräftiger, schärfer wahr, nicht nur weil die Farben satter, die Kontraste nicht mehr so blaß sind, sondern auch, weil wir die Dinge wieder riechen. Das Wasser hat uns von unserer Geruchsblindheit befreit. Und wir nehmen die Welt wieder mit allen fünf Sinnen wahr.
Und ich rieche das Wasser selbst: grünes, wildes Wasser, das in einem breiten Strom wirbelnd dahinfließt. Noch bevor ich mich setze und schaue, noch bevor ich das Wasser gesehen habe, rieche ich diese kühle Frische, diesen Atem des Wassers in der frühlingshaften Luft, rieche, wie das Aufschwappen der Wellen an den Rändern des Flußbettes die Steine dazu bringt, ihren gewölbe-ähnlichen Geruch auszuströmen, benetzt von Wasser, beschienen von einer blassen Frühjahrssonne. Und dann sehe ich, wie das Wasser mit leichtem Wellenschlag den Steinen in alle Poren kriecht und ihnen ihre volle Färbung wiedergibt und ihren eigenen Geruch, den Atem des Wassers und der Steine. Und ich setze mich ans Ufer und schaue aufs Wasser, das frühjahrsgrün dahinfließt, mit unzähligen knospenartigen kleinen Strudeln, die ineinander spielen, aufquellen und sich trollen, im März, kurz vor Basel, am Rhein.
Und ich muß daran denken, was sie mir erzählte von dem Mann – einem Maler –, den sie verlassen hatte, meinetwegen, wie sie sagte, damals, in einer ganz anderen Stadt, an völlig anderen Flüssen. Er war mir mit diesem Satz – von dem ich nur hörte, daß er ihn gesagt haben soll – nähergerückt, nähergekommen, als sie es jemals sein sollte. Ich wußte, ich würde eines Tages ans Wasser zurückkehren. Und ich wußte, durch die Art, wie sie es mir erzählte, belustigt und ein wenig boshaft, daß sie nicht dabeisein würde.
Der Geruch des Wassers. Die Häuser meiner Kindheit waren erfüllt von dem Geruch des Wassers, von ganz unterschiedlichen Wassern, Flüssen, Seen, Meeren. Ich erinnere mich an die beinahe nebelhafte Kühle und den Moosgeruch der Orpe, dieses Flusses, der unmittelbar an unsern Garten grenzte und der uns Kinder bereits anatmete, wenn wir noch halb verschlafen im Sommer auf der Frühstücksterrasse saßen. Er hauchte uns so etwas wie süße Grabesluft zu, und so sehr uns auch die Mütter und Großmütter warnten, wir wußten, daß dieser Tag wieder dem Fluß gehören würde. Der schwarzen Orpe, die seltsam lichtlos und dunkel zwischen moosigen und verwitterten Steinen dahinfloß.
Zwischen zwei Flüssen, zwischen Orpe und Diemel, hatte ein geschäftstüchtiger Ururgroßvater von mir ein Landgut erworben, das sich »Die Mißgunst« nannte. Er störte sich damals an diesem Namen nicht. Er sah nur die Kraft und den Nutzen des Wassers, des vielen Wassers, das dieses Land umfloß. Dieses Wasser, sah er, war Geld. Und er errichtete auf der Mißgunst eine Papierfabrik, betrieben, gespeist und gereinigt vom Wasser. Es war das schwarze Wasser der Orpe, das in diese Fabrik hineinfloß und dort seinen unterirdischen Lauf nahm, hier und da aufschäumte in Kesseln, in Wehren gestaut und gestürzt wurde und dann in Tunnelsystemen wieder verschwand, als Wasserdampf aufschrie und schließlich still, schwarz und unergründlich unter einer bemoosten, verwitterten Brücke davonfloß, mit einem leicht süßlichen Geruch, der in meiner Erinnerung ein Grabesgeruch ist, aber sicherlich herrührte von der Stärke und dem Leim, mit dem in der Fabrik Papier gefertigt wurde.
Für uns Kinder, oder vielleicht auch nur für mich, war unbegreiflich, wie aus diesem schwarzen Wasser weißes Papier werden konnte. Papier, das überall in unserm Haushalt vorkam. Papier, auf dem Einkaufszettel geschrieben wurden, leuchtend weißes Papier, auf dem wir malten, und wenn wir ein Buch aufschlugen, um es vorgelesen zu bekommen, dann war es dasselbe weiße Papier, das uns anschaute, weiß und vielleicht sogar weißer denn je, um die schwarzen Buchstaben darauf so deutlich wie möglich zum Erscheinen zu bringen. Und dieses weiße Papier war aus schwarzem Wasser gemacht. Ich verstand es nicht. Aber mein Ururgroßvater hatte es verstanden. Und er hatte die Ströme des schwarzen Wassers in Papier und das Papier in Geld verwandelt.
Die großen Sandsteinquader der Terrasse waren selbst im Sommer nicht warm. Es war ein finsterer Sandstein, ohne die sonst so charakteristische Helligkeit. Die Grundfarbe dieses Sandsteins muß ein lehmiges, glanzloses Grau gewesen sein. Aber unter dem Einfluß der Witterung färbte der Stein sich schwarz wie Rauch oder Ruß und nahm keine Wärme mehr an. Er verschloß sich. Er verschloß seine Poren und hütete sein kühles Herz, während seine Außenhaut immer finsterer wurde und sich graugrüne Moosflechten auf ihr ausbreiteten. Er stellte sich tot. Und diese Todeskühle spürten wir unter unsern nackten Kinderfüßen auf der Frühstücksterrasse im Sommer, mit Blick auf den Garten, den Brunnen, den Fluß. Und unsere Füße vollführten kleine unruhige Choreographien unter dem Tisch, denn allzu lange konnte man den Fuß nicht aufsetzen auf diesem eisigen Stein, dessen Kälte wir mit unsern unruhigen Meinen Füßen einfach wegtanzten, um dann vom Tisch aufzuspringen und hinunter zum Garten zu laufen, zum Brunnen und weiter zum Fluß.
Auf der anderen Seite der Mißgunst floß die Diemel. Sie floß, vor unsern Kinderaugen verborgen, hinter Papierschnitzelballen und Arbeiterbaracken und einem vielleicht meterhohen Deich. Aber die Diemel war dennoch da. Sie war der geräuschvollere Fluß. Während die schwarze Orpe still und lautlos wie ein unbelichteter Film vor unsern Augen die hohlwegartigen Ufer entlangglitt, war die Diemel durch ihre Geräusche da. Sie war ein ständiges Plätschern, Sprudeln und Rauschen, von der heiteren Unruhe eines Wasserspiels. Silbrig und hell floß sie, in Terrassen gestuft, wie auf Treppen herab. Alle zwanzig, dreißig Meter waren kleine Steinwälle aufgehäuft, Hürden, die das Wasser plätschernd nahm und die den Fluß in eine Reihe von Becken unterteilten. Es war ein freigelegtes, offenes, sehr geordnetes Fließen, beinahe ein Schrebergarten aus Wasser, aus dem jedoch die Lebendigkeit des Wassers tönte, gluckste, plätscherte und sich mit dem Rauschen der hohen Pappeln verband, die am Ufer standen, ebenfalls in strenger Ordnung, gepflanzt in Reih und Glied, wo sie mit ihren silbrig grünen Blättern im Wind raschelten. Und ich erinnere mich an den Geruch der Diemel, der herüberwehte an Tagen, an denen der Wind seine Richtung wechselte und wir nicht im Garten, wie erlaubt, sondern verbotenermaßen in den Papierballen spielten oder auf den Uferweiden am Diemeldeich. Dieser Geruch war silbriges Wasser und Pappellaub, ein kühler und doch seltsam tauber Geruch, der einen Nachgeschmack hinterließ auf der Zunge, einen stumpfen Nachgeschmack, der im Widerspruch stand zur Frische von Wind und Wasser.
Die Diemel war, mit einem Wort, geheuer. Ein gezähmter, domestizierter Flußlauf. Und die einzelnen Diemelbecken waren wie kleine Seen, hatten Anfang und Ende, boten eine gewisse Sicherheit, waren nicht dieses beunruhigende Fließen und Fluten, Treiben und Immer-weiter-Treiben, der Sog und die Unwiderruflichkeit eines wild dahinströmenden Flusses, in dem, wer hineinfiel, verloren war. Wir Kinder spielten an der Diemel, in der Diemel, im Sommer, wenn sich das aufgestaute Wasser in der Sonne erwärmte und immer wieder durchmischt wurde von dem kühlenden Fluß, der die Wasserschichten verwirrte, warmes, stehendes Wasser an die Oberfläche quellen ließ und kühles, frisches Wasser untermischte. Es war ein Fluß ohne Untiefen und Gefahr, der immer wieder Halt bot, ein Fluß, dessen Grund man immer sehen konnte und der so silbergrau vor sich hinrauschte und raschelte wie die Pappelreihen an seinem Ufer.
Es ist wahr, daß die Farbe des Himmels, die Helligkeit und der Schein des Lichts dem Wasser sein Gesicht geben, genauso wie sich durch den Zug einer Wolke das Gesicht des Wassers völlig verändern kann, helles, freundliches Wasser plötzlich ergraut, versteinert oder umgekehrt dunkles, drohendes Wasser durch die Berührung eines Sonnenstrahls unvermittelt auflacht, glitzert und glänzt. Und dennoch flossen Orpe und Diemel unter ein und demselben Himmel dahin, zwei Flüsse mit entgegengesetzten Gesichtern, zwei Flüsse mit entgegengesetzten Gerüchen, keine dreihundert Meter voneinander entfernt und zwischen ihnen die Mißgunst und die Sommer unserer Kindheit.
Unmöglich zu sagen, wie oft ich an diese Flüsse gedacht, wie oft ich von ihnen geträumt habe, wie viele Nächte es mich hingezogen hat zu ihnen, wenn ich durch schlafende Städte zog, trockene, flußlose Städte, auf der Suche nach dem Wasser, auf der Suche nach der Bewegung des Wassers, und oft bis in die Morgenstunden an irgendeinem Teich saß oder einem veralgten Stadtgraben, dessen Wasser nicht floß, sondern nur die eine Richtung kannte, die des Sterbens, des Versickerns und Versiegens, Wasser, das sich in der Erde selbst begrub. Und es ist mir leicht, dies zu sagen, jetzt, wo der breite Strom des Rheins das Land vor mir teilt und öffnet und eine glatte Bahn in die Ferne zieht.
In der Diemel, dem gezähmten, terrassenartigen Flußlauf an einem Ende der Mißgunst, hatten wir schwimmen gelernt. Dort hatten wir zum ersten Mal beide Arme geradeaus von uns gestreckt und dann geteilt und unsere nackte Brust dem Wasser dargeboten, im Vertrauen, es würde nicht mit kalter Hand nach unsern Kinderherzen fassen, sondern uns hell und freundlich umspielen, uns tragen und nicht in die Tiefe reißen. Unter der silbergrauen Oberfläche schimmerte unsere Haut vor uns weiß im klaren Wasser. Kleine Wellen und Strudel begleiteten unsere Arme, wenn wir sie teilten und wieder zusammenführten. Sie waren Spielgefährten, die uns glucksend und plätschernd aufmunterten, weiterzumachen, nicht aufzuhören, noch weiter hinauszuschwimmen. Sie, diese kleinen Quirle und Wellenzüge, verhießen uns die Beherrschbarkeit des Wassers, zeigten uns und unsern rudernden Armen, wie leicht es war, dem Wasser die Gestalt unseres Willens zu geben. Es brauchte nur eine Armbewegung, um eine spiegelglatte Oberfläche zu kräuseln und mit auseinanderdriftenden Wasserringen zu überziehen, es brauchte nur ein paar kräftige Züge, und wir schoben kleine Bugwellen vor uns her, die sich hinter uns schlossen wie Umhänge aus Wasser, wie ein unsere kleinen Körper einhüllender Stoff. Es war eine übermütige Ahnung unserer Macht über die Macht des Wassers, doch es war eine Ahnung, die das Wasser selbst uns gewährte, es war eine Gunst des Wassers, seine Großzügigkeit, daß es unsern kleinen Körpern gestattete, Könige zu sein, die spritzend, platschend und prustend über das Wasser herrschten, während unter unsern strampelnden und paddelnden kleinen Füßen der sanfte Strom des Wassers gleichmütig und unaufhaltsam seiner eigenen Richtung folgte.
Und es war die Diemel, dieser glasklare, pappelduftende Fluß, der unsern Füßen immer Halt bot auf dem steinigen, deutlichen Untergrund, wenn sie ermüdeten oder unsicher wurden oder wenn uns plötzlich eine leise Unruhe befiel, die Angst und Ahnung, daß das Wasser seinen eigenen unergründlichen Willen hatte. Manchmal verschluckten wir uns und spürten für einen Augenblick die Möglichkeit des Ertrinkens in der Lunge, die Härte und Erbarmungslosigkeit des Wassers, wenn es sich auf den Atem legt und auf einmal nach Blut schmeckt, metallisch und gar nicht wie die stumpfe Süße der Pappeln. Manchmal trat der Beinschlag eines anderen Schwimmers, der uns zu nahe gekommen war, einen Wirbel los, der wie ein ungesehenes und unfaßbares Lebewesen über unsere Haut glitt, uns anstieß wie ein Fisch und sich wedelnd wieder ins Nichts auflöste. Dann packte uns ein kurzer Schrecken über das Unsichtbare selbst in dem klarsten Wasser, über die wimmelnden, schattenhaften Geheimnisse, die jedes Wasser unter seiner Oberfläche verbarg. Ein Begriff von Tiefe tat sich auf, bodenlos wie ein Fjord, der ganze Erdspalten füllt und nach ein, zwei Metern knietiefem Uferwasser siebenhundert oder neunhundert Meter in die Endlosigkeit reicht. Aber die Diemel war da und hielt ihren steinigen Grund für uns bereit, den wir nach einigen kurzen, ängstlichen Stramplern stets zu fassen kriegten, Grund, Land, Festigkeit, wo sich die Zehen einkrallen konnten zwischen den glattgeschliffenen Steinen und wir zum Stehen kamen, das Wasser bis zur Brust, ohne ums Überleben rudern und strampeln zu müssen. Und die dunkle, plötzliche Todesangst unter dem Wasser verschwand so schnell und flüchtig, wie sie gekommen war.
Seltsam ist nur, daß meine Angst vor dem Wasser wuchs, je besser ich schwimmen konnte. Je mehr unterschiedliche Schwimmstile ich erlernte, je sicherer und vielleicht sogar eleganter ich sie beherrschte, desto größer wurde meine Angst. Ich bin in zahllosen Staffeln geschwommen, habe viele Jahre hart die verschiedensten Disziplinen trainiert, mich schließlich auf Marathonstrecken im Freistil spezialisiert und regelmäßig halbe Tage im Wasser verbracht, so lange, bis der klatschende Rhythmus des Schlagarms, das Einholen und Hinausstöhnen der Luft über und unter Wasser und der Viervierteltakt des Beinschlags zu einer unaufhörlichen monotonen Begleitmusik meines Lebens wurden, auch an Land, wo mir dieser Rhythmus in den Ohren pulste wie ein zweiter übergeordneter Herzschlag, der Herzschlag eines umfassenderen Organismus aus Wasser und Körper und Kraft.
Aber die Angst wurde größer, von Mal zu Mal. Die Angst, während der letzten Schritte zum Beckenrand, die Angst beim ersten Blick aufs Wasser, in dem sich die Tribüne spiegelte mit den Zuschauerreihen, die einen Wettkampf der Schwimmer sehen wollten, wo wir doch wußten, die wir neben den Startblöcken noch einmal Wasser schöpften und es uns ins Gesicht rieben, daß es ein Wettkampf, ein Überlebenskampf ganz allein gegen das Wasser werden würde, für jeden einzelnen von uns. Wir wußten, daß das erste Eintauchen ins Wasser der Sprung in eine große Einsamkeit sein würde, daß es nichts und niemanden gab, der uns auf den bevorstehenden Kilometern beistehen konnte. Die ersten vierhundert, fünfhundert Meter vielleicht schweifte der Blick auf die benachbarte Bahn und den das Wasser dreschenden Konkurrenten, doch dann schwammen wir blind, Kopf unter Wasser. Es gab nur noch das Einschlagen der Arme, das Rattern des Beinschlags und nichts als Wasser, Entfernung und Atem. Wir wurden Teil jenes übergeordneten Organismus, dessen genaue Pulsfrequenz man erreichen mußte. Nur wer den regelmäßigen Pulsschlag dieses Elements exakt traf, hielt und darin aufging, den nahm das Wasser auf wie einen Teil seiner selbst. Wer aber zu langsam war oder zu schnell, wer durch einen falschen Schlag oder überhastetes Atmen jenseits des Pulses geriet, den ließ das Wasser nicht durch, gegen den verhärtete es sich, sperrte es sich, wurde wie eine Wand aus Wasser, gegen die man vergeblich ankraulte, mal zu schnell, mal zu langsam, wütend, verzweifelt, verloren in der Ungnade des Wassers, das einen auf der Stelle kraulen ließ, das einen bannte in Undurchdringlichkeit.
Mein Alptraum vom Wasser war der, daß es mich nicht aufnehmen möge in seine Gnade, daß es hart und erbarmungslos gegen mich sein könne, daß es mich zu einem Fremden machen würde in diesem Element. Und jedesmal, während wir die letzten Meter zum Beckenrand zurücklegten und uns das Herz bis zum Hals schlug, jedesmal von neuem lag das Wasser vor uns, glatt und unbewegt, ohne ein Zeichen seiner Gunst oder Ungnade, als hätten wir nicht schon unzählige Stunden in diesem Wasser zugebracht, als seien wir nicht vor weniger als einem Tag noch eins gewesen mit ihm, getragen wie auf einer Hand aus Wasser und beflügelt von seinem rhythmischen Rauschen, seiner schnellen Geschmeidigkeit. Aber nein, jedesmal von neuem war diese Kluft zu überwinden zwischen den Elementen, zwischen der Festigkeit und Verläßlichkeit des Fliesenbodens, auf den unsere nackten Füße klatschten, der Festigkeit und Verläßlichkeit des Betons oder Stahls der Startblöcke und der Unwägbarkeit des Wassers, das zu weich öder zu hart gegen uns sein könnte, jedesmal von neuem.
Vielleicht wächst diese Angst von Tag zu Tag, weil mich das Wasser noch nie fallen gelassen hat, weil ich bisher immer ein Günstling des Wassers gewesen bin, das mich aufnahm und auf seinem gewaltigen Rücken trug. Es wächst die Angst, daß es mir diese Gunst heute verwehren könnte, gerade heute, bei diesem Wettkampf, bei dieser Entfernung, mitten in der jetzt vor mir liegenden Wüste aus Wasser.
Ich bin noch nie in die Ungnade des Wassers geraten. Aber es ist der Charakter des Wassers, mich die Möglichkeit dieser Ungnade immer spüren zu lassen. Und gelegentlich läßt es Andeutungen seiner Willkür Wirklichkeit werden. Gelegentlich verändert es seine Beschaffenheit, und wie in einem plötzlichen Wechsel von Salzwasser zu Süßwasser zieht es für einen Augenblick die Hand weg, auf der es dich getragen hat, läßt dich die Schwere deines Körpers spüren und zieht wie mit Bleigewichten an allen deinen Gliedern. Alles droht zu sinken, sogar dein Kopf, vor dem die Arme noch wütend das Wasser schlagen, sogar er droht zu sinken, das Wenden und Luftholen zu vergessen und einfach auf die Brust zu nicken, schwer von Schlaf und Tod. Und dann bleibt es doch nur bei dieser Möglichkeit. Und der dunkle Sog in die Tiefe läßt wieder nach und gibt den schon von Todesträumen umnebelten, schon niedergesunkenen Kopf wieder frei, der ruckartig zur Seite geworfen wird und nach Luft schreit, einen Geburtsschrei nach Luft, und die Bleigewichte fallen ab von den Gliedern. Wie von einem warmen Strom Salzwasser, wie von einer warmen gütigen Hand getragen, werden die nächsten Meter unendlich leicht. Geschmeidig zieht das Wasser in Strudeln und Wirbeln vorbei, und es ist seinem Günstling freundlich und gut.
Und während unsere gebückten Körper wie gefiederlose Krähen auf den Startblöcken hocken, geduckt in der Spannung vor dem Pfiff oder Startschuß, während unsere Augen auf die Bahnen vor uns gerichtet sind und die Anzahl der Schläge abmessen bis zu Anschlag und Wende, während dieser kurze, abrupte Moment der Ruhe einkehrt und die Zeit stockt und stillsteht, währenddessen zieht ein Rausch der Angst durch die Köpfe, eine Illusion von Flucht, die Illusion des Aufgebens, des Abbrechens und der Erlösung von dieser Spannung, des Aufstehens und Heruntersteigens vom Startblock: das Handtuch über die Schultern legen und einfach hinausgehen, vor den Augen der verdutzten Zuschauer und der spöttischen, weil neidischen Schwimmer, die nur zu gern dasselbe getan hätten in genau demselben Augenblick, aber nicht den Mut aufbrachten zur Feigheit.
Aber sie ist eine Illusion, diese Flucht. Denn der Sog des Wassers, seine unnachgiebige Anziehungskraft bannt uns auf die Plätze. Es gibt kein Zurück mehr. Es gibt nur die Flucht nach vorn, die Flucht vor der Angst in die Angst, der Sprung, die Überwindung und das Eintauchen in das andere Element und die Hoffnung, es möge uns gut sein und eins werden mit unseren Bewegungen und uns nicht abweisen, fremd und unverwandt, die Hoffnung, es möge uns aufnehmen, nicht verstoßen.
Und dann das Eintauchen, der möglichst flache, langgestreckte Kopfsprung und das Eintauchen ins Naß, die ersten Meter unter einer dünnen Schicht von Wasser, das sich noch gar nicht anfühlt wie Wasser, sondern trocken wirkt im Moment des Aufpralls und danach wie ein leichter Nesselbrand über die Haut gleitet. Jetzt die nach vorne gereckten und gestreckten Arme durchziehen, die erste wirkliche Bewegung im Fluß des Wassers, das die Arme mit aller Macht an sich heranzuholen versuchen wie ein rettendes Stück Land, wie bei einem Klimmzug den Körper nachziehend, während die Beine mit den spannabwärts gestreckten Zehen in der Linie des Stromes den Auftakt schlagen, einen anschwellenden Trommelwirbel, einen Tusch, und die Arme schieben mit schaufelnden Händen ganze Wasserbrocken beiseite und stoßen sich wieder davon ab, um nach neuen Wasserbrocken zu greifen, und sie räumen die Bahn frei, während Brust und Becken ihre Balance im Wasser suchen und das Wasser sie umschließt und sich eine letzte Hoffnung in der Wut und Angriffslust der Schläge entlädt, die Hoffnung, das Wasser möge nicht mit kalter Hand nach unsern Herzen fassen, vor die sich jetzt keine schützenden Arme mehr breiten, unsere Herzen, die das Wasser jetzt so todesnah umspült, unsere preisgegebenen Herzen – möge das Wasser sie sanft einhüllen und wiegen auf unserer Bahn.
Damals, beim Bad in der Diemel, wußte ich noch nichts von dieser Angst. Prustend, platschend und lachend, tauchten wir aus dem Wasser auf und kletterten auf die Findlinge an der Uferböschung, wo wir uns in der Sonne trocknen ließen. Flossengroße Wasserflecken auf den sonnenbleichen Steinen führten zu unsern Lieblingsplätzen, wo wir die Beine von uns streckten und mit aufgestützten Ellbogen in die Sonne blinzelten. Und die Steine, von unsern Wasserspuren naß, fingen an, ihren Geruch auszuströmen, diesen leicht brackigen Geruch von trocknendem Wasser in den Poren alter Steine, auf denen wechselnde Wasserspiegel Ränder von graugewordenen Algen hinterlassen hatten. Und vielleicht waren es diese ausgetrockneten, beinahe steingewordenen Algen, die so rochen nach brackigem Wasser und salzig-süßer See und die krümelnd und körnig wie Mohn an unserer Haut hafteten, wenn wir uns in der Sonne wendeten. Noch in der Nacht roch unsere sonnengetrocknete Haut nach Wasser und Steinalgen, noch Stunden später, wenn wir uns die Lippen leckten beim Abendbrot, schmeckten wir den pappelstumpfen, süßlich-salzigen Wassergeschmack auf der Haut. Und unsere kurzärmeligen Hemden, die wir am nächsten Morgen wieder überstreiften, waren noch voll von diesem Geruch, so wie der neue, anbrechende Tag es sein würde.
Wassereinwohner
In den Geschichten der Mütter und Großmütter, in ihren Warnungen war das Wasser bewohnt. Und während wir auf der Frühstücksterrasse saßen im Sommer und die schwarze Orpe lautlos vor uns dahinglitt und unsere noch traumverwirrten Gedanken mit sich zog, und während unsere Wünsche zum Wasser hin immer stärker wurden, erzählten die Mütter und Großmütter ihre warnenden Geschichten über die Einwohner des Wassers, und wir schauten ihren Worten nach, mit großen geweiteten Augen, über die Tellerränder hinunter zum Garten, zum Brunnen, zum Fluß.
In der Orpe wohnte der Harkemann. Er verbarg sich in der Schwäne des Wassers. An den baumbestandenen, laubverhangenen Stellen schlief er in der Tiefe. Sein langer Bart reichte bis auf den Grund, seine Arme erstreckten sich über den Flußlauf, und noch weiter reichte seine Harke, mit der er, wenn jemand seine Ruhe störte, den Störenfried vom Ufer weg ins Wasser riß und zu sich in die Tiefe zog. Moos, Algen und Tang bedeckten den Harkemann am ganzen Körper, und schlammige schwarze Wasserpflanzen verfingen sich in seinem Bart. Und sein bemooster, grauschwarzer Rücken warf lange Schatten auf den Grund des Flusses. Weil der Harkemann dort hauste, war die Orpe so schwarz.
Keine der Mütter und Großmütter hatte den Harkemann wirklich gesehen, denn wer ihn sah, den tötete der Harkemann auf der Stelle, tötete ihn vielleicht sogar mit seinem Blick und holte ihn dann mit der Harke heim. Meinen Ururgroßvater, den Firmengründer, den Mann, der das Wasser zu Papier und das Papier zu Geld zu machen wußte, den hatte der Harkemann geholt. Er, der den Strom der Orpe für seine Kessel und Maschinen abgezweigt hatte und mit dem schwarzen Orpewasser Papierbrei kochte, er, dessen Räder und Walzen das Wasser aus Papier und Pappe preßten, er, der mit seinem Werk die Ruhe des Harkemanns gestört hatte, er wurde dessen berühmtestes Opfer.
Hin und wieder saß ich in dem holzgetäfelten Büro meines Großvaters, ein gewaltiger, bulliger Mann mit ganz und gar kahlem Schädel, und schaute auf das Ölporträt des Firmengründers, meines Ururgroßvaters, dessen lockiger weißer Bart ihm vor die Brust hing, dessen Wangen von vielen kleinen roten Äderchen durchzogen waren und dessen Augen hell und lustig dreinschauten, die Augen eines Mannes, der das Leben liebte und sein Werk und das Geld.
Aber mein Ururgroßvater hatte die Ruhe des Harkemanns gestört, und das belegte sein Leben mit einem Fluch. Er hatte auf der Mißgunst sein Werk errichtet und war mit Wehren und Pumpen und Wasserrädern in die Kreise des Harkemanns eingedrungen. Und er hatte Erfolg. Den Zweifeln der Alten und dem Neid der Jungen zum Trotz hatte er Erfolg mit seiner kleinen Fabrik auf der Mißgunst, die zunächst aus nicht mehr als einigen Schuppen und Maschinen bestanden hatte, die aber wuchs und sich ausweitete, die bald nicht mehr nur für den Tag gebaut war, sondern für ganze Generationen seiner Familie, die nun auf der Mißgunst herrschte und das halbe angrenzende Dorf für sich arbeiten ließ.
Und irgendwann, als der Erfolg so gefestigt war, daß er wie für die Ewigkeit gemacht schien, irgendwann hatte mein Ururgroßvater einen Künstler kommen lassen, einen Porträtmaler, und er hatte sich aufgepflanzt auf eine Bank und mitten in seinem erfolgreichen Leben stillgehalten, während ihm sein lustiges Blut durch die Wangen pulste und sich die Locken seines Bartes kräuselten auf seiner Brust. Er hatte stillgehalten und dem Maler Modell gesessen für die Generationen, die da kommen sollten, er, der Ahn, der erste in der Galerie, der Begründer und Anfang von allem.
Ich versuche mir vorzustellen, wie es war, als der Harkemann ihn zu sich holte, diesen lebenslustigen Mann mit den leuchtenden Augen. Es war mitten in der Nacht gewesen, erzählten die Mütter und Großmütter, es war mitten in einer schwarzen, verhangenen Nacht, sagten sie. Mein Ururgroßvater hatte ein Geschäftsessen außerhalb, bei einem benachbarten Fabrikanten, es war spät geworden, und wenn ich in die Augen meines Ururgroßvaters schaue, in diese hellen, lustigen Augen, dann hatte wohl die eine oder andere Flasche guten Weines nicht gefehlt. Und schließlich hatte man sich doch noch losgerissen, mit Rücksicht auf den nächsten Tag und den klammen Kutscher, der draußen vor der Tür wartete, vom Schlaf gebeugt auf seinem Bock, denn schon vor Stunden hatte man anspannen lassen und dann doch noch eine Geschichte zum besten geben müssen und darauf noch ein Gläschen getrunken. Es war eine ausufernde Herrennacht, eine Nacht der Nimmerwiederkehr, und das Lachen der beiden stattlichen Männer drang durch die hell erleuchteten Fenster bis auf den Hof hinaus zu dem windschiefen Kutscher auf seinem Bock, der sich in Schlaf und Kälte krümmte, den Oberkörper mit vor der Brust verschränkten Armen auf die schlotternden Knie gestützt. Und schließlich stand der laute, lachende Mann, der mein Ururgroßvater war, doch noch im Schein des Portals auf dem Hof und verabschiedete sich herzlich und rief dem Kutscher etwas zu, wie man dem Kutscher eben etwas zuruft, obwohl sie beide wußten, wohin es geht, doch wie um zu zeigen, wer hier befiehlt und daß es gar keinen Zweifel gibt, wer das Wort hat.
Und, so erzählten die Mütter und Großmütter, sie hatten schon bis auf fünfhundert Meter die Mißgunst erreicht, mein lustiger Ururgroßvater in der Kutsche und sein übermüdeter Kutscher auf dem Bock, als er ihm befahl, wie man einem Kutscher eben so befiehlt, Halt zu machen, denn er wolle noch einmal aussteigen, mitten in der Nacht, in dieser schwarzen, verhangenen Nacht, fünfhundert Meter vor der Mißgunst, an der Gabelung der Orpe, dort, wo sie einen kleinen Bach abzweigt und der breitere Flußlauf sich verengt und schneller fließt, die Windungen des hohlwegartigen Ufers entlang, durch die Gläserne Brücke hinunter bis zu den Wehren und Walzen der Fabrik.
Und etwas verschämt deuteten sie an, die Mütter und Großmütter, daß er wohl sein Bedürfnis zu verrichten gehabt habe, mein lustiger Ururgroßvater, daß er wohl hinabgestiegen sei vom Trittbrett der Kutsche und hinunter zum Ufer der Orpe, die schwarz, schnell und schweigsam vor sich hinglitt in dieser Nacht. Und ich stelle mir vor, wie mein Ururgroßvater, der Firmengründer, dessen Werk ihm den Haß des Harkemanns eingehandelt hatte, wie er dasteht am schwarzen Wasser der Orpe und in der verhangenen Nacht nach dem Mond Ausschau hält, nichtsahnend, und vielleicht ein Liedchen pfeift zum Plätschern des Wassers vor seinen Füßen, berauscht und siegessicher vom Feiern und vom Erfolg, und daß er nicht merkt, wie der Harkemann vor ihm auftaucht, der eigentliche Herr der Orpe, der, tangschwarz und fließend, diese letzte Demütigung durch meinen Ururgroßvater noch einen Augenblick grimmig mitanschaut, nur einen kurzen Augenblick, um sich das Bild des Mannes einzuprägen, der ihn versklavt hatte, ihn und den Strom und die Gewalt seines Wassers, und der sich jetzt, mitten in der Ruhe der Nacht noch einen übermütigen Scherz erlaubte und wie zum Hohn sein Wasser mit dem schwarzen Wasser des Harkemanns mischte, ohne zu wissen, daß es der Harkemann war, der triumphierte in diesem Augenblick und ihn mit seinen schwimmenden schwarzen Augen ansah, im Vorgefühl und im Rausch seiner Rache.
Und der Harkemann wartet. Er wartet noch, bis mein lustiger Ururgroßvater sein Wasser vollständig abgeschlagen hat, bis die Lautlosigkeit und das schwarze Schweigen in das dahingleitende Wasser der Orpe zurückgekehrt ist. Und mein Ururgroßvater, um einen weiteren Triumph lustiger, wendet sich zum Gehen, ein Liedchen der Lustigkeit auf den Lippen, und er kehrt dem Harkemann den Rücken, den er nicht gesehen und nicht gehört hat und der nun tangschwarz und riesig aus dem Wasser ragt, und gerade als mein lustiger Ururgroßvater den ersten Schritt die Uferböschung hinauf tun will, gerade als er sein Gewicht auf ein Bein verlagert und mit dem anderen ausschreitet, um zu seiner Kutsche und der Welt seiner Erfolge zurückzukehren, gerade in diesem so prekären wie alltäglichen Akt der Balance, in diesem winzigen Moment der Schwäche faßt ihn der Harkemann mit seiner Harke und reißt ihn mit sich in die Tiefe, schneller als die Chance eines Schreis, schneller als Schall, und lautlos strömt das schwarze Wasser über ihn.
Auf seinem Bock ist der übermüdete Kutscher über geflüsterten Flüchen eingenickt, und er schreckt wieder auf aus diesem kurzen tauben Schlaf, der so plötzlich und dumpf über ihn gekommen ist wie ein Schlag in den Nacken. Er schreckt auf und wundert sich kurz, wo er ist und wie lange er wohl … und wo denn der Herr … aber er wird schon noch kommen … und überhaupt, wer weiß denn schon, was dem alles einfällt, mitten in der Nacht … Und so wartet der Kutscher, diesmal wachsamer und zunehmend unruhig, er wartet noch zehn Minuten, eine Viertelstunde vielleicht, bevor er sich getraut zu rufen, den Namen seines Herrn in die Nacht zu rufen, den zu rufen, der sonst immer nach ihm rief, zunächst noch ehrfurchtsvoll leise in der Hoffnung, niemand möge ihn hören, dann zusehends lauter, bis er, erschreckt von der Stille um ihn und seiner eigenen Kühnheit, wieder verstummt und lauscht.
Aber da ist nichts. Kein Laut der Erwiderung, keine Bewegung in dieser dunklen, verhangenen Nacht. Und so bleibt dem Kutscher nichts anderes übrig als nochmals zu rufen, lauthals jetzt, beinahe rauh, und seine Rufe und das Horchen nach Antwort wechseln sich immer schneller ab, immer hastiger, und dazwischen drängen sich leise Flüche, während ihm die Katastrophe schwant, ihm ausgerechnet, dem man auf irgendeine perfide Weise die Schuld geben würde, der immer schuld war, wenn irgend etwas passierte … warum immer er, warum immer ihm, warum gerade heute in dieser unseligen Nacht …
Und als er wieder ruft und noch nichts hört, und als seine Rufe schon Schreie sind und nichts zurücktönt, nur der dumpfe Widerhall dieser verhangenen Nacht, der weniger Klang ist als das Verschwinden von Klang, und als die Angst, die in ihm aufsteigt, nicht mehr zu beherrschen ist, denn die Katastrophe ist da und er mittendrin, da schwingt er die Peitsche, panisch, und schlägt auf zum Galopp, und er sagt sich, er muß Hilfe holen, er muß hinunter zur Mißgunst, um Hilfe zu holen, aber in Wirklichkeit will er nur weg, weg aus dieser Unheimlichkeit, weg aus der Stille, die ihn umschließt, dieser Grabesstille, Totenstille, diesem Abgrund aus Stille, alles, nur nicht mehr allein sein mit dieser Stille und Schuld. Und er erreicht die Mißgunst, die nur fünfhundert Meter entfernt liegt von der schicksalhaften Gabelung, und er schlägt Alarm, die Feuerglocke läutend, bis Licht aufscheint in der vielfenstrigen Fabrikantenvilla, Licht in den hohen, herrschaftlichen Fenstern, hier und da und überall, und keuchend, von rauhen Kehlen, werden die alarmierenden Worte hin und her gerufen, einzelne Satzbrocken, keine Zeit für Erklärungen, und schon wenig später stehen die Dienstboten in hastig übergeworfenen Mänteln bereit, mit langen Stangen und Laternen bewehrt, und sie springen auf die Kutsche, und dieses Knäuel aus Stimmen, Bewegung und Hast verläßt ratternd und rasend den Hof, flußaufwärts, in Richtung Gabelung, und zurück bleiben die Frauen, die nur wenige Worte haben, zu schnell ging das alles, und eines der wenigen Worte ist vielleicht: der Harkemann.
Und noch bevor die Gabelung erreicht ist, springen die Männer ab, schaukelnde Schatten mit ihren Laternen, und sie eilen die Uferböschung hinab zum schwarzen Wasser der Orpe, das still und strömend, schweigsam und schnell vor sich hingleitet, als wäre nichts gewesen, als wäre nie etwas geschehen, der glatte Spiegelfilm wie unberührt, der jetzt von den Stangen durch-stakt wird, Stangen, die das schwarze Wasser durchstechen bis auf den knirschenden Grund, während die Laternen riesenhafte Geisterschatten ins Uferlaub und über den Strom werfen.
Aber so dringlich und tief die Stangen auch auf den Grund rühren, so wütend sie auch hineinstoßen in das schwarze Reich des Harkemanns und ihm mit ihren Stangen und Stößen zuleibe rücken, er läßt es geschehen und zeigt sich nicht. Er hat sich mit seiner Beute zurückgezogen, hat sich in schnellen Wirbeln und Wendungen getrollt mit seiner Beute, die er nicht wieder hergibt, die ihm niemand wieder entreißt. Und so bleibt der Harkemann verschwunden in dieser Nacht, schwarz und unsichtbar wie ein auf ewig abwesender Gott des Wassers.
Und dennoch geben die Männer mit den Stangen nicht auf. Unermüdlich tauchen die Stangen in die Tiefe, langsamer zwar, aber gezielt, in einer Reihe das Ufer entlang flußabwärts, Schritt für Schritt, die fünfhundert Meter unter der Gläsernen Brücke hindurch bis hinunter zur Mißgunst und zu den Wehren und Walzen der Fabrik. Und es gibt keine Untiefe und keine Schlammbank im Flußbett, woran die Stangen nicht gerührt hätten. Längst ist der Schein der Laternen und der Schattenwurf auf dem Laub und dem Wasser verblaßt in der vernebelten Morgensonne. Längst sind die Schemen der Männer zu scharf umrissenen Figuren geworden, dieser mit ernstem Gesicht und zusammengebissenen Zähnen, jener unrasiert, mit müdem Blick und wirrem Haar, die Ärmel triefend von schwarzem Wasser, das die Stangen herabrinnt, wenn sie aus den Eingeweiden des Flusses herausgezogen werden, um an anderer Stelle wieder zuzustechen. Männer in schmutzigen Mänteln und Hosen, wie Faune zerzaust vom unwegsamen Ufer mit seinem Gestrüpp, den Brombeersträuchern, den Farnen und dem Huflattich, der zum Wasser wächst. Und rote, lehmige Erde klebt an den Schuhen und Stiefeln wie Blut.
Von der Fabrik her kommen die Arbeiter, um die Domestiken abzulösen. Wortlos übernehmen sie die Stangen, schweigend setzen sie die Suche fort. Schnell hat es sich herumgesprochen. Das ganze Dorf weiß Bescheid. Es gibt nichts mehr zu sagen, nur etwas zu tun, nur diese Pflicht gegenüber ihrem Dienstherrn zu erfüllen, eine Pflicht, die immer mehr einer letzten Ehre gleicht, einem Begräbnisritual, einem Trauerzug aus hinauf- und hinabgleitenden Stangen in schwieligen Händen, einem Trauerzug aus rinnendem, triefendem Holz, der sich jetzt wieder von den Wehren der Mißgunst unter der Gläsernen Brücke hindurch flußaufwärts bewegt und die Totenstille des Wassers durchstößt, das für heute sogar die Fabrik zum Schweigen gebracht hat, zum völligen Stillstand, zu einer Ruhe, wie es sie nicht mehr gegeben hatte, seitdem mein Ururgroßvater auf der Mißgunst die ersten Schuppen zusammenhämmern ließ, sie Papierfabrik nannte und ihr seinen Namen gab. Der Fluß hatte sein Schweigen über das Werk meines Ururgroßvaters verhängt.
Einen Tag, zwei Tage schon dauerte diese stumme Trauer. Man hatte die Suche am Abend des ersten Tages eingestellt. Es gab keine Untiefe, keine Schlammbank, die man nicht dreimal, viermal durchstochert hätte. Mein Ururgroßvater blieb unauffindbar in den Fängen des Harkemanns, so unauffindbar wie der Herr des Flusses selbst, der sich in Algen, Tang, Schlamm und schwarzes Wasser aufgelöst zu haben schien, jetzt, da er seinen Todfeind, den Firmengründer, geholt hatte. So unauffindbar war der Harkemann, daß die Arbeiter am Ende ihrer Suche, nachdem sie den Flußgrund wie ein Nadelkissen an allen erdenklichen Stellen durchbohrt hatten, ihre müden Füße im Wasser badeten. Die Abwesenheit des Harkemanns hatte ihnen die Angst genommen vor dem schwarzen, schnellen Wasser. Entzaubert von seiner Gefährlichkeit floß es dahin, und sie ließen die Beine im gleitenden Strom der Orpe baumeln, obwohl sie wußten, daß die Beine ihres Dienstherrn vielleicht ebenfalls in der Orpe vor sich hin baumelten, in der Tiefe der Orpe, bleich und leblos, bis auf das schwimmend schaukelnde Spiel, das das Wasser mit ihnen trieb. Sie wußten es, aber sie glaubten es nicht, sondern saßen da, stumm und versunken, die Schultern ein wenig schief von der ungewohnten Belastung und so vergeblich, als hätten sie versucht, das Ufer vom Wasser abzustoßen und das Land den Fluß hinaufzurudern. Sie saßen da und schauten aufs Wasser.
Ein, zwei Tage stumme Trauer. Die Fabrik lag still und verlassen da, die Arbeiter kamen zu den gewohnten Zeiten, aber sie schlichen um die Schuppen und Maschinen herum und setzten sich ans Wasser, und ihre gedämpften Stimmen murmelten leise mit dem Fluß und der Strömung. Niemand wagte es, das Kommando zu ergreifen und das Memento mori, diese vom tödlichen Schweigen des Wassers verhängte Zeit des Gedenkens für beendet zu erklären, diese zu Tagen sich auswachsende Schweigeminute zu stören und den Lärm der Arbeit wieder in Gang zu setzen und das Wasser wieder der Betriebsamkeit der Papierfabrik zu unterwerfen. Niemand wagte es, auch der Sohn meines Ururgroßvaters nicht. Er, der zweite in der Ahnengalerie, wagte es nicht, seine Nachfolge anzutreten.
Mein Ururgroßvater war im schwarzen Wasser verschwunden, und weil man ihn nicht gefunden hatte, war er nicht tot. Er lähmte alles Leben um ihn her, all das Leben, das er, der Firmengründer, auf der Mißgunst versammelt hatte, aber er war nicht tot, solange er nicht tot gefunden war. Schon mehrten sich Gerüchte, mein lustiger und unauffindbarer Ururgroßvater sei vielleicht gar nicht ertrunken, er sei vielleicht werweißwo, versteckt, verreist, geflüchtet. Vielleicht wußte er, der listige und lustige Firmengründer, etwas, das niemand anders wissen durfte, vielleicht wußte er von Schwierigkeiten, Schulden, Bankrott und Ruin, und er hatte sich rechtzeitig aus dem Staub gemacht.
Dabei war der Glaube an die Allmacht meines Ururgroßvaters ungebrochen, an seine Firmengründergewalt und sein Geschick. Und ein wenig glaubte jeder, daß er es sogar fertiggebracht haben könnte, den Harkemann zu seinem Kompagnon zu machen. Vielleicht hatten die beiden alten Herren ihre Feindschaft miteinander besprochen, eine Flasche guten Weines zusammen geleert und festgestellt, daß sie einander sympathisch waren, mein Ururgroßvater mit seinem kräuselnden weißen Bart auf der Brust und den hellen lustigen Augen und der tangverhangene Harkemann mit seinem wasserschwarzen Blick und einem noch längeren, noch imposanteren Bart, gewoben aus Algen und Schlamm. Und vielleicht hatten sie sich angeschaut, die beiden barocken Herren, der Dienstherr und der Herr des Flusses, mit ihren ausufernden Bärten, vielleicht hatten sie sich eine Weile angeschaut und ihre Finger verlegen in ihren Bärten gedreht und dann herzlich gelacht, der eine über den andern und beide über sich selbst. Und vielleicht war dann ein Schweigen der Versöhnung zwischen ihnen eingekehrt, besiegelt von einem freundschaftlichen feuchten Handschlag und einem Spritzer Schlamm. Ja, zuzutrauen wär’s ihm, meinem lustigen Ururgroßvater, daß er den Harkemann selbst zu seinem Kompagnon macht und das schwarze Wasser fröhlich arbeiten läßt für sich, während er mit dem Harkemann in seinem holzgetäfelten Büro sitzt, unter dem ölgemalten Porträt seiner selbst, bei einer guten Zigarre, und blumigen Cognac schwenkt.
Aber dann kam der dritte Tag. Ein dritter Tag des Schweigens und der Trauer, an dem die Arbeiter sich morgens zur gewohnten Zeit an den Fluß begaben wie auf ihre Posten und mit zusammengekniffenen Augen auf das schwarz dahingleitende Wasser starrten, als wäre das ihre Arbeit, als hätte sie mein Ururgroßvater nie für etwas anderes als diese Tätigkeit bestimmt. Und in dem holzgetäfelten Büro geht unruhig und unschlüssig mein Urgroßvater auf und ab, einen gelegentlichen Blick auf das Bild seines Vaters werfend, dieses mächtigen, nicht auszutreibenden Vaters, der mit hellem Triumph in den Augen den Blick des Sohnes niederstarrt, der nie, tot oder lebendig, aufhören wird zu triumphieren. Und mein Urgroßvater wandert die Wege der Unruhe in dem Büro, das nicht seins ist, das nicht seins werden will, beschämt von dem Gefühl, daß er den Platz neben seinem Vater, den leeren Platz in der angefangenen Ahnengalerie, niemals einnehmen wird.
Dabei konnte er rechnen wie kein zweiter. Dabei hatte er ein Gespür für Zahlen, das es ihm möglich machte, Zahlen und Rechenvorgänge selbst dort zu sehen, wo alle andern sich von dem äußeren Schein der Dinge blenden ließen. Er hatte die Fähigkeit, in allem die Zahl zu erkennen und diese Zahlen miteinander zu verbinden, in Balance zu bringen, auf- und gegenzurechnen, bis alles in einer einzigen großen Zahl unter dem Strich zusammengefaßt war. Seine Rechenkünste hatten die Hauslehrer verblüfft, die Buchhalter fingen an zu schwitzen, wenn er mit seinem Blick für Zahlen die Kolonnen ihrer Bücher überflog, immer fand er den Fehler. Unter allen, die mit Zahlen zu tun hatten, war er gefürchtet, bewundert, respektiert. Nur seinen Vater, meinen lustigen, listigen Ururgroßvater, beeindruckte das nicht, seinen Vater, dem oftmals in einer simplen Addition Fehler unterliefen, und der dann lustlos zu seinem Sohn sagte, rechne du das. Und es war kein Kompliment, nein, es war wie eine Beleidigung. Er behandelte ihn wie einen Domestiken, wie einen Laufburschen, der in das Reich der Zahlen ausgeschickt wurde, um gefälligst das richtige Ergebnis zu holen. Da war sie wieder, diese Wut, diese kalte, unmathematische Wut, diese Wut und Verzweiflung, daß jenseits der Zahlen etwas sein könnte, ein Geheimnis, eine nicht zu errechnende Kunst, die es seinem Vater ermöglichte zu tun, was er tat, die ihm Triumph um Triumph verschaffte, die ihm die Mißgunst unterwarf und die ihm, dem Sohn, auf ewig verborgen blieb.
Es war am dritten Tag der Trauer über den Unauffindbaren, daß mein Urgroßvater in dem holzgetäfelten Büro, das sich weigerte, seins zu werden, zu dem Porträt seines Vaters aufschaute. Und diesmal ließ er sich nicht niederstarren von den hellen lustigen Augen, die den Triumph so gewöhnt waren, sondern hielt ihnen stand in offener Rebellion, in kalter, unmathematischer Feindseligkeit. Was auch immer geschehen war, was auch immer geschehen möge, er war entschlossen, die Nachfolge seines Vaters anzutreten, ihn endgültig für tot zu erklären, auch wenn er ihn damit vor der Zeit umbrachte. Er war entschlossen, ihn um jeden Preis von seinem Platz zu verdrängen. Lange genug hatte er gewartet. Lange genug hatte er für ihn gerechnet, in Verachtung gerechnet, als wäre die Mathematik, diese erhabene, klare Wissenschaft, eine Sache der Domestiken und Handlanger. Doch dieses Warten und diese Verachtung hatten nun ein Ende. Er würde die Nachfolge antreten und endlich die Zahl in ihr Recht setzen. Die Zahl, die strenge und gerechte Zahl sollte regieren auf der Mißgunst, ohne Ansehen der Person, ohne Liebe und Verachtung, ohne Günstlinge und Sündenböcke, denn vor der Zahl waren sie alle gleich, alle, auch sein Vater, dessen Rechnung jetzt und für alle Zeit abgeschlossen war, zu Ende addiert, ein nicht mehr zu aktivierender Posten.
Es war am dritten Tag, gerade als mein Urgroßvater sich probehalber an den Schreibtisch gesetzt hatte in dem Büro, das nun seins werden sollte, komme, was da wolle, gerade als er zum ersten Mal in seinem Leben dieses Büro von der andern Seite des Schreibtisches aus betrachtete und es mit seinen Blicken in Besitz nahm, gerade da ertönte vom Fluß her lautes Rufen und Geschrei. Es verbreitete sich wie ein Lauffeuer über die Mißgunst, drang bis in das holzgetäfelte Büro und ließ meinen Urgroßvater aufschrecken, aufspringen von seinem, seines Vaters Stuhl wie ein ertapptes Kind. Es zwang ihn, ans Fenster zu treten, an das Fenster zum Fluß, Haltung anzunehmen und hinauszusehen, die Hände, die zitternden Hände auf dem Rücken ineinander verhakelt, verhakt. Und auf einmal wußte er, daß er zurückgekehrt war, sein lauter, überbordender, ewig triumphierender Vater, den die Leute liebten oder fürchteten oder beides, er war wieder da, um seinen Sohn zurückzusetzen an den Katzentisch der Mathematik, seinen zur Nachfolge unfähigen Sohn, ihn, den Rechendomestiken.