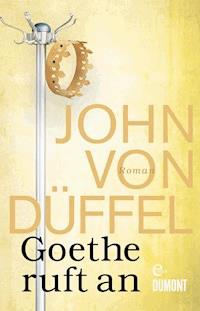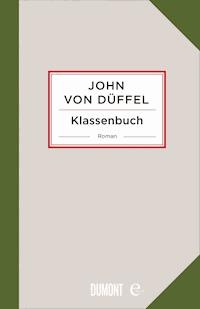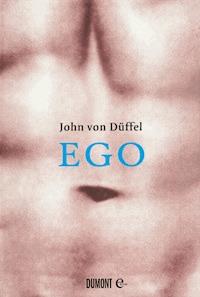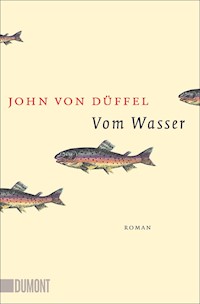9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Erfolg seiner Familienromane ›Vom Wasser‹ und ›Houwelandt‹ hat John von Düffel bekannt gemacht – sein neuer Roman erzählt davon, wie wenig selbstverständlich Familie geworden ist: Bis in die besten Jahre hinein scheint die Gründung einer Familie nur eine Option unter vielen. Ein Schauspieler stellt fest, dass das Dramatische aus seinem Leben verschwunden ist. Mit Anfang Vierzig muss er nicht mehr jedem Rock hinterherlaufen. Zusammen mit seiner Frau Lisa genießt er die ruhiger gewordene Zeit. Da taucht im Grundriss der neuen Wohnung das Wort »Kinderzimmer« auf. Die beiden gestehen sich ein, dass sie mit einem Kind noch glücklicher wären. Doch auf Kommando ist da nichts zu machen, ihr »Fruchtbarkeitswettbewerb« kennt keinen Sieger. Also lassen sie sich helfen – und das Dramatische kehrt in ihr Leben zurück. John von Düffel macht aus dem ebenso wichtigen wie aktuellen Thema der späten Familie einen höchst gewitzten Roman: ›Beste Jahre‹ erzählt eine verwickelte Liebesgeschichte aus Deutschland – der Weg vom Paar zur Familie hält manche Überraschung bereit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
JOHN VON DÜFFEL
Beste Jahre
ROMAN
eBook 2014
© 2007 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Zero, München
Umschlagabbildung: Collage unter Verwendung von FinePic-Bildern
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook: 978-3-8321-8807-8
www.dumont-buchverlag.de
1
Älterwerden
Wobei das Schöne daran war, daß er nichts mehr um jeden Preis wollte: Er mußte nicht mehr unbedingt mit dieser oder jener Frau schlafen und auch nicht länger seinen Vater umbringen. Er hatte keinen Konflikt mehr mit der älteren Generation und noch keinen mit der jüngeren. Ihm war das Dramatische in seinem Leben völlig abhanden gekommen, und nicht einmal diesen Verlust empfand er als tragisch, sondern als ausgesprochen angenehm. Er war zufrieden, um nicht zu sagen, glücklich, sehr sogar, verglichen mit sich selbst noch vor wenigen Jahren. Und er genoß es im Unterschied zu früher, als er bisweilen auch glücklich war, es aber meist erst hinterher merkte. Damals wurde ihm eigentlich immer erst klar, daß er glücklich gewesen sein mußte, wenn er schon wieder unglücklich war. Glück kam ihm nur als verlorenes und somit als akutes Unglück zu Bewußtsein, wie überhaupt sein Bewußtsein zu der Zeit ein ausgesprochenes Unglücksbewußtsein war und Glück nur jener bewußtlose Zustand der Abwesenheit von Unglück. Heute dagegen konnte er sagen, daß er sich seines – ja, doch, immerhin – Glückes durchaus bewußt war, und er genoß es sehr, auf vergangenes und, wenn man so wollte, verlorenes Unglück zurückzublicken. Es steigerte die Lebensqualität ungemein.
Die Frage war nur, wie lange er unter diesen Umständen noch in der Lage sein würde, auf der Bühne zu stehen. Konnte, fragte er sich, ein vergleichsweise glücklicher Mensch Schauspieler sein? Es gab Tage, Wochen, da fühlte er sich innerlich so ruhig, so einverstanden mit dem Leben, daß es ihm fast unmöglich war aufzutreten, den Schritt in die Erregung zu tun und sämtliche Zuschauer dazu zu bringen, sich mit ihm zu erregen. Es kam ihm künstlich vor. Er absolvierte seine öffentliche Seelengymnastik und versuchte, sich dabei so redlich wie möglich in das hinein- und zurückzuversetzen, was er einmal gespielt hatte. Doch er fragte sich die ganze Zeit, ob er dafür nicht langsam zu alt wurde.
Diese Frage hatte er sich schon mit fünfzehn gestellt, eines schönen Vormittags, Anfang der achtziger Jahre, während einer ökologischen Exkursion in den Schloßgarten, bei der er hoffte, seiner Theater-AG-Partnerin näherzukommen (damals wollte er dergleichen unbedingt). Und er war ihr auch schon ziemlich nahe gekommen, als auf einmal ein weißbärtiger, älterer Herr mit einer jungen, hübschen Schauspielerin vorüberjoggte. Plötzlich flüsterte ihm seine Theater-AG-Partnerin, die gelegentlich als Statistin am Oldenburgischen Staatstheater mitwirkte, ins Ohr, dieser Jogger dort sei niemand geringerer als der Regisseur und Oberspielleiter Hartmut Gehlen mit seiner neuen Schauspieler-Freundin, der Darstellerin der Lena aus seiner Inszenierung von »Leonce und Lena«. Das erschütterte ihn tief. Erst vor wenigen Tagen hatte er besagte Aufführung gesehen und sich ein wenig in ebendiese Lena verguckt, wie er sich damals überhaupt unentwegt in die Protagonistinnen des Oldenburgischen Staatstheaters verguckte, weshalb es ihm einen inwendigen Stich versetzte, die Lena seiner Theaterträume jetzt mit einem anderen, noch dazu graubärtigen Mann durch den Schloßgarten joggen zu sehen. Doch es war nicht allein Lena, ihr wenig jugendlicher Liebhaber und die Tatsache, daß sie so etwas Profanes tat wie Joggen in einem grauen Baumwolltrainingsanzug, anstatt in leichtem Tüll über die Wiesen des Schloßgartens zu schweben. Die sehr viel tiefere Erschütterung ging von Hartmut Gehlen selbst aus, dem Provokateur und Polittheatermacher, der das Oldenburger Publikum einschließlich der mit Bussen angekarrten Ammerländer Landbevölkerung regelmäßig in Angst und Schrecken versetzte. Die Inszenierungen des Hartmut Gehlen waren berüchtigt. Wer seinen Namen in einem Straßencafé auch nur beiläufig erwähnte, sah sich heftigsten Anfeindungen ausgesetzt. Brave, unbescholtene Bürger wurden zu Berserkern, sobald die Sprache auf Hartmut Gehlen kam. Seine Premieren waren Sternstunden des Entsetzens, Skandale im Acht-Wochen-Takt. Hartmut Gehlen übertraf immer wieder aufs neue sämtliche Befürchtungen. Er schien nicht zu ruhen, bis seine grauenerregende Theaterphantasie die Heiligtümer des gebildeten Oldenburger Beamtentums in noch nie dagewesener Weise entstellt und geschändet hatte – und dieser Hartmut Gehlen joggte gemächlich, mit unübersehbaren Schweißflecken unter den Achseln, durch den Schloßpark! Es war schockierend. Es war so normal, so unerhört alltäglich, so ganz und gar nicht monströs, daß es einem Verrat gleichkam. Das sollte der Mann sein, vor dem die heile Oldenburger Theaterwelt zitterte? Wenn er sich überhaupt einen Hartmut Gehlen jenseits des Regiepults vorstellen konnte, dann amoklaufend, aber nicht joggend, dann einen Veitstanz aufführend, aber nicht in gelenkschonendem Gesundheitstrab. Hartmut Gehlen hatte es wieder einmal geschafft: Er war wie vor den Kopf gestoßen.
Wobei sich mit der Zeit diese schockhaft-schmerzliche Begegnung mit dem Theateridol seiner Jugend in etwas Tröstliches verwandelte, je öfter er daran dachte, und er dachte sehr oft daran. Damals hatte er nichts anderes im Sinn gehabt, als Hartmut Gehlen umzubringen und mit seiner Freundin zu schlafen. Er wollte sich an ihm rächen für die fidele Turnschuhhaftigkeit seiner Erscheinung, für sein ganz und gar unkünstlerisches Streben nach Leibesertüchtigung und die gutnachbarschaftliche Freundlichkeit, mit der Gehlen ihn und insbesondere seine Theater-AG-Partnerin im Vorbeijoggen grüßte. Hartmut Gehlen sagte: »Guten Tag.« Es war der blanke Hohn!
Heute dagegen, beim Joggen vor oder nach den Proben, flößte ihm die Erinnerung an Hartmut Gehlen und seinen Frühsport eine gewisse Zuversicht ein. Man mußte nicht mit dreiundzwanzig an Typhus sterben wie Georg Büchner oder sich in der frühen Blüte seiner Dichterjahre mehr oder weniger malerisch erschießen wie Heinrich von Kleist. Man konnte auch noch mit sechzig in großmeisterlicher, Goethescher Unermüdlichkeit die Puppen tanzen lassen und einen »Faust II« oder Schlimmeres verzapfen und dabei aufgeräumt und unverdrossen durch die antike Mythologie joggen, eine junge, bildhübsche Helena an seiner Seite, in ewiger Jugendlichkeit, als Klassiker zu Lebzeiten, sportiv und unverwüstlich. Dafür stand der Name Hartmut Gehlen.
Und das war das Schöne daran.
2
Familienaufstellung
Allerdings bemerkte er als eine der deutlichsten Alterserscheinungen diesen immer größeren Abstand zu sich selbst. Nicht nur, daß er sein eigenes Treiben aus der Vogelperspektive betrachtete und auf sich als Schauspieler guckte wie von oben aus dem dritten Rang, er lebte auch zusehends in der Erinnerung, und zwar nicht so sehr in der Vergangenheit als vielmehr in einer von Erinnerungen überlagerten Gegenwart. Mit wachsender Verwunderung stellte er fest, daß sich für ihn Erleben und Erinnern immer mehr vermischten. Passierte ihm etwas, war es ihm meist schon einmal passiert. Sah er jemanden, handelte es sich meist um ein Wiedersehen. Und selbst wenn ihm auf Premierenfeiern oder bei ähnlich unvermeidlichen Anlässen jemand Neues, Wildfremdes vorgestellt wurde, entdeckte er in dem Gesicht seines Gegenübers schon bald die vertrauten Züge alter Bekannter. Sein Gehirn war geradezu geschult, alles, was ihm begegnete, in Erinnerung aufzulösen, ohne daß er sich erinnern konnte, es geschult zu haben.
Dabei hatte er seine Neugier keineswegs verloren, sie war nur anders geworden. Begegnete er einem Menschen zum ersten Mal, lautete die Frage in seinem Hinterkopf nicht länger: »Wer bist du?«, sondern: »An wen erinnerst du mich?« Es handelte sich also nicht um Neu-Gier im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr um den Drang, im Neuen das Alte zu entdecken, strenggenommen um eine Neu-Vertilgungs-Gier, die Unbekanntes augenblicklich auf Bekanntes zurückführte. Neu war allenfalls der Mix des Erinnerungscocktails, die Variation in der Wiederholung. Doch das Neue daran war eher amüsant oder, wenn’s hochkam, »interessant«, gab aber nicht den Ausschlag, es war nicht das Gier auslösende Moment. Gierig war er im Grunde nach dem Vertrauten.
Was ihn an seine Gastspielreise nach Japan erinnerte, wo er in einem geschäftsbankähnlichen Theatertower im Namen des deutsch-japanischen Kulturtransfers vor tausendfünfhundert identisch aussehenden Bankangestellten und ihren identisch aussehenden Gattinnen mal wieder unbedingt mit einer Frau schlafen und seinen Vater umbringen mußte. Anfangs hatte er sich in Tokio wie auf einem anderen Planeten gefühlt. Doch es geschah an seinem dritten Tag in dieser extraterrestrischen Stadt, daß sich der Schleier der Exotik mit einem Mal lüftete. Sprach- und orientierungslos, wie er dortzulande war, hatte er sich nur wenige Meter von seinem Hotel entfernt, als er beim Anblick eines uniformierten Parkplatzwächters plötzlich innehielt und zusah, wie der strenge, in Würde ergraute Herr mit weißen Glacéhandschuhen, flankiert von mehreren beflissenen Adjutanten, eine Limousine aus einem Parkhochhaus in Shibuya herauswinkte. Mit abgezirkelten Bewegungen teilte er das Menschengewimmel und blies dabei – anstatt viele Worte zu machen – mehrmals kurz und gebieterisch in seine Trillerpfeife. Irgend etwas an diesem ledergesichtigen alten Mann kam ihm bekannt vor, und er rätselte eine Weile vor sich hin, bis es ihn auf einmal wie ein Stromschlag durchfuhr: »Der sieht ja aus wie mein Großvater!« Und tatsächlich, je länger er den Alten, der unter den Parkplatzwächtern den Rang eines Offiziers zu bekleiden schien, aus der wartenden Menge heraus anstaunte, desto eklatanter erschien ihm die Ähnlichkeit. Diese japanische Parkplatzautorität glich seinem Großvater nicht nur, es war, genaugenommen, die japanische Ausgabe seines Großvaters, und zwar nicht nur eine mehr oder minder gelungene Kopie, sondern das Urbild. Als Japaner zeigte sein Großvater sein wahres Gesicht!
Die Limousine hatte die Ausfahrt des Parkhochhauses längst verlassen, die Passanten strömten lückenlos zusammen, und schon im nächsten Augenblick schien es, als wäre nie etwas gewesen. Doch er starrte weiter wie gebannnt über den geschäftigen Rest der Tokioter Bevölkerung hinweg, denn er hatte soeben einen tiefen Blick in die Zusammenhänge des Lebens getan. Vor seinem geistigen Auge sah er noch immer den weit über das Pensions- und Rentenalter hinaus herrschenden Parkplatzoberkommandierenden, und er stellte im Geiste seinen Großvater daneben, ohne entscheiden zu können, wer hier wem aus dem Gesicht geschnitten ähnlich sah. Es war etwas Eineiiges an den beiden. Wobei die militärisch korrekte Haltung, die keinen Widerspruch duldende Gebärdensprache wie überhaupt das ganze Auftreten des Parkplatzwächters das Japanische an seinem Großvater erst richtig zum Vorschein brachte, um nicht zu sagen, offenbarte. Ja, es gab gar keinen Zweifel, daß sein Großvater in seinem tiefsten Innern eigentlich dieser Japaner war!
In diesem Moment hörte Nippon auf, ein fremdes Land zu sein. Als wären ihm Schuppen von den Augen gefallen, streifte er durch die krummen Straßen von Shibuya und entdeckte mit einem Mal Ähnlichkeiten, wo er sich zuvor von fernöstlicher Lächelei und hilflos machender Höflichkeit hatte verwirren lassen. Erst jetzt ging ihm auf, wie japanoid seine gesamte Familie war. Seine mandeläugigen Tanten hatten zahlreiche Gesichtsverwandte unter den schaufensterbummelnden Damen der Tokioter Gesellschaft mit ihren Versace-Kostümen und Louis-Vuitton-Handtaschen, die nur vermeintlich alle gleich aussahen, bei näherer Betrachtung aber das gesamte Tantenspektrum abdeckten. Geradezu wiedergängerinnenhaft liefen sie ihm über den Weg, die jüngeren Schwestern seines Vaters, in die er als Kind reihum verliebt gewesen war, nicht allzusehr, aber doch verliebt genug, um jetzt von der plötzlichen Erkenntnis schockiert zu sein, daß diese scheinbar so vertrauten weiblichen Wesen, an die er vorübergehend sein Herz gehängt hatte, in Wirklichkeit verkappte Japanerinnen waren.
Sogar seine eigene Mutter, die von seinem Vater nicht zuletzt deshalb geheiratet worden war, weil sie auf ihrem Führerscheinfoto aussah wie Audrey Hepburn in »Frühstück bei Tiffanys«, entpuppte sich als heimliche Madame Butterfly, was ihm erst klar wurde, nachdem er wiederholt an der Plakatserie eines namhaften Schmuck- und Mode-Labels vorbeigelaufen war, das mit einem täuschend ähnlichen Audrey-Hepburn-Look-alike für seine Kollektionen warb. Schon beim Blick aus seinem Hotelzimmerfenster auf eine gigantische Anzeigentafel mit Audrey Hepburns schmuckbekränztem Konterfei hatte er sich über die große, quasi-religiöse Verehrung gewundert, die das japanische Volk ausgerechnet diesem Hollywoodstar entgegenbrachte. Irgend etwas war an der Gesichtsformel dieser Ikone, am Schnitt ihrer Augen und Augenbrauen, an ihrem leicht von unten kommenden Lächeln, das sie zum Idealbild der japanischen Frau prädestinierte. Lange strich er um die zahlreichen Audrey-Hepburn-Plakate herum, halbe Nächte blickte er nachdenklich aus seinem Fenster auf die hell erleuchtete Reklamewand gegenüber, bis er schließlich das Offensichtlichste entdeckte: Audrey Hepburn hatte Schlitzaugen! Ganz deutlich kamen mit einem Mal die langgezogenen, sich asymptotisch verengenden Augenwinkel zum Vorschein, die dem Blick Audrey Hepburns jenen unsterblich machenden Zug ins Aparte, mädchenhaft Raffinierte verliehen. Und wenn er ganz genau hinsah, konnte er unter den getuschten Augendeckeln sogar den zarten Ansatz der sogenannten mongolischen Lidfalte erkennen. Audrey Hepburn war das Idol der japanischen Frau, aber eben nicht, wie man meinen sollte, aufgrund der Verwestlichung des asiatischen Schönheitsideals, sondern weil Audrey so etwas wie Japans Geheimwaffe in Hollywood war, die fernöstliche Unterwanderung der Traumfabrik. Audrey Hepburn war Pearl Harbour mit kosmetischen Mitteln. Womit für ihn endgültig feststand, daß er väterlicherseits in mehr oder weniger direkter Linie von einem Tokioter Parkplatzwächter abstammte und mütterlicherseits – aufgrund der erbbedingten Schwäche seines Erzeugers für Audrey Hepburn – von der japanischen Schönheitsgöttin schlechthin. Er war im Grunde Vollasiate.
3
Herr Dr.Moosheimer
Unterdessen hatte er sich mit dem Älterwerden und seinen Nebenwirkungen arrangiert. Ohne Reue hatte er die Vierzig überschritten. Es ging ihm gut, seine Zipperlein hielten sich in Grenzen. Und da er sich dank der geliehenen Leben seiner Figuren erfahrener fühlte, als er es für seinen Teil war, glaubte er, ihn könne nichts mehr überraschen. Dann sagte Lisa eines Abends mit einem umwerfenden Lächeln zu ihm: »Du wirst Vater.«
Er freute sich sehr– für seine Frau, für sich, für sie beide. Seit Jahren hatten sie sich ein Kind gewünscht und es auf jede erdenkliche Weise versucht. Doch er hatte nicht mehr damit gerechnet. Die Zukunft, auf die er sich nach sämtlichen Familienplanspielen eingestellt hatte, bestand vor allem darin, Paar zu sein. Daß es außer seiner Frau und ihm nichts geben sollte, war bitter, aber nicht zu ändern, also fand er sich damit ab. Das Leben zu zweit hatte einiges für sich, die Ruhe sagte ihm zu, und in den Müdigkeiten unter der Oberfläche kannte er sich aus.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!