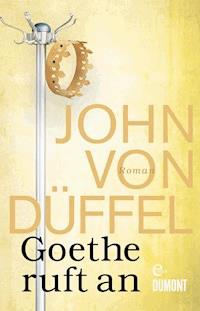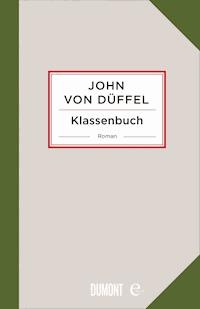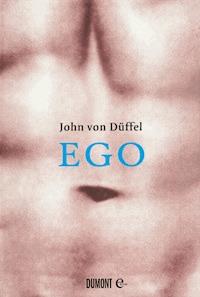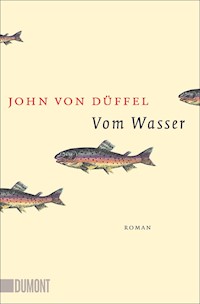13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Vom Drama, ein Drama zu schreiben
Auf bisher einzigartige Weise beleuchten ein Schriftsteller (und Dramaturg) und ein Lektor anhand vieler Beispiele aus der Praxis die Entstehung von Theaterstücken: von den ersten Skizzen bis zu erhitzten Diskussionen auf Premierenfeiern, von der Arbeit an Dialogen bis zu Inszenierungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Ähnliche
John von Düffel
Klaus Siblewski
Wie Dramen entstehen
Luchterhand
Ästhetik des Schreibens, Band 5
herausgegeben von Hanns-Josef Ortheil
Originalausgabe
©2012 Luchterhand Literaturverlag GmbH, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Satz und eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-07272-8
www.luchterhand-literaturverlag.de
VORBEMERKUNG
IM ANFANG IST DAS SPIEL
Es sind die kleinen gelben Heftchen, die seit Generationen von Schülern die erste Berührung mit dem Drama prägen. Im Anfang der Beschäftigung mit dem Theater steht meistens das Wort, nicht das Erleben einer Aufführung oder das Spiel. Insofern ist es nicht weiter verwunderlich, dass in der Diskussion über das Entstehen und Verstehen von Theaterstücken immer noch der Blick auf das Drama als literarische Gattung dominiert. Prosa, Drama und Lyrik erscheinen dabei als eine Trias, als drei unterschiedliche Ausformungen von Literatur. Doch das sind sie nicht. Das Drama ist mit dem Roman und dem Gedicht schon deshalb nicht vergleichbar, weil sich der Kreis von Entstehen und Verstehen, von Produktion und Rezeption nicht mit dem Lesen eines Stückes schließt. Lesen ist vielmehr nur ein Zwischenschritt und gegebenenfalls der Beginn der künstlerischen Produktionsprozesse des Theaters, die in einer Aufführung gipfeln und so das Publikum als den eigentlichen Rezipienten erreichen. Das Theater ist das eigentliche Medium des Dramentextes und das Manuskript oder Buch nur ein Behelf, ein Arbeitsmaterial. Dass wir heute noch Shakespeare spielen können, verdanken wir mehr oder weniger dem Soufflier-Buch.
Seit jedoch das Buch zum ersten Massenmedium der Welt geworden ist, hat das gedruckte Wort das Theater als primäre Rezeptionsstätte des Dramas verdrängt. Die Gründe dafür liegen in der Sache: Eine Aufführung ist immer ein konkretes raum-zeitliches Ereignis, sie findet hier und jetzt an diesem Ort zu einer ganz bestimmten Uhrzeit statt, und die Menge der Personen, die an diesem Ereignis teilhaben ist äußerst begrenzt – im Unterschied zum fast beliebig verfügbaren Buch oder den technischen Reproduktionsmitteln Film und Fernsehen. Anders als diese »globalen« Medien ist das Theater lokal, es ist nicht digital, sondern analog, nicht virtuell, sondern leibhaftig: ein Wechselspiel zwischen Akteuren und Zuschauern in körperlicher und geistiger Anwesenheit. Für dieses Ereignis ist das Drama sozusagen die Anleitung, eine Art Gebrauchsanweisung zur Herstellung eines Theaterabends. Nur ist dieses Ereignis momenthaft und flüchtig und schwer zu vermitteln – eigentlich muss man dabei gewesen sein –, die Gebrauchsanweisung hingegen ist haltbar und leicht zu überliefern. Womit wir wieder bei den kleinen gelben Heftchen wären, die wir lesen, als wären sie das eigentliche Werk und wir Leser dessen Rezipienten.
Für das Theater schreiben aber heißt nicht Bücher schreiben, sondern Texte, die das Zeug dazu haben, Ereignis zu werden. Es heißt, seine Geschichten in ein Geschehen zu übersetzen, das auf der Bühne Gestalt annimmt, leibhaftig wird, Raum greift und Momente erzeugt, bei denen man als Zuschauer »dabei gewesen« sein muss, um sie wirklich zu durchdringen und von ihnen durchdrungen zu sein. Insofern gleicht das Lesen eines Dramas auch nicht dem Lesen eines Romans oder Gedichts, denn das Buch ist in diesem speziellen Fall nicht die Konservierungs- und Aufbewahrungsform des Kunstwerks, sondern lediglich der Gebrauchsanweisung für ein Kunstwerk. Um ein Beispiel aus einer anderen performativen Kunstgattung – der Musik – zu bemühen: Wer einen Roman oder ein Gedicht liest, hört die Musik. Wer ein Drama liest, liest nur die Partitur und muss sich anhand der Noten und Spielanweisungen vorstellen, wie es klingen könnte, wenn er die Musik gespielt hören würde. Mehr noch! Eine Partitur ist im Vergleich zum Drama ein klar definiertes, hochauflösendes System, das sämtliche Instrumente, ihre Klangfarben, Tempi, Rhythmen, Spielweisen etc. vorgibt, während man im Drama nur die Worte notiert findet, nicht aber die »Instrumente«, nicht den Ton, die Tondauer, den Rhythmus und alles andere, was bekanntlich die Musik macht. Theaterstücke schreiben und Theaterstücke lesen ist insofern eine spezielle Kunst, um nicht zu sagen, eine systematische Überforderung, denn selbst nach über zwanzig Jahren als Theaterdramaturg, nach über tausend Theaterabenden Arbeits- und Seherfahrung erlebt man dabei immer noch Überraschungen wie am ersten Tag.
Wenn aber Theater so wenig Buch ist, kann man über die Entstehung eines Theaterstücks überhaupt eines schreiben? Man muss es sogar, um mit den vielen Missverständnissen über das Drama aufzuräumen! John von Düffel und Klaus Siblewski haben aus der Perspektive des Autors und Dramaturgs bzw. des Lektors eingehend versucht, das Spezifische des Dramas zu beschreiben, seine Verortung im Theater, dessen Produktions- und Rezeptionsbedingungen und die Beziehungen zwischen Dramatiker und Theaterbetrieb. Über die üblichen »geschlossenen«, literarisch geprägten Poetologien des Dramas geht dieses Buch damit hinaus. Es ist eine Annäherung des Theaterautors und Theaterlesers an diese schillernde Kunstform sui generis, deren Entstehen und Verstehen mit keiner anderen Gattung gleichzusetzen ist.
John von Düffel
Wie Dramen entstehen (1)
1. DER VORHANG
Es ist wie in der Oper vor der Ouvertüre, wenn das Orchester seine Instrumente stimmt. Eine Klangwoge schwillt an, Tonleitern, Triller, hupendes Blech, dann schwingen sich die Streicher langsam auf Kammerton A ein. Aus der Vielstimmigkeit wird ein Unisono. Stille schließlich, angehaltener Atem. Und ganz greifbar und gegenwärtig steht sie mit einem Mal im Raum, die wichtigste Größe aller Theateraufführungen: die Erwartung.
Beim Schauspiel sitzt das noch nicht eingestimmte Orchester im Zuschauerraum. Vor jeder Aufführung ein Stimmengewirr, Gespräche, Begrüßungen, die Unruhe der Bewegungen und Blicke im Parkett. Hier werden noch Hände geschüttelt, dort winkt man sich zu, und die Dame mit dem Mittelplatz kommt wieder in letzter Minute und lässt eine halbe Zuschauerreihe Spalier stehen, während die Theatereinzelgänger und lang verheirateten Paare schon versonnen Richtung Bühne starren oder einander die Besetzungsseite des Programmhefts vorlesen. Ein Handyklingeln ertönt über Lautsprecher und fügt den althergebrachten Ritualen des Zuschauerraums ein neues hinzu. Hektische Kontrollgriffe in Hand- und Sakko-Taschen, die letzten Mobiltelefone werden ausgeschaltet. Dann erlischt langsam das Saallicht. Es wird dunkel im Zuschauerraum und still. Nur noch vereinzelte Huster, ein letztes Sitzruckeln da und dort. Endlich ist auch das Publikum gestimmt, und die Erwartung kann Platz greifen, in den wenigen Sekunden zwischen dem Einziehen des Saallichts und dem Öffnen des Vorhangs.
Es ist ein magischer Moment, mein Lieblingsmoment im Theater, dieser Augenblick der puren Erwartung, bevor es losgeht:
A large room. Full of people. All kinds. And they had all arrived at the same building at more or less the same time. And they were all asking themselves the same question:
What is behind that curtain?
Laurie Anderson
In diesen Sekundenbruchteilen entstehen in den Köpfen der Zuschauer Hunderte von Theaterstücken, Stückskizzen: flüchtige Vorentwürfe, schemenhafte Visionen dessen, was an diesem Abend auf der Bühne zu sehen sein wird. Denn wir fragen uns ja nicht nur, was sich hinter dem Vorhang befindet, wir projizieren unsere Vorstellungen, Wunschszenarien und manchmal auch Befürchtungen auf diese große Traumgardine aus rotem Samt und werden damit zu Autoren des Moments, Autoren all jener ungeschriebenen Stücke der Erwartung, die wir immer wieder neu, um- und überschreiben werden, sobald das Licht auf der Bühne angeht, die Schauspieler auftreten, das erste Wort gesprochen wird und der Abend seinen Lauf nimmt …
Dieser Augenblick vorm roten Vorhang ist so etwas wie eine allererste Antwort auf die Frage, wie ein Theaterstück entsteht. Denn anders als alle anderen literarischen Gattungen entsteht ein Stück mit Blick auf die Bühne – und sein Entstehungsprozess ist erst dann vorläufig abgeschlossen, wenn es auf einer Bühne vor Publikum uraufgeführt wird. Während ein Roman in seinem Medium bereits angekommen ist, wenn er auf dem Papier steht, ist ein Theaterstück als Manuskript nur eine Vorstufe dessen, was es einmal werden soll: ein Stück Theater. Wer über die Entstehung von Theaterstücken nachdenkt, darf also nicht nur über den eigenen Schreibtisch reden, er muss ein ganzes Medium in den Blick nehmen, die Welt des Theaters und ihre ästhetischen Bedingungen.
Wie vermutlich die meisten Kollegen bin ich durch das Theater zum Dramatiker geworden: durch prägende Theatererlebnisse, durch die Faszination für gewisse Schauspieler, durch die Begeisterung für den Phantasie- und Erfahrungsraum Theater. Ich wollte immer zum Theater, nicht um auf der Bühne zu stehen oder Regie zu führen, sondern um zu schreiben. Ich wollte wissen, wie das Stück in allen Einzelheiten aussieht, das ich beim Blick auf den roten Vorhang erwarte und erträume. Dabei wäre es mir nie in den Sinn gekommen, Theater als etwas dem Schreiben Nach- oder Untergeordnetes zu betrachten, es war immer mein Ziel, die Ausrichtung meiner Arbeit. Die Bühne ist das Element des Dramas. Das Spannungsfeld von Spiel und Erwartung ist die Ursituation, in der jedes Wort eines Theaterstückes steht. In diesen Raum ist es gestellt, hier muss es wirken, um zu sein.
Wer die Arbeit eines Theaterautors verstehen will, muss das Theater verstehen. Wer gar Dramatiker werden möchte, ist gut beraten, sein Gespür für das Dramatische in der konkreten Theatersituation zu schulen. Deswegen muss die Frage nach dem Drama und seiner Entstehung im Theater ansetzen. Es gibt keinen idealeren Ort für einen Dramatiker als den Zuschauerraum bei geschlossenem Vorhang, im Moment der Erwartungsspannung, der imaginativen Ruhe vor dem Sturm. Denn in diesem Moment stellen sich die entscheidenden Fragen nicht nur theoretisch, sie stehen im Raum, situativ, sinnlich, unweigerlich: Was soll passieren, wenn der Vorhang aufgeht? Was will ich jetzt und hier auf dieser Bühne gerne sehen? Was interessiert mich so sehr, dass ich hier auf diesem Stuhl anderthalb oder zwei Stunden ausharre und womöglich nach der Pause wiederkomme?
Nicht, dass ich all diese Fragen beantworten könnte, wenn ich anfange, ein Stück zu schreiben. Ich will auch keineswegs so tun, als hätte ich während der Arbeit am Text stets eine komplette Inszenierung vor Augen. Das ist so gut wie nie der Fall. Meine Theaterphantasie beim Schreiben hat zahlreiche Lücken, Leerstellen und Unschärfen. Ich kenne meist den Schauplatz, aber wie das Bühnenbild genau aussehen soll, könnte ich nicht sagen. Ich habe eine sehr präzise Vorstellung davon, wie sich diese oder jene Figur in dieser oder jener Situation verhalten würde, aber welche Kleidung sie anhat, ob sie dunkelhaarig ist oder blond, bärtig oder glatt rasiert – keine Ahnung. Manchmal habe ich einzelne Bilder im Kopf, Momentaufnahmen, Schnappschüsse, Traumsequenzen, manchmal schreibe ich ganze Szenen bilderlos und blind, mit nicht mehr als einem Gefühl für die Situation und den Konflikt, in dem die Figuren stehen.
Das hat nur unwesentlich mit meinem begrenzten Vorstellungsvermögen zu tun. Das Schreiben fürs Theater ist seinem Wesen nach eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Es ist weder möglich noch erstrebenswert, ein wasserdichtes, bis in alle Einzelheiten definiertes Theateruniversum am Schreibtisch zu entwerfen. Bei einem Roman als autonomem Kunstwerk sind Vollständigkeit und Geschlossenheit zumindest theoretisch denkbar. Ein Theaterstück dagegen ist essentiell offen, weil der künstlerische Prozess in dem Moment, in dem ich das letzte Wort schreibe, keineswegs zu Ende ist, sondern auf der Ebene der Regie, der Ausstattung, des Spiels etc. überhaupt erst beginnt und immer weitergeht, in jeder einzelnen Aufführung, jeden Abend, bis der letzte Vorhang fällt.
So mancher Perfektionist mag mit den vielen Unbekannten des Dramas hadern, aber gerade dieser Mangel an Kontrollierbarkeit macht die Besonderheit der theatralischen Sendung aus. Die Rezeption eines Romans findet statt, indem er gelesen wird, damit erfüllt sich seine Bestimmung. Ein Theaterstück wird auch gelesen, von Dramaturgen, Intendanten, Regisseuren, Schauspielern etc., aber bis es aufgeführt wird, den Zuschauer erreicht und sich der Kreis seiner Rezeption schließt, durchläuft es eine ganze Reihe von künstlerischen Prozessen, die nicht nur seiner »Umsetzung« dienen, sondern insbesondere die Lücken, Leerstellen und Unschärfen ausgestalten, die der Text offen lässt. Dadurch wird er immer weiter definiert und gedeutet, und zwar nicht nur »sekundär«, sondern originär, weil es für viele Inszenierungs-Entscheidungen, Bühnenbild-, Kostüm- und Spiel-Ideen gar keine Handhabe im Text gibt. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen einem Theaterstück und beispielsweise einer Partitur, die vom Dirigenten und Orchester auch interpretiert wird, bei der aber die Töne und Tempi, der Charakter und die Klangfarben der Instrumente weitgehend feststehen. Eine Partitur ist ein musikalisch hochdefiniertes System, ein Theatertext dagegen ist chronisch unterdefiniert und nicht mehr als eine vage Wegbeschreibung in Worten, Irrtum vorbehalten.
Wäre das Theater also eine »Afterkunst«, um ein böses Wort zu bemühen, müsste es regelmäßig kapitulieren, weil sich viele wesentliche Fragen, die sich im Laufe einer Produktion stellen, durch das Stück allein nicht klären lassen. Theaterarbeit ist ein komplexes Zusammenspiel verschiedenster künstlerischer Fähigkeiten und Temperamente, deshalb ist sie so verdammt schwierig und nur bedingt planbar, denn ihr Gelingen hängt nie von einem Einzelnen ab, sondern von einer Konstellation künstlerischer Kräfte.
Insofern ist Szenisches Schreiben ein Abenteuer der Genauigkeit und höchsten Intensität inmitten einer großen Unbestimmtheit, einer Vielfalt von Prozessen, Aspekten und Details, die keineswegs nur nebensächlich sind, zugleich aber die Definitionsmacht und Kontrolle des Autors übersteigen. Und die letzte große Unbekannte in dieser offenen Rechnung ist das Publikum – mit Betonung auf »unbekannt«. Denn auch wenn ich den Erwartungsmoment im Zuschauerraum so hervorhebe, bin ich keineswegs der Meinung, man solle beim Schreiben eines Stückes unentwegt an »den Zuschauer« denken. Gemeint ist lediglich das Bewusstsein für die Theatersituation, zu der das Publikum elementar gehört. Den Zuschauer im Einzelnen versuche ich mir beim Schreiben überhaupt nicht vorzustellen, und ich misstraue auch jedem Theatermacher, der behauptet, er kenne sein Publikum.
Aus Erfahrung kann ich nur sagen: Das Publikum macht, was es will, zum Wohl und Wehe so mancher Produktion. Denn anders als der Leser eines Romans, der das Buch zwar aus der Hand legen, aber nicht beeinflussen kann, ist das Publikum im Theater eine Macht. Es ist nicht nur Rezipient, sondern mit seinen Erwartungen und Reaktionen Teil einer sehr spürbaren Wechselwirkung, die über Gelingen oder Scheitern des Theaterabends entscheidet. Es kann, kurz gesagt, mitatmen oder husten, soll heißen: Entweder es geht mit den Figuren durch die Spannungs- und Entspannungsmomente der Aufführung, weint, lacht und hält in der Stille den Atem an oder es tut all das nicht und hustet.
Die Art und Weise, wie das Publikum mitspielt, wird im Fußball mit der Formulierung vom »zwölften Mann« umschrieben. Damit ist die Unterstützung der Heimelf durch ihre Fans gemeint, der berühmt-berüchtigte »Heimvorteil«. Einen solchen Heimvorteil gibt es durchaus auch im Theater: Gewisse Schauspieler – Publikumslieblinge, Lokalmatadore – haben es mitunter leichter, die Zuschauer für ihre Sache zu gewinnen. Hinzu kommt der Bekanntheitsfaktor bereits »durchgesetzter« Autoren oder Regisseure, der dem Publikum ein gewisses Vertrauen in die Qualität des Abends und damit auch eine höhere Frustrationstoleranz bei der teilweisen Nichterfüllung von Erwartungen einflößt. Insofern kann man auch im Theater vom Publikum als »zwölftem Mann« sprechen oder von »Heimspielen«. Und dennoch gibt es einen kategorialen Unterschied: Ein Fußballspiel kann auch ganz ohne Zuschauer ausgetragen werden und trotzdem ein Ergebnis haben – es gibt ja sogenannte Geisterspiele. Eine Aufführung ohne Publikum wäre dagegen vollkommen sinn- und ergebnislos. Denn, um im Bild zu bleiben, im Theater sieht der zwölfte Mann nicht nur zu, wie das eine oder andere Tor fällt, er ist das Tor.
Kleine Phänomenologie der Erwartung
Die Macht des zwölften Mannes im Theater zeigt sich in Form von Erwartungen. Ohne sie wären die Zuschauer ja gar nicht erst gekommen. Und jeder hat seine eigenen Erwartungen mitgebracht. Sie sind das Erste am Theaterabend und füllen den Raum, noch bevor das Bühnenbild ihn definiert und die Schauspieler ihn mit Text und Aktionen füllen. Im Moment ihres Auftritts treffen sie auf diese Erwartungen, treten mit ihnen in Dialog, spielen und ringen mit ihnen, versuchen die Führung über sie zu gewinnen, sie zu steuern, zu lenken. Und sollten die Zuschauer im schlimmsten Fall aufhören, etwas von dem Stück, der Inszenierung, den Schauspielern zu erwarten, ist der Theaterabend tot. Dann wandert das Publikum ab – nach innen oder durch die Saaltüren nach draußen.
Die Erwartung war immer schon da, sie ist der ewige Antagonist aller Theatermacher. Zu Shakespeares Zeiten stand am Anfang jeder Aufführung traditionell ein Prolog, der an den guten Willen der Zuschauer appelliert. In höflichen Versen bittet der Prologus um Nachsicht für die Unzulänglichkeiten von Spiel und Darstellung. Er schraubt die Erwartung des Publikums nach unten und fordert es zur Mitarbeit auf, durch Phantasie die Mängel der Aufführung wettzumachen.
In einem solchen Prolog werden gleich mehrere fundamentale Theatergesetze angesprochen. Zunächst einmal handelt es sich um eine ausdrückliche Anerkennung der Bedeutung des Publikums und seiner Beteiligung am Gelingen oder auch Scheitern der Aufführung. Der Zuschauer ist also nicht nur Adressat, sondern Teil des Gesamtkunstwerks Theater. Mit seinen Erwartungen und Entwürfen, mit der Aufmerksamkeit und Emotionalität, die er einbringt, fungiert er als Ko-Autor, Ko-Regisseur und Mitspieler der Aufführung. Gute Gründe, sich vorab seines Wohlwollens zu vergewissern.
DieErwartungderZuschaueristeinelebendige,schwerkalkulierbareGröße:Malspringtsieweitvoraus,malversteiftsiesichaufdasNächstliegende,mitunterformiertsiesichzueinerbreiten,geschlossenenFront,einerbeinahemilitantenForderungandasGeschehenaufderBühne,siekannsichaberebensogutspaltenundinzahlreicheEinzelerwartungenzerfallen,diesichkaummehrgreifenundzusammenführenlassen.ÜberdeneinzelnenTheaterabendhinauskönnensichErwartungenzuSehgewohnheitenverfestigen,dochgenausohäufigkommtesvor,dasssiesichgegendassattsamBekannteauflehnen,Unmuts-undÜberdruss-Reaktionenbewirken,wenndieStrickmustereinerAufführung,einesbestimmtenSchreib-oderInszenierungsstilszudurchschaubarwerden.ErwartungenbefördernundbeflügelngewisseTheatermoden,sorgenaberebensoschnellfürderenAbschaffung.ImGroßenundGanzenkannmansagen,dassdieBeweglichkeitundimmanenteNeugierderErwartungeinzuverlässigerMotorvonTheaterkrisenund-entwicklungenist.AusdiesemGrundtaugtauchkeineFormel,keinRezeptzumSchreibenvonTheaterstücken,zumindestnichtauflängereSicht.SobalddieMacharteinesStückesfürdenZuschauerzuvorhersehbarwird,hatesalsSpielvorlageausgedient.DenngenaudasmachtdieErwartungsounberechenbarlebendig,dasssieebennichtihreBestätigungoderErfüllungsucht –sprich:dasErwartbare –,sonderndieÜberraschung, das Unerhörte, die Erschütterung.
Die Differenz zwischen der Erwartung und dem, was gespielt wird, macht die Spannung eines Theaterabends aus. Tritt in einem fort das Erwartbare ein, ist die Spannung gleich null. Nur wenn die Erwartung immer wieder aufs Neue herausgefordert, gewendet und verwandelt wird, entsteht ebenjene Spannung der Differenz, wie wir sie beispielsweise von einem guten Krimi kennen: Schon am Anfang haben wir unsere Theorie darüber, wer der Mörder ist, wechseln unterwegs vielleicht ein paarmal unseren persönlichen Hauptverdächtigen, wären aber enttäuscht, wenn sich unser Verdacht am Ende voll bestätigt. Vielmehr wollen wir überrascht werden mit einer Lösung, die wir so nicht vorhergesehen haben, die aber wiederum dermaßen zwingend ist, dass es uns im Nachhinein so scheint, als hätten wir es wissen können, wissen müssen!
Dieses verhältnismäßig simple Krimi-Beispiel zeigt bereits, dass die Zuschauererwartung durchaus anspruchsvoll ist im Hinblick darauf, welche Überraschungsmomente, Wendepunkte und Auflösungen sie gelten lässt. Mit x-beliebigen Knall-Effekten gibt sie sich nicht zufrieden, sie verlangt Wenden mit einer Notwendigkeit, Überraschungen, die nicht willkürlich sind, sondern ihren Grund in der Geschichte haben und deren Lesart verändern, das Geschehen in einem anderen Licht erscheinen lassen. Denn auch im Krimi geht es um ein zentrales Theatermotiv, um den Unterschied von Schein und Sein. Es geht um die Erkenntnis von Gut und Böse, um Menschenkenntnis und damit in letzter Instanz um das delphische Motto: Erkenne dich selbst. Erkenne, wozu Menschen fähig sind. Erkenne, dass unsere alltägliche Lesart der Welt mit ihren vermeintlichen Sicherheiten ein sehr dünnes Eis ist, das jederzeit brechen kann, auch wenn im Krimi wie im Märchen am Ende immer das Böse bestraft wird und das Gute siegt. Fast immer.
Im Theater ist das Spiel mit der Erwartung noch komplexer, schon allein weil die Fragestellung eines Stückes bzw. einer Aufführung in der Regel nicht auf eine so einfache Formel zu bringen ist wie das »Whodunnit« des Krimis, sprich auf die Frage: Wer hat’s getan, wer ist der Mörder? Insofern lässt sich aus der Feststellung, dass die Differenz von Erwartung und Bühnengeschehen die Spannung eines Theaterabends ausmacht, kein Rezept fürs Stückeschreiben ableiten. Die einzige Maxime, die nach meiner Arbeitserfahrung daraus folgt, ist mehr oder weniger ein Gemeinplatz: Der Autor sollte seine Geschichte und ihre Möglichkeiten, die verschiedenen Lesarten und Winkel, von denen aus man sie betrachten und unterschiedlich deuten kann, durchdrungen und durchgespielt haben, er sollte sie so gut wie möglich kennen – besser jedenfalls als der Zuschauer. Denn nur aus einem tieferen Verständnis des Konflikts und der Figuren heraus lässt sich auf eine Weise mit Erwartungen spielen, die nicht effekthascherisch ist, nicht mit Wirkungen ohne echte Ursache jongliert.
Das Spiel mit der Erwartung kann viele verschiedene Formen annehmen. Das Spektrum reicht vom Grundgestus der Provokation auf der einen Seite bis zu dem der Verführung auf der anderen. Man kann den Erwartungshaltungen der Zuschauer konfrontativ oder gar aggressiv begegnen, ihnen Härten zumuten, sie vor den Kopf stoßen, Tabus brechen oder zu brechen versuchen und nach Möglichkeit gar einen Skandal heraufbeschwören. Man kann aber auch mit der Erwartung flirten, sie reizen und aus der Reserve locken, sie zu einer Reise einladen, die an Punkte führt, die sie sich nicht hätte träumen lassen, auch an Abgründe von Schmerz und Erschütterung. Selbstverständlich gibt es die unterschiedlichsten Abstufungen und Mischformen von Provokation und Verführung, Peitsche und Zuckerbrot, Aggressivität und Zugewandtheit, mitunter an ein und demselben Theaterabend.
Die Metapher vom Flirt beschreibt recht gut, wie vielfältig und facettenreich das Spiel mit der Erwartung sein kann und muss. Vor allem aber darf es sich nicht als Strategie oder Masche selbst entlarven – nach dem leider sehr treffenden Motto: »Man merkt die Absicht, und man ist verstimmt.« Die Mittel, die bei Flirt und Verführung eingesetzt werden, dürfen eben gerade nicht nur als Mittel zum Zweck erscheinen, was übrigens auch für die Provokation gilt. Es muss wie im wirklichen Leben etwas Echtes, Ernsthaftes, »Ehrliches« dahinter aufscheinen und erkennbar sein, der eigentliche Kern. Ebendiesen Kern darf man nicht aus den Augen verlieren, wenn man über Strukturen und Techniken des Erwartungsspiels spricht. Auf ihn kommt es an, er wird nach Abzug aller Mittel schlussendlich gewogen und darf nicht für zu leicht befunden werden. Mit anderen Worten: Sämtliche schreibtechnischen Raffinessen, alle Tricks, Kniffe und Kunstgriffe taugen nur, wenn sie etwas ermöglichen, was darüber hinaus geht und nicht wieder nur Trick, Kniff oder Kunstgriff ist. Gerade das gerät bei der Lektüre von so manchem dramaturgischen Lehrbuch oder Schreibschulen-Regelwerk schnell in Vergessenheit.
Unterm Strich ist jedes Stück, sei es noch so kunstvoll gemacht, noch so virtuos geschrieben, nur so gut wie seine Figuren und deren Geschichte. Das heißt: Man kann eine gute Geschichte schlecht erzählen, so dass sie weit unter ihren Möglichkeiten bleibt – und durch beharrliche Arbeit am richtigen Ausdruck, an der ihr gemäßen Erzählweise kann man ihre spezifische Qualität zur Geltung bringen. Umgekehrt aber kann man eine schwache Geschichte so kunstvoll und raffiniert erzählen, wie man will, es bleibt immer eine schwache Geschichte, und das Publikum wird am Ende des Abends mit einem hohlen Gefühl im Bauch nach Hause gehen, so als hätte es zu viel Süßes gegessen und zu wenig Ballaststoffe zu sich genommen.
Diese Grenzen des Technischen vor Augen will ich an einigen Beispielen zeigen, auf welche Weise die Erwartung allabendlich mitspielt – im Detail wie im Gesamtzusammenhang. Versteht man die Spannung eines Theaterabends als das Zusammenspiel von Erwartung und Differenz, so kann man grob zwischen Mikro- und Makro-Spannung unterscheiden, denn der Zuschauer entwickelt sowohl eine Erwartung im Hinblick darauf, was dieser Schauspieler hier auf der Bühne gleich sagen oder tun wird, als auch eine Vorstellung davon, worauf der Abend im Großen und Ganzen hinausläuft. Das heißt, die Erwartung hat gleichsam zwei Vektoren: Was passiert als Nächstes, und was passiert insgesamt? Solch ein zweifacher, kurz- und langfristig abgesteckter Erwartungshorizont ist nichts Theaterspezifisches, wir kennen diese doppelte Optik aus dem Leben, wo wir einerseits ständig mit dem Nächstliegenden beschäftigt sind, sprich der Frage, was kommt jetzt, wie auch mit der Gesamtperspektive, worauf unser Leben überhaupt zusteuert. Diese beiden Betrachtungsweisen beeinflussen und färben einander wie Text und Kontext. Glaube ich, dass es mit meinem Leben immer weiter aufwärtsgeht, erwarte ich meist auch auf kurze Sicht Gutes oder zumindest lösbare Probleme, geht es insgesamt abwärts, rechne ich auch im nächsten Moment mit dem Schlimmsten.
Nehmen wir uns zunächst die Mikro-Perspektive vor: Wann immer ein Schauspieler einen Satz anfängt, entsteht im Kopf des Zuschauers eine mal deutliche, mal diffuse, bewusste oder halb bewusste Erwartung, wie dieser Satz weitergehen könnte, was die Figur sagen will und wird. Interessant ist die Abweichung. Natürlich nicht um jeden Preis und auch nicht jederzeit, sonst würden nur Verwirrung und Orientierungslosigkeit herrschen. Damit eine Abweichung als solche überhaupt kenntlich, das heißt, nachvollziehbar und erlebbar wird, muss sich ein Weg abzeichnen, muss eine Spur gelegt sein. Es muss sich sozusagen etwas anbahnen, erst dann entfaltet die Abweichung ihre volle Wucht. In George Taboris Stück »Jubiläum« sitzt eine junge Jüdin auf einem Grabstein und sagt mit Blick auf so viel Tod und Zerstörung ringsum: »Also, ich finde das Leben … och ja.« In diesem Moment und Kontext hätte man von ihr jede Aussage erwartet, nur die nicht. Auch hat Tabori die Auslassungspunkte im Sinne einer kurzen Pause und Verzögerung genau so gesetzt, dass Platz ist für alle möglichen Erwartungen, wie dieser Satz weitergehen könnte – um dann von ihnen abzuweichen. Und doch ist dieser Satz ein Beispiel dafür, wie begründet eine Überraschung sein kann und muss, wie zwingend auf den zweiten Blick. Denn – im Nachhinein betrachtet – wäre alles andere als dieses »och ja« am Satzende fatal gewesen. Eine Figur auf einen Friedhof zu setzen und sagen zu lassen, »ich finde das Leben … furchtbar«, ist einigermaßen tautologisch, ihr umgekehrt den Text zu geben, »ich finde das Leben … schön«, wäre nicht minder platt.
Die Auslassungspunkte in diesem Satz markieren genau den Moment der Erwartungsspannung. Im Kopf des Zuschauers entsteht die Frage: Wie findet eine junge Jüdin auf einem Grabstein das Leben? – Antwort: »Och ja.« Diese Abweichung von dem Erwartbaren macht die spielerische Differenz aus, die uns als Zuschauer überrascht, aufmerken lässt und dazu bringt, dieser Figur mit gesteigertem Interesse zu folgen. In dem konkreten Beispiel hat der Moment von Mikro-Spannung wenig mit dem Fort- und Ausgang der Geschichte zu tun, er steht nur sehr lose und indirekt in Beziehung zur Makro-Spannung, dem Spannungsbogen des Theaterabends insgesamt. Es gibt aber durchaus Momente der Mikro-Spannung an Dreh- und Angelpunkten des großen Spannungsbogens – Momente, in denen Mikro- und Makro-Spannung zusammenfallen, weil sie an Scheidewegsituationen, Wende- und Schlusspunkten stehen, die für die Richtung des Stückes ausschlaggebend sind.
SozumBeispielamEndevonIbsens»NoraoderEinPuppenheim«.DerSpannungsbogenimGroßenundGanzenließesichsoumschreiben:WirsehenanfangseineunerträglichangestrengteFamilien-IdyllekurzvorWeihnachten,beiderganzoffensichtlichetwasnichtstimmt,speziellwennesumdasThemaGeldgeht.SchonbalddrängtsichdieFrageauf,wielangekannNoradieseLügevoneinerglücklichenEhenochaufrechterhalten?WannkommtdieWahrheitansLicht,dasssie,ausLiebezuihremMannundumihminschwerenZeitenzuhelfen,GelddurchUrkundenfälschungbeschaffthat?Jetzt,daihrMannBankdirektorgewordenist,klopftdievergangeneSchuldinGestalteinesMitwissersundErpressersandieTür.Das,wasNoradieganzeZeitzuverhindernversucht,trittunweigerlichein,ihrMannHelmererfährtvonderSache.SeinelangundbangerwarteteReaktion?Erverstößtsie.InNorasTatsiehtHelmerkeinenBeweisihrerLiebe,sonderneinVerbrechen.DannkommtdieüberraschendeWende:DerErpressergibtauf,liefertdasbelastendeBeweisstückab,dieWeltscheintwiederinOrdnung.HelmerwillseineEheretten,willNorazurück,allessollwiederseinwiefrüher.Dochwiewirdsiejetztreagieren?AllesspitztsichaufdiefinaleFragezu:BleibtNora,odergehtsie?EsisteinedermeistdiskutiertenScheidewegsituationenderTheatergeschichte,dieseitmehralshundertJahrenZuschaueraufderganzenWeltinAtemhält,aufgeladenmitErwartungsenergieundEmotionenwiekaumeineandere,einShowdowndesGeschlechterkampfs,einemoralische,emanzipationspolitischeFrage.
Es folgen die finalen Sätze. Helmer will von Nora wissen, was eine Trennung verhindern könnte, und Nora antwortet ihm: »Dann müsste ein Wunder geschehen. Dann müsste mit uns beiden, mit dir und mir, eine solche Veränderung vorgehen, dass – « Sie bricht ab, und Helmer fragt nach, was denn dieses Wunder wäre – wie sämtliche Zuschauer im Stillen mit ihm. »Dass aus unserem Zusammenleben eine Ehe wird«, sagt Nora und verlässt den Raum. Ein erschütternder Satz, weil sie sich damit über die Kampfzone der Vorwürfe und Schuldzuweisungen erhebt und die schmerzliche Erkenntnis formuliert, dass das, was sie und Helmer all die Jahre gelebt haben, eine Lüge und keine Ehe war. Damit geht sie nicht nur einen wesentlichen Schritt über Helmer, sondern auch über sich selbst hinaus. Denn sie entlarvt das, wofür sie ihr ganzes bisheriges Leben gekämpft hat, als ein Puppenheim der Lüge und des Selbstbetrugs.
Um den Moment genau zu beschreiben: Der Satzanfang stellt die Frage in den Raum, welches Wunder, welche Veränderung die Ehe von Helmer und Nora noch retten könnte? Sie ist nahezu deckungsgleich mit der Makro-Spannungsfrage: Geht sie, oder bleibt sie? Noras Antwort lautet: Wir hatten gar keine Ehe, und es müsste ein Wunder passieren, damit aus unserem Zusammenleben jemals eine Ehe wird. Auf der Ebene der Mikro-Spannung geht Nora mit diesem Erkenntnisschritt über das Erwartbare hinaus: Von so weit oben, mit einer solchen Distanz hat bisher noch keine Figur im Puppenheim auf ihr Leben geblickt. Doch diese Abweichung ist erst eine Teilantwort auf die große Frage Gehen oder Bleiben. Die Makro-Spannung ist keineswegs schon erlöst, denn Erkennen heißt nicht Handeln. Und es könnte ja sein, dass Nora wider besseres Wissen doch an dieses »Wunder« glaubt oder glauben will und sich nicht von Helmer trennt.
Insofern gibt es keinen Satz, der die Makro-Spannung zu Ende führen kann, da es in letzter Instanz weniger auf das ankommt, was Nora sagt, als auf das, was sie tut. Das weiß niemand besser als Ibsen selbst. Er lässt Nora gar nichts mehr sagen, sie geht laut Regieanweisung aus dem Zimmer. Aber verlässt sie auch ihren Mann, verlässt sie wirklich das Haus? Helmer horcht ihren Schritten nach, an der Frage verzweifelnd, die sich auch der Zuschauer stellt: Geht sie endgültig? Einen Moment ist es still. Dann fällt laut Ibsen »donnernd« die Haustür ins Schloss – Vorhang. Damit wäre die Makro-Spannungsfrage mit einem sehr deutlichen Zeichen entschieden. Nora geht.
Doch das Spiel mit der Erwartung hat den Theatermachern keine Ruhe gelassen und sie immer wieder zu einer Neubefragung von Noras Geschichte und Entscheidung gereizt. Kaum eine Inszenierung, die nicht eine eigene Antwort auf die Nora-Frage sucht – abweichend von der des Autors und gegen die Logik der Erwartung, dass Noras Erkenntnis auch zu einer entsprechenden Handlung führen müsste. Es gibt Aufführungen, in denen wir mit Helmer in die Stille horchen und glauben, Nora ist gegangen – dann steht sie plötzlich wieder im Raum. Ist sie zu ihm zurückgekehrt? Hat die Geschichte damit ein Happy End, oder geht die Verstellungsqual im Puppenheim immer so weiter? Ist es nicht gar die schlimmstmögliche Wendung, wenn Nora bleibt? In anderen Inszenierungen wird der Weggang Noras nochmals dramatisiert und zugespitzt, indem man am Ende nicht eine Tür donnernd ins Schloss fallen hört, sondern einen Schuss. Nora geht – aus dem Leben. Und viele Regisseure entscheiden sich nach dem Durchspielen der verschiedensten Möglichkeiten für den offenen Schluss, das Ausbleiben einer abschließenden Antwort, die letztlich ohnehin nicht der Moment, sondern nur die Zeit geben kann. Helmer horcht Nora nach. Es ist still, es bleibt still. Steht sie hinter der Tür? Hat sie lautlos das Haus verlassen? Helmer und wir als Zuschauer wissen es nicht. Über der Stille gehen die Lichter aus. Dunkel.
The unanswered question
Das Nora-Finale zeigt deutlich die Frage-und-Antwort-Struktur des Erwartungsspiels. Demnach könnte man sagen, das Drama ist eine Konflikterzählung in Frage-Schritten, denen der Zuschauer mit seinen Erwartungen folgt, um von den Antworten des Geschehens überrascht, widerlegt oder bestätigt zu werden. Wird die zentrale Frage beantwortet oder bewegt sie sich nicht weiter, ist das Stück zu Ende. Doch bis dahin wird es immer nur Teilantworten geben oder solche, die weitere Fragen nach sich ziehen, so dass die Frage-Energie und damit die Erwartungsspannung der Geschichte sich nicht auflöst, sondern zu neuen Fragestellungen umformt bzw. umformuliert. Auf diese Weise bleibt immer ein Frage-Rest, eine Unruhe im Spiel, die sich wie bei »Nora« zu einer finalen Frage zuspitzt.
Das Bewusstsein dafür ist wesentlich beim Schreiben eines Stückes oder einer Szene: Welche Frage entsteht, welche Teilantwort wird gegeben, welche Wendung und Entwicklung nimmt die Fragestellung? Es macht gewissermaßen das Gespür fürs Dramatische aus, den zu verhandelnden Konflikt zur Frage zwischen den Figuren in der jeweiligen Situation werden zu lassen und seine Dynamik in eine Schritt- bzw. Stufenfolge von Fragen und Teilantworten, Erwartungen und Abweichungen zu verwandeln. Insoweit sich diese Fragen auch dem Zuschauer stellen, wird er sich auf der Suche nach Antworten mit dem Stück bewegen, wobei er ihm mit seinen Erwartungen immer auch vorauseilt, ja, nicht selten erlebt man Theaterabende, in denen die Zuschauer schneller sind als die Aufführung.
Die Erwartungen auf der Zuschauerseite sind Vorausprojektionen: das, was wir kommen sehen. Insofern steckt in der Rezeptionssituation des Theaters eine hohe Dynamik. Denn Rezeption bedeutet immer auch Antizipation. Und die Geschwindigkeit der Antizipation hat sich aufgrund der Seherfahrungen von Video und Filmschnitt usf. in den letzten Jahrzehnten spürbar erhöht. Man muss diese Sehgewohnheiten des beschleunigten Zuschauers von heute deswegen keineswegs bedienen. Aber man kann die Frage-Antwort-Schritte eines »gut-gebauten« Ibsen-Stückes auch nicht mehr so durchdeklinieren wie früher. Vieles, was an ihnen »anachronistisch« wirkt, hat mit einer veränderten Erwartungsgeschwindigkeit des Zuschauers zu tun.
An den meisten Ibsen-Stücken kann man mustergültig studieren, wie der Autor die Fragestellung des Konflikts, ihre Schritt- und Stufenfolge so aufbaut, dass sich die stücktreibende Frage in jeder Szene neu konfiguriert, dass ihre verschiedenen Aspekte Gestalt annehmen und dass sie dabei genügend Kraft und Dynamik entfaltet, um sich immer weiter zu verwandeln und zu verschärfen. Man kann die Bewegung eines Stückes als die Durchdringung, die szenische Auffächerung und Vertiefung einer Frage betrachten, ihre Engführung und Zuspitzung auf ihren dringlichsten, schmerzlichsten, persönlichsten Punkt – auf die menschliche Katastrophe des Tragischen oder auch des Komischen. Genau in dieser Verdichtung der Ausgangsfrage auf den Einzelfall, das Individuelle, Figürliche besteht die spezifische Qualität des Dramas, sein Erkenntniswert im Unterschied zur philosophischen Abhandlung. Es geht gleichsam den umgekehrten Weg: Anstatt zu verallgemeinern, sucht es das Besondere. Seine Bewegung ist nicht die immer größere Abstraktion, das Absehen von Umständen und Personen, sondern die maximale Konkretion und Fokussierung auf ebendiese Personen und ihre Situation bis hin zur Fleischwerdung und Verkörperung durch den Schauspieler – mit dem Ziel nicht der Allgemeingültigkeit, sondern der Gültigkeit des Besonderen.
Was ich von Ibsen gelernt habe, ist nicht der »Realismus«, für den er berühmt geworden ist, sondern ganz grundsätzlich das Spiel vom Fragen: Wie mache ich als Theaterautor mein Thema zur spezifischen Frage meiner Figuren, wie mache ich aus einem politischen, moralischen oder gesellschaftlichen Problem die individuelle Frage einer Figur, eine »Nora-Frage« sozusagen, und wie schaffe ich es, dass sich diese Frage auch für die Zuschauer am Abend auf die allerpersönlichste Weise stellt?
Das ist sehr allgemein formuliert. In der Schreibpraxis ist der konkrete Einzelfall, sind potentielle Figuren und Bruchstücke von Geschichten meist schon vorhanden. Es geht dabei also weniger ums Erfinden als ums Finden und Zusammenführen von Konkretem. Denn der Antrieb oder Einfall für ein Stück entsteht so gut wie nie aus einer abstrakten Fragestellung. Auslöser kann alles Mögliche im Leben sein: ein Satz, den man im Vorbeigehen aufschnappt, eine Zeitungsnotiz, die Faszination für eine Person, die Erfahrung oder Beobachtung einer Extremsituation, Ängste, Krisen und Katastrophen aller Art, soll heißen, der Ausgangspunkt selbst ist in der Regel überaus konkret. Und dennoch ist es oft hilfreich, sich grundsätzlich darüber klar zu werden, welche Frage die Wurzel des eigenen Interesses an einem Stückvorhaben bildet: Warum interessiert mich das so? Was suche ich eigentlich in dieser Geschichte? Und worin besteht das Ungelöste, möglicherweise Unlösbare ihrer immanenten Fragestellung?
Überprüft man seinen Stoff unter diesen Gesichtspunkten, ist es möglich, die Frage-Antwort-Schritte des Stückgeschehens insgesamt klarer zu strukturieren. Die zentrale Suchbewegung des Dramas von Szene zu Szene nimmt Gestalt an. Und man bekommt eine Vorstellung davon, auf welche Weise sich die kinetischen Energien von Erwartungsspannung und Differenz im Raum entfalten könnten – wenn sie sich entfalten.
Auf der Mikro-Ebene des einzelnen Moments heißt das, dass sich jede Replik eines Dialogs bzw. jede Handlung auf der Bühne zur vorhergehenden wie zu einer Frage verhält. Das gesamte Geflecht von Aktion und Reaktion, sei es mit Worten oder Taten, hat den Charakter eines Frage-Antwort-Spiels, das allerdings nur dann weitergeht, wenn der Antwortende mit seiner Replik oder Reaktion den Fragenden wiederum herausfordert.
Das treffendste Bild dafür ist ein Tischtennis-Match: Ping schlägt auf, Pong muss parieren. Wenn er den Ball nicht zurückspielt, ist der Schlagabtausch zu Ende. Das Spiel kommt nur in Gang, wenn Pong den Ball annimmt, also mit einer Reaktion auf die Aktion seines Gegenübers antwortet, und dabei so retourniert, dass er Ping wiederum zu einer Gegenreaktion zwingt und so weiter. Die Makro-Frage in diesem Beispiel lautet schlicht: Wer gewinnt? Doch bis die große Frage nach dem Sieger ausgespielt ist, entstehen bei jedem Ballwechsel zahlreiche Mikro-Fragen: Schmettert oder schnibbelt Pong, spielt er kurz oder lang, hat er die Schwachstelle in der Rückhand ausgemacht, und attackiert er sie, oder verteidigt er blind um sein Leben …? Als Autor einer Szene, eines Dialogs entwerfe ich gewissermaßen ein solches Tischtennisspiel und bestimme seinen Charakter und Verlauf: Stehen sich zwei annähernd gleichstarke Spieler gegenüber? Wie groß ist das Status- und Macht-Gefälle? Wer greift an, wer verteidigt? Wer hat welche Reaktionsmöglichkeiten oder Reserven? Wie viel Taktik ist im Spiel? Kann einer von beiden vielleicht nicht mehr? Geraten sicher geglaubte Positionen ins Wanken? Bröckelt das Überlegenheitsgefühl, das Selbstbewusstsein des schon sicher geglaubten Siegers? Wendet sich bei diesem Ballwechsel womöglich das Blatt? …
Nicht nur aus Autorensicht ist die Tischtennis-Metapher recht ergiebig. So mancher Regisseur nimmt sie wörtlich und lässt auf der Probebühne eine Tischtennisplatte aufstellen, gerade bei Dialogstücken. Auf diese Weise können die Dialogpartner das Zusammenspiel mit- und gegeneinander trainieren, sich auf das Aktion-Reaktion-Spektrum ihres Gegenübers einspielen und üben, schnell anzunehmen, direkt zurückzuspielen und wirklich aufeinander zu reagieren – auch auf Unvorhergesehenes, Überraschendes –, anstatt nur so zu tun als ob.
Der Moment der Mikro-Spannung in diesem Beispiel umfasst die Sekundenbruchteile, während derer der Tischtennisball in der Luft ist, bevor der Spieler unsere Erwartungen darüber, was als Nächstes geschieht, mit der darauffolgenden Aktion erfüllt, übertrifft oder enttäuscht. In diesem Moment ist alles möglich, ein ganzes Antwort-Spektrum tut sich auf: Und je nachdem für welche Reaktion oder Replik sich der Spieler entscheidet, korrigieren wir nicht nur unsere Erwartung, sondern auch unser Bild von dem Spieler selbst, seinem Profil und Charakter, seiner Disposition, seinen Möglichkeiten und Zielen.
Dieses Höchstmaß an Wachheit, Kombinationsfähigkeit und Gedankenschnelligkeit, das ein so temporeiches Spiel wie Tischtennis einem als Spieler wie als Zuschauer abverlangt, wünsche ich mir beim Stückeschreiben. Es geht in jedem einzelnen Moment darum, auf der Höhe der Situation zu sein, die ganze Bandbreite der Reaktionsmöglichkeiten im Blick zu haben und unter all den erwartbaren und überraschenden Antworten die schlagende zu finden, die nicht nur womöglich das Spiel entscheidet, sondern auch dem Charakter des Spielers entspricht. Dann, schon im nächsten Moment, habe ich als Autor ein Problem. Ich wechsele die Seiten, stehe plötzlich an der Tischtennisplatte der Figur gegenüber, die ich eben noch mit meinem ganzen Können ausgestattet habe, und muss den Ball, den ich gerade voller Wucht und Raffinesse kaum erreichbar übers Netz gespielt habe, wieder retournieren. Dafür bleiben mir wiederum nur einige Sekundenbruchteile Zeit … Und immer so weiter.
Einen guten Dialog, eine starke Partnerszene zu schreiben, ist wie Tischtennisspielen gegen sich selbst – mit dem festen Vorsatz, sich bei diesem Match nichts zu schenken, nichts zurückzuhalten. Dialogschreiben ist ein Endspiel am Schreibtisch, bei dem es darum geht, sich selbst in jedem einzelnen Moment alles entgegenzusetzen, immer hart an der Grenze des Nichtmehrweiterwissens, Nichtmehrkönnens entlang. Die Schizophrenie dieser Aufgabe besteht darin, während des Ballwechsels radikal von Subjektive zu Subjektive zu springen und sich so restlos wie möglich in die jeweilige Figur hineinzuversetzen, die gerade dran ist. Bin ich Pong und ist der Ball auf dem Weg zu mir, muss ich den Moment mit sämtlichen Handlungsmöglichkeiten aus seiner Sicht und Situation heraus erfassen, um dann das Egoistischste und Rücksichtsloseste zu tun, was Pong für seine Zwecke tun kann. Das heißt, ich muss mit einer Reaktion oder Replik aufwarten, die es Ping denkbar schwer, wenn nicht gar unmöglich macht, den Ball seinerseits wieder zurückzuspielen. Ich darf ihm keine Chance lassen! Also versuche ich, meinen Schlag so zu platzieren, als wäre es der allesentscheidende letzte – um dann im nächsten Moment wieder Ping zu sein, der zusehen muss, wie er aus den Schwierigkeiten, in die Pong ihn gebracht hat, herauskommt. Auf diese Weise wechsele ich von einer Seite der Tischtennisplatte zur anderen, von Spieler zu Spieler, Problem zu Problem, und kann nur hoffen, dass die Not, in die ich mich dabei jedes Mal bringe, erfinderisch macht.
Schizophrenie als Methode
Die Schizophrenie des Dialogschreibens setzt voraus, dass ich an beiden Figuren starken Anteil nehme bzw. habe, eine emotionale, persönliche Verbindung zu ihnen herstellen kann. Denn das Schreiben eines guten Dialogs ist ein ständiges, strapaziöses Wechselspiel von Nähe und Distanz, Außensicht und Innensicht, Einsteigen und Aussteigen in die jeweilige Figur. Nur wenn ich mir ihre Subjektive immer wieder radikal zu eigen mache, wird es mir als Autor gelingen, mich selbst zu überraschen, meine eigenen Erwartungen zu übertreffen oder zu unterlaufen – aus dem Gespür für die Figur und den Moment heraus, für das, was in dieser Situation an Möglichkeiten in der Luft liegt. Und das ist oft mehr, als man sich am Anfang eines solchen Schlagabtausches träumen lässt.