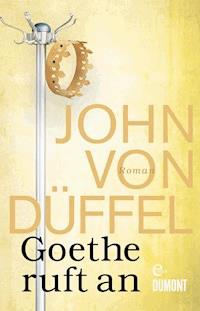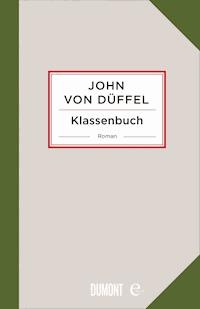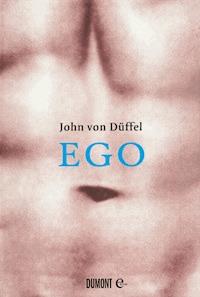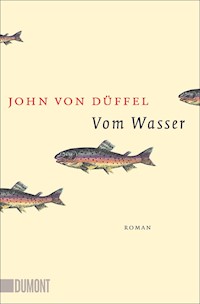19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
»Der erste Asket der Zukunft, der mir je begegnet ist, war eine Frau«, schreibt John von Düffel in seinem viel gelesenen Stundenbuch ›Das Wenige und das Wesentliche‹. Diese Frau, die Schottin Fiona, damals eine Philosophiestudentin, sucht er nun nach Jahrzehnten wieder auf. Im Gepäck hat er viele Fragen, die er mit ihr auf langen Stadtwanderungen in intensiven Gesprächen weiterdenkt: Wie leben wir richtig? Was ist das Wesentliche in einer Welt des Überflusses? Wie viel Konsumverzicht ist möglich? Und: Was hat das mit Freiheit zu tun? Zwei Tage verbringen sie zusammen in Edinburgh. Und es entwickelt sich daraus ein Gedankenaustausch über die zentralen Fragen unserer Zeit. Es folgt ein Briefwechsel, der nicht nur nach Antworten sucht, sondern auch Rätsel aufgibt. Wer genau ist Fiona eigentlich und wie ist ihr Leben seit dem Studium verlaufen? Eine Geschichte über die Angst vor Veränderung, den Mut zur Abweichung und die Frage nach dem Einsamen und dem Gemeinsamen: Solitaire oder Solidaire?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Ähnliche
Der erste Asket der Zukunft, der John von Düffel begegnet ist, war eine Frau. Diese Frau, die Schottin Fiona, eine Arbeitertochter aus Glasgow, wollte damals nach ihrem Philosophiestudium vor allem eins: auf einem Stein sitzen und denken. Jetzt sucht er sie nach Jahrzehnten wieder auf, im Gepäck viele Fragen nach dem richtigen Leben im Falschen, denen er mit ihr auf langen Spaziergängen nachgeht. Es entwickelt sich ein sehr persönlicher Austausch über die zentralen Themen unserer Zeit: Konsumverzicht und Einsamkeit, soziale Herkunft und Freiheit. Doch die Begegnung ist nicht nur von einer Suche nach Antworten geprägt, sondern auch von neuen Rätseln …
Eine Geschichte über die Angst vor Veränderung, den Mut zur Abweichung und die Frage nach dem Einsamen und dem Gemeinsamen: Solitaire oder Solidaire?
© Birte Filmer
John von Düffel wurde 1966 in Göttingen geboren, er arbeitete als Dramaturg u.a. am Thalia Theater Hamburg sowie am Deutschen Theater Berlin und ist Professor für Szenisches Schreiben an der Berliner Universität der Künste. Seit 1998 veröffentlicht er Romane, Erzählungsbände sowie essayistische Texte bei DuMont, u.a. ›Vom Wasser‹ (1998), ›Houwelandt‹ (2004), ›Wassererzählungen‹ (2014), ›Klassenbuch‹ (2017), ›Der brennende See‹ (2020), ›Wasser und andere Welten‹ (Neuausgabe 2021), ›Die Wütenden und die Schuldigen‹ (2021) und zuletzt ›Das Wenige und das Wesentliche‹ (2022). Seine Werke wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.
John von Düffel
Ich möchte lieber nichts
Eine Geschichte vom Konsumverzicht
Von John von Düffel sind bei DuMont außerdem erschienen:
Vom Wasser
Zeit des Verschwindens
Ego
Houwelandt
Beste Jahre
Wovon ich schreibe
Hotel Angst
Goethe ruft an
Wassererzählungen
KL – Gespräch über die Unsterblichkeit
Klassenbuch
Der brennende See
Wasser und andere Welten
Die Wütenden und die Schuldigen
Das Wenige und das Wesentliche
E-Book 2024
© 2024 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Satz: Angelika Kudella, Köln
E-Book Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-7558-1056-8
www.dumont-buchverlag.de
Für die Ermutigung und viele wertvolle Hinweise danke ich Claudia Bousset, ihrem Team sowie den Gastgeberinnen, Gastgebern und Gästen des Salonfestivals. Ohne die Werkstattlesungen aus dem noch unfertigen Manuskript, die Begegnungen und Gespräche über Fiona im Salon wäre dieses Buch nicht das geworden, was es ist.
Du hast Angst, sagt Fiona, Angst vor Veränderung. Dabei veränderst du dich ständig, mal schneller, mal langsamer, aber meist so allmählich, dass du es nicht merkst, sagt sie. Doch dann, irgendwann, begegnest du jemandem wie mir, den du lange nicht gesehen hast. Oder du stellst auf einmal fest, dass die Kinder groß sind und das Haus verlassen. Du gehst in deinem Viertel durch die Straßen, und dir fällt auf, dass von den Geschäften, in denen du früher eingekauft hast, kaum mehr eins übrig ist, und du bleibst stehen und siehst im Schaufenster eines Apple Stores das Spiegelbild einer Person, die deine Mutter sein könnte oder dein Vater oder beide zusammen. Und dabei wolltest du nie werden wie sie. Du hast dir so viel eingebildet auf all das, was du anders gemacht hast, auf deine Entscheidungen, deine Wege und Abweichungen von den Mustern der Familie. Es waren die kleineren und größeren Revolten, von denen du glaubtest, dass sie dich ausmachen, weil du es glauben wolltest, Veränderungen, die einen Unterschied machen sollten. Und sie haben einen Unterschied gemacht, für dich. Doch sie sind nur ein ganz kleiner Teil der großen Veränderung. Alles verändert sich, deine Arbeit, dein Leben, dein Freundeskreis, die Luft, die du atmest, die Nachrichten, die du konsumierst, das Wetter, die Welt. Dein Körper verändert sich, deine Art zu denken, sogar deine Angst vor Veränderung verändert sich. Und wenn dir das bewusst wird, merkst du vielleicht irgendwann, dass es keinen Sinn hat, dagegen anzukämpfen. Und noch viel weniger, sich davor zu fürchten. Du solltest vielmehr Angst vor der Nichtveränderung haben. Nichtveränderung ist der Tod.
ZWEI TAGE IN EDINBURGH
AUF KEINEM STEIN
Ich treffe Fiona in Edinburgh nach einer langen Fahrt durch hügelige Heidelandschaften, im Abteilfenster der bewegte schottische Himmel, Wolkenzüge mit anderen Destinationen, denen ich nachsehe, bis sie verschwinden hinter Vorstädten, Gewerbeparks, Brücken und Tunneln auf der schlingernden Einfahrt in Waverly Station. Beim Aussteigen bahne ich mir den Weg durch das Gewirr von Pendlern und Rollkoffer-Reisenden. Verhallende Lautsprecherdurchsagen, die mich nichts mehr angehen. In meiner Erinnerung war die Ankunft unter den Glasdächern von Waverly ein Weltenwechsel, jetzt ist es wie überall.
Es regnet nicht, als ich ins Freie trete, auch das ist anders als früher. Ich werfe einen Blick auf die Turmuhr vom Balmoral Hotel und beeile mich. Dann fällt mir ein, dass sie angeblich immer drei Minuten vorgeht, damit die Reisenden ihre Züge nicht verpassen. Ich nehme mir nicht die Zeit für einen Uhrenvergleich, ich will Fiona nicht warten lassen – und schüttle den Kopf über meine eigene Ungeduld: Was sind drei Minuten, wenn man sich fünfunddreißig Jahre nicht gesehen hat.
Wir sind in den Princes Street Gardens verabredet, am Denkmal von Sir Walter Scott, ganz in der Nähe. Fiona und ich waren nicht sicher, ob wir uns unter den Ankommenden und Abreisenden am Bahnsteig wiedererkennen würden. Unsere letzte Begegnung liegt ein halbes Leben zurück. Und wir waren uns damals schon fremd – sie, die jüngste Tochter einer kinderreichen Arbeiterfamilie aus Glasgow, ich, ein Lehrersohn aus der norddeutschen Provinz –, fremd in vielerlei Hinsicht, außer in Gedanken.
Fiona und ich haben beide an der University of Stirling Philosophie studiert und in denselben Seminaren gesessen, denselben spärlich besuchten Vorlesungen. Privat haben wir nie etwas zusammen unternommen und nicht mehr als fünf, sechs längere Gespräche geführt. Fiona war keine Rednerin. Aber ich weiß noch heute fast jeden Satz, den sie gesagt hat.
Die meistgestellte Frage an alle, die Philosophie studieren, lautet nicht: »Was ist der Sinn des Lebens?«, sondern: »Was willst du denn später mal machen?« Ich konnte die Frage damals nicht beantworten. Doch Fiona hatte gesagt: »I want to sit on a stone and think.« Bei ihr klang es wie die Antwort auf alles.
Sie sitzt auf keinem Stein, sondern steht in einem schwarzen Regenmantel in der Sonne. Ihr noch immer dunkles Haar weht im Wind, es ist schulterlang. Wir begrüßen uns förmlich und ohne Umarmung vor den Augen von Sir Walter Scott, der in sinnender Pose auf seinem Sockel sitzt, marmorweiß unter einem verwitterten gotischen Spitzturm, der ihn heilig und wie eine Lichtgestalt erscheinen lässt.
»Gehen wir«, entscheidet Fiona und steuert auf die Parkanlagen zu, womit sie mir die lang zurechtgelegte Erklärung erspart, warum ich hier bin und was für Fragen mich zu ihr geführt haben. Sie geht einfach voran. Ich liefere ihr einen kurzen Reisebericht von der Fähre, der Zugfahrt, dem Umstieg in London – ich bin dieselbe Strecke gefahren wie früher. Vor uns erhebt sich zeitlos und unverändert die National Gallery wie ein antiker Tempel und auf dem Castle Rock dahinter die ewige Burg. Es ist also doch ein Wiedersehen. Ein unwirkliches.
Wenn sie wüsste, wie oft ich an sie gedacht habe – jahrzehntelang nicht und dann immer mehr in den letzten Jahren. Ohne ein Bild von ihr vor Augen, ohne ein Foto. Fiona war für mich eine Stimme, und ich glaube, das war sie sogar schon mit Anfang zwanzig, als alle anderen hauptsächlich Körper waren. Deswegen musste ich sie treffen. Schon allein, um noch einmal ihre Stimme zu hören.
Die Frage, wie es ihr geht, lässt sie nicht zu. Aus irgendeinem Grund scheint sie es eilig zu haben, den Smalltalk hinter sich zu lassen. Am liebsten würde ich ihr sagen, was ich ihr nicht schreiben konnte: dass sie zu den drei noch lebenden Personen gehört, mit denen ich reden möchte bis ins Letzte. Und dass sie von diesen drei Personen diejenige ist, von der ich am allerwenigsten weiß. Aber so weit sind wir noch nicht.
»Warum tun wir nicht so«, frage ich, »als hätten wir nie wirklich aufgehört, miteinander zu sprechen, als seien wir nur unterbrochen worden, für fünfunddreißig Jahre?« Fiona schweigt. Vielleicht hat sie mich schlecht verstanden, vielleicht hat sie mich auch zu gut verstanden. Der Blick, den sie mir zuwirft, enthält die Aufforderung, meine Frage zu wiederholen. – »Würdest du heute noch immer sagen«, frage ich anders, »dass du später mal auf einem Stein sitzen und denken willst?« Und Fiona sagt: »Glaub ja nicht, dass ich dir mein Leben erzähle.«
ENTTÄUSCHT?
Die Frage, wer oder wie Fiona sein würde, war mein ständiger Begleiter während der Reise. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich Angst, bei unserem Wiedersehen von ihr enttäuscht zu sein. Jetzt habe ich Angst, Fiona zu enttäuschen. Ich hatte vergessen, wie schroff sie sein kann. Früher fand ich es verstörend, dass sie sagt, was sie denkt. Heute gehört das zu den Gründen, warum ich mit ihr reden will.
Was ich sie gerne fragen würde, aber nicht zu fragen wage: ob sie ihrer Art zu denken und zu leben treu geblieben ist. Fiona war die erste Asketin, die ich kannte, und schon damals ein Vorbild, an dem ich gescheitert bin, immer wieder, bis heute. Und sie? Hat sie all die Jahre weiter Konsumverzicht geübt, oder wollte auch sie irgendwann mehr – mehr haben, mehr sein? In gewisser Weise wäre es eine Entlastung oder gar Entschuldigung, wenn sie ein Leben gelebt hätte wie alle anderen. Doch das ist nicht der Grund meiner Reise. Ich will keine Absolution. Ich bin auf der Suche nach der Bedeutung, die Fiona damals für mich hatte und vielleicht wieder haben könnte. Auf eine Art wünsche ich mir, dass die Gespräche mit ihr mein Leben verändern. Und gleichzeitig habe ich Angst davor.
»Manchmal«, sage ich zögerlich, »kommt es mir vor, als hätten wir seinerzeit in ein und derselben Bibliothek gesessen, die gleichen Bücher gelesen und uns beim Umblättern dabei ertappt, dass wir das Gleiche denken …«
»Weißt du noch, was du damals gedacht hast?«, fragt sie. Und ich antworte etwas zu schnell: »Wir waren jung.« – »So jung waren wir gar nicht«, sagt Fiona.
Ich sehe sie von der Seite an. Sie erwidert meinen Blick nicht, als wir die Parkanlagen verlassen und auf dem schmalen Bürgersteig nebeneinander hergehen. »Vielleicht meine ich nicht ›jung‹, sondern ›frei‹.«
»Was soll das heißen?«
Ich zucke mit den Achseln. »Wir hatten nicht viel zu verlieren.«
»Glaubst du das wirklich?«, fragt Fiona.
PANIKRAUM I
»Freiheit und Sicherheit«, meint Fiona, »leider kann man nicht beides haben: Ein Panikraum, fensterlos, mit meterdicken Wänden, Stahltüren, unerreichbar für die Außenwelt, ist vermutlich der sicherste und unfreieste Ort der Welt. So wie du in einem sicheren und gut bezahlten Job gefangen sein kannst, gefangen im Funktionieren oder in der Überforderung eines Alltags, in dem dir keine Sekunde zum Nachdenken bleibt, weil du nur damit beschäftigt bist, die Dinge am Laufen zu halten. Oder du bist gefangen im goldenen Käfig einer Ehe mit einem Partner, der dir alles bietet für die Unfreiheit, von ihm abhängig zu sein. Es gibt viele Panikräume im Leben, und in irgendeinen ziehst du dich zurück, manchmal ohne es zu wissen.«
Ich frage Fiona nicht nach ihrem Panikraum, ich frage nach der Freiheit von damals und wie sie sich verändert hat.
»Ich würde nicht sagen«, sagt sie, »dass wir frei waren, weil wir nichts zu verlieren hatten. Wir hatten wenig, ja, im materiellen Sinne: wenig Geld, wenig Besitz. Meinen Umzug ins Wohnheim auf dem Campus habe ich mit einem Einkaufswagen gemacht. Und was unsere Zukunftsaussichten anging: Ich glaube, niemand hätte auch nur einen Penny auf uns und unsere ›Karrieren‹ gewettet. Und trotzdem hatte ich damals viel zu verlieren, vor allem die Freiheit, die mir mein kleines Stipendium verschafft hat, die freie Zeit, über all das nachzudenken, worüber ich immer schon nachdenken wollte.«
»Du meinst die Freiheit zum Denken, die Befreiung vom Eingespanntsein in Arbeit, Familie, andere Verpflichtungen. Doch wie ist es mit der Freiheit im Denken«, frage ich Fiona. »Damals mussten wir keinen Wohlstand verteidigen, keine Lebenslügen entschuldigen, keine Vergangenheit beschönigen. Wir waren am Anfang, insofern gab es für uns kein ›Weiter so‹ und auch keine Abwehrmechanismen gegen jede Kritik an unserer Lebensweise. Wir konnten offen und ehrlich über die Frage nachdenken: Wie lebe ich richtig?«
Das geht nur mit Fiona. Es gibt niemanden, den ich so lange nicht gesprochen habe und nach einer Viertelstunde so etwas fragen kann. Und es gibt niemanden, den ich ständig spreche und so etwas fragen würde.
Fiona antwortet nicht, nicht sofort jedenfalls. Sie hat den Blick leicht gesenkt, als würde sie sich das Gesagte noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Ihre gefürchteten Pausen, denke ich, es gibt sie also noch. Schon während des Studiums folgte auf fast jede Frage an Fiona eine plötzliche Stille – zu kurz, um das Thema zu wechseln, aber lang genug für Verlegenheitsgefühle, die sich im ganzen Seminar ausbreiteten. Einige Professoren vermieden es regelrecht, Fiona Fragen zu stellen, als wäre es nicht nur unüblich, sondern geradezu ungehörig, dass sie erst nachdachte, bevor sie antwortete. Und das war das Irritierende an den Lücken, die Fionas Ernsthaftigkeit ins Gespräch riss. Sie führte uns damit vor Augen, wie sehr wir daran gewöhnt waren, Vorgedachtes von uns zu geben, anstatt nachzudenken. Fiona war die Einzige, die wirklich antwortete, während wir nur Antworten reproduzierten. Ironischerweise wurde sie deshalb nur selten gefragt.
Allerdings konnte es auch sein, dass das ganze Seminar vergeblich auf Fionas Antwort wartete – auch daran erinnere ich mich. Wenn sie zu einer meiner Fragen nichts zu sagen hatte, sagte sie nichts. Und wenn sie für eine Antwort länger brauchte, konnte es vorkommen, dass sie bis zum Seminarende schwieg und ich irgendwann, manchmal Wochen später, einen eng beschriebenen Zettel von ihr unter der Tür durchgeschoben bekam.
Noch immer halte ich die Stille nicht gut aus.
»Vielleicht habe ich die Frage nicht klar genug formuliert«, entschuldige ich mich und versuche es noch einmal. »Würdest du sagen, dass du im Denken unfreier geworden bist mit der Zeit?«
Fiona bleibt kurz stehen und wiegt den Kopf. »Das ist eine rhetorische Frage«, sagt sie dann.
I DON’T FEEL LIKE
Eine Weile gehen wir schweigend nebeneinanderher. Zwischen den Giebeln, über den Dächern taucht immer wieder Edinburgh Castle auf, aus verschiedenen Blickwinkeln. Mal ist es eine Festung mit hohen Mauern, die uneinnehmbar aus schroffen Felsen aufragen, dann wieder wirkt es wie eine Residenz mit vielfenstrigen Wohngebäuden und im nächsten Moment wie ein kolossaler Steinhaufen mit Schießscharten. In meiner Erinnerung war das Gemäuer finsterer, der Fels schwarz durchfeuchtet, doch in meiner Erinnerung hat es auch ständig geregnet. Ich fange an, meinem Gedächtnis zu misstrauen.
»Möchtest du ins Museum oder ins Theater«, fragt Fiona, »oder in irgendein Café?« Dass ausgerechnet sie das vorschlägt, verblüfft mich. Die Fiona von früher wäre nie auf die Idee gekommen. »Ich dachte, du bist vielleicht hungrig nach der langen Reise …«
Ich könnte mit ihren Worten antworten: »I don’t feel like consuming.« So lautete damals Fionas Standardspruch, wenn sie gefragt wurde, ob sie mitkommen will in die Mensa oder in irgendeine Kneipe. Absagen aus Geldgründen wurden akzeptiert, doch Fionas Antwort klang nach Konsumkritik und einer Ablehnung aus Prinzip. Insofern blieb sie außen vor.
»Lass uns einfach nur so durch die Stadt gehen, das ist nach der Reise das Beste«, sage ich vage und verschweige ihr, dass ich immer wieder versucht habe, so zu leben wie sie.
Sie mustert mich und entscheidet sich für ein Lächeln. In wortlosem Einvernehmen lassen wir zwei, drei Cafés links liegen, eins davon hat Tische draußen – undenkbar im Schottland von damals. Dann schieben wir uns an einer langen Schlange vorbei, die vor einer kleinen Bäckerei ansteht, aus der es nach warmem, frisch gebackenem Brot duftet. Im Schaufenster sind Bleche voller Donuts zu sehen. Fiona würdigt sie keines Blickes. Ich habe diese Frau noch nie etwas essen sehen, fällt mir ein, und ich ziehe zum ersten Mal die Möglichkeit in Betracht, dass es während unserer zwei Tage in Edinburgh auch so bleibt.
»Ich hoffe, du weißt, worauf du dich einlässt«, schrieb sie mir, nachdem ich sie über das Alumni-Büro der University of Stirling ausfindig gemacht hatte. Es war alles andere als absehbar, ob und wie sie auf eine Nachricht von mir reagieren würde, nach so langer Zeit. Ich hatte ihr keinen persönlichen Brief geschrieben, nichts von der Konsumkrise meines Lebens und dem Wunsch, mich zu verändern, sondern nur eine kurze Bitte um Kontaktaufnahme. Schließlich konnte ich nicht wissen, wer mitlas. Meine Mail wurde aus Datenschutzgründen vom Alumni-Büro an sie weitergeleitet. Ein paar Tage lang sah ich abwechselnd in meinem Postfach und meinem Briefkasten nach. Doch von Fiona kam kein Brief und auch keine Antwortmail, sondern ein Handyfoto von einem Zettel mit ihrer Adresse in Edinburgh und diesem einen ominösen Satz.
»Woher soll ich wissen, worauf ich mich einlasse, wenn ich mich nicht darauf einlasse«, schrieb ich ihr zurück. Danach verabredeten wir uns.
PANIKRAUM II
»Vielleicht hätte ich fragen sollen, wonach du suchst«, meint Fiona und gibt die Richtung vor. Zwischen zwei Häusern schaue ich noch einmal zu Edinburgh Castle hinauf. Die Zinnen wirken wie gemauerte Schornsteine oder die gemauerten Schornsteine wie Zinnen. »Was ist dir gerade wichtiger, Freiheit oder Sicherheit?«
»Im Moment erlebe ich eher den Verlust von beidem«, sage ich achselzuckend. »Merkwürdig, dass sich Sicherheit und Freiheit ab einem gewissen Grad ausschließen, Unfreiheit und Unsicherheit aber nicht. Im Gegenteil. Je unsicherer ich werde, desto unfreier fühle ich mich.«
»Und was fehlt dir gerade am meisten?«
»Ich weiß nicht. Mut?«, schätze ich. Eine Gruppe von Schulkindern in Uniformen kommt uns auf dem schmalen Bürgersteig entgegen. Ich will die Straßenseite wechseln, doch Fiona hält mich zurück, nicht nur wegen des Linksverkehrs. Vor uns baut sich wie in einem Super-8-Film eine Schülerlotsin auf, bringt den Verkehr zum Stehen und winkt die munter plappernden Kinder über die Straße zum Eingang einer altehrwürdigen Primary School aus verwittertem Sandstein.
»Du warst immer schon mutiger als ich«, nehme ich den Gedanken wieder auf, nachdem es stiller geworden ist – die Stimmen der Schulkinder sind nur noch ein Gezwitscher in der Luft. »Jedenfalls kamst du mir damals viel mutiger vor als ich und alle anderen.«
Fiona stoppt und sieht mich an, als wäre ihr das neu. »Von mir wurde auch weniger erwartet«, sagt sie dann. »Ich habe als Einzige in meiner Familie die Schule abgeschlossen. Niemand hat damit gerechnet, dass ich studiere, erst recht nicht Philosophie. Eine Lehrerin hat an mich geglaubt, mich gefördert und für das Stipendium empfohlen. Als die Zusage kam, habe ich mit meiner Mutter gesprochen und meinen Vater abgefüllt, damit er unterschreibt. Was hätte mir Schlimmes passieren können? Ich war endlich weg von zu Hause.«
Ich stehe da und nicke, obwohl es meine Zustimmung nicht braucht.
»Am Anfang hat mich die Universität eingeschüchtert«, fährt Fiona fort und setzt sich wieder in Bewegung. »Allein die Bibliothek mit all den Büchern, all dem Wissen, mit dem ich noch nie in Berührung gekommen war. Dazu die Professoren mit ihrer Überlegenheit und ihren Urteilen, deren Kriterien ich nicht verstand. Und die Kommilitonen im Seminar, die mehr gelesen hatten, besser reden konnten und Wörter kannten, von denen ich nicht mal wusste, wie man sie schreibt, geschweige denn, was sie bedeuten. Auf eine Art war ich in eine Parallelwelt geraten, die ihre eigenen Gesetze und Maßstäbe hat. Ich war nicht mutiger als die anderen, ich wusste nur, dass ich anders war und dass es keinen Sinn hatte, so sein zu wollen wie sie.«
»Das war sicher nicht leicht«, sage ich und suche Fionas Blick. Doch ihre dunklen Haare verhängen ihr Gesicht.
»Ich bin in The Calton in Glasgow aufgewachsen«, sagt sie, »dem Viertel, wo man schnell landet, aber nur schwer wieder rauskommt. Für meine Brüder war ich der Freak der Familie, weil ich zur Schule ging; meine Freundinnen fanden mich ›abartig‹, weil ich mit vierzehn lieber gelesen habe, als mich schwängern zu lassen. Bei der Immatrikulation wurde zweimal überprüft, ob ich auch wirklich keine Vorstrafen hatte. Die Talente, die bei mir vermutet wurden, lagen im Bereich Kriminalität, Drogen, Alkohol. Kurz, ich war nicht gewollt, nur geduldet – das Projekt einer sozial engagierten Bildungspolitik, ein Experiment, das es mit Vorsicht zu genießen galt und dessen Abbruch wahrscheinlicher war als ein Erfolg. So viel zum Thema Erwartungen.« Fiona sieht mich an …
… und holt tief Luft. »Es hat ein bisschen gedauert, aber wenn du irgendwo so fehl am Platz bist wie ich in den heiligen Hallen der Wissenschaft, verwandelt sich dein Eingeschüchtertsein irgendwann in Trotz und der Trotz irgendwann in Stolz, und sei es nur, weil du noch da bist. Nach den ersten Monaten auf dem Campus mit seinem künstlich angelegten See und dem Golfrasengrün habe ich beschlossen: Ich gehe hier nicht weg. Nicht freiwillig. Wenn sie mich loswerden wollen, müssen sie mich aus dem Seminar raustragen, mit den Füßen voran.«
Fiona lacht – zum ersten Mal, seit wir uns wiedersehen. Ich kann mich nicht erinnern, ob sie früher oft gelacht hat. Doch ihr Gesicht erinnert sich; das Lachen verschwindet nicht so schnell aus ihren Augenwinkeln.
»Zum Glück«, sagt sie dann, »hatte ich wie du das Fach aller Freaks gewählt. Im philosophischen Seminar fiel ich weniger auf als irgendwo sonst auf der Welt. Und ich war nicht die Einzige mit einem Spitznamen. Erinnerst du dich noch an Unfall-Joe? Joseph, der mit der Hornbrille, als Hornbrillen noch nicht retroschick waren, und mit den großen Füßen, über die er ständig gestolpert ist. Er fiel so oft hin, dass er sogar Pflaster an der Brille hatte: eins am Bügel, damit der hält, und eins – so ein durchsichtiges – am Rahmen, damit das Glas nicht rausfällt. Oder ›Innocence‹, das Mädchen aus Cornwall, das kaum was gesagt hat, aber jeden Satz anfing mit ›In a sense‹ …«
Ich kann mich weder an die Namen erinnern noch daran, sie vergessen zu haben. Vielleicht war ich als Ausländer nicht in sämtliche Fein- und Fiesheiten eingeweiht. Das Einzige, was mir bekannt vorkommt, ist die Kreativität von Gruppen, die immer dann am größten ist, wenn es um Grausamkeiten geht. »Was war denn dein Spitzname?«, frage ich und vermute irgendein Wortspiel mit »I don’t feel like consuming«.
»JJ«, sagt Fiona, »Janis Joplin.«
Daran erinnere ich mich sogar. Irgendwer hatte Fiona im Seminar damals JJ genannt. Nur konnte ich mir keinen Reim darauf machen und hielt es für Ironie. Fiona war nun wirklich keine Kandidatin für den »Club 27«, der im Alter von siebenundzwanzig Jahren an einer Überdosis gestorbenen Rockstars, weil sie im Gegensatz zu Janis Joplin und sämtlichen Kommilitonen in keine Kneipe ging, auf keine Party, nicht rauchte, nicht trank und keine Drogen nahm. Jedenfalls nicht, dass ich wusste.
»Dass ich JJ genannt wurde, hatte leider nichts mit meiner Stimme zu tun und auch nur bedingt mit meiner Herkunft ›aus der Gosse‹. Der Grund ist wenig schmeichelhaft. Erinnerst du dich an Polonius Jackson, den amerikanischen Sportstudenten, der mit uns im Existenzialismus-Seminar saß? Aus irgendeinem Grund stand ich auf seiner Abschussliste – offenbar sah er sich durch meine bloße Existenz in seiner Männlichkeit gekränkt. Jedenfalls hat er sich richtig ins Zeug gelegt, um eine Anti-Miss-Wahl zu organisieren, die Wahl zur ›Missfit‹ der Uni. Und er hat dafür gesorgt, dass ich die meisten Stimmen bekomme und die Wahl gewinne. Damit erhielt ich den offiziellen Titel ›hässlichster Mensch auf dem Campus‹ – wie einst Janis Joplin auf ihrem College in Austin, glaube ich, Texas.«
»Das wusste ich nicht«, sage ich. Ich wusste wirklich nichts davon.
»Zwei Jungs aus Glasgow hatten Mitleid mit mir. Oder sie waren einfach Lokalpatrioten und wollten die Schmach nicht auf ihrer Heimatstadt sitzen lassen. Also haben sie sich den Amerikaner geschnappt und ihm zwei Kanister selbst gebrautes Bier eingetrichtert. Es war noch nicht ausgegoren und hat in seinem Körper kräftig weiter fermentiert. Polonius Jackson kam mit einer schweren Alkoholvergiftung ins Krankenhaus und wurde dann von seinen Eltern zurück in die Staaten beordert. Es gab nie wieder eine solche Wahl und keine zweite ›Missfit‹. Ich trage den Titel im Grunde noch heute.«
Fiona lächelt die Erinnerung weg. Ich schaue zu Boden und weiter die Straße hinunter. Wir sind von der Altstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten und Einkaufsstraßen in ein bürgerliches Wohnviertel gelangt. Möglich, dass Fiona mittlerweile hier zu Hause ist. Ich habe mich ihrer Ortskenntnis ganz überlassen.
»Du hattest übrigens auch einen Spitznamen, wusstest du das?«, sagt sie schließlich und lacht. Meine Ahnungslosigkeit ist mir anzusehen. »Restless legs«, hilft sie mir auf die Sprünge. »Du konntest kaum stillsitzen und bist nach jedem Seminar sofort raus an die Luft: Laufen, Wandern, Spazierengehen. Bei jedem Wetter …«
»Es war ja auch jedes Wetter, jeden Tag Wolken, Regen, Wind«, verteidige ich mich. »Wenn ich auf puren Sonnenschein gewartet hätte, wäre ich nie aus meiner Studentenbude herausgekommen.«
»Sag es«, lacht sie. »Sag noch mal: ›I’m out in the country.‹«
»Habe ich das früher so oft gesagt?« Ich erinnere mich vage an den Drang, das Campusgelände zu verlassen und durch eine Landschaft zu streifen, die nicht ummauert und parkähnlich war. Hinter Stirling beginnen die Highlands. Sicherheit oder Freiheit, da haben wir’s wieder.
»In dieser Hinsicht«, sagt Fiona, »hast du dich nicht verändert.« Sie gibt mir einen kleinen Stoß mit dem Ellbogen. Es ist unsere erste Berührung nach dem Händeschütteln.
»Stillsitzen fällt mir schwer«, gebe ich zu, »keine ideale Voraussetzung für einen Schriftsteller und auch nicht für ein gemütliches Gespräch. Aber wenn du möchtest, können wir uns gern irgendwo hinsetzen, auf irgendeine Bank oder einen Stein, es muss ja kein Café sein, kein Konsumort.«
»Ich bin gut vorbereitet«, sagt Fiona und deutet auf ihre Wanderschuhe, die aussehen, als hätten sie so manche Highland-Tour hinter sich. Meine Berechenbarkeit, nach so langer Zeit, ist mir peinlich.
»Meine Vorfahren«, rede ich mich heraus, »müssen so etwas wie Meldegänger gewesen sein, die Botschaften von fernen Schlachten zu überbringen hatten. Und da es meist schlechte Nachrichten waren, kam es darauf an, sie geschickt zu formulieren, damit einem der Empfänger nicht den Kopf abriss. Daher meine Affinität zu Texten und Bewegung. Ich glaube, in meinem vorigen Leben war ich eine Art Bote.«
»Ich glaube, in deinem nächsten Leben bist du jemand mit einer ADHS-Diagnose«, sagt Fiona und geht voran.
LEBEN IM LESEN (FIONA ÜBER SICH)
»Der hässlichste Mensch auf dem Campus zu sein hat auch seine Vorteile. In den Augen der anderen habe ich nicht existiert, weder als Gegenüber noch als Beute. Insofern ist mir einiges erspart geblieben. An den guten Tagen habe ich mich gefühlt wie die Janis Joplin der Philosophie, an den schlechten Tagen auch. Ich hatte wirklich nichts zu verlieren und eine Art JJ-Freiheit: ›Freedom’s just another word for nothin’ left to lose …‹ Nur dass es bei mir die Bücher waren, nicht die Musik.«